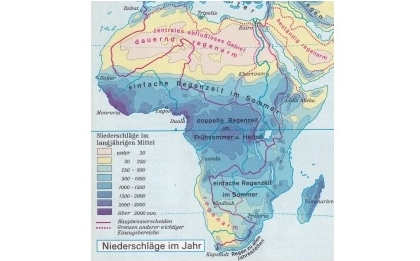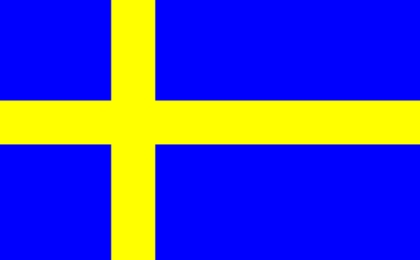Materialschutzmittel passieren Kläranlagen zum Teil ohne jegliche Elimination
Materialschutzmittel passieren die Kläranlagen zum Teil ohne jegliche Elimination. Sie zählen zu den Biozidwirkstoffen, die am häufigsten in den Kläranlagenabläufen gefunden werden, heißt es in der Studie „Belastung der Umwelt mit Bioziden realistischer erfassen – Schwerpunkt Einträge über Kläranlagen“, die das Umweltbundesamt (UBA)
Quelle: Euwid
(nach oben)
Schulze: Deutschland braucht eine nationale Wasserstrategie
Nationaler Wasserdialog entwickelt Empfehlungen für die Zukunft des Wassers in Deutschland
Das Bundesumweltministerium hat nach zwei Jahren intensiver Beratungen den Nationalen Wasserdialog abgeschlossen, der sich mit der Wasserwirtschaft der Zukunft beschäftigt. An der virtuellen Abschlussveranstaltung nehmen heute neben Bundesumweltministerin Svenja Schulze zahlreiche Fachleute aus Wasserwirtschaft, Verwaltung und Forschung teil. Ergebnis des Dialogs sind umfassende Handlungsempfehlungen zu unterschiedlichen Themenfeldern. Mehr als 200 Expertinnen und Experten erkundeten, wie Länder und Kommunen künftig besser mit klimabedingter Wasserknappheit umgehen können und wie deutschlandweit der natürliche Wasserhaushalt erhalten und geschützt werden kann. Die Empfehlungen werden nun in die nationale Wasserstrategie einfließen, die Bundesumweltministerin Schulze im nächsten Sommer vorstellen will.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze: „Unser Land ist zum Glück noch weit von einem Wassernotstand entfernt. Ich will, dass das in Zeiten des Klimawandels auch in Zukunft so bleibt. Deutschland braucht daher eine nationale Wasserstrategie. Ein wichtiges Element ist die Festlegung von Grundsätzen für eine Priorisierung von Wassernutzung, eine Wasserhierarchie. Denn sie hilft Nutzerinnen und Nutzern, sich frühzeitig auf den möglichen Ernstfall einzustellen. Natürlich werden Entscheidungen, wer bei Knappheit Vorrang hat, letztlich immer vor Ort getroffen. Aber sie sollten sich an gemeinsamen Spielregeln orientieren – auch damit es am Ende kein Gegeneinander unterschiedlicher lokaler Interessen gibt, sondern ein möglichst großes Miteinander. Ebenso große Herausforderungen sind die Schadstoff-Belastungen der Gewässer, die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Wasserökosysteme und die Sicherung der Daseinsvorsorge. Der Nationale Wasserdialog hat die aktuellen und absehbaren Herausforderungen so gründlich wie nie zuvor analysiert. Die Ergebnisse sind eine gute Grundlage für die erste nationale Wasserstrategie, die wir im Bundesumweltministerium ab heute erarbeiten werden.“
Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes: „Die Handlungsempfehlungen des Nationalen Wasserdialog zeigen die unterschiedlichen Interessen im Umgang mit Wasser. Die damit zusammenhängenden Herausforderungen, vor denen die Wasserwirtschaft steht, erfordern tiefgreifende Veränderungsprozesse – vor allem in den Leitbildern. Ziel muss es sein, dass letztlich nur Stoffe in Gewässer gelangen oder eingeleitet werden, die kein Risiko für Mensch und Umwelt darstellen. Hierzu ist eine ganzheitliche Betrachtung der Umweltwirkungen von Schadstoffen und eine systemische Betrachtung der Eintragspfade im Rahmen einer Null-Schadstoff-Strategie erforderlich. Klimawandel und Wasser machen nicht an kommunalen Grenzen halt. Deshalb brauchen wir zügig auch Wasserdargebots- und Wasserbedarfsanalysen auf Einzugs- und Flussgebietsebene.“
Deutschland muss sich auf längere Dürreperioden einstellen. Das haben die vergangenen Sommer deutlich gezeigt. Wasserknappheit wird in mehr und mehr Regionen zu einem Problem. Gleichzeitig leiden viele Gewässer unter der hohen Belastung durch Nähr- und Schadstoffe. Zukunftsszenarien wie diese haben die Teilnehmenden des Nationalen Wasserdialogs tiefgreifend analysiert und strategische Handlungsoptionen für zentrale Bereiche der Wasserwirtschaft identifiziert.
Insgesamt liefert der Nationale Wasserdialog eine aktuelle Bestandsaufnahme, formuliert Ziele und benennt Aktionsfelder mit Vorschlägen für konkrete Maßnahmen. Die Empfehlungen des Nationalen Wasserdialogs reichen von strategischen Ansätzen und neuen Finanzierungskonzepten für die Modernisierung der wasserwirtschaftlichen Infrastrukturen über Vorschläge zur Stärkung der Organisations- und Verwaltungsstrukturen. Mit verbindlichen planerischen Instrumenten und einer Minderung von Stoffeinträgen soll der Schutz der Wasserressourcen gestärkt werden. Nicht zuletzt zeichnen die Fachleute vor, wie Wasser- und Landwirtschaft gemeinsam Standards und Konzepte für eine gewässersensible Landnutzung entwickeln können.
Der Nationale Wasserdialog war 2018 vom Bundesumweltministerium gemeinsam mit dem Umweltbundesamt initiiert worden. Zwei Jahre lang beteiligten sich mehr als 200 Teilnehmende aus Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, der Forschung, von Verbänden, Ländern und Kommunen an dem intensiven Fachdialog. Nach einer Auftaktkonferenz vertieften die Teilnehmenden ihre Diskussionen in mehreren Einzelforen zu „Vernetzten Infrastrukturen“, dem „Risikofaktor Stoffeinträge“, dem Verhältnis von „Landwirtschaft und Verbraucherschutz“, dem Nexus „Gewässerentwicklung und Naturschutz“ sowie zu „Wasser- und Gesellschaft“. Der Nationale Wasserdialog ist auch ein Beitrag Deutschlands zur Umsetzung der UN-Wasserdekade (2018-2028).
Alle Ergebnisse des Nationalen Wasserdialogs sowie weiterführende Informationen finden Sie unter http://www.bmu.de/wasserdialog.
Umweltbundesamt Hauptsitz
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/schulze-deutschland-braucht-eine-nationale
(nach oben)
Nationaler Wasserdialog
2. Nationales Wasserforum
Der zweijährige Nationale Wasserdialog wird mit dem 2. Nationalen Wasserforum am 8. Oktober 2020 abgeschlossen und der Abschlussbericht zum Nationalen Wasserdialog übergeben.
Im Dialogprozess wurden die wesentlichen zukünftigen Entwicklungen der Wasserwirtschaft und der betroffenen Sektoren auf nationaler Ebene diskutiert. Im 2. Nationale Wasserforum werden die Ergebnisse des Nationalen Wasserdialog reflektiert und die nächsten Schritte in Richtung einer Nationalen Wasserstrategie in einer Podiumsdiskussion beleuchtet.
Kernbotschaften
Die hier vorliegenden 16 Kernbotschaften fassen die wichtigsten Inhalte aus dem Nationalen Wasserdialog zusammen. Sie müssen nicht der Meinung der einzelnen Teilnehmerinnen, des Bundesumweltministeriums oder des Umweltbundesamtes entsprechen. Die Reihenfolge stellt keine Priorisierung dar. Die Kernbotschaften zeigen den Spannungsbogen von unterschiedlichen Interessenslagen und die damit zusammenhängenden Aufgaben und Herausforderungen, die künftig zu bewältigen sind. In der Kürze der Zeit konnte nicht immer Einigkeit erzielt oder fertige Lösungen erarbeitet werden. Die gute Atmosphäre und die konstruktive Zusammenarbeit im Dialogprozess sind jedoch ermutigend und ein Signal, den Dialog weiter fortzuführen. Die Kernbotschaften sollen nicht nur der Kommunikation der Ergebnisse des Nationalen Wasserdialogs im politischen Raum dienen, sondern auch den weiteren gegenseitigen Austausch fördern.
Abschlussdokument
Im Abschlussdokument werden die wesentlichen zukünftigen Entwicklungen der Wasserwirtschaft und der angrenzenden Wirtschaftsbereiche auf nationaler Ebene sowie die Ergebnisse aus dem Nationalen Wasserdialog dargestellt. Die erarbeiteten Leitlinien und Ziele sowie Aktionen und Aktionsfelder sind darauf ausgerichtet, mit den sich ändernden Bedingungen umgehen zu können und damit die deutsche Wasserwirtschaft langfristig zukunftsfähig zu gestalten. Die Diskussionen fokussierten dabei auf die Zeitspanne bis 2030 für das Ergreifen von entscheidenden Maßnahmen mit einem Ziel- und Wirkhorizont bis zur Mitte des Jahrhunderts (2050
https://www.bmu.de/nationaler-wasserdialog/2-nationales-wasserforum/#c50457
(nach oben)
Mein „Indikatorenbericht“ mit aktuellen Umweltdaten
Luftqualität, Treibhausgasemissionen, Nitrat im Grundwasser oder Ökolandbau – die „Daten zur Umwelt“ geben einen umfassenden Überblick über den Umweltzustand, die Verursacher und Ansatzpunkte für verbessernde Maßnahmen. Mit dem neuen Indikatorenbericht kann jetzt online ein individueller Bericht aus insgesamt 50 verschiedenen Umwelt-Indikatoren zusammengestellt und als PDF heruntergeladen werden.
24.06.2020 40 mal als hilfreich bewertet
In den „Daten zur Umwelt“ finden Sie aktuelle Informationen zu Trends der Umweltbelastungen, Erreichung von Umwelt- und Nachhaltigkeitszielen oder auch Vorschläge für umweltpolitische Maßnahmen. Dazu wurden für alle Umweltbereiche Indikatoren ausgewählt und soweit vorhanden mit vorliegenden politischen Zielen – beispielsweise aus der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie oder auch aus EU-Richtlinien – unterlegt.
„Mein Indikatorenbericht“ ist ein individuell zusammenstellbarer Auszug aus den „Daten zur Umwelt“. Dafür lassen sich insgesamt 50 Umwelt-Indikatoren aus verschiedenen Umweltbereichen auswählen:
• Fläche, Boden, Land-Ökosysteme
• Luft
• Wasser
• Ressourcenschonung
• Klima
• Energie
• Private Haushalte und Konsum
• Umweltgerecht Wirtschaften
• Verkehr
• Land- und Forstwirtschaft
Das Angebot ist auf Deutsch und Englisch verfügbar. Verlinkungen in dem Bericht führen direkt auf die entsprechenden Internetseiten, die direkten Zugriff auf die Daten bieten.
Über die Datensuche kann außerdem das gesamte Datenangebot der UBA-Website abgerufen werden.
https://www.umweltbundesamt.de/themen/mein-indikatorenbericht-aktuellen-umweltdaten
(nach oben)
Deutscher Nitratbericht 2020 veröffentlicht
Grundwasser ist häufig mit Nitrat belastet. Eine Ursache ist die stickstoffhaltige Düngung.
Am 9. Juli wurde der Nitratbericht 2020 veröffentlicht. Der Bericht zeigt: Die Nitratsituation des Grundwassers hat sich seit dem vorherigen Bericht aus dem Jahr 2016 nur geringfügig verbessert. Aktuell weisen 26,7 Prozent der Grundwassermessstellen des EU-Nitratmessnetzes im Mittel Konzentrationen über 50 mg/l Nitrat auf und verfehlen damit das Qualitätsziel der Nitratrichtlinie.
Im vorherigen Berichtszeitraum (2012-2015) waren es 28,2 Prozent der Messstellen. Der Anteil der unbelasteten oder nur gering belasteten Messstellen bis 25 mg/l blieb mit 49,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum mit 49,0 Prozent auf nahezu gleichem Niveau. An den Oberflächengewässern konnte das Qualitätsziel für Nitrat an allen Messstellen eingehalten werden. Allerdings ist an Flüssen und Seen die Nährstoffbelastung mit Phosphor und in Küsten- und Meeresgewässern die ökologische Belastung mit Nitrat an der Mehrzahl der Messstellen weiterhin deutlich zu hoch. Ursachen sind vielfach zu hohe Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft.
Mehr: https://www.umweltbundesamt.de/themen/deutscher-nitratbericht-2020-veroeffentlicht
https://www.umweltbundesamt.de/themen/deutscher-nitratbericht-2020-veroeffentlicht
(nach oben)
Weiterentwicklung der biologischen Bewertungsverfahren zur EGWasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) unter besonderer Berücksichtigung der großen Flüsse
Zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtline wurden Bewertungsverfahren entwickelt, deren Ziel es ist, die Fließgewässer in Deutschland anhand biologischer Qualitätskomponenten ökologisch zu bewerten. Im Projekt „Weiterentwicklung der biologischen Bewertungsverfahren zur EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) unter besonderer Berücksichtigung der großen Flüsse“ wurden die in den vergangenen Jahren gesammelten Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge der Anwender bearbeitet. Das Ziel bestand in der Verbesserung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der biologischen Bewertungsverfahren. Der Fokus des Projekts lag auf der Weiterentwicklung der biologischen Bewertungsverfahren: „Perlodes“, „PhytoFluss“ und „Phylib“. Bei letztgenanntem Verfahren „Phylib“ waren die Weiterentwicklungen auf die Teilkomponenten Diatomeen und Phytobenthos ohne Diatomeen (PoD) beschränkt.
https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/weiterentwicklung-bewertungsverfahren-eg-wrrl
(nach oben)