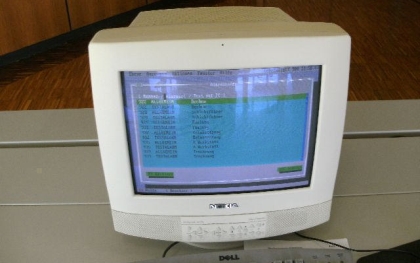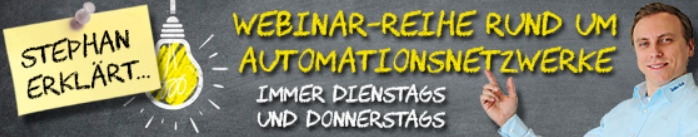Der Frage nach dem Verbleib von Reifenabrieb gingen die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) und die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) gemeinsam in einem Forschungsprojekt des BMVI-Expertennetzwerks nach. Die Ergebnisse zeigen: Der Großteil des Abriebs verbleibt im Boden, circa 12 bis 20 Prozent können in Oberflächengewässer gelangen.
Allein im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 48,5 Millionen Pkw-Reifen abgesetzt – so die aktuelle Schätzung des Branchenverbands Reifenhandel. Fahrzeugreifen bestehen etwa zur Hälfte aus vulkanisiertem Naturkautschuk oder synthetischem Gummi und enthalten darüber hinaus eine Vielzahl von Füllmitteln und anderen chemischen Zusatzstoffen. Der Abrieb von Autoreifen ist damit eine der größten Mikroplastikquellen – deutlich vor Faserabrieb, der beim Waschen von Kleidung aus Kunstfasern entsteht. Bereits bekannt war, dass ein kleiner Anteil des Reifenabriebs von der Straße in die Luft gelangt (5 bis 10 Prozent), wo er zur Feinstaubbelastung beiträgt. Der Weg des weit größeren Anteils von rund 90 Prozent des Reifenabriebes war bisher aber nicht im Detail geklärt.
Nach Berechnungen von BASt und BfG gelangen jährlich 60 000 bis 70 000 Tonnen Reifenabrieb in den Boden und 8700 bis 20 000 Tonnen in Oberflächengewässer. Die Forschungsarbeiten zeigen, dass es maßgeblich darauf ankommt, wo der Reifenabrieb entsteht: Auf Straßen in Ortschaften und Städten spült Regen den Reifenabrieb über kurz oder lang in die Kanalisation. Handelt es sich um ein Mischwassersystem mit Kläranlage, werden dann mehr als 95 Prozent des Reifenabriebs zurückgehalten. An Straßen außerorts findet die Versickerung der Straßenabflüsse in der Regel über Bankett und Böschung statt. Der größte Teil des Reifenabriebs wird so in den straßennahen Boden eingetragen und von der oberen bewachsenen Bodenzone zurückgehalten. Circa 12 bis 20 Prozent des Reifenabriebs können in Oberflächengewässern landen. Dort wird ein Teil der Partikel abgebaut beziehungsweise lagert sich im Sediment ab – die genauen Anteile sind allerdings noch nicht bestimmbar. In einer Modellstudie für das Einzugsgebiet der Seine und der Schelde fanden andere Autoren heraus, dass etwa 2 Prozent der ursprünglich freigesetzten Reifenabriebmenge in das Meer transportiert wird. Für Flüsse in Deutschland liegen noch keine Modellrechnungen vor.
https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Presse/Mitteilungen/2021/08-2021.html
Mikroplastik in der Umwelt – was hat das mit Verkehrswende zu tun?
Mehr Infos unter: http://gruene-alternative-freiburg.de/themen