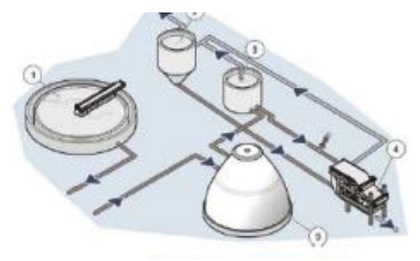| Alltech |
Was nicht passt, wird passend gemacht: Die Polymeraufbereitungsanlage CONTINUFLOC passt sich an bestehende Platzverhältnisse der Kläranlage Stuttgart Möhringen an. |
| Mall GmbH |
Umsicht beim Flocken |
| EC POWER |
Abwasser liefert Eigenstrom |
| Grundfos |
Innovatives Laufraddesign sorgt für zuverlässigen Betrieb bei geringeren Gesamtkosten und erfüllt die Herausforderungen des städtischen Abwassers |
| Stebatec |
Bewertung der Kanalnetzperformance anhand der CSB- und Ammonium-Variabilität auf Kläranlagen |
| Bindergroup |
Gasmengenmessung und -analyse von Klärgas, Deponiegas, Gasen aus MBA´s und anaerober Vorbehandlung von Industrieabwasser |
| Gardnerdenver |
ROBOX energy |
| Gardnerdenver |
Niederdruck-Schraubenkompressoren wurden bei der Charles Brand Kläranlage installiert |
| Gardnerdenver |
ROBOX energy – Effizienz in Abwasserkläranlagen |
| Aerzen |
Performance 3 – Kläranlagen bedarfsgerecht belüften |
| Nivus |
Fremdwasser richtig messen |
| Krohne |
Durchflussmesssystem für den Zulauf einer Schilfkläranlage |
| Krohne |
Füllstandmessung von Abwasser in Kunststoffbehältern |
| Eggerpumps |
Anspruchsvolle Rohabwasserförderung mit grosser Geodätik – PW Kalchreuth |
| Eggerpumps |
Förderung von stark belastetem Rohabwasser am Beispiel des Pumpwerks Lünen-Gahmen |
| Siekmann-Ingenieure |
Klimaschutz auf Kläranlagen – Wie funktioniert das? |
| Nivus |
Messungen an Regenbehandlungsanlagen |
| VTA |
Mit diesem Power-Duo holen Sie mehr raus |
| Aerzen |
Digitale Steuerungstechnik für Gebläse und Kompressoren |
| Stebatec |
Syndicat des Eaux de Tavannes et Environs, ARA Loveresse |
| Eggerpumps |
Frische Luft für das Hauptklärwerk Stuttgart mit Iris Blenden-Regulierschiebern |
| ESSDE |
S:Select®-Anlage als betriebsbereites „Paket“ im Container |
| Mall |
Ratgeber Rückstauschutz in 2. erweiterter Auflage |
| Oko-tech |
OKO-aquaclean 1000E Profiline zur Aufbereitung von Deponiesickerwasser kurz vor der Auslieferung |
| Vega |
VEGA denkt Industrie 4.0 gemeinsam mit der Open Industry 4.0 Alliance weiter |
| Huber |
Energieeffiziente Klärschlammtrocknung |
| Aerzen |
Tipps für die Betreiber von Kläranlagen |
| Aerzen |
WIE MAN DIE EFFEKTIVSTE GEBLÄSETECHNOLOGIE FÜR ABWASSERANWENDUNGEN AUSWÄHLT |
| Hach |
Anwendungsbericht: TOC Produktverlust Überwachung mit BioTector B7000i Dairy und Vakuum Venturi |
| Mutag |
Mikroplastik in der biologischen Abwasserreinigung – Muss das sein? |
| Royal HaskoningDHV |
Nereda®-Verfahren auf der Kläranlage Altena |
| Stebatec |
Steuerung Komplettersatz in 48 Stunden |
| ACO |
Oberflächennahe Entwässerung mit ACO DRAIN® Monoblock |
| ACO |
An den Klimawandel angepasst |
| FlowConcept |
Erhöhung der Umweltsicherheit durch die Leistungssteigerung von Nachklärbecken |
| FlowConcept |
Planungssicherheit und Energieeffizienz durch die Bewertung von Belüftertypen und Belüfteranordnung mittels CFD |
| Sulzer |
Hochwasserpumpwerk von Sulzer schützt historische Bauwerke in Ansbach |
| ESSDE |
Deammonifikation für eine zentrale Biogas- und Klärschlamm-Anlage in Finnland |
| Stebatec |
Abflussmessungen für gerechten Kostenverteiler |
| Barthauer |
Neue Generation des ISYBAU-Standards veröffentlicht: Das Austauschformat XML-2017 bietet erstmalig Transfer von Text- und Symbolplatzierungen |
| Grundfos |
Zur Überwachung von Dosierpumpen in Kombination mit Grundfos Chemicals App |
| Stebatec |
14 Messstellen erbringen Abrechnungs-Gerechtigkeit |
| Bitcontrol |
Kommunalrichtlinie |
| Bitcontrol |
Neue Funktionen: Maschinenliste, Messstellenliste und Fließschema |
| Aerzen |
DOW steigert mit AERZEN: Gebläsen und smarter Verbundsteuerung die Energieeffizienz der Kläranlage |
| Mecana |
OPTIMIERUNG VON KLÄRANLAGEN |
| FUNKE |
Sedimentationsschacht macht das Niederschlagswasser sauber |
| Nivus |
Radar-Füllstandssensor für anspruchsvolle Anwendungen |
| Krohne |
Neuer Feststoffgehalt-Sensor OPTISENS TSS 2000 |
| Multi Umwelttechnologie AG |
Hocheffiziente Containerkläranlagen für die biologische Abwasserreinigung mit höchster Flexibilität bei kleinstmöglicher Standfläche |
| Tsurumi |
Pumpenwahl, Pumpenqual – was beim Kauf von Wasserpumpen zu beachten ist |
| LANXESS |
LANXESS erweitert Membransortiment für die Umkehrosmose |
| StoCretec |
Mörtelsystem für Kläranlagen |
| StoCretec |
Dauerhaft widerstandsfähig gegen chemischen Angriff und Verschleiß |
| Sulzer |
Erfolgreiche Abnahme von vier Turboverdichtern |
| s::can |
Effiziente H2S Überwachung der Kläranlage von Santa Cruz |
| Stebatec |
Komplette Sanierung eines Regenbeckens in Grenchen |
| Homa |
Keine Probleme mit Verstopfungen und Verzopfungen |
| Ductor |
Neue Fermentation wird Biogas und Recyclingvon Nährstoffen revolutionieren |
| Biogest |
Regenbeckenausrüstung mit neuester Technologie Automatische Reinigungssysteme |
| Bieler+Lang |
Artikel für das SENSOR MAGAZIN |
| Rehau |
Kunststoffschächte überzeugen im Materialvergleich – AWASCHACHT |
| Eawag |
Eawag erneut zum Kooperationszentrum der Weltgesundheitsorganisation ernannt |
| bitcontrol |
Nachklärbeckenoptimierung |
| AKUT Umweltschutz |
Selektive Teilstrombehandlung von hochkonzentrierten Abwässern |
| Holinger |
Umweltschädliche Methanemissionen |
| Born-Ermel |
Wissensmanagement in der betrieblichen Praxis – Erfahrungen aus einem Ingenieurbüro |
| Clens |
Grünes Licht aus Brüssel – EU öffnet Weg für Flexibilisierung der KWK-Erzeugung |
| Nivus |
Kalibrierung mit 5 Durchflusssensoren erspart aufwändige Umbaumaßnahmen |
| Pentair Jung Pumpen |
ABWASSER UNTER DRUCK |
| Neutralox Umwelttechnik GmbH |
Geruchsbehandlung |
| Siemens |
Optimierung von Kläranlagen mit Advanced Process Control |
| Barthauer |
Die Ratten sind auf dem Rückzug! Schädlingsbekämpfung mit Betriebsführungssoftware BaSYS Regie |
| EES |
„ Die WebRTU – die all-in-one Lösung für Regenüberlaufbecken“ |
| IHS |
Rückstauklappen mit Tücken – Rattensperren für die Hauskanalisation |
| Huber |
Nutzung der Abwärme von vor Ort anfallendem Abwasser – Praxisbericht am Beispiel des Altersheims Hofmatt/Schweiz |
| Nivus |
Optimaler Mitteleinsatz in der Fremdwassermessung |
| Huber |
Kondensatminimierung in Wasserkammern durch Zwangsbelüftung |
| Huber |
Phosphorreduktion mit dem HUBER RoDisc® Scheibenfilter |
| Huber |
„Win – Win“ durch RoWin: Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Wärmerückgewinnung |
| Separchemie |
Flockungshilfsmittel trifft Filter |
| ABGS GmbH |
Neue Betriebssicherheitsverordnung |
| Barthauer |
In Zürich steht die Stadtentwässerung vor vielfältigen Herausforderungen |
| SÜLZLE Gruppe |
Spannender Auftrag – SÜLZLE liefert Anlagen zur Klärschlammverwertung an Stadtentwässerung Koblenz |
| Hölscher Wasserbau |
Kosten sparende und flexible Löschwasseraufbereitung |
| bioserve |
Sanierung der Belebtschlammqualität mit Easyflock |
| Sülzle-Kopf |
Die Lösung bei Mikroschadstoff-Elimination von SÜLZLE KOPF Anlagenbau |
| Sessil |
Getauchtes belüftetes Festbett Rütgers Deutschland GmbH |
| Armatec FTS |
Armatec FTS hat die Pumpenlösungen für Kläranlagen |
| RSV |
Rohrleitungssanierungsverband: Grundstücksentwässerungsanlagen – Ein Fachbeitrag zur GEA |
| Hach-Lange |
CSB ist immer noch einer der wichtigsten Parameter bei der Abwasseranalyse – für die Abwasserbeurteilung und die Kontrolle der Abwasseraufbereitungsanlagen |
| Hach-Lange |
Die TOC-Küvettentests von HACH LANGE verfügen über die einzigartige Methode des automatischen Schüttlers zum Austreiben des TIC |
| Grundfos |
Modulares Technologie-Konzept erweitert den Fokus von der Pumpe auf das System |
| IHS |
Ratten in der Kanalisation |
| VTA |
Eurodos: Maßgeschneiderte Dosierstationen für jeden Anwendungsfall |
| VTA |
MicroTurbine auch für kleinere Kläranlagen wirtschaftlich interessant |
| VTA |
Klärschlamm: Erste Desintegrationsanlage in ganz Irland kommt von VTA |
| VTA |
Kanalgeruch: Dank VTA Aufatmen in der Oberpfalz |
| NIVUS |
Optimaler Mitteleinsatz in der Fremdwassermessung |
| Grundfos |
Grundfos bietet einen neuen Ansatz für die fehlende Abwasserklasse IE3 |
| Convitec |
Bemessung der Belüftungstechnik in Klärwerken |
| Kronos |
Bericht zum Workshop „Abwasservorbehandlung in der milchverarbeitenden Industrie“ am 9. und 10.10.2013 in Aurich |
| ZWT |
BIOCOS Kläranlagen |
| Alltech |
Alles andere als Käse: für die Modernisierung der betriebseigenen Kläranlage setzt die Hochland Deutschland GmbH Dosiertechnik von Alltech ein |
| aquen |
FlocFormer zur Konditionierung des Klärschlammes auf einer Kläranlage, Dekanter |
| aquen |
FlocFormer zur Konditionierung des Klärschlammes auf einer Kläranlage, Kammerfilterpresse |
| VTA |
Einige schaffen es sicher :Der Weg zur energieautarken Kläranlage |
| Aquen |
Das Fachmagazin gwf – Wasser|Abwasser berichtet in der Ausgabe 5´2013 über unsere Bohrschlammentwässerung geoCLEAN. |
| Abel |
„Schneller entleert“ Abel Pumpen in der PVC-Herstellung |
| Vega |
Keep it simple |
| Kemira |
Prävention von Struvitablagerungen bei anaerober Vergärung |
| Kemira |
Erfolgreiche Beseitigung und dauerhafte Verhinderung von MAP-Ablagerungen in der Abwasserbehandlungsanlage der Molkerei Zott |
| AQUEX |
Die AQUEX Technologien |
| Endress+Hauser |
Online-Messtechnik für die 4. Reinigungsstufe |
| Separchemie |
Flockungshilfsmittel trifft Filter |
| Steinzeug |
Die Münchner Stadtentwässerung baut weiter auf Steinzeug |
| Aquen |
Flocken erster Güte |
| Hydro-Ingenieure |
Außergewöhnlicher Starkregen – Möglichkeiten der Risikobewertung und der daraus abgeleitete Objektschutz |
| Siekmann |
Schlammfaulung mit Faulgasverwertung auf kleineren Kläranlagen |
| Hach-Lange |
Früher konnten wir nie sicher sein, alle NH4-Spitzen abzufangen |
| Endress+Hauser |
Abwasser, Strom, Gas, Wasser und Fernwärme |
| Endress+Hauser |
Applicator – Auswahl und Auslegungstool für Ihren Planungsprozess |
| Inocre |
Energetische Optimierung von Kläranlagen durch Ko-Fermentation |
| Kronos |
Berechnung der biologischen Phosphateliminierung |
| Endress+Hauser |
Baumann Federn überlässt beim Abwasser nichts dem Zufall |
| E&P Anlagenbau GmbH |
Deammonifikation von Prozessabwässern |
| Cyklar |
EssDE® steht für die energieautarke Kläranlage (Energy self sufficient by DEMON®) |
| WAM |
Archimedische Schneckenpumpen von SPECO®: Der robuste Klassiker für kosteneffizientes Wasser- und Abwassermanagement |
| WAM |
Abwasservorreinigung für kleine und mittlere Kläranlagen: SPECO® Kompaktanlagen der WAM trennen Feststoffe, Sand und Fette zuverlässig ab |
| WAM |
Noch wenig bekannt: WAM liefert modernste Siebschneckentechnik der Marke SPECO® für die kommunale und industrielle Abwassertechnik |
| Huber |
Effektive und nachhaltige Schwallspülreinigung von Abwasserkanälen mit HUBER Power Flush® |
| Huber |
Warum Kanalsand teuer entsorgen? |
| Kappeler Umwelt Consulting |
Betriebsoptimierung von Kläranlagen |
| Mall |
Lagersysteme professionell planen – mit Mall |
| EUROPHAT® |
ELEKTRO-PHOSPHATFÄLLUNG (elektro-chemisches Verfahren) |
| Roediger |
Auswertung der Lebensdauer und Betriebszustände der Bauteile der NoMix-Toiletten |
| Kronos |
Entlastungsflockung mit Eisensalzen |
| Kronos |
Geruchsbindung in Abwassersammlern |
| Kronos |
Chemische Schlammkonditionierung mit Eisensalzen |
| Kronos |
Das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht in der biologischen Abwasserreinigung |
| 11.12.2011 |
Effiziente Tauchwandlösungen |
| 19.11.2011 |
Klärschlammverbrennung in der kommunalen Abwasserbehandlung |
| 31.10.2011 |
Energieketten-System statt Kabeltrommel |
| 11.08.2011 |
BUCHER: Team-Play beim Klärschlamm Entwässern |
| 05.08.2011 |
Polymermischer im Flockungsprozess: Standardanwendung mit Nutzenpotential |
| 05.06.2011 |
Süd-Chemie: Kompakt und komfortabel |
| 05.06.2011 |
Süd-Chemie: Schluss mit alten Zöpfen! |
| 05.06.2011 |
Frachtermittlung im Kanalnetz |
| 05.06.2011 |
Süd-Chemie:Wo d_r Woi _neilauft … (Wo der Wein hineinläuft …) |
| 27.04.2011 |
Aquen: Flockenbehandlung im Klärprozess, der Schlüssel zur Effizienssteigerung in der Entwässerung um bis zu 30% |
| 27.04.2011 |
Aquen: Ein neues Verfahren zur optischen Erfassung und Bewertung von Flockungseigenschaften in Klärprozessen (Prozess- und Laboranwendung) |
| 10.04.2011 |
E+H: Grenzwertüberwachung von TOC/TC in Produktionsabwässern der Chemieindustrie |
| 10.04.2011 |
E+H: Prosonic S FDU90 |
| 10.04.2011 |
VTA: Probleme mit Microthrix |
| 23.03.2011 |
Wandeln auf Rasierklinge |
| 23.03.2011 |
Desintegration tipptopp |
| 23.03.2011 |
Kreisläufe haben Zukunft |
| 05.02.2011 |
Insituform: Sanieren wo andere Urlaub machen – Kanalsanierung in Innsbruck |
| 26.09.2010 |
ProMinent: Schlammreduzierung durch Ozon mit ProLySys |
| 05.08.2010 |
E+H: Automatisierungslösungen für die Wasser- und Abwasserwirtschaft |
| 05.07.2010 |
UAS Messtechnik: Ein Fall für Edelstahl |
| 05.07.2010 |
Südchemie: Teilstrombehandlung auf dem Klärwerk Landshut |
| 05.07.2010 |
Sera: Effektive Bekämpfung unangenehmer Gerüche |
| 05.07.2010 |
VWS-Aquantis: Sedimentationsverfahren ermöglicht Wiederverwendung von biologisch behandeltem Abwasser |
| 05.07.2010 |
Online-Messung von Schwefelwasserstoff im Abwasser |
| 05.07.2010 |
VWS-Aquantis: Biogasgewinnung aus Brauereiabwasser |
| 02.06.2010 |
Zuverlässige Überwachung der Hauptparameter in einer Kläranlage |
| 16.05.2010 |
„Desi“ bringt faulen Schlamm auf Touren |
| 06.05.2010 |
Schachtsiebanlage RoK 4 heute weltweit bereits über 400 Mal im Einsatz |
| 06.05.2010 |
Huber: Kompaktanlage Ro 5HD: Aus der Praxis, für die Praxis |
| 06.05.2010 |
Passavant: Optimierungs-Ressourcen erschließen |
| 03.05.2010 |
Genauigkeit von Durchflussmessungen in der Praxis |
| 01.05.2010 |
ARA Mühlbachl: Neuer Weg der Abwasserreinigung |
| 19.04.2010 |
HUBER Abwasserwärmetauscher als Beckenversion RoWinB |
| 07.04.2010 |
Belüftungsregelung mit SC 1000: Energie -20 % und Nges <5 mg/l |
| 18.03.2010 |
Ensola Systems: Niedrig Energie Desintegration mittels Hochspannung |
| 28.02.2010 |
Eko-plant: Neue Klärschlammvererdungsanlage in Lumda steht kurz vor der Inbetriebnahme |
| 28.02.2010 |
Mikroschadstoffe im Focus der Abwasserreinigung |
| 28.02.2010 |
Kläranlage Hutthurm: Bayerns größte Membranbelebung in Betrieb |
| 28.02.2010 |
Optimierung der Klär- und Biogaserzeugung durch Desintegration im elektrischen Feld |
| 28.02.2010 |
Turbo in der Abwassertechnik – Terra-N -Verfahren nutzt Deammonifikation |
| 28.02.2010 |
Mit bedarfsgerechten Beratungsleistungen den Kläranlagenbetrieb stärken |
| 08.01.2010 |
Grabenlose Verlegung von Vakuumleitungen |
| 19.12.2009 |
Videos über die Durchfluss-Messtechnik |
| 21.11.2009 |
Schwimmschlammreduktion mit AQUAREL_ HN554 am Beispiel einer Stabilisierungsanlage |
| 21.11.2009 |
Kunststoffrohre für die Galvanikanlage bei Knorr-Bremse in Aldersbach |
| 21.11.2009 |
PE 100-RC-Rohre im Horizontal Spülbohrverfahren verlegt |
| 21.11.2009 |
Eine ingenieurtechnische Betrachtung des Projekts Steinhäule |
| 02.10.2009 |
Die Kläranlage der Zukunft mit Ozon! |
| 10.07.2009 |
UMSTIEG AUF DAS KODIERSYSTEM DER DIN EN 13508-2 |
| 05.07.2009 |
Portables Ultraschall-Durchfluss-Messgerät für die temporäre Messung von außen |
| 05.07.2009 |
Für die wirtschaftliche Durchflussmessung von Wasser |
| 05.07.2009 |
Digitale Sensortechnologie für die Prozessanalysentechnik (PAT) |
| 05.07.2009 |
Maßgeschneiderte Lösungen für die Umweltüberwachung |
| 05.07.2009 |
Flexdip CYA112/CYH112 – Halterungen und Armaturen für Eintauchanwendungen |
| 02.06.2009 |
Die Wasserlinse – Leseforum für Fachleute im Abwasserbereich |
| 29.05.2009 |
SIMONA®PE Platten für den Behälter- und Apparatebau |
| 22.05.2009 |
Rohrvortrieb: Die grabenlose Alternative für die Kanalherstellung |
| 22.05.2009 |
Die erfolgreiche Kanalsanierung in Mumbai/Indien… … |
| 06.04.2009 |
Lötschberg Basistunnel Marti AG MoosseedorfARGE MBK Raron |
| 06.04.2009 |
Kläranlage Mindelheim |
| 06.04.2009 |
Lötschberg Basistunnel |
| 04.03.2009 |
Mit moderner Regelungstechnik auf dem Weg zur Abgabenfreiheit |
| 04.02.2009 |
Robuste Klärwerks-Gleitringdichtung (GLRD) für Pumpen, Förderschnecken, Rührwerke |
| 04.02.2009 |
Langzeit-Gleitringdichtung für Klärwerks-Pumpen |
| 11.01.2009 |
Erfahrungen mit der biologischen Phosphorelimination im Klärwerk Regensburg |
| 11.01.2009 |
Kreide im Einsatz auf Kläranlagen |
| 11.01.2009 |
Höchste Messgenauigkeit in der Durchflussmesstechnik mittels Kreuzkorrelation |
| 11.01.2009 |
Durchmischung, das Stiefkind der Schlammfaulung? |
| 28.12.2008 |
Neue Messtechnik und Steuerung gewährleisten zuverlässigen Betrieb des Regenbeckens |
| 28.12.2008 |
Audi Neckarsulm investierte in eine hochmoderne Abwasseraufbereitungsanlage |
| 28.12.2008 |
Besonders stabil: mit NH4 + NO3 + O2 intermittierend regeln |
| 28.12.2008 |
Optimale Nährstoffverhältnisse für die Abwasserreinigung |
| 28.12.2008 |
Das Frühwarnsystem in der Nachklärung |
| 28.12.2008 |
Havarie-Schutz durch NH4D sc Ammonium-Elektrode |
| 03.10.2008 |
Elimination und Bestimmung von Phosphat-Verbindungen |
| 03.10.2008 |
Hohe Betriebssicherheit und niedrige Betriebskosten |
| 03.10.2008 |
BELÜFTUNGSREGELUNG MIT SC 1000 / AMTAX SC / LDO |
| 10.06.2008 |
Betriebsoptimierung mit der NH4D sc ISE Ammonium-Sonde |
| 10.06.2008 |
Telemetrie für Anlagensicherheit auf höchstem Niveau |
| 10.06.2008 |
Die richtige Prozess-Messtechnik für den N- und P-Abbau |
| 09.06.2008 |
Deutlich reduzierte Schlammmenge mit SOLITAX highline sc |
Was nicht passt, wird passend gemacht:
Die Polymeraufbereitungsanlage CONTINUFLOC passt sich an bestehende Platzverhältnisse der Kläranlage Stuttgart Möhringen an.
Im Prozess der Abwasserreinigung der Kläranlage Möhringen wird eine CONTINUFLOC Aufbereitungs- und Dosieranlage für Polymerpulver zur Verbesserung der maschinellen Überschußschlammentwässerung eingesetzt.
Der Überschussschlamm wird mit der aufbereiteten Polymerlösung vermischt, einer Zentrifuge zugeführt und dort entwässert, um danach der Schlammfaulung und -trocknung zugeführt zu werden.
Startklar für die Polymeraufbereitung
Das Polyelektrolytpulver, das zur Entwässerung des Überschussschlammes eingesetzt wird, wird in Big Bags angeliefert, mittels Krans an der Entleerstation aufgehängt. Aus dem Aufgabetrichter wird das Polymerpulver mit Hilfe des Fördergerätes AIRLIFT pneumatisch in den Vorratstrichter der vollautomatischen Zweikammer-Pendelanlage CONTINUFLOC gefördert. Die Löse- und Dosierstation wird betriebsfertig verkabelt, verrohrt und elektrisch und hydraulisch werksseitig geprüft geliefert. Die Verrohrung der Anlage wurde auf Kundenwunsch aus Brandschutzgründen komplett in PP ausgeführt.
Steuerung der Anlage über die S7-1200
Über das robuste, hochauflösende Farb-Touchpanel kann der Betreiber der Kläranlage Möhringen zahlreiche Informationen, wie zum Beispiel die Anzahl der Betriebsstunden, die Anlagenzustände oder die Alarmhistorie, anzeigen lassen und erhält so jederzeit einen Überblick über den Zustand der Anlage. Auch die Pulverdosierung wird über das Touchpanel angesteuert und die Ansetzkonzentration kann direkt an der Anlage festgelegt werden. Die Kommunikation zwischen Anlage und Leitwarte erfolgt über eine in der Anlage verbaute Profinet-Schnittstelle. Die Position des Schaltschranks wurde an die speziellen Platzverhältnisse im Maschinengebäude der Kläranlage angepasst.
Begehbarkeitspaket erleichtert den Zugang
Mit dem Begehbarkeitspaket, das aus einem Gitterrost als Standfläche auf der Anlage besteht, Geländer mit Sicherheitstür zum Treppenaufgang und Treppe mit zwei Handläufen, hat das Kläranlagenpersonal jederzeit sicheren Zugang zu allen Anlagenteilen. Dies ist für die sichere Ausführung von Wartungs- und Kontrollarbeiten wichtig.
Dosierstation für die aufbereitete Polymerlösung
Die aufbereitete Polymerlösung wird über eine Dosierstation mit integrierter Nachverdünnung, mit Exzenterschneckenpumpen zur Impfstelle in die Schlammleitung gefördert.
https://www.alltech-dosieranlagen.de/branchen/referenzen/wasser-abwasserbehandlung.html
(nach oben)
Mall GmbH: Umsicht beim Flocken
Unfällen mit Fällmitteln wirksam vorbeugen
Tom Kionka
Quasi als Grundgesetz zum Schutz aquatischer Systeme formuliert das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die basalen Anforderungen. Nachgeordnete Bestimmungen regulieren die Details – unter anderem den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Auch der Betrieb von Kläranlagen ist von diesem Normierungsbereich betroffen.
Schockszenerie: schäumende Flüsse, sterbende Fische, die Nordsee im Rotalgenfieber, Badespaß als Gesundheitsrisiko. So war es in den 1970ern. Und die ungenügende Nährstoffelimination damaliger Kläranlagen war die Ursache. Mit ihrer zweistufigen Auslegung auf einen mechanisch-biologischen Reinigungsprozess mussten sie vor dem anschwellenden Nährstoffschub im Abwasser kapitulieren. Stickstoff und Phosphat – neben menschlichen Stoffwechselprodukten durch rasant steigenden Gebrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln eingetragen – passierten die Klärwerke, landeten in den Gewässern und ließen sie eutrophieren. Abwasserprofis traten dem ökologischen Desaster entgegen und ersannen die dritte Reinigungsstufe. Mit Beginn der 1980er wurde sie implementiert, Zug um Zug vereinheitlicht im Regelwerk der sich konsolidierenden EU und heute ist die Nährstoffelimination längst Stand der Technik.
Während die Stickstofffracht mit klugem Design der biologischen Stufe gepackt wird, erfolgt die Phosphatentfernung vielfach durch Einsatz von Hilfsstoffen in einem chemisch-physikalischen Prozess: Ein dem Abwasserstrom zudosiertes Fällmittel reagiert mit den Phosphaten und bildet mit ihnen eine Flockenstruktur. In dieser wasserunlöslichen Form fixiert, können dann beide – Fällmittel und Phosphate – auf einfache Weise physikalisch abgetrennt werden. Bei korrekter Prozessführung verbleibt kein Fällmittel im Abwasser, was von hoher Relevanz ist, denn die auf Kläranlagen verwendeten Fällmittel sind als wassergefährdende Stoffe klassifiziert. Ihre Anlieferung und Lagerung unterliegt deshalb strengen Sicherheitsbestimmungen.
Regelwerk fordert höchste Sicherheit
Maßgeblich sind vor allem die Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe (AwSV) sowie die technischen Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS). Sie legen fest, mittels welcher Vorkehrungen der Schutz von Boden und Grundwasser erreicht wird. Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen erstrecken sich von der flüssigkeitsdichten Gestaltung betroffener Betriebsflächen bis hin zu Umlenk- und Rückhalteeinrichtungen mit ausreichend dimensionierten Auffangvolumina. Die hierbei eingesetzten Bauteile müssen den hohen Sicherheitsanforderungen des Regelwerks genügen.
Ein Produkt für die Rückhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) ist das Sicherheitsauffangbecken NeutraSab. Es besteht aus einem erdversetzten Stahlbetonbehälter, der je nach wassergefährdender Flüssigkeit eine hierzu passende Konfiguration der verwendeten Bauteile erhält, um die chemische Beständigkeit zu gewährleisten. Integriert sind eine Durchverrohrung mit Überlaufstutzen sowie eine Absperrklappe mit Schwenkantrieb. Sie verschließt vor einem Abfüll- oder Umschlagvorgang das Durchlaufrohr, damit die wassergefährdende Flüssigkeit im Havariefall via Überlaufstutzen in das Auffangbecken fließt. Im Regelbetrieb dagegen – bei offener Absperrklappe – fließt Regenwasser, soweit es auf der Lager-, Abfüll- oder Umschlagfläche anfällt, ungehindert in den Schmutzwasserkanal.
Die Kläranlage Trierweiler, eine der 14 Anlagen des Abwasserwerks Trier-Land, hatte Anfang 2022 ein solches Sicherheitsauffangbecken erhalten. Polyaluminiumchlorid ist in Trierweiler das Fällmittel der Wahl. Nach anfänglicher Anlieferung in kleinen Gebinden, wurde dann jedoch ein oberirdischer Lagertank für die Bevorratung größerer Mengen errichtet. Und zur Absicherung des Umfüllvorgangs musste für das Tankfahrzeug eine flüssigkeitsdichte Stellfläche erstellt werden, deren Ablauf in ein Becken vom Typ NeutraSab führt. Das Auffangbecken ist unmittelbar neben der Abfüllfläche erdeingebaut.
Baukastenprinzip bedient jeden Bedarf
Weitere Produkte können das WHG-konforme Fällmittel-Handling unterstützen. Während NeutraSab für offene Betriebsbereiche mit Regenwasseranfall konzipiert ist, dient das abflusslose Auffangbecken NeutraHav dem gleichen Zweck in vollständig überdachten Bereichen. Auch NeutraHav besteht aus einem erdversetzten Stahlbetonbehälter mit einer dem Risikomedium angepassten Ausstattung. Unter Umständen kann es im Abfüll- und Umschlagbereich notwendig sein, unterschiedlich belastete Abwasser- oder Flüssigkeitsströme zu verschiedenen Behandlungsanlagen, Auffangbecken oder auch zur Kanalisation zu leiten. Diese Aufgabe erfüllt der Umlenkschacht NeutraSwitch. Und wenn es darum geht, die Rohrleitung zur Kanalisation im Gefährdungsfall schnell sperren zu können, ermöglicht der Absperrschacht NeutraBloc eine sofortige Reaktion mittels dreier Ausführungsvarianten: elektrischer oder pneumatischer Schwenkantrieb sowie elektrischer Drehantrieb. Die Ausführung mit pneumatischem Schwenkantrieb schließt stromlos, bietet somit Sicherheit auch bei Stromausfall, und punktet mit einer Verschlusszeit von unter einer Sekunde
Die baukastenartige Kombinierbarkeit all dieser Komponenten ermöglicht die exakt situations- und bedarfsgerechte Ausgestaltung eines WHG-konformen Systems für das Fällmittel-Handling auf Kläranlagen. Dazu gehört am Ende auch die Option, den Fällmittelspeicher unterirdisch anzuordnen, wenn oberirdisch der Platz fehlt. Hierfür eignet sich der Lagerbehälter NeutraLag. Zusammen mit dem Sicherheitsauffangbecken verschwindet er im Boden, und unmittelbar darüber ließe sich mit dem flüssigkeitsdichten Ableitflächensystem NeutraDens der Anlieferbereich für das Tankfahrzeug gestalten. So geht sicherer Betrieb entlang der Regeln auf wenig Platz.
Riskante Helfer?
Fällmittel assistieren im Prozess der Abwasserreinigung bei der Phosphatentfernung. Gleichzeitig zählen sie zu den wassergefährdenden Stoffen. Der scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn Lieferung und Lagerung der Substanzen risikofrei abgesichert sind. Bei der Anwendung dann verlieren sie ihren Gefährdungscharakter durch die chemisch reaktive Einbindung in das anschließend abtrennbare Flockengerüst. Als Klassiker unter den Fällmitteln sind Kalkmilch und Eisenchloride im Einsatz. Aber auch Eisenchloridsulfat, Grünsalz, Aluminiumsulfat, Polyaluminiumchlorid oder Natriumaluminate werden verwendet.
 |
Mit der dritten Reinigungsstufe gelingt Kläranlagen die Nährstoffelimination. Dabei helfen Fällmittel gegen die Phosphatfracht.
Bild: Mall |
 |
Der Blick ins Sicherheitsauffangbecken NeutraSab zeigt Durchverrohrung, Absperrklappe mit Schwenkantrieb und Überlaufstutzen.
Bild: Mall |
 |
Klärwerk Trierweiler: der Fällmitteltank, davor die Stellfläche fürs Tankfahrzeug und erdeingebaut daneben NeutraSab.
Bild: Mall |
 |
Zur Gestaltung flüssigkeitsdichter Flächen bietet NeutraDens 20 verschiedenen Platten-, Rinnen-, Ablauf- und Bordsteinelemente.
Bild: Mall |
Mall GmbH
Hüfinger Straße 39-45
D-78166 Donaueschingen-Pfohren
Tel.: 0049 (0)7 71/80 05-0
Fax: 0049 (0)7 71/80 05-1 00
info@mall.info
http://www.mall.info
(nach oben)
Abwasser liefert Eigenstrom
KWK IN KLÄRANLAGEN Mit Blockheizkraftwerken lässt sich das bei der Abwasseraufbereitung anfallende Faulgas zur Stromerzeugung nutzen. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern auch den Gemeinden, die Ausgaben für Strom senken können. Wie viel der Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung in Klärwerken bringt und welche Kosten sich Kommunen sparen können, erläutert der folgende Beitrag.
Kläranlagen gehören mit durchschnittlich 17 bis 20 Prozent Anteil zu den größten Stromverbrauchern im kommunalen Bereich. Die Abwasseraufbereitung der Klasse bis etwa 10.000 Einwohner erfordert laut Umweltbundesamt im Mittel 55 kWh je Einwohner und Jahr. Energetisch modernisierte Einrichtungen begnügen sich zwar im Einzelfall mit 20 kWh, doch befindet sich die Masse der rund 10.000 kommunalen Klärwerke im sanierungswürdigen Zustand. Ein Repowering mit KWK tut mithin sowohl der Umwelt als auch der Stadtkasse gut. Dem zweiten Profiteur deshalb, weil die Stromversorger in der Regel der Öffentlichen Hand keinen attraktiven Sondertarif einräumen. Das heißt, für eine Gemeinde mit 5.000 Einwohnern fallen jährlich bis 70.000 Euro Stromkosten nur für die Reinigung des Schmutzwassers aus der Kanalisation an. Die Luft belasten die 275.000 kWh, bei einem Emissionsfaktor von 350 g CO2 pro 1 kWh für den aktuellen Strommix aus fossilen und erneuerbaren Energieträgern, mit ungefähr 100 t Kohlendioxid. Die Faulgas-Verfeuerung in einem hocheffizienten BHKW entlastet davon, da der Brennstoff aus dem natürlichen CO2-Kreislauf stammt.
Zum Einsatz von Klärgas in KWK liegen mittlerweile genügend Erfahrungsberichte von Zweckverbänden, Kommunen, Bundesländern, Instituten und staatlichen Stellen wie dem Umweltbundesamt vor. Energieeffizienz geht so weit, dass zum Beispiel in Weinheim die Modernisierung der Energieversorgung mit KWK und eigenem Biogas die Abwasseraufbereitung zu einer Energie-Plus-Kläranlage verwandelte. Oder auch in Bad Oeynhausen. Die Investition dort von 200.000 € führte zu einem Eigenversorgungsgrad von 113 Prozent. Laut Gemeindebericht senkten sich dadurch die jährlichen Energiekosten um rund 250.000 €.
Klärgas-KWK im Kleinformat
Aber auch KWK in Klein-Klärwerken rentiert sich. 2014 entschied sich die Kommune Bergatreute in der Nähe des Bodensees zur Sanierung der Abwasseraufbereitung. Der Energieverbrauch lag bis 130.000 kWh im Jahr. Der Strom kostete und kostet weit über 20 Cent. Nach einer von der Verwaltung in Auftrag gegebenen Energiestudie bewegte sich das Optimierungspotenzial bei rund 55.000 kWh jährlich.
Als sinnvolle Maßnahme empfahl sich neben verschiedenen Umbauten und Anpassungen die Aufstellung eines BHKW zur Eigennutzung des methanhaltigen Faulgases. In Bergatreute entwickelt sich im Faulbehälter Klärgas und das setzt der Betrieb für die Stromerzeugung ein. Dazu musste die vorhandene kalte Faulung zu einer beheizten Faulung umgebaut werden, denn die Vergärung der Biomasse läuft bei Temperaturen von 30 bis 40 °C gegenüber der kalten Fermentierung wesentlich schneller ab.
Die Wärme zur Beheizung des Faulbehälters liefert ein BHKW des Typs XRGI® 15 von EC POWER mit einer Leistung von 15/30 kW elektrisch/thermisch. EC POWER ist mit der XRGI®-Reihe 6, 9, 15 und 20 kW elektrisch Marktführer seiner Leistungsklasse in Europa.
Die thermophilen Bakterien, die die Biomasse zersetzen, produzieren im Mittel ca. 120 m³ Klärgas täglich. Jeden Kubikmeter mit einem Heizwert von ca. 6 kWh setzt die KWK, bezogen auf das Verhältnis von grob 1 : 2 für Strom zu Wärme, in Bergatreute mithin in bis zu 1,7 kWh Strom und 3,4 kWh Wärme um. Als täglichen Durchschnittswert dokumentieren die Messprotokolle 180 kWh Strom. Die Spanne reicht dabei von 100 kWh/d bis 300 kWh/d. Der Eigenversorgungsgrad der Kläranlage liegt bei einem Gesamtverbrauch von etwa 235 kWh/d somit bei 76 %. Überschüssiger Strom fließt ins öffentliche Netz.
Den Ein/Aus-Betrieb des XRGI® steuert der Füllstand im Gasspeicher. Unterschreitet der ein bestimmtes Niveau, schaltet der Füllstandsensor den Motor aus beziehungsweise nimmt ihn in Betrieb, wenn das Niveau den Sollwert wieder erreicht. Aus einem Strompreis von etwa 25 Cent je 1 kWh und unter Berücksichtigung der Annuitätskosten – die KWK-Installation schlägt mit etwa 70.000 € zu Buche – sowie des Aufwands für Wartung und Instandhaltung errechnen sich für die Gemeinde jährliche Stromkosteneinsparungen von über 10.000 €. Dazu kommen der KWK-Bonus und weitere Vergünstigungen nach EEG und KWKG. Überschlägig steht zur Finanzierung einer Installation, die, um bei dem beschriebenen Beispiel zu bleiben, täglich 180 kWh zu 25 Cent einspart, unter Berücksichtigung der Belastungen und Vergünstigungen ein Betrag von nahe 20.000 Euro zur Verfügung.
Nach Klaus Bücheler, Biologe, Ingenieur und der für Bergatreute verantwortliche Planer im Büro Jedele und Partner, hängt die Wirtschaftlichkeit eines BHKW indes entscheidend von der Betriebsweise ab: „Das EC Power-Aggregat moduliert zwischen 7 und 15 kW elektrisch. Wenn man für die Wärme einen Abnehmer hat, ist es besser, nicht bedarfsgeführt das BHKW zu betreiben, sondern auf einem höheren Leistungsstrich zu fahren und den Überschuss einzuspeisen.“ Das alles ist aber bekanntes Terrain. KWK in Kläranlagen ist kein Neuland, besonders nicht für den Anlagenbauer Enerquinn GmbH. Die KWK-Spezialisten aus dem oberschwäbischen Weingarten haben weit über 1.000 BHKWs unter Vertrag. Davon steht eine Anzahl in Kläranlagen, so in Bergatreute.
Das XRGI® 15 mit 15 kW elektrisch und 30 kW thermisch beheizt mit einem Teil seiner Abwärme den Faulbehälter.
Den KWK-Strom verbrauchen die Beckenbelüftung, die Pumpen, das Rührwerk und andere Klärwerkstechnik.
https://www.ecpower.eu/de/
(nach oben)
Grundfos: Innovatives Laufraddesign sorgt für zuverlässigen Betrieb bei geringeren Gesamtkosten und erfüllt die Herausforderungen des städtischen Abwassers
Die Abwasserpumpe ist das Herzstück eines jeden Abwassernetzes. Die Betriebszeit und Effizienz der Pumpe sind entscheidend, um die Gesamtbetriebskosten niedrig zu halten und den Abwasserfluss zu optimieren, während sie gleichzeitig dazu beiträgt, das höchste Leistungsniveau aufrechtzuerhalten.Um der zunehmenden Komplexität des städtischen Abwassers gerecht zu werden, hat Grundfos das halboffene Laufrad Open S-tube® entwickelt, das einen hohen Wirkungsgrad über einen breiten Betriebsbereich bietet. Das Open S-tube® Laufrad kann auf einen bestimmten Betriebspunkt angepasst werden und ist die ideale Lösung bei mittlerer bis extremer Verschmutzung des Abwassers. Die neue Geometrie des Laufrads erhöht die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Abwasserpumpe, reduziert die Betriebs- und Wartungskosten und hilft dem Betreiber alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Zusätzlich bieten wir Hydraulikkomponenten in Hartguss an. Diese Eisenlegierungskombination bietet eine sehr gute Verschleißfestigkeit im Vergleich zu anderen metallischen Werkstoffen und eine bessere Abriebfestigkeit als Grauguss.
Wir von Grundfos sind stets bestrebt Pumpen und Lösungen zu entwickeln und zu verbessern, um den sich ständig ändernden Anforderungen im Abwasserbereich gerecht zu werden. Vor allem kommunales Abwasser wird immer komplexer. Bestandteile wie Schwebstoffe, organische Stoffe, Öle und Fette, Fasern und Polymere oder andere Substanzen stellen neue Herausforderungen dar. Darüber hinaus erhöhen extreme Witterungen die Variation der Niederschläge und damit die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen.
Für das neue und innovative Open S-tube® Laufrad für SE/SL Abwasserpumpen haben wir im Vorfeld eine umfangreiche Anzahl virtueller Tests und Strömungssimulationen durchgeführt, um das bekannte Grundfos Qualitäts- und Leistungsniveau zu erhalten. Im Anschluss wurden alle Simulationen mit modernsten physikalischen Tests validiert. Vor der Marktfreigabe wurden darüber hinaus ausgiebige Feldtests in anspruchsvollen Anlagen auf der ganzen Welt durchgeführt, um die Funktionalität und Haltbarkeit zu bestätigen.
https://www.grundfos.com/de/learn/research-and-insights/innovative-hydraulics-deliver-reliable-operation-at-lower-total-cost
(nach oben)
Gardnerdenver: Die Möglichkeit, die Maschine auf Software-Ebene an die Prozessspezifikationen anzupassen, die deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs und der Geräuschentwicklung machen ROBOX energy von Robuschi zur idealen technischen Lösung für eine Kläranlage auch von mittlerer Größe und mit spezifischen Anforderungen
Alto Trevigiano Servizi ist das im Jahr 2007 gegründete kommunale Unternehmen, das die integrierte Wasserversorgung für dreiundfünfzig Gemeinden in den Provinzen Treviso, Vicenza und Belluno verwaltet. Ein Gebiet mit etwa 500.000 Einwohnern, in dem sechsundvierzig mittelgroße Kläranlagen betrieben werden. In den letzten Jahren hat die Verwaltungsabteilung für Kläranlagen, koordiniert von Abteilungsleiter Alberto Piasentin, neben der Verwaltung und dem Betrieb der Anlagen, den Sektor für die Optimierung der Klärprozesse entwickelt. Dafür verantwortlich ist Umweltingenieur Daniele Renzi, der vom besonderen Eingriff bei der Kläranlage der Stadt Valdobbiadene (TV) erzählt.
Variable Bedürfnisse, flexible Antworten
Die Anlage in Valdobbiadene wurde für 10.000 Einwohnerwerte (EW) mit einer städtischen und industriellen Last mit 390 mbar Differenzdruck mit schwankender Durchflussmenge zwischen 400 und 1600 m³/h entwickelt. Sie ist mit anfänglichen Vorbehandlungen, einer vorgeschalteten Denitrifikationsphase, gefolgt von einem Nitrifikations- und Oxidationssegment, einer Nachklärung und einer Klärschlammleitung strukturiert, die mit der Entsorgung durch Kompostierung endet. Vor kurzem war es notwendig, die biologische Anlage, insbesondere den Abschnitt der Luftdiffusion zu modernisieren. Man musste jedoch einige Besonderheiten berücksichtigen: „Die Anlage für ca. 5.000 Einwohnerwerte, eine niedrigere Zahl im Vergleich zum Anfangspotential des Projektes, zeichnet sich durch saisonale Schwankungen aus“, erklärt Ing. Renzi. „So findet man im Produktionsgebiet des Prosecco und während der Weinlesezeit und der vermehrten Aktivität in den Weinkellern – von Ende August bis Anfang November – eine erhöhte organische Last, die in die Anlage eintritt, sodass sie ein Niveau von 10.000 Einwohnerwerten, mit Spitzenwerten bis 13.000 EW an manchen Tagen erreicht.“
Zur Überwindung der saisonalen und täglichen Schwankungen ist es daher wichtig, Vorrichtungen zu verwenden, die eine hohe Flexibilität in Bezug auf Luftzufuhr, sowie Pump- und Mischleistung garantieren können.
Die Antwort auf diese Anforderungen liefert ROBOX energy, der neue Schraubenkompressor mit Permanentmagneten von Robuschi.
ROBOX energy, die ideale Lösung
„Im Bereich der Luftdiffusion“, so Ing. Renzi weiter, „war die Anlage bereits mit zwei Drehkolbengebläsen von Robuschi mit doppelter Drehzahl ausgestattet, die zwar funktionstüchtig, aber veraltet waren. Deshalb suchte man einen Kompressor mit einer moderneren Technologie, der die Grenzen der zwei bereits installierten Kompressoren (Lieferung einer festgelegten Luftmenge nahezu ohne Flexibilität) überschreiten und auf diese Weise die typischen Versorgungsspitzen der Anlage in Treviso abdecken konnte.“
Der Modernisierungs-Eingriff begann Ende 2016, am Ende des jeweiligen Überlastzeitraums. Um die Installation der Maschine zu ermöglichen, waren ein paar Eingriffe, minimale Bauarbeiten und einige Maßnahmen an den Leitungen erforderlich, um den neuen Kompressor anzuschließen. „Es gab keine Probleme aus Sicht der Installation“, erklärt Edi Casagrande, der Fachtechniker, der mit der Wartung der Anlagen von Alto Trevigiano Servizi betraut wurde, „da ROBOX energy eine kompakte, robuste Maschine ist, die sich auch in einen bereits aktiven Klärprozess einfach integrieren lässt. Der Kompressor wurde mit den beiden anderen bestehenden Robuschi Gebläsen verbunden, die als Ersatzmaschinen gewartet wurden, um die Kontinuität bei der Wartung der neu konzipierten Maschine sicherzustellen.“
Die gesamte Installationsphase führte überdies nicht zu langen Ausfallzeiten. „Für die Anbindung an die Hauptluftzufuhrleitung mussten wir spezielle Unterbrechungen erzeugen, und die eigentliche
Trennung der Lufteinblasung in den Prozess der Kläranlage dauerte nur wenige Stunden. Die elektrischen Anschlüsse waren jedoch bereits vorhanden, da ROBOX energy mit einer Bordelektronik ausgerüstet ist. Somit musste nur eine elektrische Stromleitung angeschlossen und das Signalkabel verbunden werden, um die Steuerung des Kompressors auf Grundlage der Prozessparameter der Anlage zu bestimmen.“
Eine Software nach Maß
Anschließend hat Alto Trevigiano Servizi in enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Robuschi die Software des Kompressors implementiert, um die Maschine über eine Fernbedienung mit einem automatischen Kontrollsystem mit intermittierender Belüftung zu steuern, die in Verbindung mit dem auf ROBOX energy installierten Smart Process Control funktioniert und sie im Fall von technischen Problemen an der Fernbedienung autonom zu machen, wodurch teure Abschaltungen vermieden werden.
„Die Betriebsarten wurden in zwei Sequenzen unterteilt: Master und Slave“, erklärt Casagrande. „Im Master-Modus ist die Maschine autonom und eigenständig. Sie wird nur durch ein Signal mit 4-20 mA direkt an einem Analogeingang und eine Sauerstoffsonde in der Biomasse der Kläranlage gesteuert, welche die für den Prozess erforderliche Sauerstoffmenge erfasst und in der Folge die Bereitstellung der Kubikmeter an Luft regelt. Im Slave-Modus wird der Kompressor hingegen durch das Remote-System betrieben, das ihm Start- und Stopp-Sequenzen liefert und je nach Prozessbedarf der Anlage intermittierende Belüftungsphasen erzeugt. Diese Arbeitsfolge gewährleistet eine Energieeinsparung und eine deutliche Reduktion von Stickstoffkomponenten im biologischen Prozess. Jedoch ist es möglich, im Falle eines Ausfalls oder einer Beschädigung der externen automatischen Steuerung den Betriebsmodus zu ändern, sodass ein Bediener vor Ort direkt am Bedienfeld des Gebläses eingreifen kann.“
Die Vorteile von ROBOX energy
In beiden Betriebsarten ist der Aspekt, den das Unternehmen sofort erkannt hat, die hohe Flexibilität von ROBOX energy. Dank der Permanentmagnet-Technologie kann die Anlage nun mit einem maximalen Potential von etwa 1.600 m3/h und einer Mindestgeschwindigkeit von einigen hundert Kubikmetern, mit einer höheren Elastizität gegenüber dem vorherigen Betriebsbereich zwischen 1.600 und 880 m3/h arbeiten. „Wir haben die untere Grenze des Kompressors auf ca. 500 m3/h eingestellt“, so Ing. Renzi, „da es auf Grundlage von vor Ort durchgeführten Messungen dieser Bereich ist, der eine ausreichende Mindestdurchmischung des oxidativen Segments gewährleisten kann. Tatsächlich könnte die Permanentmagneten-Technologie die Maschine dazu bringen, mit noch geringeren Strömungsgeschwindigkeiten zu arbeiten.“
Neben der Flexibilität war die Möglichkeit, den neuen Kompressor von Robuschi einfach mit einem Plug & Play-Modus zu installieren, ein weiterer wichtiger Aspekt für Alto Trevigiano Servizi. Es ist eine komplette Maschine mit einer integrierten elektrischen Schalttafel im hinteren Teil der Maschine und einem einfach zu bedienenden Bedienfeld an der Vorderseite; „Wir suchen häufig technologisch fortschrittliche, aber einfache Lösungen“ so der Ingenieur, „sodass unsere Bediener eine intuitive grafische Schnittstelle zur Verfügung haben und sofort erkennen, welche Parameter bearbeitet werden müssen.“
Garantierte Einsparungen
Der Kompressor ROBOX energy ist mittlerweile sechs Monate in Betrieb. Während der Startphase unmittelbar nach der Installation wurden die Hauptparameter überwacht, um den entsprechenden Durchflussbereich und die Änderungsgeschwindigkeit der Maschine zu definieren. In diesen ersten Monaten des Betriebes gab es keine Probleme mechanischer oder elektrischer Natur. Um die Vorteile im Hinblick auf die Energieeinsparung durch den Einbau von ROBOX energy zu testen, wurden zwei Arten von Analysen durchgeführt, erklärt Ing. Renzi. Vor und nach der Installation wurde der globale Transferkoeffizient des gelösten Sauerstoffs des Luftdiffusionssystems bewertet. Dabei zeigte sich, dass der durchschnittliche tägliche Energieverbrauch (in kWh) des neuen Kompressors im Vergleich zu den Vorgängermodellen zwischen 15 und 20% niedriger ist – ein hervorragendes Ergebnis für eine kleine Anlage mit einem Betriebsdruck von 390 mbar.
Eine zufriedenstellende Entscheidung
„Wir sind mit dieser Maschine zufrieden“, sagt Ing. Renzi. „Neben der einfachen Installation und Steuerung garantiert ROBOX energy Stabilität, ein Aspekt, der sich auf den Prozess auswirkt; Flexibilität, die eine Anwendung in mittleren oder kleinen Systemen, wie dem unsrigen, aber auch in leistungsfähigeren Anlagen ermöglicht; eine perfekte Kombination mit den Zyklen mit intermittierender Belüftung, und schließlich entspricht sie den Bedürfnissen einer saisonalen Anlage mit großen täglichen Schwankungen wie jener von Valdobbiadene.“
Der Ingenieur schließt mögliche zukünftige Kooperationen mit Robuschi nicht aus, um ROBOX energy in weiteren Entwicklungsprojekten von ATS einzusetzen. Er betonte, dass die Innovationsfreudigkeit von Alto Trevigiano Servizi die Bereitschaft vorsieht, mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu kooperieren, die fortschrittliche Technologien für einen umweltbezogenen und wirtschaftlichen Nutzen bei der Steuerung und Planung von Kläranlagen entwickeln möchten.
https://www.gardnerdenver.com/de-de/robuschi/about-us/case-studies/robox-energy-the-ideal-answer-to-wastewater-treatment-variables
(nach oben)
Gardner Denver: Niederdruck-Schraubenkompressoren wurden bei der Charles Brand Kläranlage installiert
Gardner Denver Vertriebshändler Team Air Power lieferte eine maßgeschneiderte Druckluftlösung, die zusammen mit anderen Maßnahmen zur Optimierung der Anlagenprozesse über einen Zeitraum von 12 Monaten den Energieverbrauch um 539,844 kW/h senkte.
Die Herausforderung
Die Kläranlage des Unternehmens in Belfast benötigt Gebläse zum Belüften der SBR-Becken der Anlage und zur Abwasserreinigung. Durch die Sauerstoffzufuhr in den Belebtschlamm im Reaktor mittels Belüftung helfen die Gebläse, organische Verbindungen im Abwasser aufzuspalten.
Bisher setzte Charles Brand fünf überdimensionierte 132 kW Gebläse für diesen Belüftungsprozess ein. Diese Aggregate waren 16 Jahre alt und erforderten erhöhte Wartung, um sie in gutem Betriebszustand zu halten. Die Kompressoren des Unternehmens erlitten innerhalb von drei Monaten drei Betriebsausfälle mit Reparaturkosten in Höhe von jeweils £6.000. Mit eskalierenden Kosten konfrontiert stellte Charles Brand fest, dass durch Modernisierung ihres Belüftungssystems durch die Nutzung fortschrittlicher Gebläsetechnologie Einsparungen erzielt werden könnten.
Die Lösung
Die revolutionäre Lösung – die erste ihrer Art in Großbritannien – beinhaltete den Ersatz von drei der 132 kW Aggregate durch 75 kW Robuschi WS 85 Robox Energy Schraubenkompressoren, mit einer Amortisationsdauer von drei Jahren.
Der Robuschi Robox Energy Niederdruck-Schraubenkompressor kombiniert einen Schraubenkompressor mit einem Permanentmagnetmotor, wodurch ein Druck bis zu 1000 mbar(g) und eine Durchflussmenge von bis zu 2.600m3/h ermöglicht werden. Sein interner Kompressor, kombiniert mit einem effizienten Permanentmagnetmotor, ist direkt auf der Antriebswelle montiert, um Leistungsverluste durch Riemenübertragung zu vermeiden.
Charles Brand ist auch in der Lage, den Betrieb des gesamten Aggregats über eine intelligente HMI-Steuertafel zu überwachen. Mittels einer Fernverbindung, kann die Leistung jerderzeit und von überall überwacht, und vorbeugend Wartungen geplant werden.
Der Niederdruck-Schraubenkompressor benötig 30 Prozent weniger Platz als vergleichbare Aggregate und wird komplett mit integriertem Frequenzumrichter (VFD) geliefert. Die Aggregate waren durch die einfache “Plug-and-play“-Installation sofort betriebsbereit.
Der Betreiber musste nur die Leitungen, die Stromversorgung und die Steuertafel an das System anschließen.
Das Ergebnis
Diese Vorteile bedeuten, dass der Robox Energy Niederdruck-Schraubenkompressor Kosteneinsparungen von etwa 20 Prozent erreichen kann, was ihn zu einem idealen Aggregat für den energieintensiven Kläranlagensektor macht.
https://www.gardnerdenver.com/de-de/robuschi/about-us/case-studies/award-winning-screw-blowers-installed-at-charles-brand-wastewater-facility
(nach oben)
Gardnerdenve: ROBOX energy – Effizienz in Abwasserkläranlagen
Extreme Effizienz und Flexibilität für die kommunale Abwasserkläranlage von Dimaro im Territorium der Autonomen Provinz Trient. Robuschi hat dort den neuen Robox energy WS 65 getestet. Eine Technologie, die alle Erwartungen übertroffen hat.
Der neue Schraubenkompressor mit Permanentmagnetmotor Robox energy WS 65 von Robuschi wurde ursprünglich probeweise installiert, hat sich aber dann als perfekte Lösung für eine Kläranlage der Autonomen Provinz Trient erwiesen.
Die Gesamtoxidationsanlage für die biologische Aufbereitung der privaten Abwässer, die seit Dezember 2011 aktiv ist, deckt die Fläche der Gemeinden von Dimaro und Commezzadura im Hochtal „Alta Val di Sole“ ab. Sie sieht eine zusätzliche biologische Denitrifikation und Entphosphatierung der Abwässer vor, um die Umweltbelastung zu verringern. Dies ist notwendig, da das Abwasser direkt in den nahen Fluss Noce abgeleitet wird. Außerdem verfügt die Struktur über ein Schlammsedimentationssystem. Der Schlamm wird einer physikalischen Behandlung unterzogen und zur Deponie geschickt.
Eine besondere Situation
Die Anlage hat also eine Standardstruktur mit einer Besonderheit. Deshalb, erklärt Giovanni Stancher, Leiter des Werkstattlagers für die Kläranlagenbewirtschaftung der Autonomen Provinz Trient, war die Anwendung des neuen Kompressors Robox energy von Robuschi interessant. Die Anlage von Dimaro verfügt nämlich über sieben Meter tiefe Oxidationsbecken, im Gegensatz zu den üblichen viereinhalb Metern aller restlichen Anlagen im Territorium. „Diese Tatsache, zusammen mit dem niedrigeren Umgebungsluftdruck im Vergleich zu den anderen Anlagen (die Anlage befindet sich auf einer Höhe von zirka 800 Meter über dem Meeresspiegel), zwingt die installierten Maschinen dazu, unter nicht optimalen Bedingungen zu arbeiten, wobei der Gegendruck hart an der Grenze liegt.” Zunächst wurden Gebläsegruppen mit traditionellen Motoren, ebenfalls mit Robuschi-Technologie, installiert, deren Aufgabe es war, die notwendige Sauerstoffmenge für die Oxidation und die Senkung des CSB, der organischen Substanzen in den Abwässern, zu gewährleisten.
Optimale Konfiguration
Der erste Schritt des neuen Weges für die Anlage im Trentino wurde gesetzt, als Robuschi den Niederdruck-Schraubenkompressor Robox screw mit traditionellem Motor präsentierte. „Es wurde uns angeboten, diesen auszuprobieren,” erinnert sich Stancher, „und so wurde er in einigen anderen Anlagen installiert. Später brachten wir ihn nach Dimaro, denn wir waren davon überzeugt, dass diese Technologie hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten am besten genutzt werden konnte.” Das war im Jahr 2012 und der neue Kompressor war nicht nur in der Lage, eines der bereits installierten Drehkolbengebläse Robox evolution zu ersetzen, sondern erwies sich als ausreichend, um alleine den gesamten Bedarf der Anlage abzudecken.
Eine neue Herausforderung stellte sich Ende 2015, als die Fa. Robuschi der Provinz von Trient vorschlug, die Leistungsfähigkeit ihres neuesten, innovativen Kompressormodells, des neuen Kompressors Robox energy, zu testen. „Ein verlockendes Angebot, das wir gerne annahmen. Wir freuen uns immer, neue Technologien ausprobieren zu dürfen,” so weiter Stancher. „Außerdem ergab sich dadurch für uns die Gelegenheit, zwei Modelle derselben Maschine zu vergleichen, die jedoch über verschiedene Motoren verfügen. Wir haben also an derselben Anlage das dreiflügelige Drehkolbengebläse Robox evolution mit traditionellem Motor, einen Niederdruck-Schraubenkompressor Robox screw, ebenfalls mit Standardmotor und Riemenübertragung, und den neuen Schraubenkompressor Robox energy mit Permanentmagnetmotor installiert,” welcher im Juli 2016 schließlich definitiv angekauft wurde. Der Vergleich schaffte es erneut, die Betreiber und den Eigentümer der Anlage zu erstaunen und zufrieden zu stellen.
Perfektes Gleichgewicht
Seit Dezember des Vorjahres funktioniert die Kläranlage von Dimaro also nicht nur weiterhin perfekt, sondern ist auch so ausgelegt, dass höchste Flexibilität gewährleistet wird. Genauer gesagt ist Robox energy die Hauptmaschine der Anlage. Dieser wurde das konventionelle Aggregat Robox screw zur Seite gestellt, das jetzt eventuelle höhere Sommerlasten, welche in der Urlaubssaison auftreten, und eventuelle Überlasten abdecken soll. Gleichzeitig dient es als Reservemaschine, falls Wartungsarbeiten, ein Austausch von Teilen, Revisionen oder andere Eingriffe am Hauptkompressor durchgeführt werden müssen. „So haben wir ein vollständiges System, das aus nur zwei Einheiten besteht, die auch abwechselnd arbeiten und uns die größtmögliche Flexibilität gewährleisten können.”
Eine der interessantesten Eigenschaften ist die Anpassungsfähigkeit von Robox energy. Dieser analysiert dank der „Smart Process Control“ die vom Prozess erhaltenen Daten und moduliert seinen Betrieb abhängig vom sich stetig ändernden Sauerstoffversorgungsverhältnis, das im Laufe des Tages erforderlich ist. „Der Wasserbedarf ist nie konstant,” erklärt Stancher. „Es kann Spitzenmomente gefolgt von Abfällen und darauf folgenden Wiederanstiegen geben. Die Maschine hat die Aufgabe, den Sauerstoff entsprechend des eingestellten Wertes konstant zu halten, indem es seinen Betrieb moduliert. Dies wird auch durch den eingebauten Inverter ermöglicht und vermeidet einerseits einen ständigen Ein-Aus-Wechsel, der die Effizienz der Anlage verringern würde, und verhindert andererseits Spitzen in der Sauerstoffzufuhr, wodurch auch die Aufbereitung verbessert wird. So erhält man gleichzeitig eine Energieersparnis und eine Optimierung der Sauerstoffmenge, ohne Verschwendung.“ Kurz gesagt garantiert der neue Kompressor geringere Kosten innerhalb der Anlage, weniger Probleme und somit eine höhere Ersparnis.
Eine langjährige Beziehung
Die Anlage arbeitet in diesem Betrieb bereits einige Monate und die fünf traditionellen Gebläse, die jetzt nicht mehr benutzt werden, werden wahrscheinlich woanders hin verlagert oder als Reserve für den Bedarfsfall an anderen Orten behalten. Die Daten, die bis jetzt zur Anlage in Dimaro erworben werden konnten, beweisen, dass sich die neue Technologie bewährt. „Wir haben einen Unterschied zwischen der Effizienz und Leistung des neuen Robox energy und der des Drehkolbengebläses Robox evolution festgestellt, der 25% erreicht. Im Vergleich zum Schraubenkompressor Robox screw erreicht die Leistungsdifferenz hingegen 9%.“
Diese Ergebnisse, erklärt diesbezüglich Stancher, beruhen auf der höheren Effizienz des Motors der neuen Maschine, sowie auf deren Auslegung ohne Übertragung und Riemen. Das heißt, die mechanischen Verluste sind ausgesprochen gering im Vergleich zu den anderen Modellen. Außerdem ist dieses Modell durch die Abwesenheit von mechanischen Teilen, die normalerweise anfällig für Brüche oder Defekte sind, nicht nur technologisch fortschrittlicher als das Vorgängermodell, sondern auch beständiger und einfacher zu installieren und zu betreiben. Die Gesamteffizienz des Kompressors hat auch einen positiven Einfluss auf den Faktor Verwaltung und Wartung.
„Die gesamte Anlage wird durch unser eigenes System fernüberwacht. Dieses gestattet es uns, einfach den Betrieb aller vorhandenen Maschinen aus der Entfernung zu kontrollieren und die im ROBOX energy verbaute „Smart Process Control“ stellt eine direkte Kommunikation zwischen unserem System und der Steuereinheit der Maschine her. Direkte Eingriffe und Wartungsarbeiten müssen hingegen vor Ort vorgenommen werden.“ Bei Schwierigkeiten bleibt der Ansprechpartner jedoch immer Robuschi. „Wir haben mit dem Unternehmen eine langjährige Geschäftsbeziehung aufgebaut und vertrauen bei jedem Problem auf seine Techniker. Die Zusammenarbeit war schon immer hervorragend, und ich bin davon überzeugt, dass diese Art der Beziehung mit einem Zulieferer von grundlegender Wichtigkeit ist,“ betont Stancher. „Die Qualität der Technologie und die Ersparnis sind wichtig, aber auch die Kundenbetreuung ist es zweifellos.“
Die Auslegung des Robox energy mit integriertem Inverter und integrierter Schalttafel gestattet außerdem eine bequeme und einfache Installation. „Dank ihres extrem kompakten Designs fügt sich die Maschine perfekt in den vorhandenen Kompressorenraum ein. Ihr Platzbedarf ist äußerst gering im Vergleich zu den anderen installierten Technologien oder möglichen gleichwertigen Lösungen. Es gab keinerlei Schwierigkeiten und wir mussten nichts Anderes tun, als die Stromversorgung und das Signal des Sauerstoffmessgeräts bis zur Maschine zu führen, um diese abhängig von der im Becken gelösten Sauerstoffmenge zu kalibrieren. Das war ein einfacher Vorgang: ROBOX energy ist tatsächlich installationsbereit – „Plug & Play“, wie man sagt. Alle Arbeiten wurden in enger Zusammenarbeit mit den Technikern von Robuschi durchgeführt. Dank ihrer Unterstützung wurden die Eigenschaften des Aggregats voll ausgenutzt, um den Prozess unserer Anlage zu verbessern. Die Zusammenarbeit lief und läuft immer noch hervorragend, mit dem Ziel, ein gemeinsames Ergebnis zu erreichen.“
Energieeinsparung: erstes Ziel
Die Erfahrung von Dimaro wird zweifellos ein Modell für andere Anlagen des Territoriums von Trient werden. Dies gilt vor allem für Anlagen, in denen aufgrund von Projektbedürfnissen tiefere Becken geschaffen werden müssen und wo somit Maschinen mit höheren Gegendrücken notwendig sind. Dort ist ein Kompressor wie der neue Robox energy ideal. „Von unserer Seite her werden wir versuchen, diese Technologie erneut anzubieten. Die Ergebnisse, die an dieser Anlage erreicht wurden, sind zweifellos vorbildhaft.“ Außerdem ist in Anlagen dieser Art ein Großteil der Kosten auf die Schlammentsorgung und die Energie zurückzuführen. Eine Energieeinsparung ist daher immer von großer Bedeutung. Das gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass das Ziel der Energieeinsparung Teil der Philosophie der Autonomen Provinz von Trient ist.
„Unser Ziel ist die Energieautonomie unserer Anlagen,“ erklärt Stancher, und gemäß dieser Politik „haben wir in der Gemeinde von Folgaria eine energietechnisch vollkommen unabhängige Kläranlage geschaffen, die durch Photovoltaik-Paneele und eine Turbine versorgt wird, die durch den Abfluss betrieben wird. Die Wichtigkeit, die wir diesen Aspekten zumessen, ist nicht ausschließlich dadurch begründet, dass wir auf eine aus ethischer Hinsicht interessante Energieoptimierung abzielen, sondern auch durch einen realen Kostenvorteil.“ Die finanzielle Ersparnis für die Energiekosten gestattet es dem Betreiber, ein größeres Budget für andere verwaltungstechnische Aspekte der Anlagen bereit zu stellen. Aus dieser Sicht beweist der Aufbau der Anlage von Dimaro, dass eine Technologie, wie die von Robuschi gebotene, eine Hauptrolle spielen kann.
https://www.gardnerdenver.com/de-de/robuschi/about-us/case-studies/robox-energy-ws-65
(nach oben)
Bindergroup: Gasmengenmessung und -analyse von Klärgas, Deponiegas, Gasen aus MBA´s und anaerober Vorbehandlung von Industrieabwasser
Thermische Gasmengenmessgeräte und Analysestationen
COMBIMASS® Gasmengenmessgeräte sind seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich im Einsatz. Sie werden sowohl direkt am Gasanfall aber auch im Verbrauch vor BHKW´s, Heizung und Fackel zur quantitativen Erfassung genutzt. Das thermische Messverfahren eignet sich im Vergleich zu den anderen Messverfahren besonders gut für die Anfallsmessung bei geringen Gasgeschwindigkeiten und Drücken. Die integrierte Feuchtekompensation ermöglicht im wasserdampfgesättigten Gas die Ermittlung der trockenen Gasproduktion in Normkubikmetern nach DIN1343.
Seit einigen Jahren bietet Binder auch die Messung der Gasqualität mit mobilen oder stationären Lösungen an. Die Analysestationen dienen der Erfassung der Gasqualität am Faulturm aber auch der Überwachung des Schwefelfilters und somit der Gasqualität vor der Verwertung im BHKW. Der modulare Aufbau der Analysestationen ermöglicht eine einfache Erweiterung bei Bedarf, aber auch den Tausch der Verschleißteile durch den Betreiber selbst. Die integrierte Wartungsdiagnose ermöglicht das Erkennen von Verschleiß in den Gasmodulen, welcher durch Rekalibrierung bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden kann bzw. zeigt den erforderlichen Tausch der Gasmodule an. Der Tausch der Gaszellen nach festen Zeiten gehört dadurch der Vergangenheit an – Wartung nach tatsächlichem Verschleiß wird möglich.
Bei Deponien ändert sich im Laufe der Betriebsjahre die Gaszusammensetzung nicht unwesentlich. Die Kopplung mit einer Gasanalyse zur Signalkompensation hält die Gasmengenmessung langzeitstabil und genau.
https://bindergroup.info/anwendungsbereich/messung-und-analyse-von-klaergas-deponiegas/
(nach oben)
Bewertung der Kanalnetzperformance anhand der CSB- und Ammonium-Variabilität auf Kläranlagen
Stebatec bietet das Algorithmus-basierte INKA-System an und veröffentlicht regelmäßig Messdaten, welche Aufschluss über die Funktionalität des Systems geben. Zur Herstellung einer gewissen Vergleichbarkeit mit anderen Systemen hat das Unternehmen nun einige Bewertungsmöglichkeiten entwickelt, die sowohl ungeregelte mit dynamischen, aber auch den Vergleich von unterschiedlichen dynamischen Systemen ermöglichen.
Kanalnetzbewirtschaftung mit dem INKA-System
INKA (INtegrale Regelung von KAnalnetzen und Abwassereinigungsanlagen) ist ein Kanalnetzbewirtschaftungstool, das Weiterleitmengen im Kanalnetz dynamisch möglichst so verändert, dass Entlastungen und Beckenbefüllungen solange verhindert werden, bis die ARA komplett ausgelastet ist. Der INKA Regler erhöht oder beschränkt dazu die Ablaufmengen an den unterschiedlichen Stellen im Einzugsgebiet.
In der akutellen Ausgabe der Zeitschrift gwf Wasser & Abwasser werden Beispiele aus der Praxis dargestellt.
Hier gehts zum vollständigen Bericht : https://www.stebatec.com/wp-content/uploads/2021/11/GWF-Artikel-CSB-und-Ammonium-Verluste-mit-INKA.pdf
https://www.stebatec.com/chde/aktuelles/bewertung-der-kanalnetzperformance-anhand-der-csb-und-ammonium-variabilitaet-auf-klaeranlagen/
(nach oben)
Bindergroup: Gasmengenmessung und -analyse von Klärgas, Deponiegas, Gasen aus MBA´s und anaerober Vorbehandlung von Industrieabwasser
Thermische Gasmengenmessgeräte und Analysestationen
COMBIMASS® Gasmengenmessgeräte sind seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich im Einsatz. Sie werden sowohl direkt am Gasanfall aber auch im Verbrauch vor BHKW´s, Heizung und Fackel zur quantitativen Erfassung genutzt. Das thermische Messverfahren eignet sich im Vergleich zu den anderen Messverfahren besonders gut für die Anfallsmessung bei geringen Gasgeschwindigkeiten und Drücken. Die integrierte Feuchtekompensation ermöglicht im wasserdampfgesättigten Gas die Ermittlung der trockenen Gasproduktion in Normkubikmetern nach DIN1343.
Seit einigen Jahren bietet Binder auch die Messung der Gasqualität mit mobilen oder stationären Lösungen an. Die Analysestationen dienen der Erfassung der Gasqualität am Faulturm aber auch der Überwachung des Schwefelfilters und somit der Gasqualität vor der Verwertung im BHKW. Der modulare Aufbau der Analysestationen ermöglicht eine einfache Erweiterung bei Bedarf, aber auch den Tausch der Verschleißteile durch den Betreiber selbst. Die integrierte Wartungsdiagnose ermöglicht das Erkennen von Verschleiß in den Gasmodulen, welcher durch Rekalibrierung bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden kann bzw. zeigt den erforderlichen Tausch der Gasmodule an. Der Tausch der Gaszellen nach festen Zeiten gehört dadurch der Vergangenheit an – Wartung nach tatsächlichem Verschleiß wird möglich.
Bei Deponien ändert sich im Laufe der Betriebsjahre die Gaszusammensetzung nicht unwesentlich. Die Kopplung mit einer Gasanalyse zur Signalkompensation hält die Gasmengenmessung langzeitstabil und genau.
https://bindergroup.info/anwendungsbereich/messung-und-analyse-von-klaergas-deponiegas/
(nach oben)
Gardnerdenver: ROBOX energy
Die Möglichkeit, die Maschine auf Software-Ebene an die Prozessspezifikationen anzupassen, die deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs und der Geräuschentwicklung machen ROBOX energy von Robuschi zur idealen technischen Lösung für eine Kläranlage auch von mittlerer Größe und mit spezifischen Anforderungen
Alto Trevigiano Servizi ist das im Jahr 2007 gegründete kommunale Unternehmen, das die integrierte Wasserversorgung für dreiundfünfzig Gemeinden in den Provinzen Treviso, Vicenza und Belluno verwaltet. Ein Gebiet mit etwa 500.000 Einwohnern, in dem sechsundvierzig mittelgroße Kläranlagen betrieben werden. In den letzten Jahren hat die Verwaltungsabteilung für Kläranlagen, koordiniert von Abteilungsleiter Alberto Piasentin, neben der Verwaltung und dem Betrieb der Anlagen, den Sektor für die Optimierung der Klärprozesse entwickelt. Dafür verantwortlich ist Umweltingenieur Daniele Renzi, der vom besonderen Eingriff bei der Kläranlage der Stadt Valdobbiadene (TV) erzählt.
Variable Bedürfnisse, flexible Antworten
Die Anlage in Valdobbiadene wurde für 10.000 Einwohnerwerte (EW) mit einer städtischen und industriellen Last mit 390 mbar Differenzdruck mit schwankender Durchflussmenge zwischen 400 und 1600 m³/h entwickelt. Sie ist mit anfänglichen Vorbehandlungen, einer vorgeschalteten Denitrifikationsphase, gefolgt von einem Nitrifikations- und Oxidationssegment, einer Nachklärung und einer Klärschlammleitung strukturiert, die mit der Entsorgung durch Kompostierung endet. Vor kurzem war es notwendig, die biologische Anlage, insbesondere den Abschnitt der Luftdiffusion zu modernisieren. Man musste jedoch einige Besonderheiten berücksichtigen: „Die Anlage für ca. 5.000 Einwohnerwerte, eine niedrigere Zahl im Vergleich zum Anfangspotential des Projektes, zeichnet sich durch saisonale Schwankungen aus“, erklärt Ing. Renzi. „So findet man im Produktionsgebiet des Prosecco und während der Weinlesezeit und der vermehrten Aktivität in den Weinkellern – von Ende August bis Anfang November – eine erhöhte organische Last, die in die Anlage eintritt, sodass sie ein Niveau von 10.000 Einwohnerwerten, mit Spitzenwerten bis 13.000 EW an manchen Tagen erreicht.“
Zur Überwindung der saisonalen und täglichen Schwankungen ist es daher wichtig, Vorrichtungen zu verwenden, die eine hohe Flexibilität in Bezug auf Luftzufuhr, sowie Pump- und Mischleistung garantieren können.
Die Antwort auf diese Anforderungen liefert ROBOX energy, der neue Schraubenkompressor mit Permanentmagneten von Robuschi.
ROBOX energy, die ideale Lösung
„Im Bereich der Luftdiffusion“, so Ing. Renzi weiter, „war die Anlage bereits mit zwei Drehkolbengebläsen von Robuschi mit doppelter Drehzahl ausgestattet, die zwar funktionstüchtig, aber veraltet waren. Deshalb suchte man einen Kompressor mit einer moderneren Technologie, der die Grenzen der zwei bereits installierten Kompressoren (Lieferung einer festgelegten Luftmenge nahezu ohne Flexibilität) überschreiten und auf diese Weise die typischen Versorgungsspitzen der Anlage in Treviso abdecken konnte.“
Der Modernisierungs-Eingriff begann Ende 2016, am Ende des jeweiligen Überlastzeitraums. Um die Installation der Maschine zu ermöglichen, waren ein paar Eingriffe, minimale Bauarbeiten und einige Maßnahmen an den Leitungen erforderlich, um den neuen Kompressor anzuschließen. „Es gab keine Probleme aus Sicht der Installation“, erklärt Edi Casagrande, der Fachtechniker, der mit der Wartung der Anlagen von Alto Trevigiano Servizi betraut wurde, „da ROBOX energy eine kompakte, robuste Maschine ist, die sich auch in einen bereits aktiven Klärprozess einfach integrieren lässt. Der Kompressor wurde mit den beiden anderen bestehenden Robuschi Gebläsen verbunden, die als Ersatzmaschinen gewartet wurden, um die Kontinuität bei der Wartung der neu konzipierten Maschine sicherzustellen.“
Die gesamte Installationsphase führte überdies nicht zu langen Ausfallzeiten. „Für die Anbindung an die Hauptluftzufuhrleitung mussten wir spezielle Unterbrechungen erzeugen, und die eigentliche
Trennung der Lufteinblasung in den Prozess der Kläranlage dauerte nur wenige Stunden. Die elektrischen Anschlüsse waren jedoch bereits vorhanden, da ROBOX energy mit einer Bordelektronik ausgerüstet ist. Somit musste nur eine elektrische Stromleitung angeschlossen und das Signalkabel verbunden werden, um die Steuerung des Kompressors auf Grundlage der Prozessparameter der Anlage zu bestimmen.“
Eine Software nach Maß
Anschließend hat Alto Trevigiano Servizi in enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Robuschi die Software des Kompressors implementiert, um die Maschine über eine Fernbedienung mit einem automatischen Kontrollsystem mit intermittierender Belüftung zu steuern, die in Verbindung mit dem auf ROBOX energy installierten Smart Process Control funktioniert und sie im Fall von technischen Problemen an der Fernbedienung autonom zu machen, wodurch teure Abschaltungen vermieden werden.
„Die Betriebsarten wurden in zwei Sequenzen unterteilt: Master und Slave“, erklärt Casagrande. „Im Master-Modus ist die Maschine autonom und eigenständig. Sie wird nur durch ein Signal mit 4-20 mA direkt an einem Analogeingang und eine Sauerstoffsonde in der Biomasse der Kläranlage gesteuert, welche die für den Prozess erforderliche Sauerstoffmenge erfasst und in der Folge die Bereitstellung der Kubikmeter an Luft regelt. Im Slave-Modus wird der Kompressor hingegen durch das Remote-System betrieben, das ihm Start- und Stopp-Sequenzen liefert und je nach Prozessbedarf der Anlage intermittierende Belüftungsphasen erzeugt. Diese Arbeitsfolge gewährleistet eine Energieeinsparung und eine deutliche Reduktion von Stickstoffkomponenten im biologischen Prozess. Jedoch ist es möglich, im Falle eines Ausfalls oder einer Beschädigung der externen automatischen Steuerung den Betriebsmodus zu ändern, sodass ein Bediener vor Ort direkt am Bedienfeld des Gebläses eingreifen kann.“
Die Vorteile von ROBOX energy
In beiden Betriebsarten ist der Aspekt, den das Unternehmen sofort erkannt hat, die hohe Flexibilität von ROBOX energy. Dank der Permanentmagnet-Technologie kann die Anlage nun mit einem maximalen Potential von etwa 1.600 m3/h und einer Mindestgeschwindigkeit von einigen hundert Kubikmetern, mit einer höheren Elastizität gegenüber dem vorherigen Betriebsbereich zwischen 1.600 und 880 m3/h arbeiten. „Wir haben die untere Grenze des Kompressors auf ca. 500 m3/h eingestellt“, so Ing. Renzi, „da es auf Grundlage von vor Ort durchgeführten Messungen dieser Bereich ist, der eine ausreichende Mindestdurchmischung des oxidativen Segments gewährleisten kann. Tatsächlich könnte die Permanentmagneten-Technologie die Maschine dazu bringen, mit noch geringeren Strömungsgeschwindigkeiten zu arbeiten.“
Neben der Flexibilität war die Möglichkeit, den neuen Kompressor von Robuschi einfach mit einem Plug & Play-Modus zu installieren, ein weiterer wichtiger Aspekt für Alto Trevigiano Servizi. Es ist eine komplette Maschine mit einer integrierten elektrischen Schalttafel im hinteren Teil der Maschine und einem einfach zu bedienenden Bedienfeld an der Vorderseite; „Wir suchen häufig technologisch fortschrittliche, aber einfache Lösungen“ so der Ingenieur, „sodass unsere Bediener eine intuitive grafische Schnittstelle zur Verfügung haben und sofort erkennen, welche Parameter bearbeitet werden müssen.“
Garantierte Einsparungen
Der Kompressor ROBOX energy ist mittlerweile sechs Monate in Betrieb. Während der Startphase unmittelbar nach der Installation wurden die Hauptparameter überwacht, um den entsprechenden Durchflussbereich und die Änderungsgeschwindigkeit der Maschine zu definieren. In diesen ersten Monaten des Betriebes gab es keine Probleme mechanischer oder elektrischer Natur. Um die Vorteile im Hinblick auf die Energieeinsparung durch den Einbau von ROBOX energy zu testen, wurden zwei Arten von Analysen durchgeführt, erklärt Ing. Renzi. Vor und nach der Installation wurde der globale Transferkoeffizient des gelösten Sauerstoffs des Luftdiffusionssystems bewertet. Dabei zeigte sich, dass der durchschnittliche tägliche Energieverbrauch (in kWh) des neuen Kompressors im Vergleich zu den Vorgängermodellen zwischen 15 und 20% niedriger ist – ein hervorragendes Ergebnis für eine kleine Anlage mit einem Betriebsdruck von 390 mbar.
Eine zufriedenstellende Entscheidung
„Wir sind mit dieser Maschine zufrieden“, sagt Ing. Renzi. „Neben der einfachen Installation und Steuerung garantiert ROBOX energy Stabilität, ein Aspekt, der sich auf den Prozess auswirkt; Flexibilität, die eine Anwendung in mittleren oder kleinen Systemen, wie dem unsrigen, aber auch in leistungsfähigeren Anlagen ermöglicht; eine perfekte Kombination mit den Zyklen mit intermittierender Belüftung, und schließlich entspricht sie den Bedürfnissen einer saisonalen Anlage mit großen täglichen Schwankungen wie jener von Valdobbiadene.“
Der Ingenieur schließt mögliche zukünftige Kooperationen mit Robuschi nicht aus, um ROBOX energy in weiteren Entwicklungsprojekten von ATS einzusetzen. Er betonte, dass die Innovationsfreudigkeit von Alto Trevigiano Servizi die Bereitschaft vorsieht, mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu kooperieren, die fortschrittliche Technologien für einen umweltbezogenen und wirtschaftlichen Nutzen bei der Steuerung und Planung von Kläranlagen entwickeln möchten.
https://www.gardnerdenver.com/de-de/robuschi/about-us/case-studies/robox-energy-the-ideal-answer-to-wastewater-treatment-variables
(nach oben)
Gardner Denver: Niederdruck-Schraubenkompressoren wurden bei der Charles Brand Kläranlage installiert
Gardner Denver Vertriebshändler Team Air Power lieferte eine maßgeschneiderte Druckluftlösung, die zusammen mit anderen Maßnahmen zur Optimierung der Anlagenprozesse über einen Zeitraum von 12 Monaten den Energieverbrauch um 539,844 kW/h senkte.
Die Herausforderung
Die Kläranlage des Unternehmens in Belfast benötigt Gebläse zum Belüften der SBR-Becken der Anlage und zur Abwasserreinigung. Durch die Sauerstoffzufuhr in den Belebtschlamm im Reaktor mittels Belüftung helfen die Gebläse, organische Verbindungen im Abwasser aufzuspalten.
Bisher setzte Charles Brand fünf überdimensionierte 132 kW Gebläse für diesen Belüftungsprozess ein. Diese Aggregate waren 16 Jahre alt und erforderten erhöhte Wartung, um sie in gutem Betriebszustand zu halten. Die Kompressoren des Unternehmens erlitten innerhalb von drei Monaten drei Betriebsausfälle mit Reparaturkosten in Höhe von jeweils £6.000. Mit eskalierenden Kosten konfrontiert stellte Charles Brand fest, dass durch Modernisierung ihres Belüftungssystems durch die Nutzung fortschrittlicher Gebläsetechnologie Einsparungen erzielt werden könnten.
Die Lösung
Die revolutionäre Lösung – die erste ihrer Art in Großbritannien – beinhaltete den Ersatz von drei der 132 kW Aggregate durch 75 kW Robuschi WS 85 Robox Energy Schraubenkompressoren, mit einer Amortisationsdauer von drei Jahren.
Der Robuschi Robox Energy Niederdruck-Schraubenkompressor kombiniert einen Schraubenkompressor mit einem Permanentmagnetmotor, wodurch ein Druck bis zu 1000 mbar(g) und eine Durchflussmenge von bis zu 2.600m3/h ermöglicht werden. Sein interner Kompressor, kombiniert mit einem effizienten Permanentmagnetmotor, ist direkt auf der Antriebswelle montiert, um Leistungsverluste durch Riemenübertragung zu vermeiden.
Charles Brand ist auch in der Lage, den Betrieb des gesamten Aggregats über eine intelligente HMI-Steuertafel zu überwachen. Mittels einer Fernverbindung, kann die Leistung jerderzeit und von überall überwacht, und vorbeugend Wartungen geplant werden.
Der Niederdruck-Schraubenkompressor benötig 30 Prozent weniger Platz als vergleichbare Aggregate und wird komplett mit integriertem Frequenzumrichter (VFD) geliefert. Die Aggregate waren durch die einfache “Plug-and-play“-Installation sofort betriebsbereit.
Der Betreiber musste nur die Leitungen, die Stromversorgung und die Steuertafel an das System anschließen.
Das Ergebnis
Diese Vorteile bedeuten, dass der Robox Energy Niederdruck-Schraubenkompressor Kosteneinsparungen von etwa 20 Prozent erreichen kann, was ihn zu einem idealen Aggregat für den energieintensiven Kläranlagensektor macht.
https://www.gardnerdenver.com/de-de/robuschi/about-us/case-studies/award-winning-screw-blowers-installed-at-charles-brand-wastewater-facility
(nach oben)
Gardnerdenve: ROBOX energy – Effizienz in Abwasserkläranlagen
Extreme Effizienz und Flexibilität für die kommunale Abwasserkläranlage von Dimaro im Territorium der Autonomen Provinz Trient. Robuschi hat dort den neuen Robox energy WS 65 getestet. Eine Technologie, die alle Erwartungen übertroffen hat.
Der neue Schraubenkompressor mit Permanentmagnetmotor Robox energy WS 65 von Robuschi wurde ursprünglich probeweise installiert, hat sich aber dann als perfekte Lösung für eine Kläranlage der Autonomen Provinz Trient erwiesen.
Die Gesamtoxidationsanlage für die biologische Aufbereitung der privaten Abwässer, die seit Dezember 2011 aktiv ist, deckt die Fläche der Gemeinden von Dimaro und Commezzadura im Hochtal „Alta Val di Sole“ ab. Sie sieht eine zusätzliche biologische Denitrifikation und Entphosphatierung der Abwässer vor, um die Umweltbelastung zu verringern. Dies ist notwendig, da das Abwasser direkt in den nahen Fluss Noce abgeleitet wird. Außerdem verfügt die Struktur über ein Schlammsedimentationssystem. Der Schlamm wird einer physikalischen Behandlung unterzogen und zur Deponie geschickt.
Eine besondere Situation
Die Anlage hat also eine Standardstruktur mit einer Besonderheit. Deshalb, erklärt Giovanni Stancher, Leiter des Werkstattlagers für die Kläranlagenbewirtschaftung der Autonomen Provinz Trient, war die Anwendung des neuen Kompressors Robox energy von Robuschi interessant. Die Anlage von Dimaro verfügt nämlich über sieben Meter tiefe Oxidationsbecken, im Gegensatz zu den üblichen viereinhalb Metern aller restlichen Anlagen im Territorium. „Diese Tatsache, zusammen mit dem niedrigeren Umgebungsluftdruck im Vergleich zu den anderen Anlagen (die Anlage befindet sich auf einer Höhe von zirka 800 Meter über dem Meeresspiegel), zwingt die installierten Maschinen dazu, unter nicht optimalen Bedingungen zu arbeiten, wobei der Gegendruck hart an der Grenze liegt.” Zunächst wurden Gebläsegruppen mit traditionellen Motoren, ebenfalls mit Robuschi-Technologie, installiert, deren Aufgabe es war, die notwendige Sauerstoffmenge für die Oxidation und die Senkung des CSB, der organischen Substanzen in den Abwässern, zu gewährleisten.
Optimale Konfiguration
Der erste Schritt des neuen Weges für die Anlage im Trentino wurde gesetzt, als Robuschi den Niederdruck-Schraubenkompressor Robox screw mit traditionellem Motor präsentierte. „Es wurde uns angeboten, diesen auszuprobieren,” erinnert sich Stancher, „und so wurde er in einigen anderen Anlagen installiert. Später brachten wir ihn nach Dimaro, denn wir waren davon überzeugt, dass diese Technologie hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten am besten genutzt werden konnte.” Das war im Jahr 2012 und der neue Kompressor war nicht nur in der Lage, eines der bereits installierten Drehkolbengebläse Robox evolution zu ersetzen, sondern erwies sich als ausreichend, um alleine den gesamten Bedarf der Anlage abzudecken.
Eine neue Herausforderung stellte sich Ende 2015, als die Fa. Robuschi der Provinz von Trient vorschlug, die Leistungsfähigkeit ihres neuesten, innovativen Kompressormodells, des neuen Kompressors Robox energy, zu testen. „Ein verlockendes Angebot, das wir gerne annahmen. Wir freuen uns immer, neue Technologien ausprobieren zu dürfen,” so weiter Stancher. „Außerdem ergab sich dadurch für uns die Gelegenheit, zwei Modelle derselben Maschine zu vergleichen, die jedoch über verschiedene Motoren verfügen. Wir haben also an derselben Anlage das dreiflügelige Drehkolbengebläse Robox evolution mit traditionellem Motor, einen Niederdruck-Schraubenkompressor Robox screw, ebenfalls mit Standardmotor und Riemenübertragung, und den neuen Schraubenkompressor Robox energy mit Permanentmagnetmotor installiert,” welcher im Juli 2016 schließlich definitiv angekauft wurde. Der Vergleich schaffte es erneut, die Betreiber und den Eigentümer der Anlage zu erstaunen und zufrieden zu stellen.
Perfektes Gleichgewicht
Seit Dezember des Vorjahres funktioniert die Kläranlage von Dimaro also nicht nur weiterhin perfekt, sondern ist auch so ausgelegt, dass höchste Flexibilität gewährleistet wird. Genauer gesagt ist Robox energy die Hauptmaschine der Anlage. Dieser wurde das konventionelle Aggregat Robox screw zur Seite gestellt, das jetzt eventuelle höhere Sommerlasten, welche in der Urlaubssaison auftreten, und eventuelle Überlasten abdecken soll. Gleichzeitig dient es als Reservemaschine, falls Wartungsarbeiten, ein Austausch von Teilen, Revisionen oder andere Eingriffe am Hauptkompressor durchgeführt werden müssen. „So haben wir ein vollständiges System, das aus nur zwei Einheiten besteht, die auch abwechselnd arbeiten und uns die größtmögliche Flexibilität gewährleisten können.”
Eine der interessantesten Eigenschaften ist die Anpassungsfähigkeit von Robox energy. Dieser analysiert dank der „Smart Process Control“ die vom Prozess erhaltenen Daten und moduliert seinen Betrieb abhängig vom sich stetig ändernden Sauerstoffversorgungsverhältnis, das im Laufe des Tages erforderlich ist. „Der Wasserbedarf ist nie konstant,” erklärt Stancher. „Es kann Spitzenmomente gefolgt von Abfällen und darauf folgenden Wiederanstiegen geben. Die Maschine hat die Aufgabe, den Sauerstoff entsprechend des eingestellten Wertes konstant zu halten, indem es seinen Betrieb moduliert. Dies wird auch durch den eingebauten Inverter ermöglicht und vermeidet einerseits einen ständigen Ein-Aus-Wechsel, der die Effizienz der Anlage verringern würde, und verhindert andererseits Spitzen in der Sauerstoffzufuhr, wodurch auch die Aufbereitung verbessert wird. So erhält man gleichzeitig eine Energieersparnis und eine Optimierung der Sauerstoffmenge, ohne Verschwendung.“ Kurz gesagt garantiert der neue Kompressor geringere Kosten innerhalb der Anlage, weniger Probleme und somit eine höhere Ersparnis.
Eine langjährige Beziehung
Die Anlage arbeitet in diesem Betrieb bereits einige Monate und die fünf traditionellen Gebläse, die jetzt nicht mehr benutzt werden, werden wahrscheinlich woanders hin verlagert oder als Reserve für den Bedarfsfall an anderen Orten behalten. Die Daten, die bis jetzt zur Anlage in Dimaro erworben werden konnten, beweisen, dass sich die neue Technologie bewährt. „Wir haben einen Unterschied zwischen der Effizienz und Leistung des neuen Robox energy und der des Drehkolbengebläses Robox evolution festgestellt, der 25% erreicht. Im Vergleich zum Schraubenkompressor Robox screw erreicht die Leistungsdifferenz hingegen 9%.“
Diese Ergebnisse, erklärt diesbezüglich Stancher, beruhen auf der höheren Effizienz des Motors der neuen Maschine, sowie auf deren Auslegung ohne Übertragung und Riemen. Das heißt, die mechanischen Verluste sind ausgesprochen gering im Vergleich zu den anderen Modellen. Außerdem ist dieses Modell durch die Abwesenheit von mechanischen Teilen, die normalerweise anfällig für Brüche oder Defekte sind, nicht nur technologisch fortschrittlicher als das Vorgängermodell, sondern auch beständiger und einfacher zu installieren und zu betreiben. Die Gesamteffizienz des Kompressors hat auch einen positiven Einfluss auf den Faktor Verwaltung und Wartung.
„Die gesamte Anlage wird durch unser eigenes System fernüberwacht. Dieses gestattet es uns, einfach den Betrieb aller vorhandenen Maschinen aus der Entfernung zu kontrollieren und die im ROBOX energy verbaute „Smart Process Control“ stellt eine direkte Kommunikation zwischen unserem System und der Steuereinheit der Maschine her. Direkte Eingriffe und Wartungsarbeiten müssen hingegen vor Ort vorgenommen werden.“ Bei Schwierigkeiten bleibt der Ansprechpartner jedoch immer Robuschi. „Wir haben mit dem Unternehmen eine langjährige Geschäftsbeziehung aufgebaut und vertrauen bei jedem Problem auf seine Techniker. Die Zusammenarbeit war schon immer hervorragend, und ich bin davon überzeugt, dass diese Art der Beziehung mit einem Zulieferer von grundlegender Wichtigkeit ist,“ betont Stancher. „Die Qualität der Technologie und die Ersparnis sind wichtig, aber auch die Kundenbetreuung ist es zweifellos.“
Die Auslegung des Robox energy mit integriertem Inverter und integrierter Schalttafel gestattet außerdem eine bequeme und einfache Installation. „Dank ihres extrem kompakten Designs fügt sich die Maschine perfekt in den vorhandenen Kompressorenraum ein. Ihr Platzbedarf ist äußerst gering im Vergleich zu den anderen installierten Technologien oder möglichen gleichwertigen Lösungen. Es gab keinerlei Schwierigkeiten und wir mussten nichts Anderes tun, als die Stromversorgung und das Signal des Sauerstoffmessgeräts bis zur Maschine zu führen, um diese abhängig von der im Becken gelösten Sauerstoffmenge zu kalibrieren. Das war ein einfacher Vorgang: ROBOX energy ist tatsächlich installationsbereit – „Plug & Play“, wie man sagt. Alle Arbeiten wurden in enger Zusammenarbeit mit den Technikern von Robuschi durchgeführt. Dank ihrer Unterstützung wurden die Eigenschaften des Aggregats voll ausgenutzt, um den Prozess unserer Anlage zu verbessern. Die Zusammenarbeit lief und läuft immer noch hervorragend, mit dem Ziel, ein gemeinsames Ergebnis zu erreichen.“
Energieeinsparung: erstes Ziel
Die Erfahrung von Dimaro wird zweifellos ein Modell für andere Anlagen des Territoriums von Trient werden. Dies gilt vor allem für Anlagen, in denen aufgrund von Projektbedürfnissen tiefere Becken geschaffen werden müssen und wo somit Maschinen mit höheren Gegendrücken notwendig sind. Dort ist ein Kompressor wie der neue Robox energy ideal. „Von unserer Seite her werden wir versuchen, diese Technologie erneut anzubieten. Die Ergebnisse, die an dieser Anlage erreicht wurden, sind zweifellos vorbildhaft.“ Außerdem ist in Anlagen dieser Art ein Großteil der Kosten auf die Schlammentsorgung und die Energie zurückzuführen. Eine Energieeinsparung ist daher immer von großer Bedeutung. Das gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass das Ziel der Energieeinsparung Teil der Philosophie der Autonomen Provinz von Trient ist.
„Unser Ziel ist die Energieautonomie unserer Anlagen,“ erklärt Stancher, und gemäß dieser Politik „haben wir in der Gemeinde von Folgaria eine energietechnisch vollkommen unabhängige Kläranlage geschaffen, die durch Photovoltaik-Paneele und eine Turbine versorgt wird, die durch den Abfluss betrieben wird. Die Wichtigkeit, die wir diesen Aspekten zumessen, ist nicht ausschließlich dadurch begründet, dass wir auf eine aus ethischer Hinsicht interessante Energieoptimierung abzielen, sondern auch durch einen realen Kostenvorteil.“ Die finanzielle Ersparnis für die Energiekosten gestattet es dem Betreiber, ein größeres Budget für andere verwaltungstechnische Aspekte der Anlagen bereit zu stellen. Aus dieser Sicht beweist der Aufbau der Anlage von Dimaro, dass eine Technologie, wie die von Robuschi gebotene, eine Hauptrolle spielen kann.
https://www.gardnerdenver.com/de-de/robuschi/about-us/case-studies/robox-energy-ws-65
(nach oben)
Aerzen: Performance 3 – Kläranlagen bedarfsgerecht belüften
Die Wirtschaftlichkeit moderner Kläranlagen wird ganz maßgeblich von dem Energieverbrauch der verschiedenen Prozessschritte während der Abwasseraufbereitung beeinflusst. Besonders der energieintensive Prozess der biologischen Belüftung steht dabei im Fokus der Betrachtung: Rund 60 bis 80 Prozent des Gesamtenergiebedarfs fallen hier an. Gleichzeitig bietet die Klärbeckenbelüftung ein großes Energiesparpotenzial, das sich Betreiber von Klärbecken zunutze machen können.
Als erfahrener Spezialist für die Wasser- und Abwassertechnik setzt die Firma AERZEN seit jeher neue Maßstäbe in puncto Energieeffizienz im Belebungsbecken. Das innovative Performance³-Konzept gilt als die wohl effizienteste, leistungsstärkste und flexibelste Technologielösung zur bedarfsgerechten Sauerstoffversorgung in Klärbecken. Das Alleinstellungsmerkmal von Performance³ ist die optimierte Anpassung der Gebläseleistung an individuelle Lastschwankungen und unterschiedliche Verschmutzungsgrade.
Es geht darum, den schwankenden Lastbedarfen optimal zu begegnen und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Technologien immer mit der effizientesten Maschinenauslastung zu fahren. Dafür eignen sich drei verschiedene Gebläsetechnologien: Drehkolbengebläse, der Drehkolbenverdichter und Turbogebläse. Je nach Anlagenkonfiguration und Auslastung können diese Technologien aufgrund Ihrer Schwerpunkte im Zusammenspiel oder als Einzellösung so geschaltet werden, dass eine maximale Effizienz erzielt wird. In Verbindung mit der Verbundsteuerung AERsmart, die für die optimale Verteilung der Luftmengen auf die Aggregate sorgt, können die Effizienzwerte weiter verbessert werden.
Performance³ ermöglicht es Ihnen, für jede Anlagenkonfiguration genau die Gebläselösung zu finden, die in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht das Optimum darstellt. Wurden in der Vergangenheit vielfach nur Gebläse einer Baugröße installiert, so findet heute häufig ein Mix aus unterschiedlichen Baugrößen oder gar Technologien statt. Einsparungen von bis zu 30Prozent sind möglich.
Weiterführende Links
http://www.aerzen.com
(nach oben)
Nivus: Fremdwasser richtig messen
Der Bedarf an Maßnahmen zur Reduzierung von Fremdwasser im kommunalen Kanalnetz steigt kontinuierlich. Das zeigt die Erfahrung als Messdienstleister. Zur Ermittlung von Fremdwasser werden Messkampagnen durchgeführt, bei denen Teileinzugsgebiete mit Durchflussmessungen ausgerüstet werden, um die Fremdwasserschwerpunktgebiete zu identifizieren. Bei nahezu allen Messkampagnen wird die Fremdwasserauswertung über die Nachtminimum-Methode (DWA-M 182) realisiert. Bei dieser Methode wird der geringste Tagesabfluss als im Wesentlichen dem Fremdwasser zugehörig gewertet.
Die DWA-M181 unterscheidet dabei:
Temporärmessungen (Dauer-, Langzeit- und Kurzzeitmessungen) und Einzelmessungen.
Sehr oft werden über Kurzzeitmessungen (DWA-M 181: Messdauer etwa zwischen einer Woche und drei Monaten) Fremdwasserschwerpunktgebiete identifiziert. Die durch NIVUS abgewickelten Messkampagnen dauern in der Regel zwischen vier und 12 Wochen.
Immer wieder gibt es auch Anfragen zur Fremdwasserermittlung über Einzelmessungen an verschiedenen Punkten eines Einzugsgebietes. Dabei sollen innerhalb einer Nacht an mehreren Punkten eines Einzugsgebietes mittels Einzelmessungen die Trockenwetterabflüsse ermittelt werden. Dies erfolgt zur Zeit des geringsten nächtlichen Abflusses. Es wird schnell klar, dass Einzelmessungen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht über dieselbe Datenqualität verfügen können, wie Messungen über mehrere Wochen. Andererseits ist der Mittelaufwand im Vergleich zu Kurzzeitmessungen niedriger. Damit stellt sich die Frage nach dem optimalen Kosten-Nutzen Aufwand für Fremdwasseruntersuchungen. Dies soll vor allem im Hinblick auf mögliche folgende Investitionen bzw. Sanierungskosten betrachtet werden.
Ergebnisvergleich von Einzelmessungen und Kurzzeitmessungen
Für einen Vergleich von Aufwand und Nutzen einer Fremdwasserbestimmung wurden die Messdaten einer mehrmonatigen Messkampagne untersucht. Ziel war eine Fremdwasserermittlung für vier Teileinzugsgebiete.
Die Fremdwasserauswertung erfolgte über die Nachtminimum-Methode (DWA-M182). Für diesen Vergleich wurden etwaige Schmutzwasseranteile während des minimalen nächtlichen Abflusses vernachlässigt. Der minimale Abfluss bei Nacht entspricht daher im Folgenden zu 100 % dem Fremdwasserabfluss.
Dabei wurden drei verschiedene Varianten zur Messdatenerfassung betrachtet:
Variante 1: Durchflussmessung an 4 Messpunkten nacheinander während einer Ortsbegehung
Variante 2: Einbau von Durchflussmessungen parallel an allen 4 Messpunkten für die Dauer einer Nacht
Variante 3: Durchführung einer Messkampagne parallel an allen 4 Messpunkten über 6 Wochen
Unterschieden wird hier lediglich in der Messdauer. Fehler bei der Messdatenerfassung (z.B. Bedienerfehler) können hierbei außer Acht gelassen werden, da für den Vergleich der Varianten dieselben Messdaten verwendet wurden.
Der Messzeitraum der Kurzzeitmessung erstreckte sich über 6 Wochen (9. Februar bis 26. März). Zur Auswahl der Trockenwettertage wurde zeitgleich ein Niederschlagsschreiber betrieben. Das Kriterium für Trockenwettertage war eine Niederschlagssumme von 0,3 mm am betrachteten Tag sowie eine maximale Niederschlagssumme von 0,3 mm am Vortag.
Für den Messzeitraum ergaben sich damit 20 Trockenwettertage, aus denen für die Beurteilung der Einzelmessungen exemplarisch 3 Tage ausgewählt wurden.
Ergebnisse aus der Datenanalyse
Aus den kontinuierlich aufgenommenen Daten der Messkampagne wurden für drei Trockenwettertage gemäß Tabelle 2 für die o.g. Varianten 1 und 2 die entsprechenden Messdaten verwendet.
Für die Variante 1 wurde von einer Messdauer von 10 Minuten ausgegangen. Zusätzlich ist der zeitliche Aufwand für die Vorbereitung der Messung zu berücksichtigen. Dazu zählen neben der Vorbereitung der Messtechnik auch die Messstellenabsicherung sowie das Anlegen der persönlichen Sicherheitsausrüstung. In der Summe wird hier von einem Aufwand von 30 Minuten ausgegangen sowie von einer Fahrtzeit zwischen den Messpunkten von 10 Minuten. Damit beträgt die Dauer der Ortsbegehung etwa 2,5 Stunden.
Bei der Variante 3 wurden alle 20 Trockenwettertage ausgewertet. Tabelle 1 zeigt für diese Variante den mittleren minimalen Abfluss aller Trockenwettertage über den gesamten Messzeitraum.
Deutlich wird, dass durch Variante 1 höhere Abflüsse gemessen wurden als bei Variante 2. Über Variante 2 wird die gesamte Nacht messtechnisch hochaufgelöst erfasst, so dass der Zeitpunkt des minimalen Abflusses eindeutig bestimmt werden kann. Damit wird für jeden untersuchten Messpunkt die Ermittlung des minimalen Trockenwetterabflusses möglich.
Für Variante 1 kann der Zeitpunkt des geringsten Abflusses nur geschätzt werden. Ebenfalls können auch nicht an allen 4 Messpunkten gleichzeitig zum geschätzten Zeitpunkt die Durchflüsse messtechnisch erfasst werden. Dadurch wird der Fremdwasserabfluss bei Variante 1 in der Regel überschätzt.
Ein deutliches Beispiel finden wir am 10. März. Hier ist eine deutliche Abweichung der Ergebnisse der Varianten 1 und 2 an der Messstelle M03 zu erkennen. Die Ganglinie aus Abbildung 1 zeigt eine deutliche Erhöhung des Abflusses bei Nacht. Die Einzelmessung aus Variante 1 fällt genau in die Zeit des erhöhten Abflusses, die Messergebnisse täuschen damit einen zu hohen Fremdwasserabfluss vor.
Die dynamischen Veränderungen des Fremdwasseranfalls stellen eine weitere Einschränkung der Verwertbarkeit der Messdaten von Einzelmessungen dar. Abbildung 2 zeigt einen um etwa 20 % niedrigeren Abfluss am 17. Februar an der Messstelle M01. Dies deutet auf einen niederschlagsbedingten erhöhten Fremdwasserabfluss hin.
Zur Erfassung von Fremdwasserschwerpunkten eignen sich Kurzzeitmesskampagnen in idealer Weise. Die Auswertung von hochaufgelösten Messdaten mit Messdauern von mehreren Wochen und Monaten zeigt neben grundwasserbedingtem Fremdwasser auch niederschlagbedingtes Fremdwasser.
Aufwand und Nutzen der Varianten
Der Aufwand bei der Umsetzung einer Messkampagne zur Fremdwasserbestimmung besteht auf der einen Seite in der Bereitstellung von Fachkräften zur Durchführung der Messungen und andererseits in der Vorhaltung der notwendigen Messtechnik. Ebenso müssen Werkzeug, Fahrzeug und Sicherheitsausrüstung für die Durchführung vorhanden sein. Zusätzlich wird bei der Durchführung der Messungen neben dem Durchführenden eine aufsichtsführende Person als Sicherungsposten benötigt. Somit sind für alle Ortstermine zwei Personen zur Durchführung der Messungen notwendig.
Für Variante 1 besteht der Aufwand aus lediglich einem Messgerät zur Durchflussermittlung bei einer Durchführungsdauer inklusive Rüstzeit von etwa 4 Stunden. Erschwert wird Variante 1 dadurch, dass während den Nachtstunden gearbeitet werden muss. Bei drei Einsätzen, wie im Beispiel beschrieben, verdreifacht sich der Aufwand.
Für die Varianten 2 und 3 werden jeweils 4 Messgeräte zeitparallel benötigt. Für die Durchführung nach Variante 3 ist zusätzlich ein Niederschlagsschreiber erforderlich. Für Einbau und Inbetriebnahme sowie den Ausbau der Messtechnik können etwa 8 Stunden angesetzt werden, für das Aufstellen und den Abbau des Niederschlagsschreibers maximal 30 Minuten.
Der wesentliche Unterschied zwischen den Varianten 2 und 3 ist der Betrieb der Messstellen für den ein Wartungsaufwand betrieben werden muss. Erfahrungsgemäß wird für 2 Wochen Messdauer mit einem Wartungsaufwand von etwa 20 Minuten pro Durchflussmessstelle gerechnet.
Das Ergebnis aus Variante 1 besteht lediglich aus je einem Messwert, für Variante 2 immerhin aus einer Ganglinie einer Nacht. Die Ergebnisse können als Orientierung zur Identifizierung von Fremdwasserschwerpunktgebieten genutzt werden (Tabelle 1), für weitere Auswertungen liegen jedoch keine Ergebnisse vor.
Aus Variante 3 können neben der Fremdwasserauswertung über die Nachtminimum-Methode weitere Erkenntnisse gewonnen werden. Je länger die Messdatenaufnahme stattfindet, desto besser werden die Erkenntnisse über den Verlauf des Fremdwasserabflusses. Die dynamische Veränderung über den Messzeitraum kann grafisch und tabellarisch dargestellt werden.
Das Vorliegen der Trockenwettertagesgänge erlaubt die Kennwerte des Trockenwetterabflusses zu ermitteln. Somit können Fremdwasseranteile bzw. –zuschläge sowie die Schmutzwasserabflüsse aus den Ergebnissen generiert werden.
Da über die Nachtminimum-Methode keine niederschlagsbedingten Fremdwasserabflüsse erkannt werden können, fehlt diese Information bei den Varianten 1 und 2. Die Messreihen aus Variante 3 zeigen bei der Analyse entsprechende Hinweise auf niederschlagbedingtes Fremdwasser. Abbildung 3 zeigt exemplarisch Regennachlaufzeiten nach Niederschlägen.
Für eine Einschätzung des Fremdwasserabflusses kann eine Nachtbegehung sowie eine Messdatenaufnahme über eine Nacht durchaus auf Schwerpunktgebiete hinweisen, jedoch sind durch geringfügig größere Aufwände deutlich sicherere und tiefergehende Ergebnisse erzielbar. Diese Ergebnisse lassen deutlich mehr Schlüsse über das Verhalten der Entwässerungsgebiete zu.
Fazit
Bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung sind Messkampagnen zur Identifizierung von Fremdwasserschwerpunktgebieten ein bedeutender Ausgangspunkt. Mitentscheidend für die Kosten-Nutzen Analyse ist die Dauer der jeweiligen Messung.
Vergleicht man Einzelmessungen mit Kurzzeitmessungen über mehrere Wochen und Monate fällt die Entscheidung klar zugunsten der Kurzzeitmessungen aus. Der Aufwand, der hauptsächlich im Personaleinsatz besteht, ist bei letzteren nur unwesentlich höher. Jedoch liefern die gewonnenen Messreihen einen deutlichen Zuwachs verwertbarer Ergebnisse.
Einerseits können durch Nachtbegehungen gleichfalls mögliche Fremdwasserschwerpunktgebiete erkannt oder zumindest abgeschätzt werden. Dies rechtfertigt jedoch nicht zwingend den unwesentlich geringeren Aufwand, etwa dadurch, dass ein einzelnes Durchflussmessgerät als messtechnische Ausstattung genügt. Dabei sollte nicht unterschätzt werden, dass für Variante 1 die messtechnische Umsetzung in den Nachtstunden bei Trockenwetterabfluss durchgeführt werden muss.
Bei der Suche nach Fremdwasserschwerpunktgebieten sollte eine Messkampagne über mindestens 4 Wochen durchgeführt werden, um eine ausreichende Zahl an Trockenwettertagen zu gewährleisten. Messzeiträume von drei Monaten haben sich bewährt. Die hochauflösenden Messreihen erlauben neben der Quantifizierung der Fremdwasseranteile oder Fremdwasserzuschläge auch die Ermittlung des Schmutzwasserabflusses. Ebenfalls lassen die Messreihen eine Abschätzung des niederschlagsbedingten Fremdwasserabflusses zu.
Literatur:
/1/ DWA-M 181. Messung von Wasserstand und Durchfluss in Entwässerungssystemen. Hennef: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., 2011
/2/ DWA-M 182. Fremdwasser in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. Hennef: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., 2012
Autor:
Dipl.-Ing. Thomas Schäfer
Projektleiter
NIVUS GmbH
Im Täle 2
75031 Eppingen
07262 9191-0
https://www.nivus.de/de/aktuelles-presse/presse/fremdwasser-richtig-messen/
(nach oben)
Durchflussmesssystem für den Zulauf einer Schilfkläranlage
Maßgeschneiderte Messanlage für die Messung von verunreinigtem Wasser aus der Erdölgewinnung
Vormontierte Messlösung mit Durchflussmessgeräten und Ventilen
Kalibriert gemäß OIML R49 für den eichpflichtigen Verkehr
Hintergrund
BAUER Nimr LLC, Oman, ein Tochterunternehmen der BAUER Resources GmbH mit Sitz in Deutschland, ist ein Full-Service-Dienstleister in den Bereichen Wasser, Umwelt und Bodenschätze. Unter anderem hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung, die Herstellung und den Betrieb von Abwasseraufbereitungsanlagen spezialisiert.
Im Rahmen eines DBOO-Vertrages verantwortet BAUER das gesamte Abwassermanagement einer Abwasseraufbereitungsanlage im arabischen Sultanat Oman. Die Anlage dient vor allem dazu, das kontaminierte Wasser aus einem angrenzenden Ölfeld zu reinigen.
Konkrete Messaufgabe
Das Produktionswasser aus dem Ölfeld ist brackig und enthält zwischen 7.000 und 8.000 mg/l gelöste Feststoffe (TDS). Der durchschnittliche Ölgehalt des Wassers liegt bei über 400 mg/l. Öl macht zehn Prozent des Mediums aus. Der Rest ist verunreinigtes Wasser. Ursprünglich wurde das Wasser vom Öl nur separiert und dann in Tiefbrunnen entsorgt.
Für eine nachhaltigere und effizientere Wasserreinigung hat BAUER die bestehende Kläranlage vollständig umgebaut und auf eine Kapazität von 175.000 m³/Tag erweitert. In einem einzigartigen Projekt wurde hierfür zusätzlich ein Schilfrohr-Feuchtgebiet angelegt. Die Pflanzen absorbieren heute die restlichen Kohlenwasserstoffe, die durch den Separator nicht entfernt werden. Dabei werden die Schilfgebiete über Freispiegelleitungen versorgt. Durch dieses ausgeklügelte System lässt sich nicht nur sauberes Wasser hocheffektiv und umweltfreundlich zurückgewinnen. Da der energieintensive Einsatz der Pumpen nicht mehr nötig ist, kann auch der Energieverbrauch um bis zu 98% reduziert und der CO2-Fußabdruck der Anlage erheblich minimiert werden.
Der Betreiber wird von den Behörden auf Basis der erhaltenen Wassermenge bezahlt. Um eine präzise Abrechnung zu ermöglichen, benötigte der Kunde daher am Zulauf der Kläranlage ein komplettes Skid zur Durchflussmessung. Dieses sollte den Anforderungen der OIML R49 für den eichpflichtigen Verkehr entsprechen.
Realisierung der Messung
KROHNE entwickelte, konstruierte und fertigte ein auf die Bedürfnisse der Kläranlage zugeschnittenes Messsystem. Es besteht aus zwei Wasserskids mit je zwei magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten OPTIFLUX 2300 (24″, Cl 300#), Ein- und Auslaufstrecken (10D/5D), Kugelhahn-Ventilen und vorinstallierten Dichtungen.
Die Messlösung wurde vor der Auslieferung nach den Richtlinien der OIML R49 für die eichpflichtige Messung kalibriert. Die Z-Ausführung des Messsystems ermöglicht sowohl eine zweikanalige Messung als auch eine einkanalige Messung, wobei der nicht aktive Kanal bei vollem Betrieb für Servicetätigkeiten genutzt werden kann.
Aufgrund der anspruchsvollen klimatischen Bedingungen mit hohen Umgebungstemperaturen wurden die Durchflussmessgeräte speziell beschichtet. Die schwierigen Prozessbedingungen erforderten zudem, dass die komplette Verrohrung der Skids zusätzlich mit einer Phenolauskleidung versehen wurde, um Korrosion vorzubeugen. Alle Ventile wurden wegen des hohen Salzgehalts im Medium aus Inconel hergestellt.
Zu jedem Messsystem lieferte KROHNE zusätzlich eine modulare Messüberwachungslösung. Für die Leitwarte wurden komplett verkabelte, vorkonfigurierte und getestete Überwachungsschränke bereitgestellt. Diese sind mit dem auf eichpflichtige Messungen ausgelegten Mengenumwerter SUMMIT 8800 ausgestattet und verfügen als zentrale Komponente über SynEnergy, eine Prozessüberwachungs- und -visualisierungssoftware inklusive entsprechender Hardware.
Als Lösung für die kontinuierliche Prozessüberwachung und Berichterstellung sammelt SynEnergy alle verfügbaren Feldgeräte-Daten und bietet die vollständige Überwachung des gesamten Messsystems. Da die Softwarelösung web-basiert funktioniert, ist ein unmittelbarer und ortsungebundener Zugriff auf alle Messdaten möglich. Dadurch kann KROHNE direkt und schnell Support leisten sowie Software-Upgrades durchführen, ohne dass ein Besuch beim Kunden vor Ort notwendig ist. Mehr:
https://krohne.com/de/anwendungen/durchflussmesssystem-fuer-den-zulauf-einer-schilfklaeranlage/
(nach oben)
Krohne: Füllstandmessung von Abwasser in Kunststoffbehältern
Automatisiertes Abwassermanagement mit Intermediate Bulk Containern (IBC)
Kontinuierliche Messung durch das geschlossene Dach der Kunststofftanks
Zuverlässige und genaue Messwerte vermeiden Umweltprobleme
Hintergrund
Ein französischer Maschinen- und Anlagenbauer verwendet Kunststofftanks, um das Abwasser aus verschiedenen Produktions- und Reinigungsprozessen zu sammeln. Die sechs Tanks vom Typ IBC (Intermediate Bulk Containers) besitzen ein Fassungsvermögen von 1000 l und enthalten vor allem mit Öl oder Reinigungsmitteln gemischtes Wasser. Sobald das maximale Fassungsvermögen erreicht ist, wird ein Zufuhrventil geschlossen und ein anderes Ventil geöffnet, um den nächsten Behälter zu füllen. Die Behälter werden regelmäßig von einem Recyclingunternehmen geleert. Sie befinden sich im Außenbereich und sind daher den herrschenden Witterungsbedingungen ausgesetzt.
Konkrete Messaufgabe
Bis vor kurzem führte der Kunden lediglich Sichtprüfungen durch, um ein Überfüllen der Behälter zu verhindern. Dies war jedoch an Tagen mit hoher Auslastung oder während der Urlaubszeit ein Risiko. Daher suchte der Kunde nach einer kostengünstigen Lösung, um diesen Prozess zu automatisieren und Umweltprobleme zu vermeiden.
Realisierung der Messung
KROHNE lieferte sechs OPTIWAVE 1400 mit Tropfenantenne aus Polypropylen (PP), inklusive einer Schelle für das elektrische Kabel. Die FMCW Radar-Füllstandmessgeräte für Wasser- und Abwasseranwendungen messen berührungslos durch das Kunststoffdach der Tanks hindurch und übermitteln die Werte an eine SPS (speicherprogrammierbare Steuerung). Die SPS steuert die Ventile und zeigt einen visuellen Alarm an, wenn ein IBC 60% seines Fassungs-vermögens erreicht und geleert werden muss.
Nutzenbetrachtung
Dank der FMCW-Technologie und des schmalen Abstrahlwinkels seiner Tropfenantenne ist der OPTIWAVE 1400 in der Lage, kontinuierliche, zuverlässige und genaue Messwerte an die SPS zu senden. Auf diese Weise kann der Kunde den Prozess automatisieren und Umweltprobleme durch Überfüllung verhindern.
Aufgrund der berührungslosen Technologie sind die Geräte wartungsfrei. Darüber hinaus musste der Betreiber keine Öffnungen in die Tanks schneiden, was einen einfachen Betrieb der Messgeräte erlaubt. Die Radare messen direkt durch das Kunststoffdach der Tanks. Die Behälter können geleert werden, ohne die Radare zu demontieren, die frei darüber hängen.
Durch die robuste Edelstahlausführung in Schutzart IP68 ist der OPTIWAVE 1400 äußerst beständig gegenüber Witterungsbedingungen in Außenbereichen. Zusammen mit dem wettbewerbsfähigen Preis profitiert der Hersteller von einer robusten, kostengünstigen und wartungsfreien Lösung für seinen Prozess. Mehr:
https://krohne.com/de/anwendungen/fuellstandmessung-von-abwasser-in-kunststoffbehaeltern/
(nach oben)
Eggerpumps: Anspruchsvolle Rohabwasserförderung mit grosser Geodätik – PW Kalchreuth
An der Kläranlage Kalchreuth (Bayern) standen umfangreiche Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an, um das Abwasser auch in Zukunft gemäß den wasserrechtlichen Anforderungen reinigen zu können.
Um mit der Ertüchtigung der Kläranlage verbundenen hohen Investitions- und Betriebskosten zu vermeiden, entschied man sich im Frühjahr 2010 zu einer günstigeren Variante in Form einer Abwasserüberleitung nach Nürnberg. Kanalnetz und Klärwerke in Nürnberg, betrieben von der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN), sind in der Lage, die zusätzlichen Abwassermengen aus Kalchreuth aufzunehmen.
Hierzu baute man ab Oktober 2012 auf dem Gelände der alten Kläranlage der Gemeinde Kalchreuth ein neues Pumpwerk. Das Rohabwasser soll durch eine rund 10,5 Kilometer lange Druckleitung gepumpt werden. Die Leitung hat einen Höhenunterschied von rund 78 Metern zu überwinden und unterquert in einem Dücker die 6-spurige Autobahn A3 Nürnberg – Würzburg. Die Druckleitung endet am nord-östlichen Stadtrand von Nürnberg und das Abwasser fließt von dort weiter in freiem Gefälle durch vorhandene Kanäle zu den Nürnberger Klärwerken.
Mit der Planung wurde das Ingenieurbüro ELO-Consult beauftragt. Die gegebenen Randbedingungen stellten an die einzusetzende Pumpentechnik höhere Anforderungen, es sollte schließlich ungereinigtes Rohabwasser bei einer Fördermenge von 40 l/s auf 92 m Druck gebracht werden.
Eine Druckstoßberechnung wurde vom Ingenieurbüro 3S-Consult angefertigt, um die erforderlichen Drehmomente und Regelungsdetails festlegen zu können. Die An- und Abfahr-Rampe der Frequenzumrichter wurde nach Vorgaben der Druckstoßberechnung eingestellt, so dass die Pumpen optimal für diese Topographie geregelt werden können.
Bei der Pumpenauswahl entschied sich die SUN schließlich für den Pumpenhersteller Emile Egger, der für diese außergewöhnliche Anwendung mit hohen Förderdrücken viele positive Referenzen nachweisen konnte. Es wurden somit vier baugleiche Pumpen vom Typ TA 81-100 H4 LB4B eingesetzt. Die patentierten Turo® Freistrompumpen TA sind für höchste Betriebssicherheit bei Verstopfungsgefahr mit einem für Rohabwasser optimiertem Freistrom-Laufrad ausgestattet. Aufgrund der hohen Betriebsdrücke wurde der Werkstoff der Hydraulik für Gehäuse und Gehäusedeckel in duktilem Grauguss ausgeführt. Jeweils zwei Pumpen in Reihenschaltung erreichen zusammen die erforderliche Förderhöhe von 92 mWS. Um das erforderliche Trägheitsmoment zu erreichen, wurde jeweils an der Kupplung eine Schwungmasse mit einem Durchmesser von 565 mm und einer Masse von 186 kg installiert.
Den ganzen Artikel lesen Sie unter http://news.eggerpumps.com/freistrompumpen/anspruchsvolle-rohabwasserfoerderung-mit-grossen-hoehenunterschieden-pw-kalchreuth/?lang=de
(nach oben)
Eggerpumps: Förderung von stark belastetem Rohabwasser am Beispiel des Pumpwerks Lünen-Gahmen
Um stark belastetes Rohabwasser zuverlässig und sicher zu fördern, bedarf es einiges an Erfahrung, die in die Entwicklung von Kreiselpumpen für eine nahezu verstopfungsfreie Förderung einfliessen. In den letzten Jahren hat sich die Abwasserzusammensetzung massiv verändert, und die Förderung von unbehandeltem Rohabwasser ist zunehmend anspruchsvoller geworden. Pumpenhydrauliken, die in der Vergangenheit problemlos und mit zufriedenstellenden Ergebnissen eingesetzt wurden, stossen zunehmend an ihre Grenzen. Das Pumpwerk Lünen-Gahmen wurde in den 1970/80er Jahren aufgrund von Bergbausenkungen im Gebiet der Stadt Lünen erbaut. Die Aufgabe des Pumpwerkes lag darin, das anfallende Schmutzwasser aus den vorhandenen Mischwasserkanal zu entnehmen und zur Kläranlage zu fördern.
Das ankommende verschmutzte Abwasser wird in das vorhandene RÜB (Regenüberlaufbecken) übergeleitet und angestaut, sodass sich die darin befindlichen Feststoffe absetzen und mittels einer Kreiselpumpe abgezogen werden können.
Hierbei entstehen Spülstöße, die dann mit sehr starken Feststoffbelastungen von den Kreiselpumpen verpumpt werden müssen. Die in der Vergangenheit eingesetzten Pumpen mit Zweikanallaufrädern konnten dieser Belastung und dem aktuellen, mit Faser- und reissfesten Tüchern behaftetem Abwasser nicht mehr gerecht werden und mussten oftmals aufwendig repariert und instandgesetzt werden.
Umbau auf vertikal aufgestellte Turo® Freistrompumpen
Im August 2012 entschloss sich der Lippeverband zum Austausch der Pumpe M2, die seitdem auch überwiegend betrieben wurde. Eingesetzt wurde die Egger Turo® Freistrompumpe mit dem speziellen Freistromlaufrad aus Hartguss. Als Bauweise wurde die von Egger empfohlene vertikale Bauform mit einer hydrodynamischen Wellenabdichtung Eurodyn® gewählt. Diese Ausführung ist nicht nur platzsparend und wartungsarm, sondern zudem noch zu 100% trockenlaufsicher!
Die vom Betriebspersonal akribisch dokumentierten Ereignisse zeigen heute, dass der Austausch den erhofften Erfolg brachte. Die noch vorhandene Pumpe M1 wird heute nur noch vereinzelt betrieben.
Der Austausch der M2 auf die T 71-150 V4 LB4B mit 150 mm freiem Kugeldurchgang konnte die Einsatz- und Reparaturkosten ab Ende 2012 auf ein absolutes Minimum reduzieren. Verstopfungen traten keine mehr auf.
Den ganzen Artikel lesen Sie unter:
http://news.eggerpumps.com/abwasser/einlaufpumpwerk-rohabwasser/rohabwasser-am-beispiel-des-pumpwerks-luenen-gahmen/?lang=de
(nach oben)
Siekmann-ingenieure: Klimaschutz auf Kläranlagen – Wie funktioniert das?
Kläranlagen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer täglichen ingenieurtechnischen Arbeit. Der wesentliche Prozess der Abwasserreinigung ist meist energieintensiv. Um dies zu vermindern und in Zukunft mehr Energie einzusparen, erstellen wir nun seit einiger Zeit sogenannte Potenzialstudien, mit dem Ziel den Fremdstrombezug und die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren.
Ziel ist es, im Rahmen des Klimaschutzplans bis 2050, die Treibhausgasemissionen zu mindern. Ein Mittel zur Erreichung der Ziele ist die bundesweit erlassene Kommunalrichtlinie (https://www.ptj.de/projektfoerderung/nationale-klimaschutzinitiative/kommunalrichtlinie).
In dieser werden Maßnahmen zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Raum gelistet., deren Förderung in Aussicht gestellt wird. Für eine Prüfung der Förderfähigkeit investiver Maßnahmen bildet die ebenfalls förderfähige Potenzialstudie eine wesentliche Grundlage.
Diese Studien bilden ein Konzept ab, wie die entsprechenden Kläranlagen klimaschonender arbeiten können. Ziel dabei ist es, den Energieverbrauch durch die Anwendung innovativer und neuer Verfahren der Abwassertechnik zu reduzieren. Zu Beginn wird dafür eine Bestandsaufnahme der jeweiligen Kläranlage durchgeführt. Mithilfe der im Prozessleitsystem erfassten Daten, Messungen und Anlagenbegehungen wird der Status Quo erfasst. Im Anschluss folgt mit der eigentlichen Potenzialstudie das Herzstück, die Analyse des aktuellen Energieverbrauchs. Was sind die großen Verbraucher im Gesamtprozess? Auf Basis aller Daten wird nun eine Energiebilanz abgeleitet. Diese hilft, spezifische Stromverbrauchskennzahlen zu ermitteln und mit konkreten anlagenspezifischen Idealwerten zu vergleichen. Sogenannte Potenzialanalysen ergründen dafür kurz-, mittel- und langfristige Energieeinspar- und Effizienzpotenziale. Die Ergebnisse der zuvor genannten Schritte werden anschließend zusammengefasst, eine Strategie sowie ein Umsetzungsfahrplan entwickelt, um jene Ziele auch tatsächlich umsetzen zu können. Die Mindestziele, die bei Umsetzung der im Rahmen der Potenzialstudie erarbeiteten Maßnahmen und entsprechend der Kommunalrichtlinie erreicht werden sollen, sind eine Eigendeckung des Energiebedarfs für Strom und Wärme von mindestens 70 % und eine Reduzierung des spezifischen Fremdstrombezugs auf unter 23 Kilowattstunden pro Einwohner und Jahr. Aufbauend auf den Ergebnissen der Potenzialstudie können dann seitens der Abwasserinfrastrukturträger Fördermittel für die eigentlichen Maßnahmen beantragt werden.
Mit unseren Stand Juni 2020 fertiggestellten bzw. in Bearbeitung befindlichen rd. 15 kann eine diesbezügliche Expertise vorausgesetzt werden. Wir freuen uns auf weitere Projekte dieser Art, die zu einer klimaschonenderen Abwasserbehandlung beitragen.
https://www.siekmann-ingenieure.de/aktuelles/news/klimaschutz-auf-klaeranlagen-wie-funktioniert-das-156/
(nach oben)
NIVUS: Messungen an Regenbehandlungsanlagen
1. Einleitung
Gewässerschutz ist eine Aufgabe, die nicht neu ist. So führten extreme Flussverschmutzungen im Ballungsraum großer europäischer Städte schon in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Bau erster, einfach konzipierter Kläranlagen. Dieser Trend setzte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts fort und bald entstanden die ersten moderneren Anlagen mit biologischer Reinigung des Abwassers, die eine technologisch bedingte Vergleichmäßigung des Zuflusses erforderlich machten.
Das stellte allerdings die damals überwiegend vorhandene Mischwasserkanalisation bei Regen und den daraus resultierenden anschwellenden Abwassermengen vor ein hydraulisches Problem. So entstanden erste Regenüberläufe vor Drosseleinrichtungen, die Kläranlagen und Kanalnetz vor Überlastung schützten; gleichzeitig aber im Regenwetterfall wieder zu einem erhöhten Schmutzeintrag in die Vorflut führten. Der Bau erster Regenbehandlungsanlagen wie Regenrückhalte- und –überlaufbecken, Staukanälen und anderen Speicherräumen begann.
Da Zwischenspeicher aber auch kein unbegrenztes Volumen aufweisen können, ergibt sich auch an diesen die technologische Notwendigkeit der Entlastungsmöglichkeit über Becken- und Klärüberlauf in die Vorflut.
2. Rechtliches Umfeld
Die seit den 60er Jahren errichteten Stauräume in teilweise sehr individueller Ausführung liegen üblicherweise im gesamten Kanalsystem verteilt und sind häufig schlecht erreichbar bzw. nur schwer zugänglich. Die frühen Anlagen enthalten kaum Mess- und Regeltechnik geschweige denn Datenprotokolliersysteme. Das Fehlen jeglicher Technik führte häufig zum Vergessen der Anlagen. Ob diese korrekt funktionieren und die geplanten Wirkungen auf Umwelt und Kanalsystem eintreten, war (und ist mancherorts auch noch heute) unbekannt.
Diesen Umstand Rechnung tragend, begannen die einzelnen Bundesländer Ende der 80er Jahre, erste gesetzliche Grundlagen zu erarbeiten und zu verabschieden, um einen verbesserten Kenntnisstand über die Funktion der errichteten externen Abwasseranlagen zu erhalten. So entstanden z.B. die EKVO (Eigenkontrollverordnung) von Baden-Württemberg oder Hessen, die Eigenüberwachungsverordnung (EÜV) von Bayern und die Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) von NRW, um nur einige zu nennen.
Diverse Arbeits- und Merkblätter der DWA wie die A 111, A 128, A 166, M 166 unterstützen seit Jahren Behörden, Planer und Betreiber bei der Bemessung, Errichtung und dem Betrieb von Regenbehandlungsanlagen.
Die am 22.12.2000 in Kraft getretene europäische Wasserrahmenrichtlinie, die das gemeinschaftliche Herangehen an die integrierte Gewässerschutzpolitik in Europa regelt, ist in diesem Zuge nur folgerichtig und ein Baustein im rechtlichen Umfeld des Schutzes unserer Gewässer vor unzulässiger Verschmutzung und Belastung.
Das dem Kenntnisstand zur möglichst optimalen Wirkung und Schutzfunktion der Regenbehandlungsanlagen in der Praxis immer mehr Beachtung geschenkt wird zeigen auch die vielen neu entstehenden DWA-Nachbarschaften RÜB, Expertenforen und angebotene Schulungen zur Ausrüstung, Überwachung und Betrieb von Regenüberlaufbecken. Diverse Arbeitsmaterialien, Merkblätter, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen der Bundesländer unterstützen diese.
Eine zunehmende Präsenz und Nachfrage nach Daten, Protokollen und Auswertungen der überwachenden Stellen (Landratsämter, Wasserwirtschaftsbehörden u.a.) zeigen ein wachsendes Bewusstsein der Behörden in die Wichtigkeit der Datenerfassung, Bewertung und Auswertung und daraus resultierender Systemoptimierungen zur Verringerung der Gewässerbelastung.
3. Messungen an Regenbehandlungsanlagen
3.1 Datengrundlagen
Die Datenerfassung und Protokollierung an Regenbehandlungsanlagen hat die Aufgabe, das Befüllen und eventuelles Überlaufen des Stauraumes zu überwachen, zu registrieren und abzuspeichern.
Die über einen längeren Zeitraum gewonnenen Daten geben Aufschluss über Häufigkeit und Dauer von Einstau- und Überlaufereignissen sowie über die mengenmäßige Belastung des Kanalsystems. Die nicht behandelte Menge an verschmutzen Mischwasser (Überlaufmenge) kann quantitativ erfasst werden.
An Regenbehandlungsanlagen sind vorrangig die Daten von Bedeutung, die mit Einstau- bzw. Regen-ereignissen zusammenhängen, wie:
· Beginn und Ende des Beckeneinstaus. Aus diesen beiden Zeitpunkten ergibt sich die Einstaudauer
· der Einstauverlauf (Ganglinie über das Befüllungs- und Entleerungsverhalten des Staubereiches)
· Beginn, Ende und Zeitdauer des Klärüberlaufs (falls vorhanden)
· Beginn, Ende und Zeitdauer des Beckenüberlaufes
· Anzahl/Häufigkeit und Dauer der Entlastungen (Überläufe)
· Entlastungsmenge von Beckenüberlauf und – falls vorhanden – Klärüberlauf
Der Beginn sowie das Ende eines Ereignisses sind durch die Über- bzw. Unterschreitung einer zu definierenden Mindesteinstauhöhe im Staubereich festgelegt. Diese Höhe ist so hoch zu wählen, das sie im Trockenwetter sowie auch nach einem Einstau durch liegen gebliebene Sedimente nicht erreicht wird.
Das bedeutet: Ein Ereignis beginnt und endet mit einem Einstau im Rückhaltebereich des Bauwerkes. Es ist nicht durch eine Entlastung – auch Abschlag oder Überlauf genannt – gekennzeichnet. Auch ein Einstau ohne Entlastung in die Vorflut stellt ein Ereignis da.
In der Praxis hat sich für die meisten Stauvolumina als Ereignisbeginn eine Höhe von etwa 20% des Stauvolumens bewährt.
Bei der Festlegung von Einstaubeginn- und -ende muss darauf geachtet werden, dass der Ausschaltpunkt mit einer entsprechenden Hysterese unter dem Einschaltpunkt liegt. Die Hysterese ist so groß zu wählen, dass Wellenbewegungen u.ä. nicht zu einer Vielzahl von Pseudo „Mini“-Ereignissen von nur wenigen Sekunden Dauer führen.
Die Forderung nach einer Schalthysterese betrifft ebenfalls Becken- und Klärüberlauf. Der Punkt „Ende Abschlag“ sollte ca. 2 cm unterhalb der Schwellenoberkante definiert werden.
Aus der Summe der erfassten Daten eines Ereignisses ist ein Ereignisprotokoll zu bilden, welches die oben genannten Punkte umfasst. Dieses Protokoll wird aus den vor Ort erfassten Rohwerten in nachgeordneten Systemen wie Prozessleitsystemen, WEB-Portalen oder Cloud-basierenden Systemen gebildet.
Die Protokolle über Einzelereignisse werden am Ende des Monats zu einem Monatsprotokoll zusammengefasst; die Monatsprotokolle am Ende des Jahres zum Jahresprotokoll.
Zusätzlich zu der Ereignisprotokollierung ist die Messung und Aufzeichnung der Weiterleitungsmengen zur Kläranlage sinnvoll. Diese gestatten neben der Information zu eventuellen Fremdwasser (Nachtabflüsse) auch den Nachweis zur Einhaltung der korrekten Drossel- bzw. Regelmenge im Regenwetterfall. (àDrosselüberprüfung)
Weitere Protokollierungen, wie z.B. Laufzeiten von Pumpen und Schiebern oder Störmeldungen von Aggregaten, Schiebern und anderen Einrichtungen sind für die Beurteilung des Zustandes und des Betriebes der Anlage sinnvoll und nützlich, haben aber mit den eigentlichen Ereignisprotokollen nichts zu tun.
3.2 erforderliche Messungen
Beckenfüllstandmessungen
Die kontinuierliche Erfassung des Beckenfüllstandes mittels Druckmesszellen (Einhängedruck-sonden) oder über dem Wasserspiegel befindlichen berührungslosen Ultraschall- und Radarsensoren ermöglicht die Ermittlung des Einstaubeginns und Einstauendes, des Einstauverlaufes, der Einstauhäufigkeit und des genutzten Volumens des Speicherraumes.
Die zur Anwendung kommenden Messverfahren und Sensoren sind nach physikalischen und technischen Erfordernissen auszuwählen. (Messbereich, Mediumberührung, Drift, Genauigkeit, Robustheit, Messsicherheit bei Schnee und Wind etc.)
Becken- und Klärüberläufe
Je nach Forderung der Aufsichtsbehörde und Wichtigkeit des Beckens im Kanalsystem (Naturschutzgebiet, Badegewässer, Trinkwasserschutzgebiet, systemrelevanter Speicher, …) werden entweder nur Beginn und Ende sowie Dauer des Überlaufes und somit keine Aussage über die Überlaufmenge oder zusätzlich dazu die konkrete Abschlagmenge gemessen.
Je nach Position der Überläufe (im Trennbauwerk, direkt am Staubecken, ….) und nach gewählten Messverfahren der Beckenfüllstandmessung (Druckmessungen sind aus Genauigkeitsgründen oft ungeeignet) lässt sich unter Umständen die Beckenfüllstandmessung auch für die Überlaufmessung nutzen.
Bei der konkreten Mengenmessung haben sich die Methoden der Füllstandmessung über der Abschlagschwelle und der daraus resultierenden Q/h-Berechnung nach Poleni oder die wesentlich genauere direkte Messung von Füllstand mittels Ultraschall- oder Druckmessung zur Berechnung der hydraulisch benetzten Fläche und der mittleren Fließgeschwindigkeit (Kreuzkorrelations- oder Dopplermessung) im Abschlagkanal bewährt.
Formel für die Berechnung
Q= 23 · µ · b · c · 2g · hü32
Q = Überfall-/Abschlagmenge
µ = Überfallbeiwert
b = Wehrbreite
c = Abminderungsfaktor (in der Praxis zu „1“ gesetzt)
hü = Überfallhöhe
g = Erdbeschleunigung (9,81m/s²)
Das Messprinzip der Kreuzkorrelation erfasst die individuellen Geschwindigkeiten in den verschiedenen Fließhöhen und ermittelt dadurch das real existierende Fließprofil.
Diese Messung ist momentan noch nicht in allen mit Messtechnik ausgerüsteten Anlagen zu finden.
Zum Einsatz kommen hier magnetisch-induktive Verfahren in Zwangsdükerung. Diese sind verschmutzungsempfindlich durch Sedimente, Fett/Öl und biologische Belege. Ebenfalls werden kombinierte Höhen-/Fließgeschwindigkeitsverfahren mittels driftfreien und genauen Ultraschallsensoren mit Doppler- oder Kreuzkorrelationverfahren eingesetzt. Diese eigenen sich zum direkten Einbau in der Freispiegelleitung. Zusätzlich zum Messergebnis kann damit eine Regelung der Abflussmenge und in Verbindung mit geeigneter Fernwirktechnik eine intelligente und optimierte Kanalbewirtschaftung ermöglicht werden.
Die Weiterleitungsmenge gibt häufig auch gute Anhaltspunkte über eventuelle Fremdwassermengen im System durch die Messung der Trockenwettermenge in der Nacht.
4. Zusammenfassung
Die installierten Messungen liefern die Datengrundlagen für Protokollierung, Auswertung und Bewertung der Regenbehandlungsanlagen.
Im Zeitalter der Digitalisierung, von schnellen Übertragungs- und Cloudlösungen, animierter Visualisierungen und komplexer Berechnungen rückt dieser klassische Bereich manchmal in den Hintergrund. Dabei wird nicht bedacht, das falsch ausgewählte Messtechnik, ungeeignete Montagepositionen, fehlerhafte Inbetriebnahme und mangelnde Wartung zu Messfehlern führen, die den nachgeordneten Prozess in Bezug auf Praxisrelevanz ad Absurdum führen.
Die Firma NIVUS beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Durchfluss-, Abfluss- und Pegelmessungen sowie Datenprotokollierung und –übertragung auch an hydraulisch und bautechnisch anspruchsvollen Anlagen.
Im Rahmen von Schulungen und Weiterbildungen am Stammsitz in Eppingen oder durch konkrete Beratung vor Ort unterstützt das Unternehmen bei der Planung von Messprojekten an Regenbehandlungsanlagen. Die Serviceabteilung des Unternehmens führt auf Wunsch die Einrichtung, Inbetriebnahme und Wartung von Anlagen sowie die Datensichtung, Plausibilitätsprüfung und Protokollerstellung zur Weitergabe an die Behörden durch.
https://www.nivus.de/de/aktuelles-presse/presse/messungen-an-regenbehandlungsanlagen/
Dipl. Ing. Steffen Lucas
NIVUS GmbH
Im Täle 2
D 75015 Eppingen
Steffen.lucas@nivus.com
(nach oben)
VTA: Mit diesem Power-Duo holen Sie mehr raus
Der VTA mudinator® sorgt mit Ultraschall dafür, dass sich Faul- und Überschussschlämme wesentlich besser entwässern lassen und weniger Schlamm zu entsorgen ist. Ihre optimale Wirkung erzielt die innovative Technologie im Zusammenspiel mit dem Hochleistungsprodukt VTA Biocitran®.
Ob kommunale Verbände oder Industrie: Wer Abwasser reinigt, ist mit massiv steigenden Kosten für die Entsorgung der anfallenden Schlämme konfrontiert. Strengere Vorschriften (z. B. die Düngemittelverordnung in Deutschland) und immer mehr Restriktionen lassen die Preise für die thermische Verwertung durch die Decke gehen, auch deshalb, weil die vorhandenen Entsorgungskapazitäten begrenzt sind. Fachleute halten Kosten von bis zu 200 Euro pro Tonne schon in naher Zukunft
für realistisch.
Optimale Entwässerung, die das Gewicht der zu entsorgenden Schlammmengen reduziert, wird daher immer wichtiger – schließlich will niemand Wasser zur Verbrennung transportieren. Hier setzt der VTA mudinator® an: Bei dieser von VTA entwickelten Technologie wird der Schlamm unmittelbar vor der Polymerzugabe mit Ultraschall behandelt. Im Gegensatz zur Desintegration ist der Energieeintrag deutlich geringer. Die Schlammstruktur wird dabei so verändert, dass sich die Wirkung der Flockungsmittel (Polymere) verbessert.
„Der effektivere Ladungsausgleich erzeugt scherstabilere Flocken, aus denen auch das Zwischenzellwasser freigesetzt wird. So erhöht sich das Entwässerungsergebnis um bis zu 5 %-Punkte“, erklärt VTA-Biologe Andreas Gabriel, MSc. Umgelegt auf die Menge bedeutet das deutlich weniger Schlamm, der zu entsorgen ist. Zugleich sinkt der Polymerverbrauch.
Gefertigt wird nach Maß
„Der VTA mudinator® lässt sich in Kombination mit allen gängigen Entwässerungsaggregaten einsetzen. Dank der kompakten Bauweise ist die Nachrüstung auf bestehenden Anlagen problemlos und ohne Änderung der vorhandenen Infrastruktur möglich“, betont Ing. Robert Reitinger (Technischer Außendienst VTA). Durch den flexiblen, modularen Aufbau kann der VTA mudinator® punktgenau für die jeweiligen Anforderungen (Schlammvolumen, Entwässerungszeit)
konfiguriert werden.
Dazu dient ein aussagekräftiges Verfahren, beginnend mit Schlammanalysen und einer unbeschallten Null-Probe im VTALaborbus direkt vor Ort auf der Anlage. Daran schließen sich umfangreiche Versuche mit standardisierten Pressen und Schwingermodulen im VTA-Labor samt Ermittlung des Trockenrückstands im Austrag an. Die Ergebnisberichte werden mit dem Anlagenbetreiber besprochen, ehe ein begleiteter Praxisversuch auf der
Anlage startet.
Auch das geht ganz einfach: Ein Test-mudinator in der benötigten Größe wird als Bypass in den Zustrom des Entwässerungsaggregats eingekoppelt. VTA-Spezialisten ermitteln die Grundeinstellung, deren Parameter in den folgenden zwei bis drei Wochen vom Betreiber selbst adaptiert und angepasst werden können. Eine objektive Amortisationsrechnung bringt die erzielbaren wirtschaftlichen Vorteile auf den Punkt.
Synergieeffekte werden genutzt
Nochmals erhöht wird die Effektivität des VTA mudinator® durch VTA Biocitran®: Dieses Hochleistungsprodukt zur Schlammkonditionierung auf Basis von Zitronensäure wird direkt in die Beschickungsleitung des VTA mudinator® eingemischt und verbessert das Ergebnis. Aber nicht nur das: Es bindet organische Substanzen, sorgt für ein klareres Filtrat (bzw. Zentrat) und vermindert dadurch die Rückbelastung auf die Biologie der Kläranlage. Außerdem ermöglicht VTA Biocitran® eine Reduktion des Polymerverbrauchs um bis zu 20 %.
Die positiven Effekte durch den VTA mudinator®, ob mit oder ohne VTA Biocitran®, zeigen sich mittlerweile auch in der täglichen Praxis auf Kläranlagen. Sie werden durch aktuelle Untersuchungen eines externen Analyselabors, u. a. auf der Kläranlage Piding, so wie vielen Weiteren, untermauert.
Praxisbericht aus dem Wissensmagazin der VTA Gruppe „Der Laubfrosch“, Ausgabe 85
https://vta.cc/news/mit-diesem-power-duo-holen-sie-mehr-raus
(nach oben)
AERZEN: Digitale Steuerungstechnik für Gebläse und Kompressoren
Digitalisierung, Automatisierung und Industrie 4.0 sind in aller Munde. Auch bei der Steuerung von Gebläsen und Kompressoren bietet die Integration digitaler Anwendungen ein großes Potenzial zur Steigerung der Maschinenverfügbarkeit, Ausfallsicherheit und Informationstransparenz in der übergeordneten Steuerung des Maschinenbetreibers. AERZEN entwickelt sein Portfolio im Bereich der Aggregatsteuerung daher konsequent weiter und setzt auf die Vorteile der Digitalisierung. Mit der neu entwickelten AERtronic ist es AERZEN nun gelungen, das Funktionsspektrum des Vorgängers zielgerichtet um digitale Anwendungen zu erweitern.
Als kundennaher und praxiserfahrener Hersteller von hocheffizienter Gebläse- und Kompressorentechnik arbeitet AERZEN stets nah am Bedarf der Kunden. Der Technologievorreiter hat daher schnell festgestellt, dass die Weiterentwicklung digitaler Funktionen in der Steuerungstechnik von Prozessluftsystemen weitreichende Vorteile für den Betreiber der Maschinen mit sich bringt: Neben der höheren Anwenderfreundlichkeit digitaler Lösungen lassen sich durch die softwarebasierte Erfassung, Analyse und Bewertung von relevanten Prozessparametern auch signifikante Optimierungen im Betrieb erreichen.
Die neue Generation der Maschinesteuerung AERtronic wurde daher speziell in Hinblick auf die Kundenanforderungen der verschiedenen Branchen entwickelt. AERZEN bietet das System in den drei Varianten Basic, Advanced und Premium an. Diese unterscheiden sich in ihrem Funktionsumfang und können daher maßgeschneidert auf den individuellen Bedarf des Anlagenbetreibers eingesetzt werden.
Die Variante AERtronic Basic fungiert als digitale Maschinenparameteranzeige und Störungsmelder. Anders als beim Vorgänger, einer analogen Anzeigeeinheit mit Rundinstrumentierung, kann der Anwender die relevanten Prozessparameter wie Drücke und Temperaturen nun auf einem modernen Display ablesen und sie via Modbus RTU Schnittstelle einfach und bequem auf die Leitwarte bringen.
Die Steuereinheit AERtronic Advanced bietet neben diesen Funktionen auch die Möglichkeit, Prozesse aktiv zu steuern.
So identifiziert das Gerät über die Sensorik kritische Zustände im Prozess und schaltet die Maschine gegebenenfalls ab, um Schäden zu vermeiden. Zudem hat der Anlagenbetreiber die Möglichkeit, die erfassten Parameter per Modbus RTU an seine übergeordneten Systeme wie Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) zu übermitteln. Durch diese Funktion gelingt es, Prozesse in der Anlage noch transparenter zu gestalten und Verbesserungspotenziale frühzeitig zu identifizieren. Diese Funktionsvielfalt spielt ihre Vorteile vor allem beim Schraubenverdichter Delta Screw aus und ist bei diesem daher standardmäßig vorgesehen. Wer auf der Suche nach einer „Industrie 4.0 ready“-Lösung für seine Prozesse ist, findet in der AERtronic Advanced eine fortgeschrittene und anwenderfreundliche Maschinen-steuerung. Optional haben Kunden zudem die Möglichkeit, mit der Advanced-Steuereinheit auf weitere Schnittstellen wie Modbus TCP, ProfiNet® und Profibus® zurückzugreifen oder alle Informationen auf dem Smartphone, Tablet oder PC via WebView zu visualisieren.
Die Premium-Variante der AERtronic baut auf der Advanced-Steuereinheit auf und ermöglicht dem Betreiber über die AERZEN Plattform Zugriff auf weitere Dienste zur Steigerung der Verfügbarkeit, Effizienz und der Auswertung. Die auf Basis der über 150-Jährigen Maschinenbauerfahrung trainierte und programmierte KI gewährleistet einen noch effizienteren, zuverlässigeren und smarteren Betrieb der Maschine. Mit den innovativen Steuereinheiten von AERZEN stellen Betreiber von Gebläsen und Kompressoren die Weichen in Richtung Digitalisierung der Produktion. Dank der weitreichenden Funktionsvielfalt der Anlagen gelingt es, höchste Sicherheitsstandards mit einem Maximum an Anwenderkomfort und Prozesseffizienz zu kombinieren. Darüber hinaus verlängert der Einsatz einer AERtronic-Steuereinheit auch die Lebenszeit der Anlage, indem die Maschine gezielt vor Ausfällen durch Überlastungen geschützt wird.
https://www.aerzen.com/de/aktuelles/presse/presseartikel/digitale-steuerungstechnik-fuer-geblaese-und-kompressoren-1.html
(nach oben)
Stebatec: Syndicat des Eaux de Tavannes et Environs, ARA Loveresse
Neue Elektroverteilung ohne Betriebsunterbruch
Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) von Loveresse klärt die Abwässer der Gemeinden aus dem Einzugsgebiet des Syndicat des Eaux de Tavannes et Environs mit total rund 7000 Einwohnergleichwerten. Sie unterliegt wie alle ARA des Kantons Bern der Auflage des kantonalen Amts für Wasser und Abfall, die Einleitbedingungen des geklärten Abwassers in den Vorfluter auch bei einem Stromunterbruch einzuhalten. Damit musste die ARA Loveresse eine Notstromversorgung installieren und diese in ihre elektrische Schaltanlage integrieren.
Die Wahl fiel auf einen dieselbetriebenen Notstromgenerator, der für solche Fälle bei öffentlichen Bauten und Anlagen oft zum Einsatz gelangt. Dafür spricht zum einen die hohe Energiedichte des Diesels und zum anderen die sichere Versorgungslage. Diese soll bei Stromausfällen im Kanton Bern sogar noch sicherer werden, arbei-tet der Kanton derzeit doch ein Konzept aus, damit die notwendigen Diesellieferungen jeder-zeit gewährleistet sind.
Sämtliche Leistungen aus einer Hand
Im Falle eines Stromunterbruchs muss die Anlage vom öffentlichen Netz getrennt und auf Notbetrieb um-geschaltet werden. Für diese zusätzliche Betriebsart musste die Elektroverteilung entsprechend angepasst werden. Es zeigte sich jedoch, dass die bestehende Anlage diverse altersbedingte Mängel aufwies. So war der Personenschutz nicht gewährleistet und elektrische Komponenten waren teilweise nicht mehr verfüg-bar, was die Betriebssicherheit…mehr:
https://www.stebatec.ch/fileadmin/user_upload/Projektbericht_Loveresse_D.pdf
(nach oben)
Eggerpumps: Frische Luft für das Hauptklärwerk Stuttgart mit Iris Blenden-Regulierschiebern
Im Rahmen einer Energieoptimierung auf dem Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen der Stadtentwässerung Stuttgart wurden existierende dezentral schliessende Viereckblenden durch Iris®-Blenden-Regulierschieber ersetzt. Insgesamt sind 4 Egger Iris®-Schieber der Nennweite DN250 für die Regelung der Belebungsluft der Kläranlage im Einsatz. Mit je einer Durchflussmenge zwischen 1000 und 7000 Nm³/h ersetzen sie die alten Viereckblenden in Baugrösse DN 350.
Aufgrund der hohen Regelgüte und der Ausnutzung des grossen Regelbereiches der Iris®-Blendenregulierschieber konnte der Verdichterdruck im Vergleich zu den alten Viereckblenden mit absinkender Strömungsachse deutlich reduziert werden.
Die genauen Energiekosteneinsparungen sind derzeit noch in Ermittlung.
http://news.eggerpumps.com/blendenregulierschieber/frische-luft-fuer-das-hauptklaerwerk-stuttgart-mit-iris-blenden-regulierschiebern/?lang=de
(nach oben)
ESSDE: S:Select®-Anlage als betriebsbereites „Paket“ im Container
Die Kläranlage Schweinfurt (Ausbaugröße 250.000 EW) hat Ende 2019 eine S::Select®-Anlage in Betrieb genommen, die komplett vorgefertigt im Container geliefert wurde. Da die Fundamente und Anschlüsse vorbereitet waren, konnte die Anlage innerhalb weniger Tage mit dem Betrieb starten und sehr bald Verbesserungen der Schlammabsetzgeschwindigkeit, ISV, abfiltrierbaren Stoffen und Pges erzielt werden.
Aufgrund der stabilen und betriebssicheren Prozessbedingen, die S::Select® für die Kläranlage Schweinfurt erreicht hat, werden weitere Optimierungen im gesamten Betriebsablauf angegangen. Mehr:
https://www.essde.com/de/news?2643
(nach oben)
Mall: Ratgeber Rückstauschutz in 2. erweiterter Auflage
Wirksame Maßnahmen zum Überflutungs- und Rückstauschutz
Der Ratgeber Rückstauschutz von Mall wurde inhaltlich um den Aspekt Überflutungsschutz erweitert und steht in einer 2. Auflage zur Verfügung, die auf jetzt 36 Seiten das gesamte fachliche Spektrum der Überflutungs- und Rückstauthematik darstellt. Er richtet sich sowohl an Eigentümer von Grundstücken und Gebäuden als auch an Planungsbüros, Kommunen, Handwerksbetriebe und die Wohnungswirtschaft.
Da Starkregenereignisse häufiger und intensiver auftreten, sind Immobilien gleich zweifach gefährdet: durch Überflutung und durch Rückstau aus überlasteten Kanalisationen. Der Ratgeber ordnet das Starkregenphänomen zunächst in den aktuellen Kontext des Klimawandels ein; Experten erklären dann die Entstehung von Überflutungs- und Rückstaulagen, beschreiben die Möglichkeiten des technischen und baulichen Schutzes, zeigen Versicherungsaspekte und bringen Übersicht in die anzuwendenden Normen. Ergänzend erläutert der Ratgeber, was im Sonderfall von Gebäuden in Hanglage zu beachten ist. Typische Anwendungsbeispiele runden die in der Fachbuchreihe „Ökologie aktuell“ erscheinende Broschüre ab. Sie kann per E-Mail unter info@mall.info zum Preis von 15 Euro inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten bestellt werden (ISBN 978-3-00-060966-4).
https://www.mall.info/presse/pressemitteilungen/news-detail/ratgeber-rueckstauschutz-in-2-erweiterter-auflage/
(nach oben)
Oko-tech: OKO-aquaclean 1000E Profiline zur Aufbereitung von Deponiesickerwasser kurz vor der Auslieferung
Bald geht es los – noch ein paar kleine Handgriffe und die Endabnahme im Werk, dann kann die neueste OKO-aquaclean 1000E Profiline auf die Reise nach Österreich zum Kunden gehen. Einsatzort wird eine Abfalldeponie sein. Die dort anfallenden Deponiesickerwässer sollen in einem mehrstufigen Prozess so aufbereitet werden, dass sie indirekt eingeleitet werden können. Herzstück dieses Prozesses wird die OKO-aquaclean sein, die Abwasserinhaltsstoffe wie Schwermetalle, CSB-verursachende Substanzen sowie suspendierte und dispergierte Inhaltsstoffe durch pH-Wert-Einstellung und Fällung/Flockung aus dem Wasser entfernt. Selbstverständlich werden ausschließlich moderne, ressourcenschonende Koagulier- und Spaltmittel eingesetzt; ein Sensornetzwerk, eine SPS mit Möglichkeit der Fernwartung und die OKO-control Software sorgen dabei für einen automatischen Betrieb der Anlage.
Deponiesickerwässer gehören mit zu den am schwierigsten aufzubereitenden Abwässern, u.a., weil sie in der Regel verschiedenste Schwermetalle enthalten und sich die Zusammensetzung der Belastungen ständig ändert. Daher freuen wir uns darauf, die Leistungsfähigkeit, Effizienz und Flexibilität der Anlagen aus dem Hause OKO-tech erneut unter Beweis stellen zu können!
Haben Sie Fragen zum Thema? Dann kontaktieren Sie uns!
Telefon +49 (0)5152 524410
E-Mail: sales@oko-tech.de
https://www.oko-tech.de/aktuelle-meldungen/artikel/oko-aquaclean-1000e-profiline-zur-aufbereitung-von-deponiesickerwasser-kurz-vor-der-auslieferung.html
(nach oben)
VEGA denkt Industrie 4.0 gemeinsam mit der Open Industry 4.0 Alliance weiter
Ökosystem statt Insellösung
So schnell kann‘s gehen. Seit dem Frühjahr 2019 gibt es die „Open Industry 4.0 Alliance“ und innerhalb kürzester Zeit ist die Zahl ihrer Mitglieder von 8 auf rund 60 gestiegen. Eines davon ist jetzt VEGA. Denn der Schwarzwälder Messtechnik-Spezialist steht voll und ganz hinter dem Ziel der Alliance, den heterogenen Cloud-Diensten am Markt zu einer Art Teamwork-Fähigkeit zu verhelfen.
Ob Smart Factory, Industrie 4.0 oder auch IIoT: Letztlich verbirgt sich hinter den Begriffen ein und dasselbe. Fabriken, Maschinen und Komponenten werden vernetzt und immer smarter. VEGA bietet mit ihrem umfassenden Sensorik-Portfolio leistungsstarke Messtechnik für alle Füllstand- und Druck-Anforderungen – von Standardapplikationen bis hin zu hochkomplexen Lösungen für alle erdenklichen Produktionsumgebungen. Immer wichtiger wird dabei, die Produktion stärker mit IT-Technik zu verknüpfen und Messergebnisse für eine intelligente Steuerung des Gesamtprozesses zu nutzen.
Just in Time-Lösung von VEGA
Ein starkes Beispiel dafür ist die Softwaretechnologie VEGA Inventory System. Sie baut die Brücke zwischen automatisierter Logistik und IT. Dank ihr fließen mit Datenströmen auch Waren „Just in Time“. Es werden kaum noch Lager benötigt, die die Material-Versorgung innerhalb der Fertigung puffern müssen. Angeliefert wird automatisch und genau dann, wenn der Produktionsprozess es benötigt. Die Daten dafür stellt bewährte VEGA-Sensorik zur Verfügung.
„Inzwischen kommt kaum ein Geräte-Hersteller daran vorbei, auch eigene IIoT-Dienste über die Cloud anzubieten. Bei VEGA unterstützen wir unsere Kunden mit einem ganzen Paket an Automationslösungen, die für schnellere und flexiblere Produktionsprozesse sorgen,“ fasst Jakob Hummel, VEGA-Produktverantwortlicher für digitale Lösungen, die Ist-Situation der Industrie zusammen.
Auf Offenheit kommt es an
Je mehr die Industrie 4.0 zur Realität wird und je allgegenwärtiger proprietäre Cloud-Dienste, desto klarer wird auch, dass sie nicht im Alleingang umgesetzt werden kann. Industrie 4.0 lebt von der Zusammenarbeit und Kompatibilität über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – vom Zulieferer bis zum Hersteller. Offene Standards entscheiden über den Erfolg oder Misserfolg. Seit Beginn des Jahres ist VEGA daher Mitglied der „Open Industry 4.0 Alliance“. Rund 60 Mitglieder vertrauen inzwischen auf deren Ansatz, bei der Produktion – von einzelnen Komponenten bis hin zum Service – eine offene und standardisierte Verknüpfung zu realisieren.
Mehr Freiheit für die Kunden
Für die Kunden bedeutet dies die freie Wahl aus modularen und skalierbaren Lösungsbausteinen. „Niemand muss mehr einen sogenannten Vendor Lock-in befürchten,“ sagt Hummel. Denn, habe man sich bislang mit der Entscheidung für das Produkt eines Anbieters auch auf dessen Technologie festgelegt, „so wird ein Lieferantenwechsel mit dem offenen Standard der Alliance sehr viel einfacher.“ Der Kunde muss neue Geräte und Maschinen nicht länger automatisch wieder beim früheren Anbieter kaufen. Auch kann er, ohne einen Technologiewechsel zu befürchten, die Lösungen mehrerer Anbieter miteinander kombinieren. „Zukünftig werden wir durch die Alliance immer mehr Angebote mit einer Sprache sprechen,“ blickt Hummel in die Zukunft. Dies sei eine erhebliche Erleichterung auf dem Weg hin zu smarten Prozessen und Fabriken.
Vielzahl der Insellösungen überwinden
Die Open Industry 4.0 Alliance selbst spricht gerne von einem offenen Ökosystem, auf das sie abziele. Im Klartext will sie die Vielzahl individueller Insellösungen überwinden und der europäischen Industrie damit einen entscheidenden Schub verpassen. Gemeinsam planen die derzeitigen und zukünftigen Mitgliedsfirmen ein verbindendes und verbindliches Rahmenwerk, also ein Framework für eine „Open Industry 4.0″. Im Vergleich zu anderen Initiativen hebt sich die Organisationsform der Alliance deutlich ab. „Gerade dies wird ihren Erfolg ausmachen,“ ist sich Hummel sicher. Zum einen bedeute „open“, dass jedes Mitglied gleichberechtigt sei. Zum anderen verpflichte sich jeder dem Prinzip des „one“. Das heißt, jeder bringt seine Kompetenzen und Technologien so ein, dass am Ende der Kunde König ist. Er kann stets sicher sein, die verlässlichste und skalierbare Gesamtlösung zu erhalten.
https://www.vega.com/de-de/home_de/unternehmen/news-und-events/news/2020/vega-denkt-industrie-4-0-gemeinsam-mit-der-open-industry-4-0-alliance-weiter
(nach oben)
Huber: Energieeffiziente Klärschlammtrocknung
Die IKB (Innsbrucker Kommunalbetriebe AG) investierte in einen Huber Bandtrockner BT 16. Mit der Strategie „Vom Klärwerk zum Kraftwerk“ erzeugt die Abwasserreinigungsanlage der IKB nachhaltig Energie und integriert sie intelligent in ihr bestehendes System. Ziel ist es, die Effizienz der gesamten Abwasserreinigungsanlage weiter zu steigern und dadurch zu den fortschrittlichsten Kläranlagen Europas zu gehören.
Innsbruck, die mit ca. 130 000 Einwohnern fünftgrößte Stadt Österreichs und Landeshauptstadt Tirols, produziert zusammen mit 14 umliegenden Gemeinden 50 000 m³ Abwasser pro Tag (Spitze: 145 000 m³), welche die moderne Abwasserreinigungsanlage aufbereitet. Zwei Huber Bandeindicker DrainBelt 2.0 liefern täglich ca. 320 m³ Dünnschlamm mit 6 bis 7 % TR, dem pro Tag etwa 70 m³ Bioabfall beigemischt werden. Durch die Co-Fermentation erhöht sich die Biogasausbeute der Faultürme auf der Kläranlage. Im Durchschnitt produziert die Faulung ca. 9000 m³ Gas am Tag, das größtenteils in zwei Blockheizkraftwerken verstromt wird. Die dabei entstehende Abwärme aus der Motorenkühlung mit einer Vorlauftemperatur von 90 °C wird im Mitteltemperaturbereich des Bandtrockners verwertet. Der restliche Teil des Biogases wird in einem 1800-kW-Heißwasserkessel zur Wärmeproduktion mit einem Temperaturniveau von 140 °C genutzt. Huber realisiert hier einen maßgeschneiderten Zwei-Temperaturzonen- Trockner, der gleichzeitig über Mitteltemperaturenergie aus den Blockheizkraftwerken und Hochtemperaturenergie aus dem Heißwasserkessel betrieben wird.
So wurde der Bandtrockner von Huber entsprechend modifiziert, um in das bereits existierende ehemalige Schlammentwässerungsgebäude integriert werden zu können. Hierzu reduzierte man die Höhe des Standardtrockners, um die Durchgangshöhen oberhalb des begehbaren Bandtrockners einzuhalten. Auch die Länge des Trockners war durch die Gebäudemaße vorgegeben. Aus diesem Grund musste die thermische Energie im Inneren des Bandtrockners so verteilt werden, dass trotz limitierter Baulänge eine Wasserverdampfung von 2000 kg/h erzielt wird.
Huber konzipierte für die IKB einen Trockner, der auf die Bedürfnisse der Abwasserreinigungsanlage zugeschnitten ist. Neben den 330 kW Abwärme aus den bauseits vorhandenen Blockheizkraftwerken wird das Biogas effizient genutzt, um in einem Hochtemperaturkessel thermische Energie zu erzeugen. Ein sicherer Betrieb der Trocknungsanlage auch bei Revision der Blockheizkraftwerke wird gewährleistet, da der Trockner mit einem zusätzlichen Wärmetauscher ausgestattet ist, der es ermöglicht, die Hochtemperaturwärme auch in den Mitteltemperaturbereich zu übertragen. Bei Betriebsstörungen oder Revisionsarbeiten auf Seiten der Blockheizkraftwerke …
Den ganzen Artikel lesen Sie In der Korrespondenz Abwasser Heft 2-2020 ab Seite 216
Huber SE
www.huber.de
(nach oben)
Tipps für die Betreiber von Kläranlagen
Auf die Belüftung kommt es an
Kläranlagen sind gemäß einer Studie des Umweltbundesamtes für rund 1 % des bundesweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Was sich zunächst nach einem sehr geringen Prozentsatz anhört, bietet aus Sicht des einzelnen Kläranlagenbetreibers jedoch ein hochattraktives Einsparpotenzial. Ein typisches Beispiel für das Einsparpotenzial in Kläranlagen ist die Beckenbelüftung. So gelingt es durch den Einsatz hochmoderner Gebläsetechnologien und einer bedarfsgerechten Steuerungstechnik beispielsweise mit vergleichsweise geringem Aufwand, den energieintensiven Prozess der Beckenbelüftung energetisch zu optimieren und die Wirtschaftlichkeit des Klärbeckens signifikant zu steigern.
Dieser Ansatzpunkt ist gerade für Städte und Gemeinden hochinteressant. Ein Blick auf den Energiebedarf kommunaler Klärbeckenbetreiber zeigt, dass Kläranlagen in Städten und Gemeinden einen beachtlichen Anteil von rund 20 % am gesamten Stromverbrauch einnehmen. Im Vergleich zu Schulen, Krankenhäusern, Wasserversorgungssystemen oder anderen kommunalen und städtischen Energieverbrauchern spielt die Wasseraufbereitung also eine ganz entscheidende Rolle.
Das Energieeinsparpotenzial von Kläranlagen wird jedoch häufig unterschätzt. Viele Kläranlagen werden auch heute noch mit ungeregelten und ineffizienten Belüftungsanlagen betrieben, die für einen Großteil des gesamten Stromverbrauchs verantwortlich sind. Aus heutiger Sicht ist die ungeregelte und nicht bedarfsgesteuerte Belüftung in Kläranlagen jedoch technisch veraltet. Schon seit einigen Jahren sind auf dem Markt hocheffiziente Anlagen wie Turbogebläse, Drehkolbengebläse und Drehkolbenverdichter verfügbar. Diese bieten nicht nur für sich gesehen eine höhere Effizienz und können in einem breiten Teillastbereich betrieben werden, sondern können im Sinne einer optimalen Gesamteffizienz sogar zusammen betrieben werden. Auf diese Weise gelingt es, Lastwechsel im Bedarfsprofil des Beckens optimal zu bedienen und die Energiekosten nachhaltig zu senken.
In unserem Ratgeber gehen wir nicht nur auf die Bedeutung der Belüftungstechnik für die Wirtschaftlichkeit von Kläranlagen ein, sondern zeigen auch das Potenzial bedarfsgerechter Gebläsetechnologien auf. Darüber hinaus zeigen wir, wie Klärbeckenbetreiber ihr Belüftungsbecken von der ersten Analyse bis zur Verbundsteuerung energetisch optimieren können.
Die Bedeutung der Belüftungstechnik für die Wirtschaftlichkeit von Klärbecken
Kläranlagen verbrauchen jährlich eine gigantische Strommenge in Höhe von etwa 4.400 Gigawattstunden (GWh) elektrischer Energie . Das entspricht in etwa der Jahresleistung eines modernen Kohlekraftwerks und einer jährlichen CO2-Erzeugung in Höhe von rund 3 Millionen Tonnen. Von einer Steigerung der Energieeffizienz in der Kläranlage …mehr:
https://www.aerzen.com/de/anwendungen/wasser-und-abwasseraufbereitung/ratgeber/tipps-fuer-die-betreiber-von-klaeranlagen.html
(nach oben)
Aerzen: WIE MAN DIE EFFEKTIVSTE GEBLÄSETECHNOLOGIE FÜR ABWASSERANWENDUNGEN AUSWÄHLT
Aufgrund der zahlreichen Einflussvariablen bei der Auswahl eines Belüftungsgebläsesystems für Abwasseranwendungen und ebenso zahlreicher Ansprüche durch Technologieanbieter, ist es nicht überraschend, dass Verwechselungsgefahr besteht. Schlimmer noch als die Verwirrung, ist die Ent-täuschung, die sich ergibt, wenn eine Gebläsetechnologie nicht das Erwartete abliefert und Betriebs-kosten und Effizienzvorteile unerfüllt bleiben.
Dieser Leitfaden erklärt drei Gebläsetechnologien mit Beispielen aus gegenwärtigen Abwasseranla-gen, beschreibt die effektivste Technologie für besondere Anwendungen und warum. Natürlich gibt es keinen Ersatz für eine Beratung, speziell für Ihre Anwendung; jedoch kann das Handbuch helfen, die richtigen Fragen zu stellen und einen produktiven Verkaufs-und Technologiebewertungsprozess sicherzustellen.
Einführung
Energieverbrauch und Kosten waren die wichtigsten Trei¬ber hinter der Entwicklung von effizienteren Belüftungs¬gebläsesystemen. Diese Systeme können bis zu 60 % des gesamten Energieverbrauches von einer Abwasseraufbe¬reitungsanlage ausmachen. Deshalb ist die Einsparung durch größere Energieeffizienz maßgeblich. Technolo¬gische Fortschritte bei Belüftungsgebläsen bieten neue Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauches. Jedoch erfordern diese Optionen…mehr unter:
https://www.aerzen.com/fileadmin/user_upload/02_documents/02-02_applications/02-02-01_water_and_waste_water_treatment/white_paper/White_Paper_DE.pdf
(nach oben)
Hach: Anwendungsbericht: TOC Produktverlust Überwachung mit BioTector B7000i Dairy und Vakuum Venturi
Probenahme erspart den Ausbau der Kläranlage
Die Betriebskläranlage der MEGGLE AG, eine traditionsreiche, Milch- und Molke verarbeitende Unternehmensgruppe in Wasserburg / Bayern, fuhr nahe an ihrer Auslastungsgrenze. Um gesetzliche TOC-Grenzwerte sicher einhalten zu können, stand eine größere Investition zur Erweiterung der Anlage kurz bevor. Stattdessen entschloss man sich, TOC-Messtechnik von Hach, den BioTector B7000i Dairy, an strategisch wichtigen Punkten zu installieren, um so die Produktion und den Klärprozess besser steuern zu können.
In der ersten Phase wurde der Kläranlagenzulauf mit Hilfe eines BioTector B7000i Dairy auf TOC-Spitzen überwacht. Das bessere Verständnis des TOC-Gehaltes im Abwasser wurde zur Optimierung des Klärprozesses genutzt.
Die Robustheit, Verlässlichkeit und einfache Handhabung des Analysators überzeugten zur Installation eines weiteren BioTector B7000i Dairy, der nun den TOC-Gehalt an drei verschiedenen Produktionsabläufen überwacht. TOC-Spitzen, die durch Leckagen hervorgerufen werden und zu Produkt- bzw. Rohstoffverlusten führen, werden dadurch schnell erkannt, lokalisiert und von den Mitarbeitern gezielt behoben.
Durch die Verringerung der auslaufenden Rohstoffe bzw. Produkte ist die Schmutzfracht im Abwasser nun deutlich geringer. Neben Einsparungen bei Energie, Klärschlammentsorgung und Produktverlusten, ist die Kapazität der Kläranlage nun wieder ausreichend und die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte ist gewährleistet.
Den vollständigen Bericht lesen, um mehr zu erfahren
https://de.hach.com/news/2020-02-04-MeggleAnwendungsbericht-de.jsp
(nach oben)
Mikroplastik in der biologischen Abwasserreinigung – Muss das sein?
Der Begriff der Mikroplastik tauchte erstmals vor ca. 10 Jahren im Sprachgebrauch auf und bezeichnet kleine Kunststoff-Teilchen, die einen Durchmesser unter 5 mm besitzen. Dabei unterscheidet man zwischen den zu Gebrauchszwecken produzierten Mikroplastik-Partikeln, wie sie z.B. in Kosmetika verwendet werden, und den durch den Zerfall von Kunststoffprodukten entstehenden Partikeln (Plastikmüll).
Nun macht die Mikroplastik auch vor Wasser- und Abwasserreinigungsanlagen nicht halt und die Belastung der Gewässer und auch der Wasserkreisläufe in der Aquakultur durch diese steht dadurch vermehrt in der Diskussion.
Warum ist das so
In der Wasser- und Abwasserreinigung wird die Wirbelbetttechnologie (MBBR) seit Jahrzehnten mit großem Erfolg eingesetzt und ist (je nach Anwendungsgebiet) nahezu unverzichtbar. In diesen MBBR-Reaktorbecken werden verschiedenste Trägermaterialien zur Immobilisierung von Mikroorganismen verwendet.
Nun stellt man fest und es steht zur Diskussion, dass durch die Verwendung dieser Kunststoffelemente eine Belastung der Gewässer durch Mikroplastik entsteht, wobei doch eigentlich diese Anlagen das Wasser reinigen sollen. Warum ist das so? Lässt sich dieses Risiko vermeiden, um diese wichtige Technologie beibehalten zu können?
In MBBR-Anlagen werden seit jeher Kunststoffträger eingesetzt, die auf Grund ihrer Geometrie oder Materialbeschaffenheit Mikroplastik durch Abrieb bzw. Abnutzung freisetzen können.
Ein besonders hoher Verschleiß wurde immer wieder an weichen PU-Schaumstoffwürfeln festgestellt, die auch auf Grund von derartigen Verschleißerscheinungen durch neues Material zu ersetzen waren.
 |
 |
| Abb. 1 Schaumstoffwürfel: Neuware und durch Abrieb abgenutzte Träger |
Abb. 2 Durch zu hohe kinetische Energie
beschädigte Träger
|
Der Verschleiß entsteht durch Abrieb (Abb. 1), durch gegenseitiges Berühren/Zusammenstoßen (Abb. 2) oder durch Kollision an Behälterwänden oder -einbauten. Neben den Materialeigenschaften spielt auch die kinetische Energie eine große Rolle. Die kinetische Energie gibt an, mit welcher Energie ein bewegter Körper gegen einen anderen Körper oder eine Behälterwand prallt. Die Grundformel ist Ekin = (1/2) m V2. Die wesentlichen Faktoren sind also Masse und die Bewegungsenergie. Damit die kinetische Energie so gering wie möglich ist, sollte ein Träger „leicht wie eine Feder“ sein und sich im Wasser mit geringer Geschwindigkeit bewegen. Optimaler Zustand wäre, dass sich ein Träger freischwimmend im Wasser befindet und sich nicht bewegt, was jedoch nur in der theoretischen Betrachtung möglich ist. Schon durch die Wasserströmung und ggf. durch den Lufteintrag werden die Aufwuchskörper bewegt.
Ein zu beeinflussender Faktor ist die „Masse“ der Körper. Diese wird u.a. durch die Geometrie beeinflusst. So ist zum Beispiel bei Hohlkörpern (Röhrchen-, Spiralenform) festgestellt worden, dass sich im Innenraum eine inaktive Biomasse aus abgestorbener Biomasse bilden kann, die damit den Körper in der Masse belastet. Diese Masse kann folglich nicht am weiteren Stoffaustausch /-umsatz teilnehmen. Die abgestorbene Biomasse im Inneren des Hohlkörpers erhöht somit „unnütz“ die Masse bzw. das Gewicht und führt folglich zu erhöhtem Verschleiß. Der dadurch entstehende Abrieb zählt zu dem Begriff der Mikroplastik.
Die weiter oben sowie unten aufgeführten Fotos zeigen verschiedene Trägerelemente die durch Abrieb verschlissen sind.
 |
 |
| Abb. 3 Durch Abrieb beschädigte Träger |
Abb. 4 Im Vergleich: Verblockte Träger & Chipförmige Träger |
MBBR-Trägermaterial für eine umweltfreundliche Zukunft
Entgegen den verschiedenen Hohlkörpern oder Schaumwürfeln zeigt ein dünner, chipförmiger Träger keinen Abrieb. Dies wurde in verschiedenen Referenzanlagen mit mehr als 10 Jahren Betriebszustand nachgewiesen. Die Gründe sind vielschichtig aber logisch nachvollziehbar. Zunächst hat der Chip ein sehr geringes Eigengewicht durch seine feste HDPE-Schaumstruktur. Sein äußerer Schutzring wirkt wie eine elastische Puffer-Knautschzone. Durch die Dicke von ca. 1,1 mm wird beidseitig eine aktive Biomasse angelagert, die auf Grund der optimalen Diffusion mit Substrat und Sauerstoff versorgt wird. Der Chip ist nicht mit toter Biomasse belastet und folglich ist die kinetische Energie sehr gering.
Der Chip hat auf Grund seiner Geometrie und Bewegungseigenschaften eine sehr geringe Bewegungsgeschwindigkeit, die wesentlich durch die Berechnung V² – Quadrierung – positiv die geringe kinetische Energie zu seinem weiteren Vorteil nutzt. Schwere, große Körper bewegen sich mit höherer Geschwindigkeit.
Durch den Biofilm hat der Chip rundum eine „geschmierte“ Fläche, die für einen ausreichenden Schutz des Körpers sorgt. Wie in geschmierten Gleitlagern entsteht durch den Schmierfilm kein Abrieb.
Von derartigem Material gehen also keine Umweltbelastungen in Form von Mikroplastik aus und sie tragen weiterhin durch hohe Effektivität zum Umweltschutz bei.
© Multi Umwelttechnologie AG, 2019
Autoren:
Christian Börner
Cornelia Harmsen
info@mutag.de | www.mutag.de |
(nach oben)
Nereda®-Verfahren auf der Kläranlage Altena
Kurzbeschreibung
Der Ruhrverband betreibt für seine Mitglieder über 60 Kläranlagen in Nordrhein-Westfalen und reinigt dort die Abwässer von mehr als zwei Millionen Menschen und zahlreichen Gewerbebetrieben. Die Kläranlage im sauerländischen Altena wurde 1984 mit einer Ausbaugröße von 52.000 Einwohnerwerten (EW) in Betrieb genommen. Die biologische Reinigung erfolgt derzeit nach dem Belebungsverfahren. Im Faulbehälter wird der Schlamm anaerob stabilisiert, dann maschinell entwässert und anschließend einer thermischen Verwertung zugeführt.
Der Kläranlagenstandort soll umfassend saniert und an die seit den 1980er Jahren deutlich gesunkene Einwohnerzahl angepasst werden (zukünftige Ausbaugröße 20.000 EW). Ein Ziel der Umbaumaßnahmen ist es, die Anlage künftig ohne eigene Schlammbehandlung als so genannte Satellitenanlage, also von einer benachbarten Kläranlage aus, zu betreiben.
Die geringe Flächenverfügbarkeit und die eingeschränkte Zugänglichkeit des Geländes für schweres Baugerät stellten wesentliche Herausforderungen für die Neuplanung dar. Auf Basis der Ergebnisse einer umfangreichen Machbarkeitsstudie wurde vom Ruhrverband die Umsetzung des Nereda®-Verfahren als die vorteilhafteste Lösung für die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe ausgewählt. Das Nereda®-Verfahren ist ein neuartiges biologisches Abwasserreinigungsverfahren, in dem die Bakterien durch eine spezielle Reaktorgestaltung und gezielte Betriebsführung anstelle von Flocken kompakte „Granulen“ ausbilden. In diesen Granulen laufen die verschiedenen biologischen Prozesse der Abwasserbehandlung in den inneren anaeroben Bereichen und den äußeren aeroben Bereichen gleichzeitig ab. Das Verfahren basiert auf einem modifizierten Sequencing Batch Reactor (SBR)-Betrieb, bei dem Beschickungs- und Ablaufphase, Reaktionsphase und Sedimentationsphase zyklisch aufeinander folgen. Überschüssiger Schlamm wird regelmäßig abgezogen und zur Weiterbehandlung auf eine benachbarte Kläranlage verbracht.
Im Vergleich zu konventionellen biologischen Reinigungsverfahren nach dem Stand der Technik ergeben sich beim Nereda®-Verfahren deutliche betriebliche und wirtschaftliche Vorteile durch den geringeren Flächenbedarf, eine hohe Robustheit des Verfahrens sowie geringere Betriebskosten und verminderten Wartungsbedarf. Eine moderne Mess-, Steuer- und Regeltechnik mit Online-Überwachung und Fernzugriff ist Bestandteil des Verfahrens. Mit der neuen Anlage und dem neuen Verfahren soll eine weitestgehend biologische Phosphorelemination erfolgen. So kann im Vergleich zum Ist-Zustand eine Einsparung von Fällmitteln für die chemische Phosphatfällung um voraussichtlich etwa 75 Prozent realisiert werden. Insgesamt wird mit der neuen Technologie eine deutliche Verbesserung der Ablaufwerte erwartet.
Zusätzlich wird im Vergleich zum Ist-Zustand für die Kläranlage in Altena mit dem Nereda®-Verfahren eine Verringerung des Energiebedarfs um mindestens 30 Prozent erwartet. Insgesamt ergeben sich Einsparungen von 130 Tonnen CO2 pro Jahr bzw. 7,6 Kilogramm CO2 pro EW und Jahr.
https://www.umweltinnovationsprogramm.de/projekte/neredar-verfahren-auf-der-klaeranlage-altena
(nach oben)
Stebatec: Steuerung Komplettersatz in 48 Stunden
STEP V.O.G, La Verna, Ecublens, Schlammbehandlung
Bereits mehrere Modernisierungsepochen hat die Kläranlage La Verna in Ecublens FR während der beinahe 30-jährigen Zusammenarbeit mit der Stebatec realisiert. Nach dieser langen Zeit vertrauensvoller Zusammen-arbeit steht nun das nächste Grossprojekt an; die Vergrösserung der Kläranlage von 22`500 Einwohnergleich-werten (EW) auf 50`000 EW.
Im laufenden Klärbetrieb einen Steuerungsersatz vorzunehmen, bedarf einer akribischen Planung, umfangrei-chen Vorbereitungsmassnahmen und letztlich grosser Einsatzbereitschaft während der effektiven Umbau-phase. So geschehen ist dies nun auch während dem Teil-Umbauprojekt der Schlammtrocknung, wobei Ste-batec für die Elektroplanung, den Schalt-schrankbau, die Softwareprogrammierung, die Umbaumassnahme Vorort bis hin zur Inbetriebnahme verantwortlich war…Den ganzen Artikel lesen unter:
https://www.stebatec.ch/fileadmin/user_upload/News/Dokumente/PB_La_Verna_Zentrifuge_D.pdf
(nach oben)
aco-tiefbau: Oberflächennahe Entwässerung mit ACO DRAIN® Monoblock
Parkplatz am Westfälischen Landestheater
Genug Platz für ihre kreative Arbeit haben nun endlich die Ensembles des 1933 in Paderborn gegründeten Westfälischen Landestheaters am Europaplatz in Castrop-Rauxel. Auf einem insgesamt 4.400 Quadratmeter großen Grundstück direkt gegenüber des Theaters ist ein neues Proben- und Logistikzentrum entstanden. Es besteht aus zwei in schlichtem Design gehaltenen Gebäuden, die über ein Dach miteinander verbundenen sind. Das erste dient als 650 Quadratmeter großes Lager für Requisiten und Kulissen, im zweiten befinden sich auf 750 Quadratmetern Sozialräume, Räume für die Klassenzimmerproduktionen und Spielclubs sowie vier große Holzbühnen. Diese sind in identisch großen Räumen ohne Fenster untergebracht und ermöglichen Proben unter optimalen Bedingungen von vier unterschiedlichen Inszenierungen an einem zentralen Ort. Zeitgleich wurde auf dem angrenzenden Grundstück ein öffentlicher Parkplatz errichtet, der sowohl von Theaterbesuchern als auch den Sportlern und Zuschauern der Sportgemeinschaft Castrop-Rauxel genutzt wird.
Um gleichzeitig einen Beitrag zur zukunftsfähigen Regenwasserbewirtschaftung zu leisten und einen Ausgleich zu den versiegelten Parkplatzflächen zu schaffen, entschieden die Planer das anfallende Niederschlagswasser in einer langgestreckten Mulde abzuführen bzw. teilweise versickern zu lassen. Zur Umsetzung dieser Anforderungen bieten die bewährten ACO DRAIN® Linienentwässerungssysteme eine ideale Lösung, um das Oberflächenwasser sicher und gezielt dem Muldensystem ohne große Höhenverluste zu übergeben. Folglich wurden die Rinnenstränge nicht an die Grundleitung angeschlossen und mit einem offenen Auslauf geplant. Eine Ausspülung am Rinnenauslauf und in der Muldefläche wird durch kleine, gepflasterte Teilbereiche mit Natursteinen bzw. Muldensteine erreicht.
Für die am Westfälischen Landestheater entstandenen Parkplatzflächen wurde das Linienentwässerungssystem ACO DRAIN® Monoblock PD 200 V bzw. PD 100 V (gemäß DIN EN 1433/DIN 19580) gewählt, das sich durch eine Vielzahl an Vorteilen auszeichnet. Ausschlaggebend für den Einsatz dieses Rinnensystems ist die Widerstandsfähigkeit und Bauweise der Rinnenelemente. Da öffentliche Parkplätze vor großen Veranstaltungsstätten besonders hoch frequentierte Verkehrsflächen sind und häufig von Fahrzeugen überfahren werden, wurde entsprechend ein monolithisches, stark belastbares System gewählt.
Die Dimensionierung der Linienentwässerung wurde mit Hilfe der örtlichen Regenspende (R52 nach Kostra DWD 2010) und der Größe der zu entwässernden Fläche ermittelt. Die Nennweiten von 200 mm bzw. 100 mm und die Schlitzweite von 15 mm bzw. 8 mm garantieren eine schnelle und sichere Entwässerung. Die Forderung der Planer nach einem Entwässerungssystem ohne Rost wird durch die ACO DRAIN® Monoblock PD 200 erfüllt. Sie ist aufgrund ihrer monolithischen Bauweise prädestiniert für Bereiche mit hohen dynamischen Belastungen. Die aus einem Guss gefertigten Elemente, also Rinne und Abdeckung in einem, haben keine losen Teile oder Klebefugen. Durch die monolithische Konstruktion bleibt der Monoblock bei Belastungen in den Belastungsklassen bis D 400, nach DIN EN 1433 standfest.
Zu den Kennzeichen der Monoblock Rinnen gehört außerdem…
https://www.aco-tiefbau.de/service-askaco/train-information-und-weiterbildung/referenzen/referenz/acoreference/Reference/show/oberflaechennahe-entwaesserung-mit-aco-drainr-monoblock/
(nach oben)
An den Klimawandel angepasst
Regenwassermanagement und Gewässerschutz mit ACO Systemlösungen
Starkregenereignisse gehören wie auch länger anhaltende Trockenperioden mittlerweile zur Wetterlage unserer Breitengrade und sind Folgen des fortschreitenden Klimawandels. Können große Niederschlagsmengen im ländlichen Raum vom offenen Boden größtenteils aufgenommen werden und versickern, haben die versiegelten Flächen im urbanen Raum erhebliche Auswirkungen auf die Natur, Menschen, Infrastruktur und Gebäude. So sind beim Wohnungs- und Industriebau, Garten- und Landschaftsbau sowie Straßen- und Wegebau innovative Lösungen gefragt, die ein gesamtheitliches Regenwassermanagement bieten und den schonenden Umgang mit der Ressource Wasser favorisieren. Die Produktanforderungen an ein effektives Regenwassermanagement sind komplex: Regelwerke, Bauvorschriften und DIN-Normen müssen berücksichtigt werden. Es ist daher besonders wichtig, ganzheitliche Konzepte zu schaffen, in denen alle Interessen und Vorschriften einbezogen werden.
Herausforderungen der aktuellen Situation
Bei der Planung eines effektiven Regenwassermanagements ergeben sich zwei zentrale Herausforderungen:
Zum einen die zunehmende Urbanisierung, denn seit 2008 leben auf der Welt mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Dies hat hauptsächlich wirtschaftliche Gründe, doch auch das veränderte Klima verstärkt diesen Effekt.
Zum anderen der Klimawandel mit einer Häufung extremer Wetterverhältnisse, wie Trockenperioden und Starkregenereignisse. Durch diese ist die Kanalisation oft überlastet und es kommt zu Überflutungen
In Deutschland ist mehr als die Hälfte der bebauten Flächen versiegelt. So wird verhindert, dass Regenwasser direkt dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt werden kann. Deshalb müssen versiegelte Flächen reduziert und bei der Schaffung neuer Wohnräume auf eine Entsieglung geachtet werden. Besonders in innerstädtischen Bereichen eignen sich zur Entsiegelung Kiesstabilisierungen, Rasenwaben oder auch Gründächer. Denn auf Flachdachflächen können auch größere Mengen an Wasser zwischengespeichert werden und verdunsten.
Ein weiterer Ansatz liegt im technischen und konstruktiven Schutz gegen Überflutung in Gebäuden und in der Infrastruktur. Für private Hausbesitzer reichen oft schon kleine bauliche Veränderungen an Kellerabgängen, Kellerlichtschächten, Tiefgaragenzufahrten etc. aus, um den Keller vor Überschwemmung zu schützen. Von innen kann der Keller durch – möglichst automatische – Rückstauklappen und Hebeanlagen geschützt werden. Diese verhindern, dass bei Überlastung des Kanalsystems (Rückstau) das Wasser durch die Leitungen zurück ins Gebäude gedrückt wird. Wichtig hierbei ist, dass die Produkte regelmäßig gewartet werden.
Das größte Potenzial für ein angepasstes Regenwassermanagement in urbanen Bereichen liegt in der wassersensiblen Stadt- und Freiraumgestaltung. Bei Starkregen ist die Kanalisation oft überlastet, herkömmliche Entwässerungssysteme können die Wassermassen nicht mehr bewältigen. Die Alternative: Anfallendes Niederschlagswasser wird oberflächennah über z.B. ACO DRAIN® Entwässerungsrinnen gesammelt und auf abgesenkte Freiflächen geleitet, die geflutet werden können und so Rückhalte- und Retentionsräume („Zwischenpuffer“) schaffen. Derartige Freiflächen können gleichzeitig auch …mehr:
http://www.aco-tiefbau.de/aktuelles/angepasstes-regenwassermanagement-vor-dem-hintergrund-von-starkregenereignissen/
(nach oben)
FlowConcept: Erhöhung der Umweltsicherheit durch die Leistungssteigerung von Nachklärbecken
Die Anforderungen an die Ablaufqualität einer Kläranlage sind ständigen Verschärfungen unterworfen. Derzeit ist es ein erklärtes Ziel den Phosphoraustrag auf ein Minimum zu reduzieren, um Belastungen des aufnehmenden Gewässers zu verringern. Im Bundesland Hessen wurde hierzu bereits eine entsprechende Verordnung formuliert, die ab 2019 verbindlich ist. Sie sieht vor, dass für eine Kläranlage der Größenklasse 4 ein Überwachungswert für Pges von 0,7 mg/l und ein Monatsmittelwert von 0,5 mg/l einzuhalten ist. Um diese geforderten Grenzwerte einzuhalten, ist der Betreiber einer Kläranlage gefordert Maßnahmen zu ihrer Sicherstellung zu ergreifen und bis Ende 2018 umzusetzen. Eine geeignete Möglichkeit hierzu ist es, die Nachklärung strömungstechnisch zu optimieren. Im Rahmen einer solchen Nachklärbeckenoptimierung wurde das Einlaufbauwerk auf Basis von uns durchgeführter CFD-Berechnungen umgebaut. Das Ziel dabei war, die Systemverhältnisse zu stabilisieren und den TS-Austrag zu minimieren und auf diese Weise die Grenzwerte im Hinblick auf den Phosphorrückhalt einzuhalten. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen das Zulaufbauwerk in schematischer Weise wie es vor und nach der Optimierung Ende 2016 ausgeführt war. Während im Bestand das Wasser aus dem Mittelbauwerk relativ hoch und ungerichtet in den Absetzraum einströmte, wurde es in der Optimierung geführt und tiefer eingeleitet.
Mehr: http://www.flow-concept.de/start/aktuelles_nachklaerung.pdf
(nach oben)
FlowConcept: Planungssicherheit und Energieeffizienz durch die Bewertung von Belüftertypen und Belüfteranordnung mittels CFD
Wird in der Belebung das Belüftersystem erneuert, so stellt sich nicht nur die Frage, welcher Belüftertyp installiert werden soll, sondern ganz generell ist der Frage nach der besten verfahrenstechnischen Ausführung der Belebungsbecken im Hinblick auf eine hohe Leistungsfähigkeit in Zusammenspiel mit einem effizienten Energieeinsatz nachzugehen. Welche Ausführung des Beckens, aber auch welcher Belüftertyp am besten für den betreffenden Anwendungsfall geeignet ist, lässt sich durch CFD-Berechnungen bewerten. Durch CFD-Berechnungen (Strömungssimulationen) können dabei nicht nur die grundlegenden Strömungsverhältnisse im Becken betrachtet und z. B. Wechselwirkungen zwischen Belüftern und Rührwerken bewertet werden, sondern auch die Anordnung und die Art des Sauerstoffeintrags der Belüfter selbst kann gezielt untersucht und so verändert werden, dass ein möglichst maximaler Sauerstoffeintrag mit dem geringsten Aufwand erreicht wird. Letzteres ist gerade auch vor dem Hintergrund von Interesse, dass bei einer Ausschreibung unterschiedliche Belüftertypen angeboten werden, um die Eintrag und die Verteilung von Sauerstoff in der Belebung sicherzustellen. Durch Berechnung u. a. des Sauerstoffeintrags für die relevanten angebotenen Belüfterkonfigurationen und ihren Vergleich auf Basis von CFDSimulationen kann die am besten geeignete Belüfterauslegung ermittelt werden. Im Rahmen einer von uns durchgeführten Studie zur Bewertung des Sauerstoffeintrags unter Reinwasserbedingungen konnte in dem betreffenden Belebungsbecken gezeigt werden, dass die gewählte Belüfteranordnung zu einer gleichmäßigen Sauerstoffverteilung führt. So liegt zu dem ausgewerteten Zeitpunkt innerhalb der drei Kaskaden…mehr: Kontaktieren Sie uns, um noch mehr Details zu erfahren.
FlowConcept GmbH
Frau Privatdozentin Dr.-Ing. habil. Michaela Hunze
Warmbüchenstr. 15; 30159 Hannover
eMail: hunze@flow-concept.de
Telefon: 0511-533 553-13
Mobil: 0171-524 19 26
(nach oben)
Sulzer: Hochwasserpumpwerk von Sulzer schützt historische Bauwerke in Ansbach
Im Rahmen der Sanierung von verschiedenen Mischwassereinleitungen wurde nach rund acht Jahren Bauzeit in 2017 eine umfangreiche Baumassnahme im Kerngebiet von Ansbach vollendet. An der Fränkischen Rezat wurde über rund 600 Meter ein Stauraumkanal DN 2500 (Stauraumkanal Promenade) mit abschließendem Hochwasserpumpwerk (Hochwasserpumpwerk Inselwiese) gebaut.
Das Hochwasserpumpwerk liegt in unmittelbarer Nähe zu den historischen Bauwerken der Orangerie und des Schlosses. Das Projekt mit einem Bauvolumen von ca. EUR 6,6 Millionen ist eine gemeinsame Planung der Dr. Pecher AG (Erkrath) sowie der Dr.-Ing. Pecher und Partner Ingenieurgesellschaft mbH (München).
Neben einem deutlich verbesserten Entwässerungskomfort für die historische Altstadt Ansbachs wird mit der Inbetriebnahme des Stauraumkanals und des Hochwasserpumpwerks ein wesentlicher Beitrag zum Gewässerschutz geleistet.
Die Herausforderung
Um das mittelfränkische Ansbach zuverlässig vor Hochwasser und Überschwem-mungen zu schützen, muss das neue System aus Tauchmotorpumpen für die Abwasserentsorgung Ansbach AöR eine Gesamtförderleistung von 17 m³/s aufweisen.
Durch die unmittelbare Nähe zu der historischen Orangerie und dem Schloss war in Ansbach ein großes Bauwerk mit Hochbauteilen nicht möglich. Die Belange des Stadtbilds und des Denkmalschutzes waren zu beachten. Die Herausforderung bestand darin, den ausgewiesenen Platz bestmöglich auszunutzen und ein kom-paktes und betriebssicheres Hochwasserpumpwerk zu realisieren.
Um zuverlässig gegen ein hundertjähriges Hochwasser zu schützen, ist ein großer Betriebsbereich der Pumpen erforderlich. Auf dem Prüfstand wurden die Pumpen im Werk erfolgreich zwischen 2,40 und 10 Meter Förderhöhen getestet. Der Betrieb am Frequenzumrichter war dabei ausgeschlossen.
The Sulzer difference
Kostenneutrale, kundenspezifische Lösung durch die Ausnutzung des Modulsystems und die Möglichkeiten der Axialhydraulik.
Eine nachträgliche Anpassung bzw. Umrüstung der Propeller ist möglich.
Pumpenreihe mit einer hohen Förderleistung in Kombination mit einem hohen Gesamtwirkungsgrad
Mit Premium Efficiency IE3 -Motoren IEC 600034-30
Sichere und bewährte Stan¬dardprodukte verschaffen ein Höchstmaß an erreichbarer Sicherheit.
Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit in vorherigen Projekten, u.a. beim Hochwasserschutz von Polder Rheinschanzinsel in 2012, hat uns Sulzer auch in diesem Auftrag durch eine hervorragende Auftragsabwicklung begeistert.
Ralf Keller, Keller Industriemontagen GmbH, Durmersheim
Die Lösung
Die Pumpen der VUPX-Reihe von Sulzer wurden allen Anforderungen gerecht.
In beratender Zusammenarbeit mit dem Planer, Dr.-Ing. Pecher und Partner Ingenieurgesellschaft mbH aus München, kamen wir zu dem Entschluss, dass ange¬sichts der Vorgaben hinsichtlich Verwendungszweck, der gesamten Förderleistung von 17 m³/s und den stark unterschiedlichsten Förderhöhen, eine Aufteilung der Pumpengrößen erforderlich ist.
Es stellte sich heraus, dass eine Sulzer Axialhydraulik, bei der die Flügel des Propellers frei verstellbar sind und eine Antriebsversion mit Getriebe die Anforderungen bezüglich geringen elektrischen Strömen und großem hydraulischen Betriebsbereich perfekt abdecken.
Letztendlich wurden zwei vertikale Propellerpumpen Typ ABS VUPX0602 PE1100/6 PE6 Ex und vier VUPX1002 PE3500/4 G2,5 Ex mit 18,7° Winkeleinstellung selektiert.
Weitere charakteristische Merkmale der bereitgestellten Lösung sind ein komplettes System zur Zustandsüberwachung einschließlich PTC und PT100 Elementen zur Temperaturüberwachung und zweimaliger Feuchtigkeitskontrolle im Inneren der Pumpe, sowie Kabel mit elektromagnetischer Kompatibilität.
Kundenvorteile
Für den Endkunden:
Zuverlässiger Hochwasserschutz
Kompaktes und kostensparendes Bauwerk mit nass aufgestellten Pumpen
Unauffälliges Pumpwerk und Schalldämmung dank Nassaufstellung
Für die beratenden Ingenieure / Baufirmen:
Dank technischer Fachkompetenz von Sulzer konnten in der Ausschreibungs phase komplexe Mehrfachangebote an eine Reihe von Firmen gemacht werden.
Die Pumpen von Sulzer erreichen unter Berücksichtigung der maximalen Motornennleistung alle Betriebspunkte, was auf die entsprechende Ausrüstung der Hauptmitbewerber nicht zutrifft.
Sulzer konnte die Projektvorgaben mehr oder weniger widerspruchslos erfüllen.
Feedback seitens verschiedener Ausrüsterfirmen im Lauf der Ausschreibungen beweist, dass die VUP-Pumpen von Sulzer die Lösung mit dem besten Marktpreis für diesen Zweck waren.
Produktdaten
Der Auftrag umfasst zwei VUPX0602 PE1100/6 PE6 Ex sowie vier VUPX1002 PE3500/4 G2,5 Ex mit Getriebe und 350 kW Motornennleistung. Die Installation der Pumpen in Nassaufstellung erfolgt in Stahlsteigrohren DN 800/1000 und DN 1200. Zusätzlich sind in dem Pumpwerk noch zwei Pumpen der Baureihe XFP, ebenfalls mit Premium-Effizienz Motor und zwei weitere Pumpen der Baureihe MF installiert. Ein Sulzer Rührwerk befindet sich im Ansaugbereich der Restentleerungspumpen.
Die zwei Pumpen mit 110 kW decken jeweils einen Förderstrom von 1 100 l/s ab, weitere 3 700 l/s fördern jeweils die vier großen Pumpen.
www.sulzer.com
https://www.sulzer.com/germany/-/media/files/applications/water-wastewater/water-case-studies/hochwasserpumpwerkschtzthistorischebauwerke_de_a10239_11_2017_web.ashx
(nach oben)
ESSDE: Deammonifikation für eine zentrale Biogas- und Klärschlamm-Anlage in Finnland
Durchgängig stabiler Betrieb seit 2012 trotz anspruchsvoller und stark schwankender Zulaufverhältnisse.
Die Anlage verarbeitet Reste von Grünabfällen und Lebensmitteln sowie kommunale Klärschlämme in einer mesophilen Faulung mit einer Aufenthaltszeit von rund 40 Tagen. Durch die hohe organische Fracht ist die Belastung des Prozesswassers mit Stickstoff sehr hoch und die typischen NH4-N-Konzentrationen liegen
bei 2000 bis 2500mg/l NH4-N.
Da die Anlage das behandelte Abwasser einer kleinen Kläranlage mit nur sehr begrenzter Leistungsfähigkeit zuleitet, bestand die Notwendigkeit einer intensiven Vorbehandlung. Hierzu wurde zunächst eine konventionelle Nitrifikation/ Denitrifikation mit Dosierung einer externen Kohlenstoffquelle (Methanol) betrieben.
Wegen der hohen N-Konzentrationen mussten entsprechend grosse Mengen Methanol (Denitrifikation) dosiert werden, was zur wiederholten Überhitzung (Wärmeentwicklung aufgrund der intensiven biologischen Prozesse) und zum Kollabieren der biologischen Stufe führte. Das konventionelle biologische System (Nitrifikation/Denitrifikation) konnte somit nicht regulär betrieben werden.
Im Jahr 2012 wurde die Anlage auf Deammonifikation (System EssDe®) umgerüstet. Dabei wird der Stickstoff nur teilweise und auch nur bis zum Nitrit oxydiert. Externer Kohlenstoff wird bei der Deammonifikation nicht benötigt. Die Deammonifikation setzt kaum Wärme frei. Zudem ist der Energieverbrauch massiv reduziert. Die Betriebskosten konnten massiv gesenkt werden (die Hälfte der Belüftungsenergie wird eingespart und auf Methanol kann gänzlich verzichtet werden).
Die Anlage erreicht seit der Umrüstung exzellente Ablaufergebnisse mit ca. 95% Ammoniumelimination und über 85% Gesamtstickstoffabbau. Der Betrieb ist von Beginn an stabil und wird von der Anlage im normalen Schichtbetrieb betreut. Mehr:
https://www.essde.com/de/news?2550
(nach oben)
Stebatec: Abflussmessungen für gerechten Kostenverteiler
Ein Walliser Zweckverband aus zwölf Gemeinden suchte wegen des hohen Fremdwasseranteils in seiner ARA nach einem gerechten Kostenverteiler. Das nun installierte Messkonzept erhebt die einzelnen Abflussmengen und belohnt damit jene Gemeinden, die bereits ein Trennsystem realisiert haben. Die auf dem Gemeindegebiet von Leuk im Walliser Haupttal gelegene ARA Radet klärt die Abwässer von rund 18 000 angeschlossenen Ein wohner – gleichwerten aus einem weitverzweigten Einzugsgebiet. Insgesamt zwölf sehr unterschiedlich gelegene und verschieden grosse Gemeinden leiten ihre Abwässer zu der 1994 in Betrieb genommenen ARA Radet. «Gemäss den Statuten des Zweckverbands verteilten wir die anfallenden Kosten zu einem Drittel anhand des Bauvolumen – anteils und zu zwei Dritteln nach den Einwohnergleichwerten auf die einzelnen Gemeinden», erläutert Klärwerkmeister Reinhard Bregy die bisherige Regelung. «Zwar erstellten wir schon zu Beginn Messschächte an den Gemeindegrenzen in unserem Zulaufsystem, doch waren uns die Der Steuerschrank des Regenbeckens Erschmatt (Gemeinde Leuk) liegt an aussichtsreicher Lage hoch über dem Haupttal. Messgeräte vor zwanzig Jahren zu wenig genau, sodass wir bis auf wenige Ausnahmen auf die eigentlich vorgesehenen Messungen verzichteten. Wirtschaftliche Lösung gesucht Einige der angeschlossenen Gemeinden haben seither jedoch ein Trennsystem eingerichtet und fühlten sich nun angesichts des sehr hohen Fremdwasseranteils von 60 bis 65 Prozent aus Brunnen, Drainagen, Oberflächenwasser oder Bewässerungen mit dem herrschenden Abrechnungssystem ungerecht behandelt. Der Zweckverband musste daher nach einer Lösung suchen, um den Betriebskostenverteiler gerechter zu gestalten. Die wenigen, vorhandenen Messwerte genügten nicht, um präzise Aussagen zu machen, da die möglichen Fehler aufgrund der wenigen Messstellen kumuliert bis zu 35 Prozent betragen hätten. «Bei unserer Suche nach möglichen Partnern für die Ausarbeitung eines Messkonzepts und den Einbau der nötigen Messstationen stiessen wir auf die STEBATEC, deren Messsysteme uns beeindruckten», fährt Reinhard Bregy fort. Die Brügger machten sich darauf daran, im vorhandenen Zulaufsystem die notwendigen Messstationen so zu definieren, dass sich mit einem minimalen Mitteleinsatz ein möglichst gerechter Verteiler erzielen liess. «Es ging nicht darum, eine maximale Präzision zu erzielen, sondern es handelte sich klar um eine Optimierungsaufgabe im Rahmen des wirtschaftlich Vernünftigen », erzählt der für das Projekt zuständige Heinrich Hesse. Die einzelnen Messstationen erlauben es alle, mit einem – auf den Mess wert bezogenen – maximalen Fehler von einem Prozent den Durchfluss zu messen, doch hätte eine derart hohe Genauigkeit eine viel zu grosse Zahl an zusätzlichen Messstationen bedingt. Optimiertes Messkonzept Dem Zweckverband wurde daher ein Vorschlag für ein Messkonzept unterbreitet, das mit insgesamt zwölf neu zu erstellenden Messstationen…mehr:
https://stebatec.ch/uploads/media/Projektbericht_ARA_Radet_DE_06.pdf
(nach oben)
BARTHAUER: Neue Generation des ISYBAU-Standards veröffentlicht: Das Austauschformat XML-2017 bietet erstmalig Transfer von Text- und Symbolplatzierungen
Bei der Digitalisierung ist ein einheitliches und standardisiertes Datenaustauschformat Voraussetzung, um umfassende Informationen vollständig zu übergeben. Für die detaillierte Bestands- und Zustandserfassung von abwassertechnischen Anlagen in Liegenschaften des Bundes sind viele Ingenieurbüros und Inspektionsfirmen im Einsatz. Damit alle Projektbeteiligten dieselbe Sprache sprechen, wurde das ISYBAU-Austauschformat Abwasser (XML) geschaffen und es wird bis heute stetig weiterentwickelt. Mit der Fortschreibung der Arbeitshilfen Abwasser im Juni 2018 wurde ein weiterer Meilenstein bei der Entwicklung des bewährten Standards zum verlustfreien Datenaustausch erreicht. Die passende Schnittstelle ist bereits jetzt in das Netzinformationssystem BaSYS als Standard-Anwendung integriert.
Die Planung, die Verwaltung, der Betrieb und die Erhaltung von Abwasseranlagen stellte vor über 25 Jahren die staatlichen Bauämter der Bundesrepublik Deutschland vor enorme Herausforderungen. Die verwaltenden Dienststellen haben den Zustand der abwassertechnischen Anlagen in festgelegten Inspektionsintervallen zu dokumentieren, die Anlagen entsprechend dem Stand der Technik zu unterhalten und im Bedarfsfall Sanierungsmaßnahmen zu veranlassen. Dazu arbeiten sie mit vielen Dienstleistern wie Ingenieurbüros und Inspektionsfirmen, sowie der Bauindustrie zusammen. Permanent müssen Daten transferiert werden. Vor 1991 existiert eine Vielzahl von unterschiedlichen Datenformaten, insbesondere im Kanalzustandsbereich. Redundanzen in der Datenhaltung erschwerten die Arbeit und verminderten die Wirtschaftlichkeit. Doch dann wurde das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für den DV-orientierten, einheitlichen und konsistenten Austausch aller abwassertechnischen Informationen entwickelt. Dabei steht der Begriff ISYBAU für das „Integrierte DV-System-Bauwesen“.
Bis heute wird dieses Standardformat fortgeführt, um zusätzliche Datenstrukturen erweitert und gemäß der sich wandelnden Voraussetzungen verbessert. Die neueste Version, XML-2017, erfüllt alle erhöhten fachlichen und gesetzlichen Anforderungen zur effizienten Erfassung, der einheitlichen Bestandsdokumentation und zum reibungslosen Austausch der Daten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Das ISYBAU-Austauschformat Abwasser wurde seit der ersten Generation der Netzinformationssysteme aus dem Hause BARTHAUER bis heute unterstützt. Ab sofort ist auch die neueste Formatanpassung in der aktuellen Software, BaSYS Version 9.1, als Standard-Schnittstelle integriert.
Die wichtigste Neuerung stellt das Präsentationsdatenkollektiv dar. Bisher konnten ausschließlich Fachdaten wie zum Beispiel Stamm-, Zustands- und Hydraulikdaten in Kollektiven übergeben werden. Die manuell gesetzten Text- und Symbolplatzierungen in Layoutplänen wurden bisher nicht berücksichtigt. Das hat sich geändert: Von jetzt an können mit BaSYS alle Positionen von Texten und Symbolen in der XML-Datei in einem eigenen Kollektiv, dem Präsentationsdatenkollektiv, zusammen mit den Fachdaten übergeben werden.
Das Konzept des Liegenschaftsbezugs wurde mit der neuesten Version des ISYBAU-Formats ebenfalls aufgebrochen. Bisher existierte nur die Liegenschaft als einzige räumlich-inhaltliche Einordnung der abwassertechnischen Anlagen. Es gab keine Möglichkeit, die tatsächlichen Zuständigkeiten, beziehungsweise Eigentumsverhältnisse, abzubilden. Mit der Definition von zusätzlichen Ordnungseinheiten, wie der Wirtschaftseinheit, können jetzt die Zugehörigkeiten detaillierter erfasst werden. Außerdem lassen sich die Eigentumsverhältnisse abbilden.
Auch konnten bisher in den Stammdaten Änderungen von Attributen, wie Querschnittsveränderung oder Materialwechsel, innerhalb eines Kantenobjektes nicht beschrieben werden. Durch die Einführung von Segmenten in der neuen Version wird die Dokumentation von Attributänderungen innerhalb von Kanten und damit auch dieser Datenaustausch zwischen Auftraggeber und -nehmer ermöglicht. In BaSYS können diese Informationen entweder grafisch erfasst oder über die Inspektionsdaten von Leitungen automatisch generiert und verwaltet werden.
Durch bundesweit einheitliche und standardisierte Austauschformate wird die Einhaltung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gewährleistet. Doch auch praxisbewährte Standards müssen sich neuen Herausforderungen stellen und fortwährend angepasst werden. Mit der Erfahrung aus langjähriger und aktiver Entwicklungsarbeit von Standards setzt BARTHAUER Zeichen für die Innovationen in der Leitungsdokumentation. Wie das ISYBAU Austauschformat Abwasser XML-2017 in BaSYS effizient genutzt wird, zeigt BARTHAUER in einstündigen Webinaren.
https://www.barthauer.de/presse/pressemeldungen/pressemitteilungen-detail/artikel/detail/News/neue-generation-des-isybau-standards-veroeffentlicht-das-austauschformat-xml-2017-bietet-erstmalig.html
(nach oben)
Grundfos: Zur Überwachung von Dosierpumpen in Kombination mit Grundfos Chemicals App
Falschanschlüsse von Gebinden an eine Dosierpumpe können im harmlosesten Fall nur eine Qualitätseinbuße des Prozesses nach sich ziehen. Im schlimmsten Fall können jedoch gesundheitliche Gefahren entstehen, wenn z.B. die Gebinde von Säure und Chlorbleichlauge verwechselt werden. Ebenso wäre es ein großer Mehrwert, den aktuellen Füllstand der Gebinde online überwachen und die Nachlieferung in Abhängigkeit der Beschaffungszeit abstimmen zu können.
Aus diesem Kundenwunsch entstand die Grundfos Chemicals App für OEM, Anlagebauer oder Chemielieferanten, die als Zusatz zur Grundfos Sysmon Onlineüberwachung von Smart Digital Dosierpumpen dient.
Sehr informativ dank Buskommunikation
Durch den Grundfos eigenen RS-485 Kommunikationsbus (GeniBus), können Pumpen der Baureihe Smart Digital DDA eine Vielzahl an nützlichen Informationen weiterleiten, bzw. auch Befehle empfangen. Um ein Produkt an eine Cloud anzubinden, ist eine einzigartige Seriennummer des Produktes für eine eindeutige Identifikation unabdingbar. Grundfos DDA-FCM Dosierpumpen können neben Ihrer eindeutigen Seriennummer auch weitere produktspezifische Informationen über den Bus senden, wie z.B. die Produktbezeichnung, Bestellnummern von Wartungskits oder Zeitintervall bis zur nächsten Wartung. Neben den produktspezifischen Informationen sendet die Pumpe auch aktuelle Betriebsparameter.
Grundfos Sysmon Cloudgate – Daten sicher in die Cloud
Über den Grundfos eigenen Kommunikationsbus können bis zu 15 Dosierpumpen in Reihenverdrahtung an ein Grundfos Sysmon Cloudgate angebunden werden, welches die bidirektionale Datenkommunikation per Mobilfunk oder Ethernet zwischen den Pumpen und der Cloudplattform ermöglicht. Kommt es kurzzeitig zu einer Kommunikationsunterbrechung, speichert das Cloudgate die Daten mehrere Tage zwischen, um diese bei Wiederherstellung der Verbindung nachträglich mit Zeitstempel nachzusenden.
Selbstverständlich werden die Daten Ende zu Ende verschlüsselt, damit diese auf dem gesamten Transportweg nicht abgefangen oder verändert werden können.
Die zugehörige Grundfos Sysmon Cloudplattform ist eine bereits vorgefertigte Online Überwachungs- und Steuerplattform, die in Sekundenschnelle an Kundenbedürfnisse angepasst werden kann. Damit sie über den gesamten Vertriebskanal genutzt werden kann, verfügt sie zudem über die wichtigen Funktionen Subdomain-Aufbau und Branding Creator Funktion.
Die Grundfos Chemicals App für das optimale Chemikalienhandling
Die Sysmon Chemicals App kommuniziert mit der dazugehörigen Dosierstation und verfügt über folgende Hauptmerkmale:
– Verhinderung von Fehlanschlüssen
– Online-Überwachung der Gebinde ohne teure Sensorik
– Benachrichtigung bei niedrigem Füllstand
– Gebindedatenbank
Die App unterteilt sich in 3 verschiedenen Menüs, von denen die ersten beiden durch einen Administrator benutzt werden können:
• Datenbank: in der Gebindedatenbank kann der Administrator alle relevanten Gebinde mit Name, Bild, Gebindegröße, Links zu Sicherheitsdatenblättern und dem QR- oder Barcode erfassen.
• Verheiraten: der Administrator scannt mit der Kanister App den QR Code der Dosierpumpe und anschließend den Barcode des Gebindes. Natürlich lassen sich auch unterschiedliche Gebindegrößen einer Chemikalie mit der Dosierpumpe verheiraten.
• Austausch: steht ein Gebindewechsel an, so scannt der Benutzer den QR- oder Barcode an der Dosierpumpe und anschließend den des Gebindes. Sind die Pumpe und das Gebinde in der Gebindedatenbank verheiratet, so gibt die Sysmon Cloud die Dosierpumpe frei. Anderenfalls zeigt die App dem Benutzer das korrekte Gebinde an und lässt den letzten Schritt wiederholen.
Die Vorteile der Grundfos Chemicals App auf einen Blick:
• Fertig vorkonfigurierte Cloudplattform im eigenen Design
• Steigerung der Prozesssicherheit
• Erhöhung der Sicherheit durch Vermeidung von Fehlanschlüssen
• Unkomplizierter Mehrbenutzermodus dank Online-Gebinde- datenbank
• Optimale Nachlieferung durch Online-Überwachung der Gebindefüllstände
• Unkompliziertes Verheiraten von Dosierpumpe und Gebinde
• Anpassen des Layouts an das eigene Branding
https://de.grundfos.com/about-us/news-and-press/news/grundfos-sysmon-cloudplattform.html
(nach oben)
STEBATEC: 14 Messstellen erbringen Abrechnungs-Gerechtigkeit
Die zwölf an der ARA Radet in Leuk (Kanton Wallis) angeschlossenen Gemeinden haben von der STEBATEC AG neue Messstellen in ihrem Kanalisationsnetz installieren lassen. Diese erheben laufend die Abflussmengen der einzelnen Gemeinden und sorgen für eine gerechte Verteilung der Betriebskosten.
Zum Projektbericht >>>https://stebatec.ch/uploads/media/Projektbericht_ARA_Radet_DE_06.pdf
(nach oben)
Bitcontrol: Kommunalrichtlinie
Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld
Die Kommunalrichtlinie ist seit 01.01.2019 in Kraft. Antragsberechtigt sind Kommunen, Kommunale Zusammenschlüsse, Betriebe mit kommunaler Beteiligung und Wasserwirtschaftsverbände. Im Abwasserbereich gibt es eine Reihe investiver und strategischer Förderschwerpunkte.
Energiemanagementsysteme
Hier wird die Implementierung eines Energiemanagementsystems – für Liegenschaften, Gebäude und auch für Kläranlagen gefördert. Über dieses Fördermodul kann auch die Software PROVI ENERGY – Online Energieanalyse nach DWA-A 216 gefördert werden.
Förderquote 40 / 65%
Zuwendung: max. 5.000 € für Software, zzgl. Installation, Schulung, Wartung
Bewilligungszeitraum: 36 Monate
Klärschlammverwertung im Verbund
Das ist interessant bei der vorherrschenden Anlagenstruktur vieler Verbandsgemeinden und Abwasserverbände. Kriterium ist hier: Der Abstand der Anlagen zur Zentrale darf max. 50 km betragen.
Förderquote 30 / 40%
Zuwendung: 10 – 200.000 €
Bewilligungszeitraum: 48 Monate
Aufbau eines kommunalen Ressourceneffizienznetzwerkes
zum dauerhaften Erfahrungsaustausch
Förderquote Phase 1 bzw. 2: 100 % bzw. 60%
Zuwendung: 1000 bzw. 10 – 200.000 € / TN
Erneuerung der Belüftung
Hierzu zählen zum Beispiel: Maßnahmen zur Senkung des Druckluftbedarfs im Belebungsbecken, Umbau hocheffizienter Kompressoren, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Förderquote 30 / 40%
Zuwendung: 5 – 200.000 €
Bewilligungszeitraum: 24 Monate
Erneuerung von Pumpen und Motoren
Hierzu zählen zum Beispiel: energieeffiziente oder drehzahlgeregelte Motoren (IE4, IE3), energieeffiziente Pumpen (EEI < 0,23)
Förderquote 30 / 40%
Zuwendung: 5 – 200.000 €
Bewilligungszeitraum: 24 Monate
Neubau einer Vorklärung und Umstellung auf Faulung
Gefördert wird hier die Umstellung von aerober zu anaerober Klärschlammbehandlung zur Gewinnung von Methan. Es darf keine Faulung vorhanden sein und das Methan muss in KWK-Anlagen genutzt oder in ein Netz eingespeist werden.
Förderquote 30 / 40%
Zuwendung: 5 – 500.000 €
Bewilligungszeitraum: 48 Monate
Anwendung innovativer, neuer Verfahren der Abwasserreinigung
Z.B. Verfahren zur Stickstoffelimination im Schlammwasser vor der Rückführung in die biologische Abwasserreinigung oder Verfahrenskombinationen zur Energieeinsparung im Belebungsbecken.
Förderquote 30 / 40%
Zuwendung: 5 – 200.000 €
Bewilligungszeitraum: 36 Monate
Potenzialstudie
Ziel der Studie ist die Deckung des Eigenbedarfs an Strom und Wärme von 70 % und ein jährlicher Energiebedarf von max. 23 kWh / EW*a. Die Potenzialstudie ist Voraussetzung für einige der vorgenannten Maßnahmen und kann relativ einfach beantragt werden. Alternative hierzu ist eine max. 2 Jahre alte Studie nach DWA-A 216.
Förderquote 50 / 70%
Zuwendung: 10.000 €
Bewilligungszeitraum: 12 Monate
Quellen:
Kommunalrichtlinie, Vortrag skkk vom 14.01.2019, Energieagentur RLP
Weitere Informationen
Kommunalrichtlinie (pdf)
Anträge auf https://klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
Förderlotse auf https://www.klimaschutz.de/foerderlotse
http://www.bitcontrol.info/217-klimaschschutz-förderung.html
(nach oben)
Bitcontrol: Neue Funktionen: Maschinenliste, Messstellenliste und Fließschema
Die Bemessungssoftware AQUA DESIGNER ist seit 20 Jahren auf dem Markt und eines der wenigen Kläranlagenbemessungswerkzeuge, das kontinuierlich an die aktuellen DWA-Richtlinien angepasst wurde. Nachdem schon 2016 eine Version mit der neuen DWA-A 131 von Juni 2016 verfügbar war, die auch in die SBR-Bemessung integriert ist, wurde im Frühjahr auch die DWA-M 229-1 von September 2017 nachgezogen. Zum Ende des Jahres 2018 konnten wertvolle weitere Engineering Werkzeuge fertig gestellt werden.
AQUA DESIGNER bietet die Möglichkeit, Maschinendaten aus integrierten Datenbanken direkt in den Bemessungsprozess zu integrieren. Mit diesen Informationen wird nun automatisch eine Maschinenliste generiert. Sandfang, biologische Stufe und Schlammbehandlung können in AQUA DESIGNER bemessen werden. Weitere periphere Verfahrensstufen können über ein Menü hinzugefügt werden. Daraus wird eine umfangreiche Maschinen- und Messstellenliste mit einem AKZ-System generiert. Auf Basis der Maschinenliste wird dann auch ein Fließschema, passend zum Rechenweg und der gewählten Anzahl von Stufen und Straßen mit den gewählten Maschinen erzeugt.
Neben den schon enthaltenen Werkzeugen wie Betriebskostenermittlung, maßstäbliche Zeichnungen, Sauerstoffertragswert, Massenermittlung, Auftriebsberechnung etc., stehen damit weitere wertvolle Werkzeuge für die Projektbearbeitung zur Verfügung.
AQUA DESIGNER 8.3 steht ab sofort zur Verfügung und kann als Demo heruntergeladen werden.
http://www.bitcontrol.info/211-aqua-designer-8-3.html
(nach oben)
DOW steigert mit AERZEN: Gebläsen und smarter Verbundsteuerung die Energieeffizienz der Kläranlage
DOW steigert mit AERZEN Gebläsen und smarter Verbundsteuerung die Energieeffizienz der Kläranlage.
DOW produziert im niedersächsischen Bomlitz chemische Grundstoffe auf Cellulosebasis. Die vom amerikanischen Chemiekonzern betriebene Gemeinschaftskläranlage ist entsprechend auf die Reinigung der in der Produktion entstehenden Chemieabwässer ausgerichtet. Eine Modernisierung der Biologie hat DOW jetzt dazu genutzt, bei der Gebläsetechnik einen intelligenten, vollautomatischen Verbund aus Strömungs- und Verdrängermaschinen von AERZEN einzusetzen.
AERsmart von AERZEN hat die Aufgabe, die von der Belebung geforderte Luftmenge energetisch optimal auf die installierten Gebläse in der Kläranlage in Bomlitz zu verteilen. Die Kläranlage liegt etwa 1,5 Kilometer vom DOW-Chemiewerk entfernt.
Cellulose ist ein wichtiger „Konstruktionswerkstoff“ der Natur und stabilisiert Pflanzen und Bäume. Sie ist der Hauptbestandteil von pflanzlichen Zellwänden und wird aus Holz oder Baumwolle gewonnen. Die Grundeigenschaften der Cellulose macht sich DOW im Industriepark Walsrode (Heidekreis) zu Nutzen und stellt Derivate her, die je nach Zusammensetzung und Verarbeitung verschiedenste Eigenschaften entwickeln können. Einige gelieren bei hohen oder niedrigen Temperaturen, andere bilden Filme oder kleben, einige machen Flüssigkeiten unterschiedlich zähflüssig. Diese Derivate sind aufgrund ihrer wasserbindenden, verdickenden und klebenden Eigenschaften begehrt für eine Vielzahl an Produkten. In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie ersetzen sie beispielsweise Gluten in Backwaren, tragen dazu bei, den Fettgehalt in Lebensmitteln zu senken und ermöglichen in Medikamenten die zeitverzögerte Abgabe von Wirkstoffen. Im Bausektor sorgt Methylcellulose für die richtigen Eigenschaften in Fliesenklebern, Wandputzen oder Mörtel.
Gemeinschaftskläranlage für Chemie und Kommune
Die während der Produktion anfallenden Abwässer werden in der etwa 1,5 Kilometer vom Werk entfernten Kläranlage gereinigt. DOW betreibt die 350.000-EWG-Anlage als Gemeinschaftskläranlage – nimmt damit also auch die kommunalen Abwässer der Stadt Bomlitz samt umliegender Ortschaften auf.
Im Zuge kontinuierlicher Modernisierungen tauschte der Betrieb 2017 drei magnetgelagerte Turbogebläse aus, die mehr und mehr Servicekosten verursachten. Heute versorgt ein Verbund aus zwei AERZEN Turbogebläsen mit Luftlagerung sowie ein Delta Hybrid-Aggregat die Belebungsbecken der Biologie. Die beiden Turbogebläse vom Typ AT200 liefern mit einer Motornennleistung von jeweils 150 kW ein Ansaugvolumen von 5.340 m³/h bei einer maximalen Druckdifferenz von 1 bar. Beide Aggregate decken in der Gemeinschaftskläranlage die Grundlast ab und fahren nach Auskunft des stellvertretenden Betriebsmeisters Sebastian Göritz mit einem durchschnittlichen Differenzdruck von 0,8 bis 0,9 bar. Beide Turbos werden über einen integrierten Frequenzumrichter betrieben, sodass der geförderte Volumenstrom mit einem Regelbereich von 40 bis 100 Prozent dem Lastbetrieb entsprechend angepasst werden kann.
Bei sinkendem Sauerstoffbedarf werden die beiden Grundlastmaschinen schrittweise abgeschaltet, da der Wirkungsgrad von Turbos mit niedrigen Drehzahlen stark abnimmt. „In diesem Fall übernimmt der Delta Hybrid die Luftversorgung“, sagt Sebastian Göritz. Im Gegensatz zum Strömungsprinzip bei den Turbos sei der Drehkolbenverdichter durch sein Verdrängungsprinzip im Teillastbetrieb und durch seinen hohen Regelbereich von 25 bis 100 Prozent im niedrigen Volumenstrombedarf entsprechend effizienter. Der installierte Delta Hybrid des Typs D98S fördert einen maximalen Volumenstrom von 5.800 m³/h bei 200 kW Motornennleistung.
Das Beste aus zwei Welten im Hybrid
Die Verbundsteuerung AERsmart steuert den Verbund der drei Gebläse autark. Die abgesetzte Terminallösung verfügt über eine eigene Visualisierung mit Touch-Pad.
AERZEN verbindet beim Delta Hybrid die Arbeitsprinzipien von Drehkolbengebläsen und Schraubenverdichtern zu einer energieeffizienten Lösung. Die Maschine nutzt in niedrigen Druckbereichen das Roots-Prinzip der Volldruckverdichtung und in höheren Druckbereichen das Schraubenverdichter-Prinzip mit innerer Verdichtung. Im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren senkt dieser Zweiklang den Energieverbrauch um rund 15 Prozent.
Die Gemeinschaftskläranlage in Bomlitz geht allerdings noch einen großen Schritt weiter in puncto Energieeffizienz – und kombiniert Turbogebläse und Drehkolbenverdichter zu einem Gesamtsystem, das sich dank der AERZEN Verbundsteuerung AERsmart eigenständig optimiert. „Das ist schon eine innovative Sache“, meint Sebastian Göritz. AERsmart ist dafür konzipiert, die von der Leitwarte angeforderte Luftmenge optimal auf die angeschlossenen Aggregate zu verteilen. Diese Verteilung erfolgt anhand der vorhandenen Technologien und den damit verbundenen Kennlinien und Wirkungsgraden. „Die Steuerung entscheidet, welche Maschinen aus dem Pool mit welchen Leistungsdaten zur Erreichung der besten Gesamteffizienz betrieben werden“, meint der Abwassermeister bei DOW. AERsmart geht damit weit über eine Kaskadierung mit Drehzahlsteuerung hinaus und fährt den installierten Maschinenpark immer am energetischen Gesamtoptimum. Ausgestattet ist die AERsmart-Regelung als abgesetztes Terminal mit einer Visualisierung auf einem Touch-Display. Das Betriebspersonal sieht vor Ort sofort den herrschenden Betriebszustand und kann.
Ausblick
Springt ein bei Schwachlasten: Der Delta Hybrid zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz auch im Teillastbetrieb aus.
Mit Blick auf die neuen Möglichkeiten, die die Industrie 4.0 der Abwasserreinigung an Effizienzverbesserungen bietet, will DOW in Bomlitz in Zukunft die Teilströme kontinuierlicher überwachen. Gerade die Onlineanalytik biete sehr gutes Entwicklungspotenzial. „Bei den Kohlenstofflieferanten müssen wir dort die Messungen durchführen, wo der Kohlenstoff anfällt und nicht erst in der Kläranlage. Wir sind so in der Lage zu agieren, statt nur zu reagieren“, macht Sebastian Göritz deutlich. Die Anbindung der AERsmart-Steuerung an die Leitebene ist in diesem Zusammenhang genauso der richtige Weg wie die Steuerung von Frachtmengen auf Basis von Ist-Werten.
https://www.aerzen.com/de/aktuelles/kundenzeitung/2018/ausgabe-012018/article/turbo-hybrid-symbiose-hier-stimmt-die-chemie.html
(nach oben)
MECANA: OPTIMIERUNG VON KLÄRANLAGEN
DURCH TUCHFILTRATION
Mit zunehmender allgemeiner Leistung von Kläranlagen wird die Ablaufqualität in immer stärkerem Masse durch die an suspendierte Feststoffe gebundenen Schmutzanteile (BSB5, CSB, N, P usw.) bestimmt, so dass eine möglichst effektive Feststoffent¬nahme die Grundvoraussetzung für jegliche Form der weitergehenden Abwasserreinigung ist. Neue CO2 Ziele und steigende Energiepreise erhöhen das Investitionspotential für energieeffiziente Verfahren.
TUCHFILTRATION MIT POLSTOFFEN
Mecana Polstofffilter werden heutzutage in fast allen Fällen eingesetzt, in denen Feststoffe aus dem Wasser entfernt wer-den müssen.
Die bei diesem patentierten Verfahren eingesetzten Polstoffe sind in ihrer Struktur einem Pelz vergleichbar. Die während der Filtrationsphase flach liegenden Polfasern bilden eine dichte und sehr abscheidewirksame Faserschicht. Beim Absaugvorgang werden die Fasern innerhalb der Absaugeinrichtung kurzzeitig aufgestellt, so dass die zurückgehaltenen Feststoffe leicht ausgetragen werden können.
VORTEILE DER TUCHFILTRATION
• hohe Feststoffbelastung möglich
• keine Hebung des Abwassers erforderlich
• kein Spülwasserspeicher erforderlich
• geringer Grundflächenbedarf
• kontinuierliche Betriebsweise
• unempfindlich gegen Stossbelastungen
• kein Ausfall bei Überlastung
• hohe Betriebssicherheit
• geringer Spülabwasseranfall
• auch in aggressiven Medien beständige Filtertücher
• einfacher Tuchwechsel
• keine chemischen Reinigungsmittel erforderlich
• geringer Wartungsbedarf
• geringe Betriebskosten
• einfache Montage
ELIMINATION VON SPURENSTOFFEN
Die Polstofftechnologie bietet auch die Möglichkeit, sehr feine Fasern einzusetzen und entsprechend hohe Abscheideleis-tungen zu erzielen. Dies ist z.B. erforderlich für die Filtration von Pulveraktivkohle (PAK). Die Tuchfiltration kann mit einer PAK-Adsorptionsstufe kombiniert werden. Mehr:
http://www.mecana.ch/images/sampledata/PDF/Downloads/Tuchfilter/DE/Optimierung-von-Klranlagen-0517A.pdf
(nach oben)
FUNKE: Sedimentationsschacht macht das Niederschlagswasser sauber
In Niederschlagswasserabflüssen von Verkehrs- und Dachflächen sind je nach Standort und anderen Randbedingungen Sink-, Schweb- und Schwimmstoffe enthalten. Mit dem Funke Sedimentationsschacht lässt sich ein Großteil der sogenannten abfiltrierbaren Stoffe (AFS) zurückhalten.
Der Funke Sedimentationsschacht wird aus einem Funke Profilrohr DN 1000 monolithisch gefertigt. Zu den wesentlichen Bauteilen zählen der tangentiale Zulauf, eine senkrecht im Schachtkörper integrierte Spirallamelle, ein Strömungstrenner sowie eine Tauchwand, die vor dem Auslauf angebracht ist. Das Bauwerk hat inklusive der Abdeckplatte eine Gesamthöhe von ca. 3,20 m. Der Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf beträgt ca. 0,8 m, die Ablauftiefe liegt bei ca. 1,50 m. Der Funke Sedimentationsschacht ist für eine Anschlussfläche von bis zu 3.000 m2 geeignet. Bei einer solchen Fläche beträgt der Wirkungsgrad ca. 70 % – das haben die den Zulassungsgrundsätzen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) entsprechenden Prüfungen mit der Prüfsubstanz Milisil W4 ergeben. Das Niederschlagswasser, das den Sedimentationsschacht durchlaufen hat, kann in ein Oberflächengewässer abgeleitet werden (Ablauf von Flächenkategorie I und II nach Gelbdruck DWA-A 102).
Durch Spirallamelle nach oben
Das Regenwasser fließt über den seitlichen Zulauf in den Sedimentationsschacht. Insbesondere durch die bei größeren Wasserfrachten auftretende Fließgeschwindigkeit gelangt das einströmende Wasser in eine Rotationsbewegung, bei der die Sedimente langsam absinken und durch den kegelförmigen Strömungstrenner zum Schachtboden geführt werden. Der hydrostatische Druck ist dafür verantwortlich, dass das Regenwasser durch die Spirallamelle im Inneren des Sedimentationsschachtes nach oben geführt wird. Die Spirallamelle sorgt dafür, dass der Weg der im Regenwasser enthaltenen Teilchen um das Mehrfache verlängert und die Fallhöhe auf eine Lamellenfläche minimiert wird. Das trägt dazu bei, dass wiederum ein Großteil der im Regenwasser enthaltenen Sedimente zurückbleiben und durch die Spirallamelle nach unten sinken, bevor die Wasserfracht in den oberen Schachtkörper gelangt. Im oberen Schachtkörper sorgt eine vor der Ablauföffnung angebrachte Tauchwand dafür, dass die noch im Niederschlagswasser enthaltenen Schwimm- und Schwebstoffe zurückgehalten werden, bevor das dann behandelte Wasser sukzessive aus dem Schachtkörper nach außen geführt wird.
Weitere Informationen: www.funkegruppe.de
https://www.gwf-wasser.de/aktuell/produkte-verfahren/22-08-2018-sedimentationsschacht-macht-das-niederschlagswasser-sauber/
(nach oben)
NIVUS: Radar-Füllstandssensor für anspruchsvolle Anwendungen
Nivus GmbH stellt mit den R-Sensoren eine Ergänzung des Produktprogramms zur berührungslosen Füllstandsmessung vor.
Diese eignen sich für Messungen von Flüssigkeiten, pastösen Medien und Schüttgütern. Die Radar-Sensoren arbeiten mit neuestem frequenzmodulierten Dauerstrich-Verfahren (FMCW) auf 63 GHz Basis.
Damit liefern sie zuverlässige und genaue Messwerte auch bei wechselnden Temperaturen, Dämpfen, Stäuben, Nebel, Gasüberlagerungen und anderen Umwelteinflüssen. Die Sensoren eignen sich auch für anspruchsvolle Anwendungen mit Kondensations- oder Schaumbildung.
Die geringe Blockdistanz und der schmale Abstrahlwinkel ermöglichen eine zuverlässige Füllstandsmessung auch bei beengten Platzverhältnissen. Durch die intelligente Störechoausblendung können z.B. Einbauten in einem Tank oder Silo sicher ausgeblendet werden. Mit Hilfe der Mikrowellentechnik lassen sich Messungen auch außerhalb von Kunststoffbehältern durch die geschlossene Decke zuverlässig durchführen.
Darüber hinaus können die kompakten Sensoren einfach und schnell installiert werden. Das robuste und überflutungssichere Gehäuse verfügt über eine Schutzklasse von IP68. Damit sind unterbrechungsfreie Messungen auch bei rauen Umgebungsbedingungen gewährleistet. Die Sensoren verfügen über Ex-Zulassungen für die Zone 0 und 1 und eignen sich damit auch für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen in Abwasseranwendungen.
Die R-Sensoren sind kompatibel mit allen Messumformern der NivuMaster-Serie des Herstellers. Neben der permanenten Anzeige des aktuellen Messwertes und der Parametrierung sowie Diagnose des Messsystems bieten die Messumformer je nach Variante verschiedene Möglichkeiten der Steuerung für nachgelagerte Prozesse.
FMCW-Radarsensoren zeichnen sich gegenüber gepulsten Radarsensoren durch mehrere Vorteile aus. Aufgrund der besseren Ortsauflösung können Objekte genauer erkannt werden. Der größere Dynamikbereich bietet zuverlässig genaue Messwerte auch bei großen Messbereichen mit sehr unterschiedlichen Füllständen. Die zuverlässigere Oberflächendetektion ermöglicht den Einsatz des Messsystems bei sehr engen Platzverhältnissen.
Neben den neuen Radarsensoren bietet NIVUS ebenfalls Systeme für berührungslose Füllstandsmessung auf Ultraschallbasis sowie hydrostatische Füllstandsmesssysteme an.
Die R-Sensoren arbeiten mit FMCW-Radartechnologie
Quelle: https://www.nivus.de/de/aktuelles-presse/presse/radar-fuellstandssensor-fuer-anspruchsvolle-anwendungen/
(nach oben)
KROHNE: Neuer Feststoffgehalt-Sensor OPTISENS TSS 2000
• Feststoffgehalt-Sensor zur Prozess- und Qualitätsüberwachung in Abwasseranwendungen in verschiedenen Branchen
• Kurze Ansprechzeit, robuste Bauart
• Kostengünstige Messstelle bei Einsatz mit Transmitter MAC 100
KROHNE stellt OPTISENS TSS 2000 vor: ein neuer Feststoffgehalt(TSS)-Sensor, der als robuster und kostengünstiger Eintauchsensor für die Prozess- und Qualitätsüberwachung in industriellen und kommunalen Abwasseranwendungen eingesetzt werden kann.
OPTISENS TSS 2000 bietet eine kurze Ansprechzeit und lässt sich zur Prozessoptimierung, Ertragssteigerung und Grenzstandüberwachung nutzen. Zielanwendungen in der Wasser- & Abwasserindustrie sind unter anderem die Überwachung des Feststoffgehalts in biologischen Schlämmen (MLSS), der Schlammabzug aus Vor- und Nachklärbecken (Sedimentationstanks) und die Überwachung der biologischen Abwasserbehandlung in Belebungsbecken. Der neue Sensor kann auch zur Überwachung von Produktverlusten in offenen Gerinnen in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie, von Abwässern in der chemischen Industrie, von Siebwasser in der Papier- & Zellstoffindustrie oder von Eindickern in der Metall- & Bergbauindustrie eingesetzt werden.
In Kombination mit dem Transmitter MAC 100 ergibt der OPTISENS TSS 2000 eine komplette preisgünstige TSS-Messstelle für den Messbereich 0…4 AU / 0…18,5 g/l. Der Einstrahl-Sensor ist in einem robusten Edelstahlgehäuse mit kratzfestem Saphirglas-Messfenster untergebracht und kann optional mit automatischer Sensorreinigung ausgestattet werden. Dank Nahinfrarot-Technologie (NIR) haben Farben und natürliches Umgebungslicht keinen Einfluss auf die Messung. Der Sensor ist werkseitig kalibriert mit bis zu 6 Messpunkten zur linearen oder nicht-linearen Einstellung. Die Installation ist ohne großen Montageaufwand möglich (Aufhängung am Kabel). Empfohlen wird jedoch die Verwendung der Sensorarmatur SENSOFIT IMM 2000 mit Teleskopstange aus Glasfaser. Für anspruchsvollere Anwendungen, z. B. bei schwierigen Abwasserbedingungen oder hygienischen Anforderungen, sind die Modelle OPTISENS TSS 3000 und 7000 mit 4-Strahl-Technologie erhältlich.
Über KROHNE: KROHNE ist ein Anbieter von Komplettlösungen für Prozessmesstechnik zur Messung von Durchfluss, Massedurchfluss, Füllstand, Druck und Temperatur sowie für Analyseaufgaben. Das 1921 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg, Deutschland, beschäftigt weltweit über 3.700 Mitarbeiter und ist auf allen Kontinenten vertreten. KROHNE steht für Innovation und höchste Produktqualität und gehört zu den Marktführern für industrielle Prozessmesstechnik.
Herausgeber:
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Straße 5
47058 Duisburg, Germany
(nach oben)
Multi Umwelttechnologie AG: Hocheffiziente Containerkläranlagen für die biologische Abwasserreinigung mit höchster Flexibilität bei kleinstmöglicher Standfläche
Basic-Engineering als Franchise-Concept
Um den zukünftig weltweit weiter steigenden Anforderungen an flexible, biologische Wasserreinigungsanla-gen gerecht zu werden, bietet die Multi Umwelttechnologie AG ihren Support basierend auf langjähriger Ent-wicklung in Form von Basic-Process-Engineering und Verfahrenstechnik in der Form eines Franchise-Konzeptes. Das Konzept richtet sich an Unternehmen, die Interesse an der Vermarktung und/oder Betriebs-führung dieser Technologie haben, oder die diese als zusätzliches Know-how nutzen wollen.
Was ist an der Mutag MBBR power packTM Unit anders und worauf kommt es an?
Zunächst stellt sich die Kostenfrage, standardisierte Anlagenkonzepte in Deutschland zu produzieren, was sich aus finanzieller Sicht eher nicht empfiehlt. Werden hingegen Stahl- und Rohrleitungsbau nach Bauplan direkt vor Ort in den jeweiligen Zielländern ausgeführt, in denen solche Anlagen dringend benötigt werden, lassen sich diese sicherlich wesentlich günstiger herstellen. Zusätzlich trägt eine solche Unterstützung auch zur weiteren Entwicklung der Zielländer bei. Unternehmen in diesen Ländern erhalten damit die Möglichkeit, in einem Franchise-Konzept das langjährige Know-how und die Planungsgrundlagen zu nutzen und benöti-gen dafür weder zusätzliche Entwicklung noch eine hochqualifizierte Ausbildung ihrer Mitarbeiter. Mit dem Franchise-Concept wird eine Geschäftsidee, nämlich das Angebot zur Produktion und Betriebsführung von kompakten, flexiblen Abwasserreinigungsanlagen, in preisbewusste Märkte und Entwicklungsländer ge-bracht.
Es kommt darauf an, dass hoch effiziente und flexible Anlagen direkt vor Ort hergestellt und betrieben wer-den können und dadurch weitere Kosten so niedrig wie möglich gehalten werden.
Die Effizienz der Mutag MBBR power packTM Units wird in einem direkten Vergleich mit anderen auf dem Markt verfügbaren Containeranlagen sehr deutlich.
Eine Mutag MBBR power packTM Unit auf einem 40ft Containerrahmen mit den Abmessungen (L x B x H) 12.0 m x 2.3 m x 2.5 m ist für kommunales Abwasser mit einer Leistung von 2.400 m³/Tag, einer Fracht von 6.600 EGW und 400 kg BSB/Tag bei 15°C ausgelegt. Damit ist die Leistung bei gleichem MBBR Reaktionsvolumen gegenüber vergleichbaren Container-lösungen verdoppelt oder sogar ver-vielfacht.
Für den Anwender ist besonders wichtig, dass er anstatt 2 oder sogar mehreren Containern nur eine Mutag MBBR power pack Unit benötigt. Hierdurch lassen sich weitere Kosten einsparen.
Was bietet das Franchise-Konzept?
Der Franchise-Nehmer oder -Nutzer wird nicht nur mit dem Hochleistungsträgermaterial Mutag BioChipTM und den Membranbelüftungsplatten beliefert. Er nutzt das langjährige Know-how der MBBR-Verfahrens- und Anwendungstechnik, Biofilm-Technologie sowie Unterstützung von der Auslegung von Anlagen bis zur Be-rechnung und Gestaltung der einzelnen Komponenten. Die konstruktive Gestaltung der Rückhaltesysteme, Massenbilanzierung, Flow-sheets, Basic-P&ID, Data-Sheets der Zukaufkomponenten und Baupläne gehören zur Beistellung durch den Franchise-Geber.
Besonders wichtig ist die Unterstützung nach dem Bau der Anlagen zur Betriebsführung. Hierzu stellt der Franchise-Geber komplette Inbetriebnahme-, Betriebsanweisungen und Dokumente zur Verfügung und be-treut das Betriebspersonal mittels Auswertung der Betriebsdaten mit Empfehlungen für den optimalen Be-trieb.
Warum ist die Leistungsfähigkeit im Vergleich zu anderen MBBR-Containeranlagen höher?
Die Effizienz auf geringstem MBBR-Reaktionsraum (-volumen) lässt sich durch die Verwendung und Kombi-nation von ausgewählten Materialien oder Komponenten erheblich steigern.
Durch den Einsatz von höchst effektiven Membranbelüfterplatten wird sehr feinblasig die Prozessluft bereit-gestellt, womit die für die hohe biologische Umsatzleistung erforderliche Sauerstoffmasse eingetragen wer-den kann. Wäre die hohe Sauerstoffmasse nicht sichergestellt, wäre der aerobe biologische Abbau nicht rea-lisierbar.
Besonders wichtig ist, dass in dem MBBR-Reaktionsraum ausreichende aktive Biomasse kontrolliert gehalten wird. Die notwendige Biomasse wird im Vergleich zu anderen Trägermaterialien in Containeranlagen durch die Verwendung der hoch effizienten Mutag BioChipTMs ermög-licht. Entscheidend ist, dass durch die in der Porenstruktur aufgenom-mene Biomasse in dem ca. 1,1 mm flachen Chip (Scheibe) von beiden Seiten ausreichend Substrat und Sauerstoff diffundiert (zugeführt) wird. Folglich ist die gesamte Biomasse aktiv und es bildet sich kein inaktiver Schlamm in den Poren. Durch das aneinander vorbei streifen der be-wegten Chips wird kontinuierlich der Biofilm bzw. die Biomasse auf einer Schichtdicke von ca. 0,5 mm je Seite gehalten bzw. abgeschert. Durch die definierte Porentiefe ist somit der Biofilm optimal und kontrolliert eingestellt und somit höchst effektiv.
Dieser Effekt bei den Mutag BioChipTMs ist in seiner Art unvergleichbar. Erstaunlich ist, dass dieser positive Effekt sehr selten in der Fachwelt mit seinen äußerst vorteilhaften Eigenschaften erkannt wird. Bei anderen PE-Carriern wird hingegen die Biomasse abgespült und nicht kontrolliert in einer Schichtdicke von 0,5 mm gehalten. Der große Vorteil des Mutag BioChipTMs wird mit gespritzten Kunststoffträgern nicht erreicht.
Betriebsführungs- oder Betreibermodelle
Mit dem Kostenvorteil neben dem Bau der Anlagenkomponenten in den Bedarfsländern, bestehend aus Rohrleitungs- und Stahlbau, wird durch die Unterstützung des Franchise-Gebers auch die Betriebsführung vereinfacht oder ermöglicht.
Des Weiteren sind Betreibermodelle realisierbar. In diesem Fall werden die Anlagen auf Fundamente gestellt und sind somit nicht mit dem Boden verbunden. Sie können also bei Bedarf wieder demontiert und an ande-rer Stelle wieder montiert und genutzt werden. Dadurch wird das Mutag MBBR power packTM zur idealen Lösung für zeitlich Begrenzten Einsatz, zum Beispiel für Arbeiterlager im Bergbau oder in der Öl- und Gasex-ploration.
Welche Container-Konzepte sind verfügbar?
Im Gesamtkonzept sind verschiedene Standardkomponenten, bestehend aus der MBBR Technologie für CSB- und BSB-Abbau, Nitrifikation oder ANAMMOX verfügbar. Für den Denitrifikationsprozess stehen Con-tainer-Units mit optimierter Rührtechnik zur Verfügung. Je nach Anwendung können Varianten der standardi-sierten Module unterschiedlich angeordnet werden, um das System entsprechend anzupassen.
Je nach Bedarfsanforderung stehen Anlagenkonzepte zur Nutzung der MBBR/IFAS Technologie in der Kom-bination mit der MBR Technologie (Membrantrenntechnik) zur Verfügung.
FAZIT:
Die höchste Effektivität wird durch die kombinierte Verwendung der beiden Key-Komponenten bestehend aus Sauerstoff-Eintragssystems und den Mutag BioChipTMs erzielt, wodurch höchste biologische Umsatzraten in geringstem Reaktionsraum sowie eine Einsparung an Investitions- und Betriebskosten ermöglicht werden. Der Bau von Units nach Planvorgabe vor Ort spart zum einen Kosten und fördert zum anderen die Struktur der Bedarfsländer. Der Franchise-Geber unterstützt den Betreiber dabei in allen verfahrenstechnischen, bio-logischen oder betriebsführungsbezogenen Belangen.
Autoren:
Cornelia Harmsen
René Trübenbach
(nach oben)
Tsurumi: Pumpenwahl, Pumpenqual – was beim Kauf von Wasserpumpen zu beachten ist
Wer nach einer neuen Pumpe für seine Wasserlogistik fragt, bekommt bei den Herstellern zunächst keine Antwort – sondern viele Gegenfragen. Tsurumi gibt im 10-Punkte-Check einen Überblick und nützliche Tipps, worauf es ankommt.
1. Was soll gepumpt werden?
Dieser Punkt ist elementar. Nicht jede Flüssigkeit kann mit jeder Pumpe bewegt werden. Es gibt vier große Gruppen: Pumpen für Klarwasser, Schmutzwasser, Abwasser und Salzwasser. Mit letzteren werden oft auch weitere chemisch-reaktive Medien gepumpt. Die Pumpen bestehen dann aus widerstandsfähigem Material. Für Trinkwasser wird meist Edelstahl verwendet.
2. Welche Fördermenge?
Die zu bewegende Wassermenge (l/min oder m³/h) bestimmt im Wesentlichen die erforderliche Leistung der Pumpe. Jede Pumpe deckt einen Bereich ab und hat ein Optimum. Deshalb gibt es so viele Typen – bei Tsurumi etwa 800. Pumpen für Schmutzwasser bewegen bis zu 30 m³/min. Auf den Querschnitt der gegebenenfalls vorhandenen Rohrleitung achten, der zur Pumpenleistung passen muss.
Tipp: Langsam laufende Pumpen bevorzugen, da sie weniger verschleißanfällig sind.
3. Wie hoch wird gepumpt?
Die Frage ist in Kombination zur vorherigen zu sehen. Denn die Fördermenge nimmt ab, je höher gepumpt wird. Auf die absolute Höhendifferenz zwischen dem unteren und oberen Wasserspiegel (geodätische Förderhöhe) kommt es an. Hochdruckpumpen schaffen über 200 Höhenmeter. Ist statt dessen die horizontale Distanz sehr groß, gilt gleiches.
Tipp: Manchmal lassen sich zwei (gleiche) Pumpen per Adapter in Reihe betreiben – die zweite fungiert als Booster, was die Leistung fast verdoppelt.
Ob Branchennews, innovative Produkte, Bildergalerien oder auch exklusive Videointerviews. Sichern auch Sie sich diesen Informationsvorsprung und abonnieren Sie unseren redaktionellen Branchen-Newsletter „Wasser/Abwasser“.
4. Kommt es zum Schlürfbetrieb?
So nennen Experten den Zustand, wenn neben Wasser auch Luft angesogen wird. Zum Beispiel bei Entnahmestellen mit zeitweise (zu) niedrigem Wasserstand. Für viele Pumpenmotoren ist dies kritisch, weil sie ohne kühlendes Wasser schnell überhitzen.
Tipp: Auf trockenlaufsichere Pumpen achten – sie widerstehen dieser Tortur.
5. Ist der Wasseranfall unregelmäßig?
Ist der Pumpbedarf diskontinuierlich, sind Pumpen mit fest verbautem Niveausensor die Lösung. Sie schalten sich selbsttätig ein und aus. Elektroden-Sensoren sind im Vergleich zu mechanischen Kontaktgebern zuverlässiger. Alternativ ein externes Steuergerät einsetzen.
Tipp: Frequenzumrichter sorgen für einen sanften Anlauf, verhindern Druckstöße und balancieren Mehrpumpensysteme aus.
Inhalt des Artikels:
• Seite 1: Pumpenwahl, Pumpenqual – was beim Kauf von Wasserpumpen zu beachten ist
• Seite 2: Top 6-10 der Checkliste zur Auswahl von Wasserpumpen
Quelle: https://www.process.vogel.de/pumpenwahl-pumpenqual-was-beim-kauf-von-wasserpumpen-zu-beachten-ist-a-667637/
(nach oben)
LANXESS: erweitert Membransortiment für die Umkehrosmose
Drei neue Lewabrane-Typen zur Trinkwasseraufbereitung und Abwasserbehandlung
Entfernung von Spurenstoffen für „End-of-Pipe“-Lösungen
Pilotanlage des vom BMBF geförderten Projektes „Multi-ReUse“ geht mit Lewabrane-Elementen im Juli 2017 in Betrieb
Der Spezialchemie-Konzern LANXESS erweitert sein Produktsortiment an Membranelementen für die Umkehrosmose (RO, Reverse Osmosis). Ab sofort stehen mit der neuen Reihe Lewabrane RO ULP drei Typen für die Wasseraufbereitung zur Verfügung. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wasserdurchlässigkeit im Vergleich zu Standardelementen aus – bei gleichzeitigem hohen Rückhalt von kritischen Substanzen. Im Druckrohr ist ein um 40 Prozent niedrigerer Betriebsdruck erforderlich, was die Betriebskosten senkt. Zudem stellt der neue Membrantyp eine gute Option zur Entfernung von Spurenstoffen aus Abwasser oder Trinkwasser dar.
„Die neuen ULP-Typen werden für Anwendungen empfohlen, bei denen eine hohe Flussrate, ein moderater Salzrückhalt und ein niedriger Stromverbrauch die primären Auslegungsparameter darstellen. Einsatzgebiete sind daher insbesondere die wirtschaftliche Filtration von Trinkwasser und die zukunftsweisende Abwasserbehandlung“, sagt Alexander Scheffler, der bei LANXESS im Geschäftsbereich Liquid Purification Technologies (LPT) das Membrangeschäft verantwortet. „Unsere Kunden sind vom Eigenschaftsprofil so überzeugt, dass schon zahlreiche Vorbestellungen vorliegen“, ergänzt Scheffler.
Wirtschaftlich bei niedrigem Betriebsdruck Spurenstoffe eliminieren
Synthetische organische Substanzen, so genannte Spurenstoffe, kommen in Gewässern in Konzentrationen von Nano- bis maximal wenigen Mikrogramm pro Liter vor. Hervorgerufen beispielsweise durch Arzneimittel, Haushalts- und Industriechemikalien sowie Kosmetikprodukte oder Pflanzenschutzmittel, gelangen sie über häusliche und industrielle Abwässer in den Wasserkreislauf.
Die Typenbezeichnung ULP steht für Ultra Low Pressure, denn die Stärke dieser Membranen liegt darin, solche organische Verbindungen selbst bei niedrigem Betriebsdruck nahezu vollständig zu entfernen. „Trinkwasseranlagen verarbeiten oft täglich große Mengen an Oberflächenwasser. Daher ist aus Investitionskostenüberlegungen eine Membran mit einer hohen Wasserdurchlässigkeit und dadurch bedingt mit einer hohen Flussrate, wie wir sie mit Lewabrane RO ULP bieten, nur wünschenswert“, sagt Scheffler.
Um die Bildung von organischem Bewuchs – das typische organische Fouling – in Abwasser zu verringern, zeichnet sich die ULP-Membran dadurch aus, dass sie die höchste hydrophile Oberfläche aller Lewabrane-Typen aufweist. Die Hydrophilie trägt dazu bei, dass sich ein dünner schützender Wasserfilm auf der Membranoberfläche ausbildet, der die Adsorption von organischen Substanzen verringert.
Auch die in den Membranelementen eingesetzten ASD-Feedspacer, die Raum für das strömende Wasser zwischen den Membranflächen schaffen, reduzieren Fouling. Für das „Alternating Strand Design“ (ASD) werden unterschiedlich dicke Filamente verwendet, die eine gleichmäßige Wasserüberströmung bewirken und so organischem Bewuchs entgegenwirken. Dies führt zu geringeren Betriebskosten, da weniger Reinigungschemikalien benötigt werden und das Intervall zwischen den Reinigungsvorgängen länger sein kann.
Lewabrane bei Projekt Multi-ReUse im Einsatz für „End-of pipe“-Lösungen
In 2016 ist das Forschungsprojekt „Modulare Aufbereitung und Monitoring bei der Abwasser-Wiederverwertung“ (Multi-ReUse) gestartet, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. So sollen Verfahren zur wirtschaftlichen Nutzung von Abwässern entwickelt bzw. verbessert werden. Vor diesem Hintergrund haben sich der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) mit den Forschungspartnern IWW Zentrum Wasser GmbH, dem Biofilm Centre der Universität Duisburg-Essen (UDE) und den Ausrüsterfirmen inge GmbH, IAB Ionenaustauscher GmbH Bitterfeld – eine 100%ige LANXESS-Tochtergesellschaft – und De.EnCon GmbH zusammengeschlossen und entwickeln flexible Verfahrensketten zur Produktion von definierten Wasserqualitäten sowie -mengen. Hierzu kommen innovative Verfahrenskombinationen und neue Entwicklungen im Bereich der Membrantechnologie zum Einsatz. Parallel dazu werden schnelle und zuverlässige Monitoring-Verfahren zur Prozesskontrolle und Qualitätsüberwachung von hygienerelevanten Parametern entwickelt.
Die praktische Umsetzung erfolgt am Standort der Kläranlage Nordenham in Niedersachsen in Zusammenarbeit mit dem OOWV. Die Pilotanlage geht im Juli 2017 in Betrieb. Zum Einsatz kommen dort Membranelemente von LANXESS – auch die neuen ULP-Typen. „Wir untersuchen in langfristig angelegten Testreihen in der Praxis unsere Membranelemente im Hinblick auf Fouling und Rückhalt“, erläutert Scheffler.
Ausführliche Informationen zu den neuen Typen und dem umfangreichen Sortiment von LANXESS für die Wasseraufbereitung bietet der Internetauftritt http://lpt.lanxess.de/.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich Annahmen, Erwartungen und Meinungen der Gesellschaft sowie der Wiedergabe von Annahmen und Meinungen Dritter. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, die finanzielle Lage oder die wirtschaftliche Entwicklung von LANXESS AG erheblich von den hier ausdrücklich oder indirekt dargestellten Erwartungen abweicht. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, zutreffend sind und übernimmt keinerlei Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Erklärung getroffenen Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der hier dargestellten zukünftigen Entwicklungen. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr (weder direkt noch indirekt) für die hier genannten Informationen, Schätzungen, Zielerwartungen und Meinungen, und auf diese darf nicht vertraut werden. Die LANXESS AG übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler, fehlende oder unrichtige Aussagen in dieser Mitteilung. Dementsprechend übernimmt auch kein Vertreter der LANXESS AG oder eines Konzernunternehmens oder eines ihrer jeweiligen Organe irgendeine Verantwortung, die aus der Verwendung dieses Dokuments direkt oder indirekt folgen könnte.
LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 75 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good.
https://lanxess.de/de/corporate/presse/presseinformationen/2017-00062/
(nach oben)
StoCretec: Mörtelsystem für Kläranlagen
Klärbecken dauerhaft schadenfrei
Höhere Restdruck-Festigkeit, geringere Korrosionstiefe und weniger Dehnung als ein „Norm-Mörtel“: Die StoCretec-Mörtel für Kläranlagen übertreffen die technischen Werte eines Referenzmörtels gemäß Sielbaurichtlinie in vielen Anforderungspunkten. Sie kommen oberhalb, innerhalb und unterhalb der Wasserwechselzone zum Einsatz und stellen eine Komplett-Lösung zur Sanierung von Kläranlagen dar – bis zur Expositionsklasse XA3.
Kläranlagen sind unter anderem stark durch biogene Schwefelsäuren und im Abwasser gelöste Sulfate belastet und müssen mit besonders widerstandsfähigen Baustoffen errichtet werden. Das gilt gleichermaßen für den Neubau als auch für die Instandsetzung. Erst ein System mit aufeinander abgestimmten Komponenten bietet Sicherheit und Dauerhaftigkeit. Unter diesem Leitgedanken entwickelte StoCretec kunststoffmodifizierte, zementgebundene Mörtel für kommunale Kläranlagen.
Für den Schutz und die Instandsetzung wasserberührter Betonbauteile stehen mehrere Mörtel zur Verfügung:
• der Nassspritzmörtel StoCrete TS 250
• der manuell verarbeitbare Grobmörtel StoCrete TG 252 (mit zugehöriger Haftbrücke StoCrete TH 250)
• der Feinspachtel StoCrete TF 250
• der Estrichmörtel StoCrete TG 154
Die auf den jeweiligen Anwendungsbereich optimierten Mörtel erreichen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber den chemischen Expositionen im Bereich kommunaler Kläranlagen – bis zur Expositionsklasse XA3. Damit eignen sie sich ideal für das dauerhafte Instandsetzen von Vorklär-, Belebungs- oder Nachklärbecken. Neben dem optimierten Mörtelgefüge und einem extrem geringen C3A-Gehalt (0 M.-% nach Bogue), zeichnen sich die Mörtel auch durch einen niedrigen Alkaligehalt (Na2O-Äquivalent < 0,6 M.-%) aus, was sie für weitere Anwendungsbereiche interessant macht. http://www.stocretec.de/
(nach oben)
STO Cretec: Dauerhaft widerstandsfähig gegen chemischen Angriff und Verschleiß
Kläranlage Niederselters: Sanierung von Sandfang und Gerinne
Kläranlagen müssen einiges aushalten: Chemische Bela-stung durch aggressive Abwässer, Erosion durch Sand, Steine oder Glassplitter sowie ständiges Befahren durch die Räumer hinterlassen ihre Spuren. So auch bei der Kläranlage Niederselters im Taunus, die seit 1978 in Betrieb ist. Eine Schadensanalyse stellte schlechte Zug- und Druckfestigkeiten, einen erhöhten Sulfatgehalt und fortgeschrittene Karbonatisierung fest – vor allem an den Regenüberlaufbecken sowie dem Sand- und Fettfang inklu-sive Zu- und Ablaufgerinne. Mit Spezialmörteln von StoCretec wurden die Betonbauwerke innerhalb von zwei Monaten wieder fit gemacht gegen Chemikalien und mechanische Belastungen – Substanzerhalt und Funktion sind wieder dauerhaft sichergestellt.
Die Kläranlage Niederselters ist seit 1978 in Betrieb. Aufgrund von Mängeln am Beton wurde 2013 bei einem Ingenieurbüro eine Schadensanalyse in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse: Schlechte Zug- und Druckfestigkeiten, ein erhöhter Sulfatgehalt und fortgeschrittene Karbonatisierung. Es bestand dringender Sanierungsbedarf. Am stärksten waren die Regenüberlauf-becken 1 und 2 sowie der Sand- und Fettfang einschließlich der Zu- und Ablaufgerinne betroffen. Ein Fortschreiten der Zustands- und Substanzverschlechterung musste zwingend vermieden werden.
Der Abwasserverband beauftragte die SiB Ingenieurgesellschaft mit der Planung der Instandsetzungsmaßnahmen. Die Herausforderungen dabei:
• Es handelte sich um chemisch und mechanisch stark beanspruchte Betonbauwerke.
• Der Kläranlagenbetrieb musste während der Sanierungs-arbeiten aufwändig aufrechterhalten werden.
Gesucht wurde ein Sanierungssystem für das Instandsetzungsprinzip R gemäß Instandsetzungsrichtlinie, welches den speziellen Expositionen standhält. Zudem war die Verarbeitungszeit ein wichtiges Kriterium. Zum Einsatz kamen für den Anwendungsfall Kläranlage entwickelte Mörtel- und Beschichtungssysteme von StoCretec.
Im ersten Bauabschnitt widmete sich die Schachtbau Nord-hausen Bau GmbH dem Sandfang sowie dessen Zu- und Ablaufgerinne. Der chemische Angriff durch das Abwasser, Erosion durch harte Schwebstoffe wie Sand, Steine oder Glassplitter sowie die ständige Befahrung durch den Räumer hatten diese Betonbauwerke über die Jahre hinweg stark geschädigt. Nach dem Ausbau aller maschinellen Ausrüstungsteile und der Reinigung der Becken entfernten die Handwerker den geschädigten Beton mittels Höchstdruckwasserstrahlen, in Teilbereichen sogar bis hinter die Bewehrung.
Sulfatbeständige Mörtel bis XA3
Die freigelegte und entrostete Bewehrung erhielt den Korro-sionsschutzanstrich StoCrete TK. Danach brachten die Fachkräfte auf die gestrahlten tieferen Betonausbrüche die sulfat-beständige Haftbrücke StoCrete TH 250 auf. Diese dient als Haftverbund zwischen dem Altbeton und den Instandsetzungs-mörteln StoCrete TG 252 an der Wand und StoCrete TG 154 auf dem Boden. Anschließend spritzten sie StoCrete TS 250 im Nassspritzverfahren vollflächig auf die vorbereiteten vertikalen Betonflächen auf. Dieser Mörtel wurde zur Betoninstandsetzung sowie zur Erhöhung der Betondeckung eingesetzt. Um ihre Reinigung zu erleichtern, erhielten die Becken ein feinstrukt-uriertes Oberflächenfinish mit dem Feinspachtel StoCrete TF 250.
Die Mörtel zeichnen sich durch ein optimiertes Mörtelgefüge und einen extrem geringen C3A-Gehalt (0 M.-% nach Bogue) aus. Damit verfügen Sie über eine hohe Widerstandsfähigkeit bis zur Expositionsklasse XA3, weshalb sie sich ideal für das dauerhafte Instandsetzen von Betonbauteilen in Kläranlagen eignen.
Beschichtung für zusätzlichen Schutz
Zusätzlich versahen die Verarbeiter die sanierten Becken-Außenwände mit StoCryl V 100 in zwei Lagen. Das geprüfte Oberflächenschutzsystem von StoCretec verhindert die Wasser- und Schadstoffaufnahme in den Beton und wirkt CO2-bremsend. Die Räumerlaufflächen mussten außerdem gegen den Verschleiß durch das Räumerlaufrad geschützt werden. Um bei Feuchte den Antrieb des Räumers zu gewährleisten, war eine rutschhemmende Oberfläche nötig. Die betroffenen Flächen wurden mit dem Epoxidharz StoPox 452 EP grundiert und gespachtelt. Nach der Abstreuung mit Quarzsand erhielten sie als Beschichtung das EP-Harz StoPox KU 601.
Nach gut zwei Monaten wurden Sandfang und Gerinne der Kläranlage Niederselters wieder in Betrieb genommen. Sie verfügen nun über einen dauerhaften Schutz gegen chemische Angriffe und mechanische Belastungen. Substanzerhalt und Funktionsfähigkeit sind wieder zukünftig sichergestellt.
http://www.stocretec.de/
Bautafel
Objekt: Kläranlage Niederselters, Selters
Sandfang und Gerinne
Bauherr: Abwasserverband Emsbachtal, Bad Camberg
Planer: SiB Ingenieurgesellschaft mbH, Ober-Mörlen
Verarbeiter: Schachtbau Nordhausen Bau GmbH, Nordhausen
Ausführung: 2015
Produkte: Instandsetzung
Korrosionsschutz: StoCrete TK
Haftbrücke: StoCrete TH 250
Grobmörtel: StoCrete TG 252
Estrich: StoCrete TG 154
Nassspritzmörtel: StoCrete TS 250
Feinspachtel: StoCrete TF 250
Oberflächenschutz/Beschichtung
Räumerlaufbahn: StoPox 452 EP + StoQuarz + StoPox KU 601
Beckenaußenwände: StoCryl V 100
(nach oben)
Sulzer: Erfolgreiche Abnahme von vier Turboverdichtern
Auf der zentralen Kläranlage in Chemnitz sind seit Ende April fünf magnetgelagerte Turboverdichter im Einsatz. Sie lösen technisch überholte Aggregate ab. Die neuen Aggregate amortisieren sich in weniger als zwei Jahren durch deutlich geringere Energie- und Wartungskosten. Bei der Umstellung wurde auch die gesamte Stromversorgung und Steuerung ersetzt.
(Bonn) Die neuen mit Frequenzumformern gesteuerten Turboverdichter ersetzen vier alte Aggregate. Diese wurden noch über Vor- und Nachleitapparate geregelt und erforderten regelmäßige aufwendige Wartungen. Die neuen Verdichter sind magnetgelagert und damit nahezu wartungsfrei. Hartmut Begemann, Technische Beratung und Vertrieb Sulzer Pumps Wastewater Germany GmbH: „Es gibt kein Öl und damit keinen Ölwechsel, keine Reinigung und auch keinen Lagerwechsel. Wir rechnen mit einer Verminderung der Wartungs- und Servicekosten von etwa 95 Prozent.“ Die Anlage spart allein damit etwa 10.000 Euro jährlich. Zusammen mit dem deutlich höheren Wirkungsgrad und damit einem etwa 25 Prozent geringeren Energiebedarf ergeben sich jährliche Einsparungen bei den Energiekosten von etwa 170.000 Euro. Neben diesen Einsparungen steht für die Anlage die sehr hohe Betriebsstabilität im Vordergrund: „Die neuen Verdichter garantieren uns eine sehr hohe Verfügbarkeit und sind entscheidend für die Funktion unserer Biologie“. so der stellv. Kläranlagenleiter Sven Nicolai.
Die neuen Turboverdichter ersetzen die alten Maschinen 1:1. Dabei wurde auch die Stromversorgung von Mittelspannung mit 10-kV-Motoren auf Niederspannung umgestellt. Die gesamte Umstellung inklusive der dafür nötigen Transformatoren, Steuerung und Verkabelung übernahm Sulzer als Generalunternehmer. Zusammen mit dem Chemnitzer Ingenieurbüro Prowatec wurden zehn Subunternehmen so koordiniert, dass die Umstellung innerhalb des Zeitrahmens glückte. „Es gab keine technischen Probleme. Die Koordination aller Teilbereiche war die größte Herausforderung“, so H. Begemann.
Neu installiert wurden zwei Turboverdichter der Baureihe 40 und zwei der Baureihe 20. Die Aggregate leisten bis zu 16.000 Nm3/h und gehören damit zu den leistungsfähigsten am Markt angebotenen Verdichtern. Ein fünfter Turboverdichter von Sulzer ist bereits länger im Einsatz.
Die zentrale Kläranlage Chemnitz-Heinersdorf sammelt das gesamte Abwasser der Stadt Chemnitz und aus Teilen des Umlandes. Die Anlage kann 9.450 Kubikmeter pro Stunde aufnehmen. Bei Trockenwetter kommen bis 3.500 Kubikmeter Abwasser pro Stunde an, nachts sind es etwa 1.300 Kubikmeter. Jährlich bewältigt sie zwischen 30 und 38 Millionen Kubikmeter Schmutz- und Niederschlagswasser.
Quelle: Heike Goes, Marketing Sulzer Pumps Wastewater Germany GmbH
Telefon +49 2246 13-285, E-Mail heike.goes@sulzer.com
Sulzer mit Sitz in Winterthur, Schweiz, gegründet 1834, ist auf Pumpen, Wartung und Dienstleistungen für rotierende Maschinen sowie Trenn-, Reaktions- und Mischtechnologie spezialisiert. Das Unternehmen schafft zuverlässige und nachhaltige Lösungen für seine Schlüsselmärkte: Öl und Gas, Energie und Wasser. Sulzer bedient Kunden auf der ganzen Welt mit einem Netzwerk von über 170 Produktions- und Servicestandorten und hat eine starke Präsenz in aufstrebenden Märkten. 2016 erzielte das Unternehmen mit rund 14 000 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund CHF 2,9 Milliarden. www.sulzer.com
(nach oben)
s::can Messtechnik: Effiziente H2S Überwachung der Kläranlage von Santa Cruz
Der spectro::lyser von s::can überwacht und kontrolliert die Dosierung von Chemikalien zur Reduktion von H2S (Schwefelwasserstoff). Dadurch wird die Dosierung effizienter, Geruchsbelästigung verringert, die Umwelt geschützt und die operativen Kosten gesenkt.
Hintergrund
Der Bezirk Santa Cruz entsorgt unbehandeltes Abwasser in seine Kläranlage. Einige der Rohre haben lange Verweildauer und leiden im speziellen im Sommer an den erhöhten H2S Konzentrationen, wenn die Temperaturen hoch und geruchsproduzierende Bakterien aktiver sind. Niedrige Konzentrationen von H2S verursachen gesundheitsschädliche Gerüche, in hoher Konzentration kann H2S tödlich sein. Zusätzlich bewirkt H2S die Korrosion von Beton. Das beeinträchtigt die Stabilität der Sammelkanäle und stellt eine potentielle Gefahr für die Umwelt dar. Die Kläranlage von Santa Cruz befindet sich in dicht bevölkertem Gebiet und Beschwerden über die Geruchsbelästigung häufen sich, wenn die Schwefelwasserstoff-Konzentration steigt. Um dieses Problem zu bekämpfen, wird zulaufseitig vor der Abwasseranlage eine nitratbasierte Chemikalie zur Geruchskontrolle zugeführt. Zwar ist diese Chemikalie effizient bei der Reduktion der gelösten H2S-Konzentration, jedoch ist die zu dosierende Menge aufgrund der sich rasch verändernden Konzentration schwer zu bestimmen. Das führt zu einer Verschwendung der Chemikalie bei einer Überdosierung und zu Beschwerden aufgrund der Geruchsbelästigung bei einer Unterdosierung.
Lösung von s::can
Um die Konzentration des gelösten Schwefelwasserstoffes genauer in Echtzeit messen und kontrollieren zu können, entschied sich der Bezirk Santa Cruz für eine der chemischen Dosierungsanlage nachgelagerten Installation des spectro::lysers. Einer der großen Vorteile des spektor::lysers ist seine Fähigkeit, mehrere wichtige Abwasser Parameter simultan zu messen, wie Nitrat, Nitrit, COD, BOD, TSS und gelöstes H2S. Für eine genaue Dosierung der nitratbasierten Chemikalie werden in Santa Cruz folgende Schlüsselparameter gemessen:
• Gelöstes H2S
• Nitrat-Konzentration
Durch die zeitgleiche Messung dieser zwei Parameter überwacht der Bezirk Santa Cruz nicht nur die Konzentration von Schwefelwasserstoff, sondern beobachtet auch, ob die nitratbasierte Chemikalie zur Geruchskontrolle überdosiert wird. Dadurch resultiert die Installation in einer besseren Kontrolle des H2S und einer Kosteneinsparung. Mehr:
http://www.s-can.at/de/waste-water/item/93-effiziente-h2s-schwefelwasserstoff-ueberwachung-der-klaeranlage-von-santa-cruz
(nach oben)
Stebatec: Komplette Sanierung eines Regenbeckens in Grenchen
Die veraltete Steuerungstechnik wurde auf den heutigen Stand gebracht. Sämtliche Prozesse wurden visualisiert und lassen sich nun mit dem Prozessleitsystem ARAbella per Browser online überwachen. Aber auch alle Pumpen, die Mess und die Elektrotechnik wurden grundlegend ersetzt.
Zum Projektbericht >>> http://www.stebatec.ch/fileadmin/user_upload/Referenzen/pdf/DE/STEBATEC_Projektbericht_RB_Schwimmbad_Grenchen.pdf
Quelle: http://www.stebatec.ch/unternehmung/news/artikel/komplette-sanierung-eines-regenbeckens-in-grenchen/
(nach oben)
HOMA: Keine Probleme mit Verstopfungen und Verzopfungen
In einem Pumpwerk im oberbayerischen Grassau waren bis Ende 2014 Pumpen aus den 1980er Jahren im Einsatz, die Anfang 2015 ausgetauscht wurden. Die neu eingebauten Pumpen mit optimierten Motoren und Hydrauliken sorgen jetzt für einen hohen Wirkungsgrad gemäß Premium Efficiency IE 3.
Um das Abwasser zukünftig effizienter zu fördern und dem zunehmenden Problem mit Verzopfungen entgegenzuwirken, entschied sich der Gemeinderat für einen Austausch der alten Modelle gegen neue Pumpen aus der EffTec-Baureihe von HOMA. Diese sind besonders für schwierige Einsatzbedingungen – beispielsweise eine erhebliche Feststoffbelastung – geeignet und wurden in Grassau nun erstmals in Trockenaufstellung eingesetzt. Durch den neu konzipierten Motor und die mechanisch optimierte Hydraulik zeichnen sich die Einkanalrad-Pumpen nicht nur durch einen hohen Wirkungsgrad sondern auch durch eine hohe Laufruhe aus, was die Lebensdauer der robusten Konstruktion zusätzlich erhöht. Die Aggregate fördern 13 l/s und laufen seit Januar 2015 störungsfrei.
„Die Pumpen, die wir bis 2014 im Pumpwerk im Erlenweg eingesetzt haben, waren bereits etwa 30 Jahre alt und im Vergleich zu heutigen Pumpenmodellen nicht mehr besonders effizient“, so Sebastian Stephan vom Wasserwerk Grassau. „Um auf den neuesten Stand der Pumpentechnik zu kommen und das Abwasser hier die nächsten Jahre optimal entsorgen zu können, hat sich der Gemeinderat daher für die Erneuerung des Pumpwerks entschieden.“ Da auf dem Gebiet der Marktgemeinde bereits mehrere Pumpen von HOMA erfolgreich im Einsatz sind, beschlossen die Verantwortlichen, auch dieses Mal Modelle des Herstellers aus der Nähe von Köln anzuschaffen. Nachdem es vor dem Austausch der Pumpen an den alten Aggregaten einen erkennbaren Anstieg von Problemen mit Verzopfungen gegeben hatte, fiel die Wahl zunächst auf Freistromradpumpen, die in dieser Hinsicht als besonders unauffällig gelten.
Nach der Installation der neuen Modelle kam es jedoch wieder zu Schwierigkeiten mit Verstopfungen. „Unserer Einschätzung nach lag das an der hohen Feststoffkonzentration und der relativ geringen Strömungsgeschwindigkeit innerhalb der Pumpe“, erklärt Markus Steimel, Leiter Service und Projektverantwortlicher bei HOMA. Generell beobachten die Mitarbeiter des Pumpenherstellers in jüngster Zeit eine Zunahme von Problemen mit verzopften Pumpen, was auf immer geringer werdende Fremdwasseranteile in den Abwasserkanälen und eine Zunahme von nicht-zersetzbaren Feststoffen – insbesondere Feuchttüchern – zurückzuführen ist. „Gerade bei Freistromradpumpen wird in Verbindung mit geringer Fließgeschwindigkeit durch den Zentrifugaleffekt eine Trennung des schwereren Wassers von den leichten Feststoffen begünstigt. Das führt letztlich zu den Verzopfungen“, so Steimel.
EffTec-Pumpen in Trockenaufstellung
Da die maximale Leistung der Pumpen in Grassau durch den zur Verfügung stehenden Stromanschluss begrenzt ist, konnte mit den bestehenden Modellen beziehungsweise der vorliegenden Laufradvariante keine positive Veränderung erzielt werden. HOMA empfahl daher den Einsatz von Pumpen aus der EffTec-Baureihe:
„Diesen neu entwickelten Pumpentypus haben wir bereits vor dem Projekt in Grassau in verschiedenen Pumpwerken mit erheblicher Feststoffbelastung eingesetzt und konnten dabei seine Zuverlässigkeit insbesondere unter schwierigen Einsatzbedingungen unter Beweis stellen“, erläutert Steimel. Nachdem es sich dabei aber ausschließlich um Pumpwerke in Nassaufstellung gehandelt hatte, wollte der Hersteller in Grassau die Verwendbarkeit der Aggregate in einem Pumpwerk mit horizontaler Trockenaufstellung testen. „Dass EffTec-Modelle wahlweise nass oder trocken aufgestellt werden können, liegt am PermaCool-System, einer neuartigen permanenten Motorkühlung“, so der Experte.
Für diese Baureihe wurde der gesamte Motor neu konzipiert. So sorgt beispielsweise das spezielle Design dafür, dass sich der Kühlmantel nicht mit Feststoffen zusetzen kann, wodurch eine hohe Betriebssicherheit erreicht wird. Unterstützt wird dies durch eine mechanisch sehr robuste Konstruktion sowie eine geringe Wicklungstemperatur, die zu einer niedrigeren thermischen Beanspruchung und damit zu einer längeren Lebensdauer führt. Durch den deutlich verbesserten Wirkungsgrad der Motoren erreichen die Modelle der EffTec-Baureihe die Klasse Premium Efficiency IE 3.
Einkanalräder mit großen Kugeldurchgängen
Um einen hohen Gesamtwirkungsgrad zu erzielen, wurden zusammen mit den Motoren auch die Hydrauliken verändert: Insbesondere die wesentlichen Komponenten jeder Kreiselpumpe, das Laufrad und das Pumpengehäuse, wurden komplett neu entwickelt. Um angesichts der veränderten Beschaffenheit des Abwassers mit immer mehr Feststoffen zuverlässig arbeiten zu können, verwendet die neue Baureihe ausschließlich geschlossene Einkanalräder mit großen Kugeldurchgängen, das heißt großen freien Durchgängen für Feststoffe: „Mit Hilfe von Strömungssimulationen haben wir ein Laufrad geschaffen, das nahezu ideale Strömungsbedingungen ohne störende Verwirbelungen generiert. Dadurch werden auch Faserstoffe optimal durch die Pumpenhydraulik geleitet und die Gefahr der Verzopfung auf ein Minimum reduziert“, erklärt Steimel. Zudem wurden die Hydrauliken mechanisch dahingehend überarbeitet, dass die EffTec-Baureihe eine sehr hohe Laufruhe aufweist, was die Beanspruchung aller Bauteile minimiert.
„Seit die Einkanalrad-Pumpen im Januar im Erlenweg eingebaut worden sind, hat es keine Probleme mit Verstopfungen mehr gegeben“, so Stephan. Neben einem störungsfreien Pumpwerk war für den Markt Grassau auch die schnelle Umsetzung der Demontage und Montage der Aggregate von entscheidender Bedeutung, da die komplette Abwasserentsorgung des Ortsteiles Mietenkam über dieses Pumpwerk läuft. Nach der Erneuerung liegt der Betriebspunkt der Anlage nun bei hman = 10 m und die Fördermenge bei 13 l/s. „Diese Werte unterscheiden sich deutlich von den Pumpen aus den 1980ern, beispielsweise lagen die Schaltpunkte bei den alten Modellen wesentlich träger“, erklärt Stephan. „Nach dem Austausch ist der Stromverbrauch nun merklich gesunken.“
http://www.homa-pumpen.de/de/news/presse/?hz=1PHPSESSID%3Dc4vqnrh0ikcp6ucduiv3ffhrk5&tx_ttnews%5BbackPid%5D=34&tx_ttnews%5Btt_news%5D=159&cHash=621c8421c557ba0c9ca793b81622e6af
(nach oben)
Neue Fermentation wird Biogas und Recyclingvon Nährstoffen revolutionieren
Patentierte Prozess für Stickstoff Entfernung aus organische Abfall
Vortrag von Dr. Ilkka Virkajärvi in Offenburg 2017
http://www.ductor.com/de/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/Virkajarvi_Offenburg2.pdf
Quelle: http://www.ductor.com/de/
(nach oben)
BIOGEST: Regenbeckenausrüstung mit neuester Technologie Automatische Reinigungssysteme
Schwallspüleinrichtungen haben sich als effizientes und am häufigsten eingesetztes Verfahren durchgesetzt. Autor: Thorsten Neuerer Starkregenereignisse kommen immer häufiger vor und stellen die Betreiber vor neue Herausforderungen. Die Kanalnetze sowie Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung müssen neu ausgebaut bzw. angepasst und mit moderner Maschinentechnik ausgerüstet werden. Die Aufgabe des öffentlichen Kanalnetzes ist es, häusliches Abwasser von den Haushalten zur Kläranlage zu transportieren. Im Regenwetterfall wird Regenwasser mit Abwasser häufig zusammen in einem Kanal gesammelt. Dies führt bei den so genannten Mischsystemen….
den ganzen Artikel lesen sie unter: http://www.biogest.de/wp-content/uploads/Neuerer-wwt-11-12-14.pdf
(nach oben)
Bieler+Lang GmbH :Artikel für das SENSOR MAGAZIN
Gaswarnsensoren: Mit Wärmetönung gefährliche Gase einfach zuverlässig aufspüren
Ob Methan, Propan oder Ethanol: Explosive Gase und Gase brennbarer Flüssigkeiten werden sowohl mit Wärmetönungs- als auch mit Infrarot-Technologie zuverlässig aufgespürt. Gaswarnsysteme, die auf das Messprinzip der katalytischen Verbrennung, also der Wärmetönung setzen, arbeiten je nach Anwendung jedoch wesentlich effizienter und effektiver als vergleichbare Infrarot-Systeme.
Die Gaswarn-Spezialisten der Bieler+Lang GmbH besitzen entsprechendes Know-how für beide Systeme und können zur entsprechenden Anwendung passende Lösungen anbieten. Dabei zeigt sich, dass Wärmetönungssensoren oder Pellistoren im Allgemeinen erheblich preisgünstiger sind: Ein klarer Vorteil gegenüber der Infrarot-Technologie. Zudem können diese eine deutlich größere Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten abdecken. So reagieren Pellistoren viel umfassender auf brennbare Gase und Dämpfe. Der Wärmetönungssensor wird auf das Gas kallibriert, welches das geringste Messsignal erzeugt. Andere vorhandene oder entstehende Gase lösen bereits zuvor einen Alarm aus.
Im Produkt-Portfolio von Bieler+Lang befinden sich derzeit drei Messfühler mit ähnlichen Eigenschaften:
Der Ex-Detector HC 100 zeigt sich in diesem Umfeld beispielsweise als günstiger Allrounder, um Kohlenwasserstoffe aufzuspüren. Der vielseitig einsetzbare Messfühler eignet sich für Ex-Zone 1. Auch in Gesamtsicherheitssystemen, die nach Sicherheits-Integritätslevel (SIL) 1 eingestuft sind, ist dieser Messfühler im Einsatz.
Auch der Ex-Detector HC 150 nutzt das Messprinzip der katalytischen Verbrennung und wird zur Messung der aktuellen Konzentration explosionsfähiger Gase und Gase eingesetzt. Eine aktuelle Neuerung dieses Messfühlers ist die kürzlich erfolgte BAM-Zertifizierung: Das renommierte Prüfinstitut bescheinigte mit seinem Funktionsgutachten die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen durch Übereinstimmung mit EN 60079-29-1 für den Einsatz in der Ex-Zone 2. Zudem ist das Gerät mit dem Sicherheits-Integritätslevel 1 (SIL 1) ausgezeichnet.
Ein weiterer Messfühler, der ExDetector HC 200 kann aufgrund seiner Stand-Alone-Fähigkeit ohne zusätzliches Auswertegerät selbstständig Schutzmaßnahmen einleiten. Zur Messung der aktuellen Konzentration explosionsfähiger Gase und Dämpfe wird der HC 200 ebenfalls in der Ex-Zone 2 eingesetzt.
Typische Anwendungsbereiche für diese Messfühler sind in der Petrochemie, in Lackierereien, Druckereien, Stahlwerken oder in Gastankstellen zu finden. Ein weiteres zukunftsweisendes Einsatzgebiet sind in diesem Zusammenhang Biogasanlagen. Der ExDetector HC 150 wird auch zur Leckage-Überwachung in Biogasanlagen mit Blockkraftheizwerk eingesetzt. Die Zusammensetzung von Biogas, welches im Wesentlichen aus Methan und Kohlendioxid sowie aus geringen Mengen von Spurengasen besteht, macht den Einsatz des Messefühlers an dieser Stelle so wertvoll.
http://www.bieler-lang.de/fileadmin/Artikel_Bieler_Lang_SENSOR-MAGAZIN_1610.pdf
(nach oben)
Rehau: Kunststoffschächte überzeugen im Materialvergleich – AWASCHACHT
Rund 78 Prozent des öffentlichen Kanalnetzes in Deutschland müssen mittel- bis langfristig saniert werden. Bislang setzten die Kommunen hauptsächlich auf Abwasserschächte aus Beton (71,6 Prozent) oder Mauerwerk (26,9 Prozent). Dass diese Materialwahl jedoch nicht mehr zeitgemäß ist, zeigt der faktenbasierte Vergleich durch unabhängige Institute mit den Kunststoffschächten AWASCHACHT von REHAU. Die Kunststofflösungen sind langfristig bis zu 37 Prozent günstiger als ihre Gegenstücke aus Beton und Mauerwerk sowie im alltäglichen Gebrauch deutlich sicherer, dichter, belastbarer und wartungsarmer. Und auch bei der Nachhaltigkeit können sie über ihren gesamten Lebenszyklus von rund 100 Jahren punkten.
Milliarden Euro müssen jährlich für die Sanierung beschädigter und undichter Abwasserschächte von den Kommunen ausgegeben werden. Die DWA-Studie zum „Zustand der Kanalisation in Deutschland“ 20151 zeigt, dass rund 26 Prozent aller Schäden an Betonschächten an Abdeckung und Rahmen auftreten, circa 22 Prozent an den Steighilfen, 12 Prozent machen undichte Anschlüsse aus und weitere 9 Prozent gehen auf das Konto von Infiltration beziehungsweise Exfiltration. Weitere 9 Prozent werden durch Risse verursacht. Hinzu kommt, dass laut einer Untersuchung des Instituts für unterirdische Infrastruktur (IKT) beinahe jeder zweite Betonschacht bereits beim Einbau undicht ist2. Dabei kostet beispielsweise die Behebung von Schäden an Abdeckung und Rahmen zwischen 500 und 1.000 Euro pro Schacht, für Ausbesserungen oder Verkleidungen an einer Betonschachtwand werden 3.000 bis 5.000 Euro3 fällig. Alle Schäden sind jedoch materialbedingt und können mit Kunststoffschächten vermieden werden.
Mechanische, thermische und chemische Vorteile
Sind Beton und Stein scheinbar unschlagbar beständige und harte Baustoffe, liegt exakt hier auch ihr Nachteil: Bereits leichte Erschütterungen wie darüber rollender Straßenverkehr können sie auf Dauer zermürben. Im Gegensatz dazu fängt ein AWASCHACHT aus reinem Polypropylen durch seine dynamische Belastbarkeit die Erschütterungen problemlos ab. Möglich macht dies die hohe Materialqualität, die eine optimale Ausgewogenheit zwischen hoher Steifigkeit und Schlagzähigkeit aufweist – ohne die Verwendung von Rezyklaten (Sekundärrohstoffe) oder Füllstoffen wie bei anderen Kunststoffschächten. Aufgrund dieser hohen Qualität entstehen auch keine Risse oder gar Abplatzungen. Dies schätzt auch die Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem, denn sie plant für ihre Auftraggeber mit homogenen und füllstofffreien Kunststoffabwassersystemen für eine Infrastruktur, die den zukünftigen Anforderungen an Kanalrohrsystemen entspricht.
Des Weiteren werden Schäden an Betonschächten auch durch aggressive Abwässer und Gase verursacht. Auch hier punktet ein AWASCHACHT durch seine Materialität: Hochwertiges Polypropylen widersteht sogar biogener Schwefelsäurekorrosion und kann selbst zur Ableitung aggressiver Industrieabwässer genutzt werden. Thermisch betrachtet stellen extreme Temperaturen von -20 °C bis kurzfristig 90 °C kein Problem dar. Abhilfe bei Korrosionsschäden an den Steighilfen – immerhin 22 Prozent aller Schäden4 – schafft REHAU mit dem korrosionsresistenten glasfaserverstärktem Kunststoff GFK, aus dem sie gefertigt sind.
Dass Kunststoffschächte aufgrund ihrer Materialeigenschaften also kaum saniert werden müssen, ist für Marco Agthe, Bereichsleiter Abwasser beim ZWAG (Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) Geiseltal, ein wichtiger Aspekt: Der Einbau von Kunststoffschächten und Rohren ist für ihn eine Investition für die Zukunft, da diese die Anforderungen für die Schmutzwasserentsorgung erfüllen und ihm unnötige Sanierungen ersparen.
Spezielles Dichtsystem sorgt für höchste Sicherheit
Damit die Kunststoffschächte direkt nach ihrem Einbau zu 100 Prozent fremdwasserdicht sind, hat der Hersteller ein spezielles Safety-Lock-Dichtsystem im Anschlussbereich entwickelt: Mit ihm sind versehentliche Verschiebungen der Dichtung beim Steckvorgang erst gar nicht möglich. Ebenfalls für höchste Sicherheit sorgt die Lage der Dichtungen: Sie sitzen geschützt in einer Sicke und dichten horizontal und radial ab.
Belastbare Leichtgewichte
Ein AWASCHACHT ist im Vergleich zu einem Betonschacht um 95 Prozent leichter. Dadurch wird für den Einbau kein schweres Gerät benötigt. Das geringe Gewicht und die auftriebssichere Verzahnung des Schachts mit dem Erdreich durch horizontale Verstärkungsrippen verhindern außerdem, dass der Schachtboden sich setzt oder kippt. Trotzdem ist er nachgewiesenermaßen bis 10 t Radlast belastbar, also ein doppelt so hohes Gewicht wie durch die Belastung mit einem LKW entsteht. Bröckelnde Mörtelfugen und absinkende Deckel werden durch die Lagerung mit einem in die Straße eingelassenen Auflagering vermieden. Setzt sich die Straße, setzt sich der Auflagerring mit.
100 Jahre Lebensdauer und bis zu 37 Prozent günstiger
Die AWASCHACHT-Produktfamilie bietet mit drei Schachtgrößen in DN 1000, DN 800 und DN 600 für jedes Kanalnetz die passende Lösung. Dahingegen sind Betonschächte überwiegend mit der Nennweite DN 1000 auf dem Markt erhältlich. So lassen sich allein mit einen bedarfsorientierten „Schachtmix“ die Materialkosten um bis zu 30 Prozent senken. Weiteres Einsparpotenzial bietet die Betriebsphase, die mit mindestens 100 Jahren doppelt so lang eingestuft wird wie bei Betonschächten mit 48,8 Jahren5. Vor allem durch die deutlich geringen Sanierungs- und Wartungskosten ist ein Kunststoffschacht über den gesamten Lebenszyklus hinweg um 37 Prozent günstiger als herkömmliche Betonschächte. Dies bewies eine neutral durchgeführte dynamische Kostenvergleichsrechnung nach DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.), in die Anschaffungs- und Betriebskosten gleichermaßen einflossen.
Und auch die Gesamtenergiebilanz eines AWASCHACHT muss den Vergleich mit einem Schacht aus Beton nicht scheuen: Über den gesamten Lebenszyklus ist er energiesparender als ein Kanalschacht aus Beton6 und allein die Co2-Emissionen lassen sich mit ihnen um 22 Prozent reduzieren7.
Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.rehau.de/awaschacht
(nach oben)
Eawag erneut zum Kooperationszentrum der Weltgesundheitsorganisation ernannt
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat der erneuten Ernennung der Eawag zu einem «Kooperationszentrum der WHO für Wasser und Siedlungshygiene in Entwicklungsländern» zugestimmt. Die Eawag ist eines von 21 solcher Zentren in der Schweiz und von 281 in Europa. Forschende aus den 12 Abteilungen der Eawag werden durch das Kooperationszentrum mit der WHO an gemeinsamen Aktivitäten in den Bereichen Wasser, Hygiene und globale Gesundheit mitwirken.
Im September 2016 erhielt die Eawag die Bestätigung ihrer erneuten Ernennung als Kooperationszentrum der WHO für weitere vier Jahre. Die erste Ernennung der Eawag erfolgte 2012 in Anerkennung ihrer Fachkompetenz in den Bereichen Feststoffabfälle, Wasser und Siedlungshygiene für Entwicklung und für ihre Einwilligung, Arbeiten zur Unterstützung von WHO-Zielen auszuführen. Die Ernennung der Eawag folgte auf die 1968 erfolgte Gründung des «Internationalen Referenzzentrums zur Abfallentsorgung», aus dem später die Abteilung für Wasser und Siedlungshygiene in Entwicklungsländern (Sandec) wurde. Vor Kurzem änderte die Sandec ihren Namen in Abteilung Siedlungshygiene und Wasser für Entwicklung, um ihren Zweck als Abteilung für angewandte Forschung besser widerzuspiegeln.
«Das Referenzzentrum wurde 1968 als Wissenshub und Dokumentationszentrum ins Leben gerufen», erklärt Christian Zurbrügg, Mitglied der Direktion und Gruppenleiter Sandec. «Unter der Führung von Roland Schertenleib verlagerte das Referenzzentrum den Fokus 1975 auf die Forschung, mit dem erklärten Ziel, zur globalen Evidenzbasis Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene (WASH) beizutragen. Dies war die Geburt der Abteilung Sandec und führte zu unserer Rolle als Zusammenarbeitszentrum der WHO.»
Zusammenarbeit mit Fokus auf sauberem Trinkwasser und nachhaltiger Abwasserentsorgung
Die Zusammenarbeit der WHO und Eawag wird sich in dieser nächsten Phase unter der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung allgemein auf das Thema sauberes Wasser und nachhaltige Abwasserentsorgung konzentrieren. Die Aktivitäten dieser Kooperation sind auf die vier Bereiche Wissenstransfer, Gender und WASH, Trinkwasserqualität und urbane Abwasserentsorgung aufgeteilt.
«Eines unserer Arbeitsgebiete sind unsere Bemühungen, zur ersten Ausgabe der WHO-Richtlinien für Siedlungshygiene beizutragen. In den nächsten vier Jahren werden wir fachlichen Input liefern, Sektor-Erfahrungen einbringen, bei der Verbreitung der Richtlinien Unterstützung bieten und Ländern bei deren Umsetzung zur Seite stehen», erklärt Christoph Lüthi, Abteilungsleiter von Sandec.
Die Gruppenleiterin Sara Marks beschreibt die Arbeit ihrer Gruppe als Fokussierung auf die Entwicklung und Felderprobung von Wasserqualitäts-Prüfungskits und Überwachungsprogrammen zur Ergänzung von «Water Safety Plans», die in risikobasierte Abhilfestrategien einfliessen. «Diese Aktivitäten werden beispielsweise im Rahmen einer laufenden Feldstudie von Wasserversorgungssystemen im westlichen Teil von Nepal in Zusammenarbeit mit HELVETAS und dem Programm REACH: Wassersicherheit für die Armen stattfinden», sagt sie.
Zu den Kooperationszentren der WHO gehören Forschungsinstitute, Hochschulfakultäten und andere Organisationen, die vom Generaldirektor mit der Ausführung von Aktivitäten zur Unterstützung der Programme der Organisation betraut werden. Derzeit gibt es weltweit über 700 WHO Zusammenarbeitszentren, die in Bereichen wie Krankenpflege, Arbeitsmedizin, übertragbare Krankheiten, Ernährung, psychische Gesundheit, chronische Krankheiten und Gesundheitstechnologien mit der WHO kooperieren.
http://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/news/eawag-erneut-zum-zusammenarbeitszentrum-der-weltgesundheitsorganisation-ernannt/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=334541a0c21c7fcbc62a92d4e1b6b9b2
(nach oben)
Nachklärbeckenoptimierung
Einfache Lösung – große Wirkung
Nachklärbecken sind das hydraulische Nadelöhr der Kläranlage. Auch wenn sie ausreichend groß bemessen sind, setzt sich der Schlamm sehr oft schlecht ab, weil insbesondere das Mittelbauwerk ungünstig gestaltet wurde.
In den vergangenen Jahren haben wir einige Nachklärbecken mit geringem Aufwand umgebaut und in allen Fällen deutliche Verbesserungen der Absetzwirkung erzielt. Nach einer Neudimensionierung des Mittelbauwerkes und Prüfung der Ablaufrinne wurde der Einlauf in das Nachklärbecken weiter nach unten geführt, der Einlaufspalt neu gestaltet und bemessen und die Verweilzeit im Mittelbauwerk erhöht. Weitere Details wie ein richtig bemessener und platzierter Strömungsring sorgen für eine gleichmäßige und horizontale Einströmung in die richtige Dichtezone.
Weiterlesen: Nachklärbeckenoptimierung :
http://www.bitcontrol.info/aktuelles/169-nachkl%C3%A4rbeckenoptimierung.html
http://www.bitcontrol.info/
(nach oben)
Selektive Teilstrombehandlung von hochkonzentrierten Abwässern
Entwicklung einer Abwasserweiche soll kommunale Kläranlagen energetisch entlasten.
Insbesondere in kleineren und mittleren Kommunen werden häufig Abwässer der ortsansässigen Industrie und des lokalen Gewerbes über die örtlichen Abwassersysteme der Kläranlage zugeführt. Durch stoßweise Einleitungen kann es dabei zu starken Belastungsschwankungen der Kläranlage kommen. Der hohe Energiegehalt des Abwassers bleibt dagegen ungenutzt.
Deshalb will der Forschungsverbund ESTA eine intelligente Abwasserweiche entwickeln. Diese soll hochbelastete Zuflüsse abtrennen und mittels einer anaeroben Behandlung – also unter Ausschluss von Sauerstoff – energetisch verwerten. ESTA ist ein Zusammenschluss der AKUT Umweltschutz Ingenieure Burkard und Partner, der Technischen Universität (TU) Berlin, der FG Siedlungswasserwirtschaft sowie der LAR Process Analysers AG. Der Forschungsverbund will damit innovative Informations-, Wissens- und Entscheidungsgrundlagen für ein regionales Wasserressourcen-Management in Deutschland entwickeln.
„Durch dieses neu zu entwickelnde Verfahren – eine Kombination aus Abwasserweiche und anaerober Behandlung – erwarten wir erhebliche Energieeinsparungen beim Betrieb der Belebungsstufe der Kläranlage. Dabei kann das in der Anaerob-Behandlung generierte Biogas den Energiebedarf der Kläranlage teilweise decken“, erläutert Projektkoordinator Diplom-Ingenieur Thilo Burkard (AKUT) die Relevanz des Projektes.
„Häufig sind Kläranlagen die größten kommunalen Energieverbraucher“, sagt Dr. Wolfgang Genthe (LAR Process Analysers AG). Entsprechend sei die Erforschung energieeffizienterer Verfahren in diesem Bereich aus Nachhaltigkeits- und Kostengründen dringend geboten. „Zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele wird auch kein Weg an intelligent gesteuerten energieeffizienteren Verfahren zur Behandlung von Abwasser vorbeiführen“, betont Genthe.
Zentraler Bestandteil des Projekts wird der Aufbau und Betrieb einer Versuchsanlage am Standort der Kläranlage Baruth in Brandenburg sein. Diese wird in Abstimmung mit den Projektpartnern TU Berlin und AKUT geplant und installiert. Für die Entwicklung einer angepassten Online-Analyse-Technik wird insbesondere der Projektpartner LAR Process Analysers AG zuständig sein. „Auf Basis der hier gewonnenen Erfahrungen und Messdaten werden wir ein vorläufiges Verfahrenskonzept entwickeln. Dieses wird im Anschluss mit Betriebsdaten von weiteren Kläranlagen mit vergleichbarem Zulaufprofil überprüft und adaptiert“, erläutert Genthe.
„Die Kombination von Abwasserweiche mit der Anaerob-Technik erscheint insbesondere an Standorten sinnvoll, an denen ein signifikanter Abwasseranteil aus indirekt einleitender Industrie mit hoher organischer Fracht für stark schwankende Zulaufkonzentrationen sorgt“, erklärt Professor Dr. Ingenieur Matthias Barjenbruch (TU Berlin).
Alle Projektpartner sind optimistisch, dass das neue Konzept künftig auf großes Interesse beim Neubau oder der Umrüstung von bestehenden Kläranlagen sowohl auf dem deutschen als auch dem internationalen Markt stößt. Damit werden alle Beteiligten im Sinne der KMU-i Förderinitiative profitieren. Die Kooperation mit dem Fachgebiet „Siedlungswasserwirtschaft“ der TU Berlin ergänzt die fachliche Expertise. Sie sorgt so dafür, dass universitär Forschende sowie Studierende an der Entwicklung marktreifer Technologien beteiligt sind.
Das Verbundprojekt „ESTA (FKZ 02WQ1382A)“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Förderinitiative KMU-innovativ: Nachhaltiges Flächenmanagement gefördert. Start war bereits am 1.10.2016.
Kontakt und Rückfragen:
Diplom-Ingenieur Thilo Burkard
AKUT Umweltschutz Ingenieure Burkard und Partner
Wattstraße 10
13355 Berlin
E-Mail: burkard@akut-umwelt.de
https://www.lar.com/de/news-events/news-display/article-management/detail-view/news/selektive-teilstrombehandlung-von-hochkonzentrierten-abwaessern.html
(nach oben)
HOLINGER: Umweltschädliche Methanemissionen
In verschiedenen Projekten hat HOLINGER auf die umweltschädlichen Methanemissionen in offenen Schlammstapeln hingewiesen und deren Ausmass abgeschätzt. South Pole Carbon unterstützt die Abdeckung von offenen Stapeln im Auftrag der Stiftung KliK und wickelt leistungsabhängige Bezuschussungen ab. In der gesamten Schweiz wurden bisher zehn solcher KliK-Projekte eingereicht. Insgesamt wurden fünf der bewilligten Projekte von HOLINGR umgesetzt. Ein weiteres Projekt ist in Vorbereitung. Die reduzierten Gasmengen sind fallweise von erheblicher Bedeutung. Mehr:
http://de.holinger.com/news/details/?tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&tx_ttnews%5Bday%5D=10&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2924&cHash=7760385bc4ccf2bab469c1104c8bc6ec
(nach oben)
Wissensmanagement in der betrieblichen Praxis – Erfahrungen aus einem Ingenieurbüro
Am 27. und 28. September 2016 fand im Maritim Hotel in Bonn die Bundestagung der DWA statt.
Etwa 300 Teilnehmer und 35 Aussteller besuchten die 30 Vorträge zu Themen wie die Wasserrahmenrichtlinie, die Herausforderungen des 2. Bewirtschaftungszyklusses, die Überflutungsvorsorge in der Praxis, die sichere Klärschlammentsorgung und Phosphorrückgewinnung, die Personalentwicklung im Zeichen des Wandels, das Wissensmanagement in der betrieblichen Praxis und das Forum Betriebspersonal: Kanal- und Kläranlagenbetrieb.
Unser Geschäftsführer Herr Henry Och hat im Rahmen dieser Veranstaltung einen Vortrag mit dem Thema „Wissensmanagement in der betrieblichen Praxis – Erfahrungen aus einem Ingenieurbüro“ gehalten.
Hier können Sie den Vortrag einsehen: http://born-ermel.eu/files/bornermel/uploads/pdfs/Vortraege%20und%20Veranstaltungen/20160928_Präsentation_DWA_28_9_16.pdf
http://born-ermel.eu/vortraege/vortraege-detailansicht/wissensmanagement-im-ingenieurbuero.html
(nach oben)
CLENS: Grünes Licht aus Brüssel – EU öffnet Weg für Flexibilisierung der KWK-Erzeugung
Mit der beihilferechtlichen Genehmigung der EU-Kommission fällt in Deutschland der Startschuss für den Bau neuer, für einen systemdienlicheren Betrieb geeigneter KWK-Anlagen. Durch die Einführung der verpflichtenden Direktvermarktung ist es für die Betreiber interessanter geworden, ihre KWK-Anlagen flexibel zu steuern, um so auf die fluktuierende Einspeisung aus erneuerbaren Energien zu reagieren. Über die Anbindung an ein virtuelles Kraftwerk kann die Erzeugungsflexibilität der KWK-Anlagen optimal genutzt und die Wirtschaftlichkeit erhöht werden.
Nachdem das im Januar 2016 in Kraft getretene KWKG 2016 zunächst noch unter dem Vorbehalt einer beihilfe-rechtlichen Genehmigung gestanden hatte, hat die EU-Kommission heute – mit einiger Verzögerung – offiziell ihre Genehmigung erteilt und somit die bestehenden Rechtsunsicherheiten beseitigt. Außerdem wird zum Jahreswechsel die Förderung von KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung zwischen 1 MW und 50 MW auf ein Ausschreibungsverfahren umgestellt, wobei die erste Ausschreibungsrunde allerdings erst zum Jahreswechsel 2017/2018 stattfinden soll.
Auch wenn die Ausschreibungspflicht kontrovers diskutiert wird, ist das KWKG 2016 aus Sicht der Clean Energy Sourcing AG (CLENS) ein wichtiger Schritt zur Integration von KWK-Anlagen in ein von erneuerbaren Energien geprägtes Energiesystem. Denn mit der verpflichtenden Direktvermarktung für Anlagen ab 100 kW und der Aussetzung der Förderung bei negativen Strompreisen werden durch den Gesetzgeber wichtige Flexibilisierungsanreize gesetzt. Ein Instrument zur direkten Förderung flexibler Anlagenkonzepte, wie es im EEG mit der sogenannten Flexibilitätsprämie erfolgreich zur Anwendung kommt, ist im KWKG 2016 allerdings leider nicht vorgesehen.
„Aus den veränderten Rahmenbedingungen ergeben sich für den Betrieb von KWK-Anlagen neue Möglichkeiten, die die Wirtschaftlichkeit der Anlagen erhöhen, jedoch auch technische und operative Anpassungen von Seiten der Betreiber erfordern“, erklärt Marcel Kraft, Poolmanager Virtuelles Kraftwerk bei CLENS. „Unsere Berechnungen zeigen, dass eine flexible Anlagenauslegung trotz eines höheren Investitionsbedarfs meist wirtschaftlich attraktiver ist als die ‚klassische‘ Grundlastauslegung.“
Grundlage hierfür ist eine strompreisorientierte Fahrweise der KWK-Anlage, die die Preisschwankungen an den Strommärkten aufgreift und die Stromerzeugung in Zeitphasen mit hohen Marktpreisen verlegt. Die dafür erfor-derlichen Zusatzinvestitionen werden durch das KWKG gefördert. Das gilt nicht nur für Wärmespeicher, für die die Betreiber einen Investitionskostenzuschuss erhalten, sondern auch für das größere BHKW: Eine Verdoppelung der installierten elektrischen Leistung führt, vereinfacht gesagt, zu einer Verdopplung der KWK-Zuschlagszahlungen über den Förderzeitraum, da die Zuschlagszahlungen in der Summe von der installierten Leistung abhängig sind. „Grob gerechnet finanzieren die zusätzlichen KWK-Zuschläge das zusätzliche BHKW“, so Kraft.
Aus einer flexiblen Anlagenauslegung, welche in aller Regel auch einen Wärmespeicher umfasst, ergeben sich darüber hinaus weitere Vorteile:
• Erhöhung des KWK-Anteils am Wärmeabsatz bei gleichzeitiger Reduzierung der KWK-bedingten Must-run-Stromeinspeisung
• Reduktion des Primärenergiefaktors im Wärmenetz (Einhaltung EnEV-Anforderungen)
• Maximierung der Strom-Vermarktungserlöse durch optimierten flexiblen Anlagenbetrieb
• Verlängerung der förderfähigen Betriebsdauer
„Um die Vorteile einer flexiblen Erzeugung nutzen zu können, bedarf es neben der technischen Anpassung der Anlagen in der Regel auch einer Anbindung an einen Kraftwerkspool“, erklärt Marcel Kraft. „Bei CLENS betreiben wir bereits seit über fünf Jahren ein virtuelles Kraftwerk, an das neben Wind- und Bioenergieanlagen auch Blockheizkraftwerke angeschlossen sind. Unter Berücksichtigung aller relevanten Restriktionen der einzelnen Anlagen – beispielsweise Wärmebedarf, Speicherfüllstand oder Brennstoffkosten – und der Preise an den jeweiligen Märkten, erstellen wir wirtschaftlich optimierte Fahrpläne für unsere Kunden und ermöglichen Ihnen damit, Ihre Vermarktungserlöse deutlich zu steigern.“ Die Vermarktungsoptionen reichen dabei von der langfristigen Absicherung der Stromerlöse am Terminmarkt bis hin zur hochflexiblen Kurzfristoptimierung im untertägigen Stromhandel. Die Teilnahme am Regelenergiepool kann jederzeit als ergänzende Erlösquelle genutzt werden.
Alle Interessierten, die mehr über die Chancen der Flexibilisierung der KWK-Erzeugung erfahren möchten, lädt CLENS zu kostenfreien Webinaren zum Thema „Betrieb und Wirtschaftlichkeit flexibler KWK-Anlagen“ ein. Mehr Informationen unter: www.clens.eu/webinar-kwk
Betreiber von KWK-Anlagen profitieren darüber hinaus von neuen Angeboten, die CLENS durch den Zusammenschluss mit dem italienischen Energiedienstleister Innowatio seit diesem Jahr auch in Deutschland anbietet. Dazu zählen die Identifikation und die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen sowie die Errichtung und der Betrieb dezentraler und flexibler KWK-Anlagen zur effizienten Energieversorgung im Rahmen von Contractingprojekten.
http://www.clens.eu/newsroom/pressemitteilungen/pressedetails/eintrag/2016/10/24/gruenes-licht-aus-bruessel-eu-oeffnet-weg-fuer-flexibilisierung-der-kwk-erzeugung/
(nach oben)
NIVUS: Kalibrierung mit 5 Durchflusssensoren erspart aufwändige Umbaumaßnahmen
Der Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht betreibt für seine Mitglieder (29 Gemeinden und Städte) eine Verbandskläranlage bei Forchheim am Kaiserstuhl. Die Kläranlage hat ein Einzugsgebiet von 650km² und eine Behandlungskapazität von 600.000 Einwohnerwerten. Sie reinigt das Abwasser von 375.000 Einwohnern und der Industrie- und Gewerbetriebe im Einzugsgebiet. Der Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht benötigt im Zulauf der Vorklärung eine genaue Durchflussmessung, die zu Verrechnungszwecken verlässliche Daten über zufließende Abwasservolumina bereitstellt. Aufgrund baulicher und betrieblicher Randbedingungen an der Messstelle, die zwischen Sandfang und Vorklärung, sind erhebliche asymmetrische Strömungsbedingungen vorhanden. Deshalb war der Einbau einer induktiven Durchflussmessung geplant. Der Einsatz dieser Messung wäre nur mit erheblichem Investitionsaufwand und baulichen Änderungen an der Messstelle möglich gewesen.
Alternativ zur induktiven Durchflussmessung wurde von NIVUS der Einbau von drei CS2-Sensoren und einer externen Füllstandmessung im Rechteckgerinne an der Messstelle vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde vom Abwasserzweckverband aufgegriffen. Voraussetzung für die Übernahme der Messtechnik nach einer Testphase war dabei die Einhaltung eines spezifischen Qualitätskriteriums: Das mit Hilfe der NIVUS-Messung ermittelte Tagesvolumen im Zulauf durfte maximal um ±3% von dem Tagesvolumen abweichen, das mit einer kalibrierten induktiven Durchflussmessung im Ablauf der Nachklärung ermittelt wurde.
Testmessungen über einen Zeitraum von drei Monaten ergaben, dass die Abweichungen zwischen den ermittelten Tagesvolumina der NIVUS-Messung und der induktiven Durchflussmessung fast ausschließlich im angestrebten Bereich von ±3% lagen. Damit erreichte die installierte NIVUS-Messung bereits das vorausgesetzte Qualitätskriterium.
Neben dem Vergleich zwischen den Messergebnissen der drei CS2-Sonden und der induktiven Durchflussmessung im Kläranlagenablauf, wurde eine COSP-Kalibrierung der NIVUS-Messung durchgeführt. COSP steht dabei für COrrelation Singulartity Profile. Die NIVUS-COSP-Technologie ist eine Methode unter ungünstigen Strömungsbedingungen Messungen der Fließgeschwindigkeit zu kalibrieren und zu justieren. Dabei kann die COSP-Kalibrierung mit Hilfe des neuen NivuFlow 750 M9 Messumformers unter Nutzung von bis zu neun Fließgeschwindigkeitssensoren nach dem Kreuzkorrelationsverfahren durchgeführt werden. Bei der COSP-Kalibrierung auf der Kläranlage Forchheim kamen 5 CS2-Keilsensoren zum Einsatz. Mit diesen Sensoren konnten zeitlich hoch aufgelöste Fließgeschwindigkeitsprofile aus jeweils 16 Einzelgeschwindigkeiten für 5 Messpfade gemessen werden. Diese Fließgeschwindigkeitsprofile wurden ausgewertet, um die Geschwindigkeitskomponenten in Totzonen und Randbereichen erweitert und zu einem zweidimensionalen Fließgeschwindigkeitsfeld interpoliert. Zusätzlich wurde die mittlere Fließgeschwindigkeit im betrachteten Fließquerschnitt ermittelt. Anschließend wurden die Abweichungen der mittleren Fließgeschwindigkeiten der COSP-Anwendung von den mittleren Fließgeschwindigkeiten der Messung mit drei Sonden berechnet.
Die Abschließende Bewertung ergab, dass die Messlösung mit drei Sonden, die als permanente Zulaufmessung vorgesehen ist, die mittlere Fließgeschwindigkeit der COSP-Referenzmessung nur um etwa 0,7% überschätzt. Die Messung wurde durch einen entsprechenden Korrekturfaktor justiert.
Quelle: Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht
Weitere Vergleichsmessungen über einen Monat ergaben, dass die mittlere Abweichung zwischen der NIVUS-Zulaufmessung und der Messung im Kläranlagenablauf mit Hilfe der COSP-Kalibrierung auf weniger als ±1% reduziert werden konnte. Damit war der ursprünglich geplante Einsatz einer induktiven Durchflussmessung nicht mehr notwendig. Die erheblichen Umbaumaßnahmen waren obsolet und das Investitionsvolumen bewegte sich auf einem Bruchteil des ursprünglich vorgesehenen Betrags.
Die vergleichenden Bewertungen zwischen den Durchflussmessungen im Zu- und Ablauf der Kläranlage Forchheim wurden vom Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht durchgeführt.
Das NIVUS-Team bedankt sich bei Herrn Schultz und Herrn Schweizer vom Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht herzlich für die Unterstützung der COSP-Kalibrierung und für die zur Verfügung gestellten Resultate der Vergleichsuntersuchung.
Die COSP-Kalibrierungen werden von der Abteilung für Stadthydrologische Messungen der NIVUS GmbH durchgeführt. Ihre Anwendung wird zur Kalibrierung und Justierung von Durchflussmessungen empfohlen, die an Messstellen mit ungünstigen strömungsmechanischen Randbedingungen (z.B. asymmetrische Anströmung) installiert sind.
Quelle: https://www.nivus.de/de/aktuelles-presse/presse/kalibrierung-mit-5-durchflusssensoren-erspart-aufwaendige-umbaumassnahmen/
(nach oben)
Pentair Jung Pumpen: ABWASSER UNTER DRUCK
8. OWL Abwassertag in Steinhagen
Zum achten Mal lud der Pumpenhersteller Pentair Jung Pumpen interessiertes Fachpublikum zum jährlich stattfindenden OWL Abwassertag nach Steinhagen ein. Die hochkarätig besetzte Veranstaltung mit dem diesjährigen Titel „Abwasser unter Druck“ beschäftigte sich mit dem Thema Druckentwässerung und lockte 160 Besucher aus ganz Deutschland nach Ostwestfalen Lippe (OWL). Die Referentinnen und Referenten aus Forschung und Praxis betrachteten die Druckentwässerung aus verschiedenen Blickwinkeln und lieferten facettenreiche Einblicke.
Potentiale der Druckentwässerung
Marco Koch, Leiter der Verkaufsförderung bei Gastgeber Jung Pumpen, gab einen kurzen Abriss über die Geschichte der Druckentwässerung. Das Verfahren hat in Deutschland Tradition. Erstmals wurde es 1968 in größerem Umfang in Hamburg angewendet, inzwischen sind bundesweit etwa 350.000 bis 400.000 Pumpstationen im Einsatz. Seit mehr als 30 Jahren bietet der Steinhagener Pumpenhersteller Schacht-, Pumpen- und Steuerungstechnik an. Nach dieser langen Zeit liegen die Potentiale nun in der Sanierung, denn der „Zahn der Zeit“ hat den Anlagenkomponenten zugesetzt. Für Druckentwässerungsschächte aus Kunststoff trifft das nicht zu. Sie sind korrosionsfest und haben daher kein Alterungsproblem. Ganz anders sieht es bei dem Schachtinnenleben aus. Oft ist dieses korrodiert und muss ersetzt werden. Dieser Ausgangslage tragen Austauschsets Rechnung. Sie bestehen aus Traverse, Kupplung, Kugelhahn und Rückschlagventil. Alle Komponenten sind aus korrosionsfesten Materialien (Kunststoff und Edelstahl) und können komplett gegen die alten Schachtinnereien ausgetauscht werden. Da sowohl der Kunststoffschacht als auch die Pumpe erhalten bleiben, ist die Investition für das Set und den Umbau eher gering. Der Austausch der Traverse mitsamt der Peripherie kann mit geringsten Flurschäden erfolgen, da allenfalls der Druckrohranschluss – sofern er außerhalb des Schachtes erfolgt – kleinere Erdarbeiten erfordert.
Dichtheitsprüfung von Druckleitungen – geht das?
Lassen sich Druckleitungen prüfen und wo liegen die Besonderheiten? Diese Frage warf Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.- Ing. Sissis Kamarianakis vom Institut für Unterirdische Infrastruktur (IKT) auf. Hierzu wird am IKT intensiv geforscht und folgende Erkenntnisse lassen sich zusammenfassen: Es gibt verschiedene Verfahren zur Dichtheitsprüfung von Druckleitungen aber keine klaren Regelwerke zur Sanierung. Auch sind die Prüfverfahren nicht immer anwendbar, z.B. weil der vorgeschriebene 1,5 fache Systemdruck womöglich die Leitung beschädigt oder die Prüfung schlicht zu zeitaufwendig ist. Da Druckleitungen dem Geländeverlauf angepasst sind, gibt es viele Hoch- und Tiefpunkte oft aber keine Be-und Entlüftungsventile , so dass Lufteinschlüsse die Prüfergebnisse verfälschen. Inspektionsöffnungen sind selten und so beschränken sich die Inspektionen im Regelfall auf die Pumpstationen. Häufig handelt es sich um kilometerlange Leitungen, deren genauer Verlauf nicht immer bekannt ist. Auch sind vorhandene Inspektionstechniken aus dem Freispiegelbereich in der Regel nicht übertragbar, da diese häufig erst ab DN 200 und damit nicht in den in den dünnen Druckleitungen einsetzbar sind. An verkürzten und optimierten Prüfverfahren wird derzeit gearbeitet.
Auf die Pflege kommt es an
Das Einzugsgebiet des Brandenburgischen Herzberger Wasser- und Abwasserzweckverbandes (HWAZ) ist eine ländlich geprägte und vom Bevölkerungsrückgang stark betroffene Region. Mit der Einwohnerzahl sank auch die jährliche Wasserabgabe, während die Kosten für die Infrastruktur gleich blieben. Dennoch mussten Spitzenlasten bedient werden, was laut Verbandsvorsteher Mario Kestin zwangsläufig Preissteigerungen nach sich zog und ein Umdenken erforderte. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Folgekosten rechnete sich die Druckentwässerung für den HWAZ und so wurden von 1997 bis 2001 über 158.000 m Druckleitungen verlegt, 181 Haupt- und Zwischenpumpstationen sowie 765 Hauspumpstationen errichtet. Aus deren Instandhaltung und Pflege liegen folgende Erfahrungen vor: Nicht die Länge von Druckleitungen ist entscheidend für das Auftreten von Verstopfungen, sondern z.B. zusätzliche Sonderbauwerke (Düker) oder auch nicht genutzte Hausanschlussdruckleitungen. Als Konsequenz daraus werden inaktive Hausanschlüsse nachträglich abgesperrt bzw. vor Wiederinbetriebnahme entsperrt und entlüftet sowie verstopfungsgefährdete Sonderbauwerke regelmäßig gespült. Kompressorstationen spülen automatisch die Druckleitungen und verhindern so Ablagerungen sowie Geruchsbelästigungen am Druckleitungsende. Die Haupt- und Zwischenpumpwerke unterliegen einer 14- tägigen optischen Kontrolle vor Ort und eine jährliche Zustandsanalyse gibt Aufschluss über den Handlungsbedarf.
Abwasserpumpen – alles Öko oder was?
Bevor Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen vom Institut für Strömungsmechanik der der TU Berlin auf europäische Ökodesign-Richtlinie zu sprechen kam, ging es zunächst um Müll im Abwasser und dessen Auswirkungen auf die Abwasserinfrastruktur. Das Team um Professor Thamsen hat eine zunehmende Verstopfungshäufigkeit von Abwasserpumpen festgestellt und sieht hier einen klaren Zusammenhang zu einem stark wachsenden Anteil an Vliesstoffen wie Feucht-, Wisch- und Reinigungstüchern im Abwasser. Hier kommt die europäische Ökodesign-Richtlinie ins Spiel. Ihr unterliegen alle energiebetriebenen Produkte die europaweit ein Marktvolumen von mehr als 200.000 Stück besitzen, von denen erhebliche Umweltauswirkungen ausgehen und die ein hohes Potential bei der Verbesserung der Umweltverträglichkeit aufweisen, – mit anderen Worten auch Abwasserpumpen. Haben diese einen geringen Energieverbrauch, so erfüllen sie die europäischen Anforderungen. Die Funktionalität der Pumpen wird dabei nicht betrachtet. Dies würde in der Konsequenz das Aus für Freistromradpumpen bedeuten, obwohl diese, gerade mit Blick auf die Faserstoffe im Abwasser, technisch viel besser geeignet wären. Allein die schlechtere Energieeffizienz gegenüber z.B. Kanalradpumpen würde sie disqualifizieren. Diesen Missstand will Prof. Thamsen nicht hinnehmen und führte mit synthetischem Abwasser (abgeleitet aus Rechengutanalysen von Klärwerken) eine Funktionsprüfung für Abwasserpumpen durch. Diese Prüfung ergab, dass mit steigender Verschmutzung des Abwassers der Wirkungsgrad von Kanalradpumpen sinkt, während der von Freistromradpumpen steigt, obwohl diese weniger energieeffizient sind. Eine Erkenntnis, die nach Meinung von Professor Thamsen die Brüsseler Energiekommissare keinesfalls außer Acht lassen sollten.
Satzungsregelungen – welche sind sinnvoll, welche nicht?
Rechtsanwältin Daniela Deifuß-Kruse von BRANDI Rechtsanwälte in Paderborn führte zu Sinn und Unsinn von Regelungen in Entwässerungssatzungen im Bereich der Druckentwässerung aus. Insbesondere die Satzungsregelungen zur Wartung der privaten Anlagenteile sind oftmals entweder realitätsfremd und unpraktisch oder rechtlich fragwürdig. Soweit beispielsweise gefordert wird, dass der Grundstückseigentümer einen Wartungsvertrag mit einem Fachunternehmer abschließen muss, der eine Wartung der Druckpumpe entsprechend den Angaben des Herstellers sicherstellt, ist dies rechtlich bedenklich. Zum einen kann der Anlagenbetreiber nur solche Regelungen treffen, die zum Schutz des Betriebs der öffentlichen Anlage wirken – dies ist aber bei dem Verweis auf Herstellerregelungen nicht gesichert. Zum anderen ist die Verpflichtung zum Abschluss eines Vertrages mit einem Dritten bedenklich. Die starre Regelung lässt z.B. nicht zu, dass bei eigener Fachkunde die Wartung selbst durchgeführt wird. Eine gerichtliche Überprüfung solcher Regelungen unter diesen Gesichtspunkten fehlt zwar noch – bei der Gestaltung oder Überarbeitung von Satzungen sollte jedoch nach geeigneteren und sichereren Formulierungen gesucht werden.
Das DWA Arbeitsblatt A113 ist in Bearbeitung
Prof. Dr. habil. Hartmut Eckstädt stellte das sich in Bearbeitung befindliche neue Arbeitsblatt DWA-A 113 vor, welches künftig das bisherige Regelwerk ergänzen wird. Es wurde für die hydraulische Dimensionierung und den Leistungsnachweis von Abwasserdrucksystemen außerhalb von Gebäuden entwickelt. Im Fokus stehen die abwasserspezifischen Besonderheiten von Abwasserdrucksystemen sowie die Betrachtung des Gesamtsystems. Im Anhang des Arbeitsblattes finden sich zahlreiche Hinweise zu Bemessung, Gestaltung und Betrieb sowie eine Reihe von Rechenbeispielen. Derzeit wird das Gelbdruckverfahren vorbereitet, das heißt, der Normentwurf liegt demnächst zur Prüfung und Stellungnahme vor. Laut DWA wird es künftig eine Gemeinschaftspublikation geben, die die Arbeitsblätter DWA-A 134 (Planung und Bau von Abwasserpumpanlagen), DWA-A 116 (Druckluftspülung von Abwassertransportleitungen) Teile 1-3, DWA-A 113 und die europäische Normung prEN16932 Teile 1-3 zusammenfassen soll.
Effektiv gegen Schwefelwasserstoff
Sulfide sind für die Korrosion von Pumpen, Leitungen und Schächten sowie für Geruchsemissionen verantwortlich und es gilt, diese intelligent zu reduzieren. Dr.-Ing. Ute Urban von der Energie- und Umweltberatung erklärte, dass mit zunehmender Länge von Abwasserleitungen der Sulfatgehalt abnimmt und zu Sulfid reduziert wird. Der Schwefelwasserstoff führt dann zu Geruchs- und Korrosionsproblemen. Nach modellhaften Untersuchungen präsentierte Frau Dr. Urban zwei Verfahren, die Sulfide sehr effektiv reduzieren. Zum einen hat sich die feinblasige Belüftung durch einen mit Löchern versehenen Schlauch, der direkt in die Abwasserleitung eingebracht wird, als wirksam erwiesen. Hier ist die Auswahl des Einsatzortes entscheidend. Zum anderen ist es gelungen, durch ein intelligentes Dosiersystem zur chemischen Abwasserbehandlung den Sulfidgehalt deutlich zu reduzieren. Das System, welches in Zusammenarbeit mit der ECH Elektrochemie Halle GmbH entwickelt wurde, misst den Gehalt von Schwefelwasserstoff und dosiert bedarfsgenau die Chemikalienmenge, die eine Bildung des Gases verhindert. Dadurch können Kosten gespart und eine unnötige Umweltbelastung durch Überdosierung verhindert werden.
Resümee und Ausblick
So breitgefächert wie das Publikum war auch der Blick auf das Thema, das kam bei allen Teilnehmern gut an. Vertreter von Städten und Kommunen, Zweckverbänden, Kläranlagen, Abwasser – und Umweltbetrieben sowie Planer und Tiefbauer aber auch Vertreter aus der Wissenschaft nutzten die Möglichkeit, einmal über den Tellerrand zu blicken. Auch im nächsten Jahr gibt es wieder die Möglichkeit dazu. Am 19. Januar 2017 wird der 9. OWL Abwassertag stattfinden. Themenvorschläge werden gern entgegen genommen. Im August wird das neue Programm veröffentlicht.
http://www.jung-pumpen.de/service/presse/presse-details/article/abwasser-unter-druck-1.html
(nach oben)
Neutralox Umwelttechnik GmbH: Geruchsbehandlung
Die Neutralox Umwelttechnik GmbH hat sich mit Verfahren der physikalisch-chemischen Abluftreinigung, auf die Behandlung von Abluft und Gerüchen aus der Abwasserreinigung spezialisiert.
Die Sammlung, der Transport und die Behandlung von Abwasser sind mit Geruchsemissionen verbunden. Gerüche stellen jedoch i.d.R. nur dann ein Problem dar, wenn Gebäude nahe der Emissionsquelle stehen. Die TA-Luft fordert „Soweit in der Umgebung einer Anlage Geruchseinwirkungen zu erwarten sind, sind die Möglichkeiten, die Emissionen durch dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen weiter zu vermindern, auszuschöpfen.“
Die Art der Geruchsemissionen kann relativ stark variieren. Im Bereich der Abwasserableitung werden Geruchsemissionen durch anaerobe Verhältnisse begünstigt. Verweilzeit und Temperatur, Sulfat und Sauerstoffkonzentration, Konzentration an organischem Material und Turbulenzen beeinflussen die Emission von Gerüchen. Abwasserpumpstationen sind daher häufig mit Geruchsbehandlungsanlagen auszustatten. Auf Kläranlagen treten Geruchsemissionen vor allem im Bereich der mechanischen Reinigung und in der Schlammbehandlung auf.
Schwefelwasserstoff (H2S) ist ein bekannter und häufig angeführter Stoff zur Beschreibung von Geruchsemissionen. H2S entsteht durch die biologische Reduktion von organischen Schwefelsubstanzen und Proteinen unter anaeroben Verhältnissen. H2S ist farblos, potentiell giftig und wird üblicherweise mit einem Geruch von faulen Eiern charakterisiert. H2S ist korrosiv und schon in geringen Konzentrationen geruchsintensiv. Ein Geruch von faulen Eiern kann auf Kläranlagen jedoch nur selten festgestellt werden. Der Grund ist, das Geruchsemissionen auf Kläranlagen nicht nur H2S, sondern auch viele andere organische und anorganische Substanzen enthalten. H2S kann dabei ggf. als Leitparameter oder Indikator verwendet werden, aber nicht zur Beschreibung aller Gerüche.
H2S tritt häufig in Verbindung mit Dimethyl Sulfid (DMS) und Merkaptanen auf. Die letztgenannten haben geringere Geruchsschwellen als H2S und stellen in Bezug auf die Geruchsproblematik daher häufig das größere Problem dar. Indole und Skatole sind für die typischen Fäkalgerüche verantwortlich. Ammoniak steht häufig mit der Schlammbehandlung in Verbindung.
Die in der Literatur angegebenen Geruchsschwellen gelten i.d.R. nur für die Einzelstoffe, nicht für die Stoffe als Teil einer komplexen Geruchsfracht, so wie sie auf Kläranlagen angetroffen werden. Ein Einzelstoff kann immer nur als Indikator eines Geruchs angesehen werden. Die Beschreibung eines Geruchs erfolgt in der Regel mit Hilfe einer dynamischen Olfaktometrie nach DIN EN 13725.
Die TA-Luft fordert: „Sofern eine Emissionsbegrenzung für einzelne Stoffe oder Stoffgruppen, z.B. für Amine, oder als Gesamtkohlenstoff nicht möglich ist oder nicht ausreicht, soll bei Anlagen mit einer Abgasreinigungseinrichtung die emissionsbegrenzende Anforderung in Form eines olfaktometrisch zu bestimmenden Geruchsminderungsgrades oder einer Geruchsstoffkonzentration festgelegt werden.“
Eine Ableitung der Geruchsstoffkonzentration aus der gemessenen H2S-Konzentration ist nicht möglich. Zu verschieden kann die Zusammensetzung der Geruchsfracht sein.
Als Zielwert einer Geruchsbehandlung werden häufig 500 GE/m³ angesetzt. Dieser Wert wird z.B. für Abgasreinigungseinrichtungen für Klärschlammtrocknungsanlagen vorgeschrieben. Dieser Wert muß am Austritt der Geruchsbehandlungsanlage eingehalten werden und ist i.d.R. ausreichend um in der Umgebung der Kläranlage eine zusätzliche Geruchsbelastung zu vermeiden.
http://www.neutralox.com/de/verfahren/geruchsbehandlung.html
(nach oben)
SIEMENS: Optimierung von Kläranlagen mit Advanced Process Control
Wie kann der Betrieb von Kläranlagen, insbesondere die Belüftung der biologischen Reinigungsstufen, mithilfe der Advanced Process Control Funktionen von SIMATIC PCS 7 optimiert werden?
Sie wollen den Betrieb ihrer Kläranlage optimieren, beispielsweise im Hinblick auf Prozess-Stabilität, Energieverbrauch und Einhaltung von Ablaufwerten?
Sie wollen eine Automatisierung, die einheitlich, übersichtlich und einfach anzupassen ist?
Das vorliegende White Paper bietet einen Überblick, wel-che regelungstechnischen Ansätze hierfür in Frage kom-men und wie Sie mithilfe der SIMATIC PCS 7 Advanced Process Library transparent und aufwandsarm realisiert werden können. Mehr:
http://w3.siemens.com/mcms/water-industry/de/ihre-wasseranlage/Documents/Optimierung-von-Klaeranlagen.pdf
(nach oben)
BARTHAUER: Die Ratten sind auf dem Rückzug! Schädlingsbekämpfung mit Betriebsführungssoftware BaSYS Regie
Ausgangslage
Laut Schätzungen leben bis zu 350 Millionen Ratten in Deutschland, das sind rund vier Ratten pro Einwohner. In milden Wintern vermehren sie sich explosionsartig. Die Betreiber von abwassertechnischen Anlagen sind nach den deutschen Unfallverhütungsvorschriften zur Rattenbekämpfung verpflichtet.
Eine professionelle Schadnagerbekämpfung setzt sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:
– Befallsermittlung und Befallsorte
– Entscheidung, ob, wo und mit welchem Produkt bekämpft wird
– Durchführung der Bekämpfung · Erfolgskontrolle und weitere Maßnahmen
– Dokumentation
Diese Maßnahmen müssen koordiniert und verwaltet werden. Ist die Digitalisierung dieser Routinearbeiten wirklich sinnvoll? Dieses Praxisbeispiel der KISTERS AG zeigt, wie mit einer Betriebsführungssoftware die Arbeitsabläufe nicht nur geregelt, sondern auch vereinfacht werden.
Als Partner der Barthauer Software GmbH vertreibt und konfiguriert die KISTERS AG BARTHAUER Software bei Versorgungsunternehmen und Kanalnetzbetreibern. Hauptprodukte der Barthauer Software GmbH sind das datenbankbasierte Netzinformationssystem BaSYS sowie das Geoobjects Design Studio GeoDS, der Baukasten für individuelle Informationssysteme. Als Werkzeug für ein umfassendes Netzmanagement bietet BaSYS unter anderem Lösungen für Betriebsführung und Wartung der Anlagen mit integriertem mobilem Workforce-Management.
Kanalreinigung und Schädlingsbekämpfung mit Betriebsführungssoftware BaSYS Regie
Klassisches Thema für Kanalnetzbetreiber ist die turnusmäßige Arbeit der Kanalreinigung. Dazu setzte KISTERS bei einem kommunalen Kanalnetzbetreiber in Nordrhein-Westfalen die Betriebsführungssoftware BaSYS Regie von BARTHAUER ein. BaSYS Regie verwaltet alle Arbeitsabläufe, die für die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen von Kanalnetzen (Eigenkontrollverordnung) notwendig sind. Es ermöglicht die Verwaltung aller zu wartenden Anlagen, der Bibliotheken der Wartungsabläufe, der Aufträge, der Unterhaltungsplanung sowie der Auswertungen und Berichte. Für den Einsatz auf mobilen Geräten wird BaSYS Regie durch BaSYS Regie Mobil erweitert.
Teil der Wartung ist die Kanalreinigung und die dazugehörige Schädlingsbekämpfung. Dazu beauftragte der kommunale Kanalnetzbetreiber ein privates Schädlingsbekämpfungsunternehmen. Grundvoraussetzung für die Auftragsvergabe war, dass dieser für die Dokumentation der Arbeiten BaSYS Regie Mobil einsetzt. Hintergrund ist, dass durch Nutzung von BaSYS Regie im Büro beim Kanalnetzbetreiber und BaSYS Regie Mobil durch das Schädlingsbekämpfungsunternehmen vor Ort die Übergabe und Auswertung der Daten vor und nach der Schachtüberprüfung ohne Probleme möglich ist. Darüber hinaus sind die Schachtarbeiten durch das private Unternehmen exakt dokumentierbar. Das schafft Transparenz und Sicherheit, auch für die Abrechnung.
Konfiguration und Arbeitsweise
Die laut Leistungsverzeichnis erforderlichen Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung wurden von KISTERS in der Anwendung BaSYS Regie Mobil auftragsgerecht konfiguriert. So integrierte KISTERS die Arbeitsvorlage „Schädlingsbekämpfung“ in die Bibliothek für Arbeitsvorlagen im Bereich Schachtarbeiten. Mit dieser Arbeitsvorlage war die schachtbezogene Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte und Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung problemlos möglich.
Die Schädlingsbekämpfung erfolgte durch die Mitarbeiter des Privatunternehmens direkt am Schacht. Dazu fuhren zwei Mitarbeiter turnusmäßig die einzelnen Schächte ab, öffneten diese und entschieden vor Ort, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Die Ergebnisse der überprüften Schächte wurden anschließend über eine Schnittstelle in BaSYS Regie importiert und standen dort zur Auswertung bereit. Gleichzeitig wurden die Abläufe in BaSYS Regie Mobil so definiert, dass dem mobilen Team die eigenen Ergebnisse aus der Erstbegehung eigenständig angezeigt werden. Somit ist das Team mit Unterstützung des Programmes in der Lage, eine gezielte Nachkontrolle autonom durchführen und dokumentieren zu können.
Die Arbeitsvorlagen können je nach Kundenwunsch individuell angepasst werden.
Fazit und Nutzen
Wie dieses Beispiel aus der Praxis zeigt, ist die Digitalisierung von Routinearbeiten durchaus sinnvoll. Bei diesem kommunalen Netzbetreiber setzte KISTERS die Betriebsführungssoftware BaSYS Regie Mobil aus dem Hause BARTHAUER ein. Dem Betreiber brachte BaSYS Regie und dessen mobile Anbindung einen deutlichen Mehrwert.
1. BaSYS Regie Mobil ist eine Arbeitsunterstützung für die Außendienstmitarbeiter vor Ort und liefert zeitgleich auswertbare Ergebnisse für das Büro.
2. Verschiedene Abteilungen greifen auf die Kanaldaten zu und nutzen diese für unterschiedliche Prozesse. Durch diese mehrdimensionale Nutzung der Kanaldaten werden Arbeitsabläufe optimiert und zeitsparend durchgeführt. Auch die Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen wird somit erleichtert.
3. Die detaillierte Dokumentation der Arbeitsschritte vor Ort schafft Transparenz und Sicherheit, auch für die Leistungsabrechnung.
4. Im Zuge turnusmäßiger Wartungsarbeiten am Schacht werden auch die entsprechenden Kanaldaten stetig aktualisiert. Durch den Einsatz von BaSYS Regie Mobil werden die aktualisierten Daten über eine Schnittstelle automatisch in die Datenbank importiert.
http://www.barthauer.de/Single.83+M58bccd2f026.0.html
(nach oben)
EES: „ Die WebRTU – die all-in-one Lösung für Regenüberlaufbecken“
Regenüberlaufbecken nehmen im Kanalnetz eine immer wichtigere Bedeutung ein, da Starkregenfälle mit zunehmender Intensität und Häufigkeit auftreten. Die Betreiber von Regenüberlaufbecken und Stauraumkanälen sind vom Gesetzgeber dazu verpflichtet, ihre Anlagen regelmäßig zu überprüfen. Aber auch für eine optimierte Beckenbewirtschaftung und als Planungsgrundlage für mögliche Erweiterungen der Anlage sind verlässliche Betriebsdaten und Messwerte nötig. Dazu sind die Anlagen mess- und steuerungstechnisch auszurüsten und die Daten regelmäßig auszuwerten.
Mit der WebRTU als all-in-one Lösung für Regenüberlaufbecken bietet EES ein Produkt an, das alle wesentlichen Funktionen in einem kompakten Gerät vereint. „Auf Knopfdruck“ oder periodisch wird der RÜB-Bericht generiert und automatisch an die betreffenden Empfänger z.B. per Email oder FTP zugesendet. Der Excel- basierte Bericht erfüllt die Nachweispflichten für Regenüberlaufbecken und ähnliche Sonderbauwerke und kann auch auf der WebRTU archiviert werden. Dadurch kann dieser zusätzlich mittels eingebauten Web-Browser visualisiert werden.
Weiterhin beinhaltet die Lösung z.B. Ereignisprotokolle in Form eines Meldebuchs, schichtplanabhängige Alarmierung bei Fehlerzuständen von Aggregaten und Messeinrichtungen, die per SMS oder Email übermittelt werden können. Der Beginn, das Ende, die Dauer, die Anzahl und abgeschlagene Mengen aller Einstau- und Überlaufereignisse wird erfasst, berechnet und ggf. an ein Leitsystem mittels genormten IEC 60870-5-104 Protokoll übertragen. Ebenso lassen sich Kopplungen an die SIMATIC S7 über ISO on TPC realisieren. Damit lässt sich die WebRTU in Regenüberlaufbecken, in denen bereits eine S7-Steuerung integriert ist, zur Visualisierung, Überwachung, Protokollierung und zum Fernwirken nachrüsten. Zur schnellen Fehlerdiagnose kann über die integrierte Visualisierung eine (Fern-) Diagnose eingerichtet werden. Daten können mobil via Notebook, Tablet oder Smartphone abgerufen werden. Durch den Einsatz von skalierbaren Vektorgrafiken lassen sich die Webseiten ohne Verlust an Auflösung auf allen Endgeräten darstellen. Mittels dynamischer Objekte kann das Regenüberlaufbecken und der Zustand aller angeschlossenen Aggregate dargestellt werden. Änderungen von Schaltbefehlen, Parameter und Sollwert lassen sich direkt aus der Visualisierung heraus vornehmen. Wir bieten eine fertig projektierte Musterlösung für den RÜB-Controller an, die bereits alle wichtigen Elemente wie beschrieben beinhaltet. Das vorbereitete Projekt kann individuell angepasst und beliebig vom Anwender erweitert werden. Dank der Musterlösung können erste Projekte unter enormer Zeitersparnis schnell und sicher umgesetzt werden.
Die WebRTU ist mit allen wichtigen Schnittstellen und Prozessankopplungen bereits ausgerüstet, wie z.B. Ethernet, RS485 und RS232, USB-2.0. Darüber hinaus mit optionalem 3G Modem, einer SD-Karte und optionalen 16 x digitalen E/As sowie 8 x AE und 2 x AA.
Die all-in-one Lösung für Regenüberlaufbecken biete zahlreiche Vorteile in einem kompakten Gerät, dass in rauen Umgebungsbedingungen bis -40°C eingesetzt werden kann. Da alle Daten auf der WebRTU vorliegen, bedarf es keiner Cloud-
• Lösung, die Abhängigkeit von einem weiteren Provider birgt. Die Lösung bietet alle Funktionen und eine enorme Zeitersparnis und schnelle Resultate durch individuell anpassbare Musterlösungen, bei einem einzigartigem Preis- / Leistungsverhältnis.
Elektra Elektronik GmbH & Co. Störcontroller KG
Hummelbühl 7-9 ·
71522 Backnang ·
Germany
Sascha Hahn
E-Mail: sascha.hahn@ees-online.de
Tel.: 07191/182245
(nach oben)
Rückstauklappen mit Tücken – Rattensperren für die Hauskanalisation
Hauskanalisationen und Abwasserkanäle sorgen für einen stetigen und meistens störungsfreien Ablauf unserer kommunalen Hausabwässer. Wie wichtig diese funktionierenden Systeme sind, wird uns häufig erst bei Störungen klar.
Für Absicherung von Risiken gilt: Der beste Schaden ist derjenige, der erst gar nicht entstehen kann. Vor diesem Hintergrund macht es für Gebäudebesitzer durchaus Sinn, zu überlegen, welche baulichen Maßnahmen sinnvoll sind, um Schäden von vornherein zu vermeiden. Diejenigen, die von Überschwemmungen schon einmal betroffen waren, werden vermutlich alles dafür tun, damit sich so etwas nicht wiederholen kann.
Um sich vor unliebsamen Überraschungen und Rückstauungen aus dem kommunalen Kanalrohren zu schützen, lassen viele Hauseigentümer elektronische Rückstauklappen in ihre Hauskanalisation einbauen. Gebäudeversicherungen verlangen im Überschwemmungs- und damit im Leistungsfall den Nachweis einer regelmäßigen technischen Überprüfung dieser Rückstauklappen.
Immer wieder erreichen uns Meldungen über ganz unerwartete Störungen – trotz technischer Wartungen und Kontrollen dieser Klappen. Auch bei Neubauten und neu verlegten Abwasserkanälen treten Funktionsstörungen an Stauklappen oder Dichtungen in den Rückstauklappen auf.
Die Ursachen für diese Störungen liegen am ungebremsten Nagetrieb von Wanderratten in der Kanalisation. Sie machen sich mit ihren scharfen Nagezähnen an Rückstauklappen und den Dichtungen zu schaffen und setzen damit in wenigen Minuten die Abdichtung der Bauteile außer Funktion.
Rückstauwasser aus dem Kanal dringt nun ungehindert in die Kellerebene und in die unteren Geschossbereiche und sorgt hier für einen erheblichen Abwasser- und Gebäudeschaden.
Baulich marode und nicht mehr genutzte Hausanschluss- und Grundleitungen sind ein hervorragender Lebensraum für Ratten. Die beste Rattenbekämpfung beginnt deshalb damit, Lebensraum und Bewegungsradius der Tiere einzuschränken.
Die Forderung, nicht nur öffentliche Abwasserkanäle konsequent zu sanieren, sondern auch die Inspektion und Sanierung von privaten Elementen der Stadtentwässerung durchzusetzen ist dabei durchaus im Sinne der neuen Biozidverordnung.
Unter dem Gesichtspunkt der präventiven Rattenbekämpfung reicht es dabei nicht aus, defekte Rohre außer Betrieb zu nehmen. Sie müssen verschlossen, besser aber noch komplett verfüllt werden, um sie als Lebensraum langfristig zu beseitigen.
Dies ist nur ein Aspekt von Rattenbefall in der Hauskanalisation.
Der absolute Albtraum aller Toilettenbenutzer ist eine Rattenattacke „von unten“. Es hört sich zunächst wie eine abenteuerliche Horrorgeschichte an, bei der einem schaudert – aber sie ist durchaus real und schon viele haben genau das erlebt.
Tatsächlich sind Ratten in nahezu allen Kanalnetzen präsent und immer wieder finden sie den Weg nach oben in die menschliche Zivilisation über den Ausgang an der Toilette.
Gerade bei Hochwasserereignissen im Kanal flüchten Ratten in die höheren Bereiche – bis in die oberen Stockwerke von Mehrfamilienhäusern.
Werden zudem noch Lebensmittelreste durch die Toilette entsorgt, zieht das Ratten unwiderstehlich an, denn sie folgen den „Leckerbissen“ von Tellerresten nur zu gerne. Ratten sind extrem schlau, sie merken sich den Weg zu ihren beliebten Nahrungsquellen – schneller als uns lieb ist.
Auf dem Weg dorthin überwinden sie fast jedes Hindernis – manchmal sogar Rückstauklappen insbesondere, wenn diese aus Kunststoff sind! Mit ihren superscharfen Nagezähnen bearbeiten sie alles, was sich ihnen in den Weg stellt – meistens erfolgreich!
Um Immobilien und Hauskanalisationen langfristig vor Rattenbefall aus dem Kanal zu schützen, ist der Einbau von Rattensperren unbedingt notwendig. Rattensperren sind einseitig passierbare Sperrklappen, die für die waagerechte Montage in Revisionsschächten, in Reinigungsöffnungen oder direkt in Rückstauklappen geeignet sind.
Die Installation der Rattensperren im Revisionsschacht oder in der Rückstauklappe ist von Fachbetrieben meistens in wenigen Minuten durchgeführt und stellt für Ratten ein unüberwindbares Hindernis im Kanalrohr dar.
Rattensperren aus säurefestem Edelstahl sind zudem extrem langlebig und robust. Sie arbeiten störungs- und verstopfungsfrei und sichern so die Hauskanalisation vor Nagerschäden und bösen Überraschungen.
Ein Auszug aus einer kommunalen Entwässerungssatzung:
1. Gegen den Rückstau des Abwassers aus der öffentlichen Abwasseranlage hat sich jeder Anschlussberechtigte nach den Vorschriften der DIN 1986 selbst zu schützen.
2. Bei Mängeln oder Schäden, die unmittelbar oder mittelbar durch Rückstau infolge von Naturereignissen wie Hochwasser, Wolkenbrüche oder Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Wasserablauf hervorgerufen werden, hat der Anschlussberechtigte gegen die Stadt keinen Anspruch auf Schadenersatz, Entschädigung oder Minderung der Abwassergebühren.
3. Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene sind durch automatisch arbeitende Abwasserhebeanlagen mit Rückstauschleife nach DIN EN 12056-4 oder unter bestimmten Voraussetzungen durch Rückstauverschlüsse nach DIN 1997 oder DIN 19578 bzw. E DIN EN 13564-1 gegen Rückstau aus dem Kanal zu sichern.
Fakten aus dem Untergrund:
Über 500.000 km öffentlicher Kanal sorgen in Deutschland für den Abfluss unserer häuslichen und industriellen Abwässer. Hinzu kommen schätzungsweise 1.500.00 km Kanal auf privatem Grund.
Gerade hier ist der Zustand der Abflussrohre in einem besorgniserregenden, schlechten und maroden Zustand. Ein Eldorado für Ratten und Ungeziefer- ein fast endloses Rohrsystem mit stetiger Nahrungsversorgung. Ein Biotop wie aus dem Bilderbuch.
Seit über 50 Jahren werden Ratten in der Kanalisation systematisch mit Giftködern bekämpft oft leider nur mit mäßigem Erfolg. Nicht nur die Entwicklung von Giftresistenzen bereiten den Fachleuten Probleme.
Die eingesetzten Wirkstoffe sind in hohem Maße umweltgefährdend und reichern sich in Nahrungsketten an. Ein biologischer Abbau findet nur sehr langsam statt. Schädlingsprävention und giftfreie Alternativen sind hier zu Zeit gefragter denn je!
In Dänemark z.B. sind präventive Maßnahmen – wie Rattensperren in der Hauskanalisation – bereits gesetzlich vorgeschrieben.
Wenn Sie sehen möchten, wie einfach die Montage ist, werfen Sie doch mal einen Blick auf die Montagevideos:
http://www.ihs-neuber.de/pipesec/
https://www.youtube.com/watch?v=AkYMQ46zmlI
-IHS- Ingenieurbüro für Hygieneplanung und Schädlingsprävention
Hans-Rainer Neuber
Dipl.-Ing. agr. – Freier Sachverständiger
Staatl. gepr. Desinfektor & Schädlingsbekämpfer
Landweg 8 – 33829 Borgholzhausen
Telefon 05425-5529
Mobil 0163-1424849
Fax 05425-954280
E-mail: info@ihs-neuber.de
Web: http://www.ihs-neuber.de/
(nach oben)
HUBER: Nutzung der Abwärme von vor Ort anfallendem Abwasser – Praxisbericht am Beispiel des Altersheims Hofmatt/Schweiz
Abwasser als Wärmequelle für Wärmepumpensystem stellt eine hocheffiziente Energiequelle und -senke dar. Ihre Verwendung ist jedoch oft auf große Kanaldurchmesser und Durchflussmengen beschränkt. Im folgenden Artikel soll eine Alternative zur Abwasserwärmenutzung aus dem Kanal am Beispiel des Altersheimes Hofmatt in Münchenstein in der Schweiz vorgestellt werden: die Nutzung der Abwärme des vor Ort anfallenden Abwassers als regenerative und nachhaltige Energiequelle zur Brauchwassererzeugung und Heizung des Gebäudes.
Einführung
Durch immer besser werdende Gebäudehüllen reduziert sich der Wärmebedarf moderner Gebäude kontinuierlich. Die Raumluft wird, so gut es geht, am Entweichen aus dem Gebäude gehindert oder über Wärmetauscher ins Freie geleitet, damit möglichst wenig Energie verloren geht. Diese Energie steckt auch in unserem Abwasser, jedoch wird nicht verhindert, dass es ungenutzt in die Kanalisation entweicht. An diesem Punkt setzt die Abwasserwärmenutzung (AWN) an. Die im Abwasser enthaltene Energie soll weiter verwendet werden.
Hierzu sind Wärmetauscher notwendig, die den schmutzigen Abwasserstrom von einem sauberen Kühlwasserstrom trennen. Diese Wärmetauscher gibt es zum Einbau in einem Abwasserkanal und als oberirdisch aufgestellte, externe Variante. Ihr Einsatz ist inzwischen erprobt und ihre Leistungsfähigkeit bewiesen.
Die meisten bisher realisierten Projekte nutzen dabei den Abwasserstrom, der den Kanal bereits erreicht hat. Im Altersheim Hofmatt in Münchenstein in der Schweiz wurde in dieser Hinsicht ein neuer und sehr viel versprechender Weg beschritten: die Nutzung des hauseigenen Abwassers zu Heizzwecken und zur Brauchwassererwärmung.
Die Nutzung des Abwassers am Entstehungsort birgt ein sehr hohes Potential. Pro Person fallen im Schnitt 130 l Abwasser pro Tag mit 23-25°C an. Bei einer Abkühlung von 15 K können somit pro Tag und Person ca. 2,26 kWh Energie zurückgewonnen werden. Bei einem zulässigen Jahresenergiebedarf von 55 kWh/m² laut KfW85 und angenommenen 170 Heiztagen können mit dieser Energie ca. 7 m² Wohnfläche volllastfähig versorgt werden. Es kann eines der größten Energielecks moderner Gebäude auf kurzem Weg geschlossen werden.
Projekt
Historie
Das Altersheim Hofmatt am Rande der Gartenstadt Münchenstein nahe Basel in der Schweiz ist eine Stiftung der Familie Zaeslin im Gedenken an ihre beiden bei einem Eisenbahnunglück 1891 verstorbenen Söhne. In der damaligen „Erholungsstation Hofmatt“ fanden Rekonvaleszente des Spitals aus Basel Aufnahme. 1940 erfolgte die Neunutzung als Fürsorgeheim und in den 1960er Jahren schließlich der Wandel zum Alters- und Pflegeheim aufgrund der veränderten Nachfragesituation. Deshalb erfolgte zwischen 1966 und 1968 der Bau des ersten Bettenhauses mit ca. 60 Betten und im Jahre 1977 kam der Erweiterungsbau West hinzu. Einer ersten Sanierung 1984 folgte eine zusätzliche Erweiterung 1995, sodass der Grundstein zur Pflege mit 124 Betten geschaffen wurde.
Im Jahr 2010 erfolgte die Planung für eine komplette Renovierung und nochmalige Erweiterung des Pflegeheims. Auf der IFAT 2010 stellte die Firma Huber Technology erstmalig einen Wärmetauscher vor, der speziell für den Einsatz mit Abwasser konzipiert war. Die Ingenieure der ETA Group wurden auf diesen aufmerksam und stellten ihre Idee der Abwasserwärmenutzung im kleinen Kreislauf der Firma Huber Technology vor. Schnell war klar, dass mit dem Abwasserwärmetauscher RoWin der optimale Wärmetauscher für die Idee der AWN für die Hofmatt gefunden wurde.
Das Alters- und Pflegeheim Hofmatt wird seit 2012 saniert und in diesem Zuge um zwei Blöcke erweitert. Hierbei wurde auch das Energiekonzept des Hauses von Grund auf überarbeitet. Die Nutzung der Restwärme des Abwassers des Hauses und der zugehörigen Kantine spielte hierbei eine wichtige Rolle. Das gesamte Abwasser des Komplexes wird in einem Sammelschacht vor dem Gebäude gesammelt (vgl. Abbildung 1) und anschließend über den Abwasserwärmetauscher Huber RoWin geleitet. Dabei wird dem 23 °C warmen Abwasser die Energie entzogen und einer Wärmepumpe zugeführt.
Vergleich mit alternativen Lösungen
Zu Beginn der Planung dieses Vorhabens wurde ein manuell zu reinigender Wärmetauscher zum Einbau in einen Abwasserschacht in Betracht gezogen. Das Abwasser wird dabei beim Einlaufen in den Wärmetauscher über eine Filtereinheit geleitet, um den Wärmetauscher vor Grobstoffen zu schützen. Aufgrund der Biofilmbildung und der nicht vorhandenen präventiven Abreinigung der Wärmetauscherflächen ist eine manuelle Reinigung dieses Systems notwendig und es fallen hohe Wartungskosten an. Zudem ist ein recht großer Schacht notwendig, in den der Wärmetauscher verbaut wird.
Aus diesen Gründen entschied sich die EBM als Contractor, Anlagenbesitzer und Betreiber für den Einsatz eines HUBER RoWin welcher durch seine vollautomatische mechanische Reinigung der Wärmetauschermodule wartungsfrei seinen Dienst verrichtet. Gleichzeitig garantiert einer Turbulenzerzeuger eine konstant hohe Wärmeübertragungsleistung auch bei Batch-Beschickung (chargenweise Beschickung). Es kommt eine vollautomatische Siebanlage im Abwasserschacht zum Einsatz, welche die Pumpe und den Wärmetauscher vor Grobstoffen schützt. Der Abwasserschacht konnte zudem deutlich kleiner ausgeführt und mit Gas- und Geruchsdichten Schachtdeckeln versehen werden (vgl. Abbildung 3). Dadurch war es möglich den Schacht in direkter Nähe des Gebäudes zu platzieren ohne die Bewohner durch Emissionen zu belästigen.
Auf der Heizungsseite kommt eine Kolbenkompressor-Wärmepumpe mit Direktkondensation zum Einsatz welche das Brauchwarmwasser in den Kombispeichern auf bis zu 70°C erhitzen kann. Als 100% Backup und Spitzenlastabdeckung steht der Fernwärme¬anschluss der EBM Münchenstein zur Verfügung, die auch als Contractor des Systems auftritt. Die Idee der speziellen Fernwärmstation mit vollständig integrierten Anlagenteilen erfolge über die Firma HLK Consutling GmbH in Dornach. Von ihr stammt das Konzept Konzept der Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung statt reiner Brauchwasserwärmung. Diese Lösung wurde bereits vor rund 15 Jahren diversen Anlagen in Basel realisiert, dort diente Abwärme aus den Kühlprozessen als Wärmequelle, hier wie beschrieben Abwasser. ETA Group hat die schlüsselfertige Lieferung der Anlage übernommen. Ebenfalls kommt die Steuerung der gesamten Anlage aus der Feder der ETA Group.Obwohl eine höhere Nutzung der Abwärme durch die Heizungsunterstützung möglich wurde, war die Anlage als Gesamtkonzept nicht teurer als die ursprünglich vorgesehene Lösung..
Maschinentechnik
Neben dem Abwasserwärmetauscher HUBER RoWin in seiner kleinsten Baugröße 4S wurde auch die Siebanlage RoK1 von der HUBER SE geliefert. Der Wärmetauscher wurde im Keller des Gebäudes neben der Wärmepumpe installiert (vgl. Abbildung 4).
Von Seiten der ETA Group wurde eine Wärmepumpe mit Kolbenkompressor und Direktkondensation geliefert welche das Brauchwarmwasser auf bis zu 70°C erhitzen kann. Die ETA Group verbaute dabei Speicher der Firma Jenni, die für den Betrieb mit Direktkondensation geeignet sind. Durch den entfall eines weiteren Wärmetauschers kann die Effizienz des Systems gesteigert werden und auch die erreichbare Temperatur steigt an. Im Inneren des Schichtspeichers wird das Brauchwarmwasser im oberen Teil mit 65°C vorgehalten, in der Mitte liegt 30-40 °C Wasser für die Gebäudeheizung und im unteren Teil des Speichers wird das Wasser mit 25°C zur weiteren Kühlung des verflüssigten Kältemittels vorgehalten.. Ein drehzahlgeregelter Kompressor erhöht den Wirkungsgrad bei Teillastbetrieb.
Betriebserfahrung
Die Anlage befindet sich seit 2012 im Betrieb und in den 2 Jahren Betriebserfahrung wird von Seiten der ETA Group und der EBM Münchenstein ein durchweg positives Fazit gezogen.
Seit die ersten Anlaufschwierigkeiten gelöst sind produziert das System Brauchwarmwasser mit 65°C und versorgt große Teile der Heizung mit einer JAZ von 3,2. Eine Wartung des Wärmetauschers war bisher noch nicht erforderlich. Auch der Sammelschacht läuft bisher weitgehend wartungsfrei.
Bei diesem Projekt konnten die beteiligten Parteien im kleinen Maßstab Erfahrungen zum Betrieb einer solchen Anlage sammeln, um diese bei größeren Projekten direkt in die Planung integrieren zu können.
Fazit
In modernen Gebäuden wird ein Großteil der Heizenergie für die Erzeugung von Warmwasser benötigt. Dieses wird anschließend ohne weiteren energetischen Nutzen in die Kanalisation eingeleitet und entschwindet zur Kläranlage. Durch die Möglichkeit der Abwasserwärmenutzung kann dieses energetische Loch nun geschlossen und die bereits eingesetzte Energie zurückgewonnen werden. Dies senkt den Primärenergiebedarf und reduziert die CO2 Emissionen. Die Abwasserwärmenutzung kann somit einen großen Anteil an der gesamten energetischen Optimierung eines Gebäudes haben. Zudem ist die AWN als regenerative Ersatzmaßnahme nach EEWärmeG anerkannt.
Für zukünftige Projekte sollte zudem nicht nur über Wärmerückgewinnung aus Abwasser nachgedacht sondern auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden mit Abwasser zu kühlen. Durch einfach Wärmepumpenkreislaufumkehr kann das gleiche System, welches im Winter zur Beheizung des Gebäudes eingesetzt wird im Sommer zur Kühlung genutzt werden. Durch diesen Doppelnutzen sinkt die Amortisationszeit deutlich und es besteht kein Bedarf nach zusätzlicher Maschinentechnik zur Kühlung.
Die Firma HUBER ist durch ihre über 130 jährige Geschichte ein solider und zuverlässiger Partner bei der Projektierung und überzeugt technisch durch hochqualitative Maschinen. Durch ein weltweites Vertriebsnetz kann die Technik welche zur AWN benötigt wird auf allen Kontinenten für den Einsatz bereitgestellt werden.
Die gute Zugänglichkeit der Ressource Abwasser, kurze Entscheidungswege bei der Realisierung und die Möglichkeit sowohl die Energiequelle als auch -senke sprichwörtlich unter einem Dach zu haben, sprechen für eine solche Anlage. Eine Wiederholung ist unter den entsprechenden Rahmenbedingungen zu empfehlen.
Eingesetzte Produkte und verwandte Lösungen
Verwandte Produkte:
– HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin
Verwandte Lösungen:
– Kleinräumige Kreisläufe zu Wärmerückgewinnung aus Abwasser in Gebäuden
– Heizen und Kühlen mit Abwasser aus dem Kanal
Quelle: http://www.huber.de/de/huber-report/praxisberichte/energie-aus-abwasser/nutzung-der-abwaerme-von-vor-ort-anfallendem-abwasser-praxisbericht-am-beispiel-des-altersheims-hofmattschweiz.html
(nach oben)
NIVUS: Optimaler Mitteleinsatz in der Fremdwassermessung
Die Erfahrungen als Messdienstleister zeigen in den letzten Jahren einen zunehmenden Bedarf an Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung in Entwässerungssystemen von Kommunen in ganz Deutschland. Dabei werden Messkampagnen durchgeführt bei denen Teileinzugsgebiete mit Durchflussmessungen ausgerüstet werden, um die Fremdwasserschwerpunktgebiete zu identifizieren. Nahezu bei allen Messkampagnen findet die Fremdwasserauswertung über die Nachtminimum-Methode (DWA-M 182) statt. Hierbei wird der geringste Tagesabfluss als im Wesentlichen dem Fremdwasser zugehörig gewertet.
Nachfolgend wird nach DWA-M181 unterschieden in
· Temporärmessungen (Dauer-, Langzeit- und Kurzzeitmessungen) und
· Einzelmessungen.
Vielfach werden über Kurzzeitmessungen (DWA-M 181: Messdauer etwa zwischen einer Woche und drei Monaten) Fremdwasserschwerpunktgebiete identifiziert. Die durch NIVUS abgewickelten Messkampagnen haben in der Regel Messdauern zwischen vier und 12 Wochen.
Vereinzelt erreichen den Messdienstleister Anfragen über Einzelmessungen an verschiedenen Punkten eines Einzugsgebietes mit derselben Zielsetzung. Dabei sollen innerhalb einer Nacht, zur Zeit des geringsten nächtlichen Abflusses bei Trockenwetter, an mehreren Punkten eines Einzugsgebietes über Einzelmessungen die Trockenwetterabflüsse ermittelt werden. Es ist offensichtlich, dass Einzelmessungen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht über dieselbe Datenqualität verfügen können wie Messungen über mehrere Wochen. Auf der anderen Seite ist der Mittelaufwand im Vergleich zu Kurzzeitmessungen niedriger. Damit stellt sich die Frage nach dem optimalen Kosten-Nutzen Aufwand für Fremdwasseruntersuchungen.
https://www.nivus.de/de/aktuelles-presse/presse/optimaler-mitteleinsatz-in-der-fremdwassermessung/
(nach oben)
HUBER: Kondensatminimierung in Wasserkammern durch Zwangsbelüftung
In manchen Wasserkammern bilden sich an der Decke und an den Wänden Kondensattropfen. Grundsätzlich sollte diese Erscheinung durch gute Deckenisolierung, schräge Decken oder Gewölbe oder durch spezielle Beschichtungen vermieden werden. Häufig ist dem Problem mit statischen Methoden aber nicht beizukommen.
Bereits 2011 veröffentlichten wir einen Bericht über die Betriebserfahrungen mit der Nachrüstung einer Zwangsbelüftung im Hochbehälter Utzenaich im österreichischen Innviertel.
Der dort im Jahre 2007 neu installierte Hochbehälter mit zwei rechteckigen Kammern von je 250 Kubikmetern Fassungsvolumen wurde nach hohen hygienischen Standards errichtet. Eine Edelstahlauskleidung, eine schräge Decke sowie eine Luftzuleitung mit integriertem Luftfilter und einer erdverlegten Schleife mit Gefälle zur Luftabkühlung und Kondensatausschleusung waren Ausstattungsmerkmale.
Luftfilteranlagen von HUBER Typ L251 bis L662 filtern Luft mit einem HEPA-Filter Klasse H13 (HEPA = High Efficiency Particulate Filter bzw. Schwebstofffilter). Filterklasse H13 bedeutet nach DIN 1822:2011 einen Abscheidegrad (Integralwert) von > 99,95 %. Das ist Standard für Operationssäle.
Die Typen L361 bis L662 verfügen zusätzlich zum HEPA-Filter H13 über einen Feinfilter Klasse M5 (nach EN 779:2012) als Vorfilter. Man merke: Eine Wasserkammer, deren Luftzufuhr über eine HUBER Luftfilteranlage erfolgt, atmet Luft in einer Reinheit, wie sie sonst OP-Sälen zugeführt wird.
Aber: In einem OP-Saal arbeiten Menschen. Das bedeutet, dass Luft ein- und ausgeatmet wird und auch anderweitig in einen Verbrauchszustand gelangt. Daher verfügen diese Räume über eine Zu- und Abluftführung.
Diesem Beispiel galt es zu folgen – jedoch in einem der Notwendigkeit angepassten Maß. Ähnlich wie Menschen im OP-Saal gibt auch die Wasseroberfläche Feuchtigkeit an die Luft ab. Was in der Wasserkammer fehlt, wenn es zu Kondensatbildung kommt, sind zusätzlich zur Luftfilteranlage eine Zwangsbelüftung (mittels Ventilator) und eine Abluftführung.
Utzenaich: In Strömungsrichtung nacheinander: Wandanschlussplatte innerhalb der Sicherheitsjalousie (außen, nicht abgebildet), Luftansaugleitung zum Radial-Rohrventilator mit 5-stufigem Trafo zur Drehzahlverstellung, Luftfilteranlage L251 (oberhalb der zugehörige Differenzdruckschalter), Sicherheitsventil Typ 170-1 (rot, ca. 1.000 Pa Auslösedruck)
Im Hochbehälter Utzenaich wurde der erste erfolgreiche Versuch gemacht, die Kondensatbildung durch Zwangsbelüftung zu eliminieren. In den folgenden Jahren wurden weitere Behälter mit einer Zwangsbelüftung zusätzlich zu bereits vorhandenen Luftfiltern eingebaut. Überall konnte die Kondensatbildung minimiert werden. Ein weiterer Vorteil dieser Maßnahme ist, dass sich ab dem Ventilator das gesamte System in einem leichten Überdruck befindet und mit Sicherheit keine ungefilterte Luft in die Wasserkammer gelangen kann.
Nicht bekannt ist der Verlauf der relativen Luftfeuchte über die Höhe zwischen Wasseroberfläche und Wasserkammerdecke. Es macht aber auch wenig Sinn, dieses Profil zu messen, denn die Rahmenbedingungen sind meistens verschieden und so kann nicht von einem auf den nächsten Fall geschlossen werden.
Der Einbau einer Luftfilteranlage sollte mittlerweile – nachdem solche Anlagen seit 15 Jahren in zunehmender Zahl eingesetzt werden – Stand der Technik geworden sein, wenngleich es dazu noch keine bindenden Vorschriften gibt.
Sind bei einem Neubau alle baulichen Maßnahmen nach dem Stand der Technik getroffen oder bei Sanierungen die in vertretbarem Kostenrahmen realisierbaren Maßnahmen zur Kondensatvermeidung durchgeführt worden, und das Kondensatproblem erscheint dennoch: Es reicht aus, zu wissen, dass durch die Nachrüstung einer Zwangsbelüftung (Ventilator mit ca. 150 – 250 Pa Druckerhöhung im Betriebsbereich) und einer Luftfilteranlage (sofern nicht schon vorhanden) sowie einer Fortluftleitung mit leicht öffnender Rohrverschlussklappe (Δp ca. 80 – 120 Pa) bzw. einer definierten Fortluftführung (es muss keine Leitung sein) der Kondensatbildung mit hoher Wahrscheinlichkeit gänzlich Einhalt geboten werden kann.
KONTAKT
HUBER SE
Industriepark Erasbach A1
D-92334 Berching
+49 8462 201-0
+49 8462 201-810
info@huber.de
http://www.huber.de/de/huber-report/praxisberichte/edelstahlausruestungsteile/trinkwasserspeicher/kondensatminimierung-in-wasserkammern-durch-zwangsbelueftung.html
(nach oben)
HUBER: Phosphorreduktion mit dem HUBER RoDisc® Scheibenfilter
Einfache und günstige Methode zur Entnahme von Phosphor aus dem Abwasser
Durch den Menschen zusätzlich in die Gewässer eingeleitete Nährstoffe (Phosphor, Stickstoff) verschlechtern die Gewässerqualität nachhaltig. So können sich Phosphatgehalte im unteren Mikrogrammbereich bereits negativ auf den Sauerstoffgehalt im Gewässer auswirken und dadurch das Eutrophierungspotenzial des Gewässers steigern.
Als Eutrophierung bezeichnet man die Anreicherung eines Gewässers mit Pflanzennährstoffen (Überdüngung). Diese
Nährstoffe bewirken ein verstärktes Algenwachstum und die Algen wiederum trüben das Wasser, sodass nach einiger Zeit nur noch in der oberflächennahen Schicht genügend Licht für die Fotosynthese vorhanden ist. Durch die verringerte Fotosyntheseleistung sinkt die Sauerstoffkonzentration im Wasser. Außerdem werden abgestorbene Algen von Mikroorganismen abgebaut – und bei diesem Vorgang wird Sauerstoff verbraucht. Die Folge der Eutrophierung ist also eine sehr niedrige Sauerstoffkonzentration im Wasser, was letztendlich zu Fäulnis (anaerobe Zersetzungsprozesse) und Fischsterben sorgen kann. In diesem Fall spricht man auch vom „Umkippen des Gewässers“.
In einzelnen Ländern, wie beispielsweise China und Russland, gefährdet die Algenplage sogar die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. So wucherten im Sommermonat Juni die Algen im Taihu-See in China bereits so stark, dass für einige Tage die Trinkwasserversorgung für die angeschlossene Bevölkerung in der Stadt Wuxi (Provinz Jiangsu) unterbrochen werden musste. Fünf Millionen Menschen waren daraufhin auf in Flaschen abgefülltes Wasser angewiesen.
Da durch menschliche Einflüsse Nährstoffe wie Stickstoff, Schwefel etc. in der Regel in größeren Mengen im Gewässer verfügbar sind, gilt der Gehalt an Phosphor als der limitierende Faktor für ein übermäßiges Algenwachstum. Der Entnahme von Phosphor fällt damit im Schutz unserer Gewässer eine Schlüsselrolle zu, da jeder zusätzliche Eintrag eine weitere Steigerung des Pflanzenwachstums bewirkt.
Phosphor wird in der Abwasserreinigung im festen Aggregatzustand über den Schlammweg aus dem Abwasser entnommen. Der Phosphor wird dabei entweder durch Aufnahme in die Biomasse oder durch eine zusätzliche chemische Fällung in Feststoffe überführt und im Schlamm eingebunden. Weil die biologische Aufnahme des Phosphors (Bio-P-Prozess) limitiert ist, wird auf den meisten Kläranlagen eine Kombinationsfahrweise der biologisch-chemischen Phosphorreduktion betrieben. Bei der chemischen Phosphorelimination bilden mehrwertige Metallionen mit den im Abwasser gelösten Phosphationen unlösliche Verbindungen. Insbesondere da der Phosphor durch diese zum Teil aufwendigen Verfahrensschritte in die ungelöste Form überführt wird, kommt der sicheren Abscheidung der Feststoffe eine große Bedeutung zu. Der Huber RoDisc® Scheibenfilter ist hierfür eine kostengünstige und sichere Filtrationsanlage, welche eine weitgehende Feststoffentnahme aus dem Ablauf des Nachklärbeckens gewährleistet. Der geringe Platzbedarf, der geringe Druckverlust und der modulare Aufbau sowie die Beschickung im freien Gefälle ermöglichen eine einfache Anpassung an vorhandene Gegebenheiten und beschränken die baulichen Maßnahmen auf ein Minimum.
Die Restverschmutzung des Kläranlagenablaufs wird zu einem großen Teil durch gelöste Stoffe und zum anderen Teil von suspendierten Schlammflocken verursacht. Jedes Milligramm an suspendiertem belebtem Schlamm, das mit dem gereinigten Abwasser abtreibt, erhöht die Phosphorablaufwerte um ca. 0,02 bis über 0,04 mg/l (ATV-DVWK-A131). Dies bedeutet, dass beispielsweise bei einer Entnahme von 20 mg/l abfiltrierbaren Stoffen durch einen nachgeschalteten Scheibenfilter die Phosphorkonzentration bereits um ca. 0,4 bis 0,8 mg/l reduziert werden kann. Durch eine höhere Zugabe von Fällungsmitteln in den vorgeschalteten Verfahrensschritten (Simultanfällung) kann die Entnahmeleistung für Phosphor weiter gesteigert werden. Durch Fällungsmittel erhöht sich der anorganische Anteil, welcher durch Agglomeration an die Schlammflocke gebunden ist, und wird ebenfalls durch die Filtration aus dem Abwasser entnommen. Üblicherweise können Phosphorablaufwerte < 1 mg/l mit der Filtration und ausreichender Dosierung an Fällungsmitteln in den vorgeschalteten Verfahrensstufen sicher eingehalten werden – und sogar Ablaufwerte < 0,5 mg/l Phosphor sind erreichbar. Bestehen sehr hohe Anforderungen hinsichtlich einer weitgehenden Phosphorelimination, kann der Scheibenfilter auch als Flockungsfiltration eingesetzt werden. In diesem Fall sollten in der vorhergehenden Abwasserreinigung Simultanfällung und biologische Phosphorelimination genutzt werden, damit die Phosphorablaufkonzentration des Nachklärbeckens bereits relativ gering ist und damit auch ein wirtschaftlicher Betrieb des Scheibenfilters erzielt werden kann. Die Dosierung der Fällungsmittel erfolgt dabei in den Ablauf des Nachklärbeckens und wird nach kurzer Fließstrecke bzw. Reaktionsstrecke in den Scheibenfilter geleitet. Zur Entnahme dieser feinsten vom Fällungsmittel gebildeten Flocken wird der Scheibenfilter mit dem Filtermaterial Nadelfilz bestückt. Der dreidimensionale Aufbau des Nadelfilzes bewirkt, dass die Abscheideeffekte nahezu denen eines klassischen Tiefenfilters entsprechen, was zur sicheren Absonderung der Mikroflocken auch notwendig ist. Die Nachrüstung dieser zusätzlichen Reinigungsstufe ermöglicht es, Überwachungswerte auch < 0,3 mg/l Phosphor zu erreichen.
Eine Scheibenfilteranlage ist eine einfache und effiziente Lösung, welche für unterschiedliche Anforderungen der Phosphorreduktion eingesetzt werden kann, und dadurch einen entscheidenden Beitrag zum Schutz unserer Gewässer leistet. Der minimale Druckverlust sowie der geringe Platzbedarf ermöglichen eine problemlose Integration der nachgeschalteten Filtrationsstufe in bestehende Kläranlagen.
KONTAKT
HUBER SE
Industriepark Erasbach A1
D-92334 Berching
+49 8462 201-0
+49 8462 201-810
info@huber.de
(nach oben)
HUBER: „Win – Win“ durch RoWin: Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Wärmerückgewinnung
„Nur eines steht fest: Das Zeitalter der günstigen Energie ist vorbei!“
Nobuo Tanaka, Chef der Internationalen Energieagentur
Dieses Zitat beschreibt in wenigen Worten, warum es immer wichtiger wird, bereits eingesetzte Energie wieder zurückzugewinnen. Wie dies auch in der Praxis erfolgreich gelingen kann, zeigen nachfolgende Anwendungen der Abwasser- Energierückgewinnung aus Brüdenwasser
In Kläranlagen fällt Brüdenwasser von 30 – 60 °C bei der Schlammentwässerung und im Waschwasser der Abluftreinigung der Klärschlammtrocknung an. Dank des HUBER Abwasserwärmetauschers RoWin ist es uns bereits bei zwei Projekten (ARA Bern/Schweiz und Firma Lindenschmidt KG/Kreuztal, Deutschland) gelungen, aus diesem Abwasser mit ca. 1 % TS-Gehalt durch Abkühlung erhebliche Energie zurückzugewinnen.
In Abbildung 1 ist eine beispielhafte Auslegung einer solchen Anwendung für eine Kläranlagengröße 100.000 EW dargestellt. Es zeigt sich, dass über 580 kW Wärme aus dem Brüden entzogen und einer Wärmepumpe zugeführt werden können. Diese erzeugt daraus ca. 750 kW Wärme, die anschließend für Faulschlammerwärmung und/oder Beheizung einer Gebäudefläche bis 25.000 m² (= 3,5 Fußballfelder) oder für externe Fernwärmeversorgung zur Verfügung steht. Die Investition rechnet sich nach kurzer Zeit und rechtfertigt sich zusätzlich durch eine signifikante Verbesserung der CO2-Bilanz.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass während der Abkühlung des Abwassers Ausfällungen stattfinden, und so das bisherige lästige Zuwachsen von Leitungen verhindert wird. Die anfallenden Feststoffe können separat aus dem Wärmetauscher abgezogen und entsorgt werden.
Hierbei wird ein Abwasserstrom hoher Temperatur durch den Wärmetauscher geleitet, welcher auf der anderen Seite von frischem Trinkwasser durchströmt wird. In diesem Anwendungsfall ist der Einsatz einer Wärmepumpe nicht notwendig, da die Wärme bereits auf einem hohen Niveau vorliegt. Im Klinikum rechts der Isar München wird auf diese Weise die Wärme aus den Operationsbesteckspülmaschinen direkt zurückgewonnen und den Spülmaschinen auf der Frischwasserseite wieder zugeführt (vgl. Abbildung 2). Wärmerückgewinnung in solch einem kleinen Kreislauf hat zwei Vorteile: Zum einen sind die Systeme meist relativ einfach und deshalb günstig zu realisieren, zum anderen ist wenig zeitlicher Versatz zwischen dem Anfall von warmem Abwasser und dem Bedarf nach Frischwasser. Die einzigartige Pufferfunktion in Kombination mit der patentierten Reinigung des HUBER RoWin-Wärmetauschers verhilft dieser Anwendung zu ihrer Effizienz.
Win-win durch RoWin
Die Lindenschmidt KG aus Kreuztal ist ein Entsorger für ölhaltige Problemstoffe. Beim biologischen Abbau dieser Stoffe kommt es zu einer starken Erwärmung des Abwassers im Belebungsbecken, sodass hier eine Abkühlung gewünscht war. Durch den HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin kann dem Wasser der Biologie Energie entzogen und direkt in den Altöl-Lagertank weitergegeben werden. So werden zwei Probleme auf einmal gelöst: Zum einen wird die Temperatur der Biologie optimiert, zum anderen werden fossile Energieträger zur Beheizung des Altöl-Lagertanks eingespart.
Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Industrien
Die Grundidee dieser wirtschaftlichen Anwendungen zur Wärmerückgewinnung aus verschmutzten Medien kann zum Beispiel auch auf die Lebensmittelindustrie (Vorwärmung des Speisewassers zur Dampferzeugung), Papierfabriken sowie Entsorger und sonstige produzierende Industrien mit warmem bis heißem Abwasser übertragen werden.
KONTAKT
HUBER SE
Industriepark Erasbach A1
D-92334 Berching
+49 8462 201-0
+49 8462 201-810
info@huber.de
http://www.huber.de/de/huber-report/praxisberichte/energie-aus-abwasser/win-win-durch-rowin-vielfaeltige-einsatzmoeglichkeiten-fuer-waermerueckgewinnung.html
(nach oben)
Separchemie: Flockungshilfsmittel trifft Filter
Einleitung:
Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie oder ein Flockmittelvertreter aus Schlamm und Polymer
wundervolle Flocken generiert haben, unzerstörbar und schön groß. Dann haben Sie diesen
konditionierten Schlamm z.B. auf eine Siebbandpresse gegeben oder einen anderen Filter und das
Gemisch aus Flocken und Wasser steht auf dem Band und läuft einfach nicht durch?
Damit Sie mir glauben, dass das nicht nur graue Theorie ist. Hier sehen Sie ein paar schwarze Flocken,
mit zwei verschiedenen Flockungshilfsmitteln behandelt.
Darum soll es im diesjährigen Vortrag gehen:
Was sind die Gründe für eine schlechte Filtration und welche Möglichkeiten gibt es, diese zu
beseitigen. Aber erwarten Sie bitte nicht, dass ich jetzt eine große Matrix entwickle, welcher
Schlamm mit welchem Polymer auf welchem Entwässerungsaggregat bei welcher Temperatur sich
wie schnell filtrieren bzw. entwässern lässt. Das geht gar nicht, aber ich will Ihnen ein paar
Zusammenhänge aufzeigen, die Hinweise auf mögliche Probleme geben bzw. Lösungen anbieten
können. Und so kam der Titel zustande: Flockungshilfsmittel trifft Filter.
Teil 1: Flockungshilfsmittel
Was passiert, wenn ein Flockungshilfsmittel auf einen passenden Schlamm trifft? Dabei gehe ich
davon aus, dass jemand festgestellt hat, welche Ladung zum Schlamm passt, hier soll es also nur
darum gehen, festzustellen, ob eher ein niedermolekulares oder eher ein hochmolekulares
Flockungshilfsmittel eingesetzt werden kann. Eigentlich geht man ja davon aus, dass das
Flockungshilfsmittel vom Schlamm gebunden wird. Aber scheinbar wird es nicht ganz gebunden,
dann wäre der Einfluss auf die Filtration wohl kaum zu bemerken. Zumindest, wenn man wie im
Experiment eine große Oberfläche bei wenig Schlamm im Wasser anbietet.
Wenn Sie sich einmal vor Augen halten, dass ein gestrecktes Polymer‐Molekül mehrere Meter lang
ist, also in gestreckter Form von meinem Kollegen bis zu mir reichen würde, dann kann man eher
verstehen, dass auf dieser Schnur nicht alle Andockplätze belegt sind. Immerhin charakterisiert man
Polymere durch die Angabe wie viele Mio. Dalton es an Molgewicht hat. Auch in einer noch so
verdünnten Lösung liegen also immer verknäulte Moleküle vor.
Vielleicht kann man es sich so vorstellen:
Habe ich einen feinteiligen Schlamm aus starren Partikeln, z.B. aus einem Steinmetzbetrieb oder
einen Hydroxidschlamm aus einer Galvanik, dann reihen sich viele Partikel auf einer Leine, also dem
Flockungshilfsmittel auf. Ist die Leine sehr lang, bleiben zwangsläufig einige Plätze auf der Leine frei.
Eine andere Vorstellung ist, dass die feinen Partikel in die Wolke aus Polymeren eindringen muss,
dadurch quillt das Knäuel auf, aber es wird sich nie verhalten wie ein gestreckter Faden. Diese übrig
bleibenden freien Stellen legen sich auf das Filtergewebe und blockieren es. Das polymere
Flockungshilfsmittel legt sich wie eine Barriere über die Löcher im Filtergewebe und verschließen
diese. Zusätzlich können sich die Flockungshilfsmittelmoleküle noch überkreuz legen, was eine
zusätzliche Blockade verursacht.
Hier sehen Sie an einem gebrauchten Tuch aus einer Kammerfilterpresse wie fein diese Löcher sind.
Besonders schlimm wird die Situation, wenn das Flockungshilfsmittel zu hoch dosiert wird, also
überschüssiges Produkt sich um den Schlamm lagern kann. Und die Schlammpumpe vor der
Kammerfilterpresse pumpt und pumpt und pumpt, aber kein Filtrat läuft heraus.
Habe ich dagegen Partikel oder Mikroflocken, die beweglich sind, also z.B. biologische Flocken aus
einer kommunalen Kläranlage, so können diese sehr viele Plätze auf der Leine belegen, es bleibt
nichts über.
So können kommunale Überschussschlämme oder schlecht ausgefaulte Schlämme gut mit
hochmolekularen Flockungshilfsmittel behandelt werden, während feinteilige Schlämme, gut
ausgefaulte Schlämme mit niedermolekularen Produkten gute Ergebnisse erzielen.
Teil 2: Feinstflocken
Wenn durch die Auswahl von Flockungshilfsmitteln die Filtrierbarkeit beeinflusst wird, muss etwas
zwischen Flockungshilfsmittel und Filter geschehen, oder ist es etwas anderes? Es gibt noch andere
Mechanismen, die zum Verkleben von Filtern führen können:
Wenn ein Flockungshilfsmittel schlecht greift, verbleiben in der Klarwasserphase feine Flocken. Wenn
diese genau in die Poren von Filtergeweben passen, sind diese Poren dicht, es geht nichts mehr
durch, auch mehr Druck hilft hier nicht, nur die Auswahl eines anderen Flockungshilfsmittels, das
vielleicht feinere Flocken macht, diese aber dafür stabiler sind, oder ein vernetztes Produkt. Vielleicht
hilft aber auch einfach eine Probenahmemöglichkeit direkt vor dem Entwässerungsgerät, um
festzustellen, ob das Flockungshilfsmittel ausreichend mit dem Schlamm verknetet ist. Wenn
Schlamm eine zu kurze Reaktionszeit mit dem Flockungshilfsmittel hat, sind in einer Probe
unverbrauchtes Flockungshilfsmittel neben schlecht geflocktem Schlamm vorhanden. Wenn Sie jetzt
eine Probe davon entnehmen, bemerken Sie das vielleicht nicht, aber wenn Sie den Probeeimer ein
paar Mal in einen anderen Eimer gießen, werden auf einmal die Flocken größer und gleichmäßiger
und vielleicht auch das Wasser klarer. Dann ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, ob ein
zusätzlicher Rührbehälter oder ein statischer Mischer vor der Entwässerung eingebaut werden sollte.
Sie sehen, es gibt auch hier mehrere Gründe, dass das Flockungshilfsmittel nicht alle kleinen Partikel
erreicht, oder dass die gebildeten Flocken wieder mechanisch zerstört werden, z.B. durch
mehrfaches Umpumpen von Schlamm oder aber auch in einer schon gefüllten Kammerfilterpresse,
wo die neu in die Presse gepumpten Flocken durch den Schlamm in der Presse durchquetschen
müssen.
Hier sehen Sie eine Presse mit einem Kammervolumen von ca. 2 m3. Nehmen wir an, dass der
Schlamm sich gut entwässern lässt, so ist die Presse nach einer Beschickung von 2 m3 nicht voll, der
Schlamm ist im unteren Teil der Kammern. Aber spätestens nach 10 m3 bei einem TS von 3 % sind die
Kammern voll und der Druck steigt in der Presse. Bis jetzt sind die Flocken kaum einer merklichen
Scherbelastung ausgesetzt worden, die Filtration war ziemlich einfach. Jetzt wollen Sie aber noch
mehr Schlamm in die Presse bekommen. Diese Flocken, die jetzt in die Presse kommen, müssen sich
an den vorhandenen Flocken vorbeidrücken, da ja auch die vorderen Kammern schon voll sind. Die
dazu nötige zusätzliche Stabilität erreichen viele Kammerfilterpressen durch eine Anhebung der
Flockungshilfsmittelmenge ab ca. 10 bar.
Ein weiteres Problem tritt in vielen industrielle Abwasseranlagen auf: Hier muss das
Flockungshilfsmittel 2 Aufgaben erfüllen: Es wird zugesetzt, um schnell Flocken vom Wasser zu
trennen. Aber anschließend wird der Schlamm oft in einen oder mehrere Schlammbehälter gepumpt,
die als Puffer für die Kammerfilterpresse dienen. Dann geht es mit einer weiteren Pumpe auf die
Presse und die Kunden wundern sich, dass die Presse endlos läuft und der Schlamm, der auf die
Presse gelangt, nur noch ein einziger Brei ist. Vorne brauchen Sie nur kleine Flocken, die schnell
sedimentieren, aber deren Stabilität nicht für eine Presse ausreicht. Leider sehen nur wenige
Hersteller von Abwasseranlagen eine erneute Zugabe von Flockungshilfsmittel in die Schlammvorlage
zur Presse vor, es würde helfen.
3. Grund: Kanäle zwischen Flocken frei lassen! Das Wasser muss abfließen können.
Weshalb oft für Filtrationen niedermolekulare Produkte die geeignetere Wahl sind, kann man sich
aber auch anders erklären: Sie nehmen ein Filtertuch z.B. eines in einer Kammerfilterpresse und
geben eine Ladung geflockten Schlamm drauf, das Wasser läuft gut ab und es bildet sich in der Presse
eine zusätzliche Filterhilfsschicht. Auf diese Schicht kommt dann die nächste Portion Schlamm, die
wird sich bevorzugt dort anlagern, wo die erste Schicht noch Kanäle zwischen den Flocken frei
gelassen hat. Bei der nächsten Schicht geschieht wieder das Gleiche, dort, wo die 2te Schicht Lücken
gelassen hat, werden sich die Flocken der 3ten Ladung bevorzugt anlagern und so weiter. Jetzt
überlegen Sie, wann die Schlammpackung in der Presse mehr Kanäle frei hat, bei großen oder bei
kleinen Flocken??
4. Grund: Das Abwasser enthält selbst hochmolekulare Bestandteile
Bindemittel + Koagulant + Flockungshilfsmittel = Gute Entwässerung
Enthält das zu behandelnde Material hochmolekulare Komponenten: Acronal, Leim, Bindemittel, Öl,
Wachse, dann ist es wichtig, diese nicht mit einem hochmolekularen Flockungshilfsmittel alleine zu
binden, auch wenn damit vielleicht klares Wasser zu erzielen ist. In vielen Fällen hilft hier auch nicht
eine Vordosierung mit Metallsalzen wie FeCl3 oder PAC, weil diese zu bindenden Produkte zu
hochmolekular sind, um in die Poren von Hydroxidflocken zu gelangen. Ein niedermolekularer aber
hochgeladener Koagulant muss her, um die oft mit viel Ladung behafteten Inhaltsstoffen so zu
binden, dass dabei nicht‐klebrige Flocken entstehen. Die Flockung anschließend kann dann durchaus
hochmolekulare Produkte vorsehen, ohne eine Presse zu verkleben. Sie sehen, hier ist es nicht das
Flockungshilfsmittel, das den Filter verklebt, sondern der nicht gebundene Teil im Abwasser.
Zusammenfassung:
Aus allem vorher Gesagten können Sie schon sehen, dass ein Schlamm, der mit einem
Flockungshilfsmittel behandelt wurde, sehr viel lieber durch ein grobmaschiges Filtermedium filtriert
wird, da hier die Möglichkeiten, dieses zu verkleben viel kleiner sind, als bei einem engmaschigen
Filtergewebe. Auch kann ich nicht verstehen, wie jemand, der sich mit Flockungshilfsmittel auskennt,
in eine Abwasseranlage hinter ein Entwässerungsaggregat noch einen Feinstfilter hängt. Die
Gedanken dahinter sind: Sollte das Entwässerungsgerät nicht optimal laufen und feine Flocken
durchlassen, würden diese in diesem Filter zurückgehalten. Dass aber dieser Feinstfilter bei jeder
Unregelmäßigkeit in der FHM‐Dosierung sofort verblockt, bedenkt keiner.
Teil 5: Filterhilfsmittel, was also tun, wenn alles Vorherige nicht greift, oder nicht möglich ist?
Sie kennen vielleicht die alte Methode von Betreibern mobiler Pressen: Wenn es nicht so gut flockt
und entwässert, rührt man Sägespäne unter den Schlamm, die sorgen dann schon mit vielen Kanälen
im Schlamm für eine gute und schnelle Entwässerung. Mit Sägespänen kann man aber schlecht auf
kontinuierlich laufende Anlagen fahren, daher gibt es andere Produkte. Sehr verbreitet sind Kieselgur
und Perlite. Perlite sind Mineralien, die durch eine thermische Behandlung aufgebläht worden sind,
daher ein sehr großes Volumen bei recht kleinem Gewicht haben. Sie werden im Allgemeinen in
Wasser aufgeschlämmt und in eine Kammerfilterpresse gespült oder auf eine Vakuumtrommel
aufgezogen. Erst dann wird der Schlamm in die Presse gedrückt.
Bei allen Filterhilfsmedien kommt es sehr stark auf die richtige Körnung an. Will man diese Produkte
z.B. zum Bierklären verwenden, müssen sie sehr fein sein. Sollen sie als Filterhilfsmittel fungieren,
sollten Sie eher etwas gröber sein, um dem Wasser mehr Kanäle zum Abfließen zu lassen.
Aber eigentlich sind sie – wenn auch eben nicht in allen Fällen – verzichtbare Hilfsmittel, oft können
Sie durch ein gut geeignetes Flockungshilfsmittel ersetzt werden, aber wenn das aus irgendwelchen
Gründen nicht einsetzbar ist, sind sie eine gute Hilfe.
Wenn das geflockte Material
• kaum Feinstflocken enthält
• das Flockungshilfsmittel zum Schlamm passt
• das zu flockende Material keine hochmolekularen Inhaltsstoffen enthält,
• das verwendete Filtertuch grobmaschig genug ist,
kann eine Filtration gut und schnell funktionieren.
Sind diese Bedingungen nicht zu erfüllen, kann sie trotzdem mit Filterhilfsmedien verbessert werden.
http://www.separchemie.de/fileadmin/site_content/Artikel/FHM_trifft_Filter-L%C3%B6nsberg_korrigiert_2012.pdf
(nach oben)
ABGS GmbH: Neue Betriebssicherheitsverordnung
In den News vom April 2011 wurde die „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV)“ an Hand des Inhaltsverzeichnisses schwerpunktmäßig im Hinblick auf den Einsatz von Gaswarntechnik dargestellt.
Seit dem 01.01.2015 gilt nun die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV), hier Neue Betriebssicherheitsverordnung genannt.
Die neue BetrSichV ist in fünf Abschnitte aufgeteilt:
• 1. Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
• 2. Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen
• 3. Zusätzliche Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen
• 4. Vollzugsregelungen und Ausschuss für Betriebssicherheit
• 5. Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, Schlussvorschriften
Dazu kommen 3 Anhänge:
• 1. Besondere Vorschriften für bestimmte Arbeitsmittel
• 2. Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen
• 3. Prüfvorschriften für bestimmte Arbeitsmittel
Grundsätzliche Ziele der Verordnung sind nach Darstellung der Bundesregierung:
• Verbesserung des Arbeitsschutzes bei der Verwendung von Arbeitsmitteln durch Beschäftigte und des Schutzes Dritter beim Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen
• Die Anwendung der Arbeitsschutzregelungen bei Arbeitsmitteln soll für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) erleichtert und der Arbeitsschutz verbessert werden.
Dazu wird/werden:
• Die seit 2002 geltende Betriebssicherheitsverordnung konzeptionell und strukturell neu gestaltet.
• Doppelregelungen bei bestimmten Dokumentationen und Prüfungen beseitigt und zwar sowohl innerhalb der noch geltenden Verordnung als auch zu anderen Rechtsvorschriften wie zur Gefahrstoffverordnung und zum neuen Gewässerschutzrecht des Bundes (AwSV).
• Eine konzeptionelle und strukturelle Angleichung an andere moderne Arbeitsschutzverordnungen, insbesondere die Gefahrstoffverordnung durchgeführt.
Die Verordnung wird neu strukturiert. Allgemeine, für alle Arbeitsmittel geltende Anforderungen stehen jetzt im so genannten verfügenden Teil. Spezielle Anforderungen für bestimmte Arbeitsmittel finden sich in den Anhängen.
Neu ist, dass die Anforderungen an die sichere Verwendung von Arbeitsmitteln als Schutzziele beschrieben werden. Deutlicher wird nunmehr auch die Trennung von Hersteller und Arbeitgeberpflichten indem die Schnittstelle Hersteller/Arbeitgeber beschrieben wird.
Das Thema „Gefährdungsbeurteilung“ wurde konkreter geregelt. Hier wird jetzt unter anderem bestimmt, dass die Gefährdungsbeurteilung regelmäßig überprüft werden muss und Schutzmaßnahmen ggf. angepasst werden müssen. Damit ist das immer wieder aufflammende Thema „Bestandsschutz“ vom Gesetzgeber eindeutig geregelt.
Neu ist, dass der Gesetzgeber nunmehr klarstellt, dass die „grundlegenden Sicherheitsanforderungen“ der einschlägigen Gemeinschaftsrichtlinien bei einer Eigenherstellung in jedem Fall Maßstab sind, auch wenn diese aus sich heraus formal nicht angewendet werden müssen. Neu ist auch die Bestimmung, dass bei bestimmten Änderungen von vorhandenen Arbeitsmitteln ggf. Herstellerpflichten beachtet werden müssen.
Im Rahmen der Bestimmungen des § 14 „Prüfung von Arbeitsmitteln“ wird jetzt klargestellt: „Prüfinhalte, die im Rahmen eines Konformitätsbewertungsverfahrens geprüft und dokumentiert wurden, müssen nicht erneut geprüft werden.“
Diese Festlegung findet sich auch in § 15 für überwachungsbedürftige Anlagen.
Neu ist der Anhang 3 mit seinen konkreten Prüfvorschriften für „besonders gefährliche Arbeitsmittel“:
• Krane
• Flüssiggasanlagen
• Maschinentechnische Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik
Quellen: Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV 01/15)
Gastautor: Dipl.-Ing. Dieter Seyfert
Dieser Artikel erscheint in unserer monatlichen Fachartikel-Reihe über ausgewählte Themen der Gaswarntechnik, Gasmesstechnik, Gebäudetechnik und Sicherheitstechnik. Sie können diese Artikel über den RSS-Button abonnieren. Eine Einbindung in fremde Webseiten ist nur ungekürzt und mit Quellenangabe und Link zu diesem Artikel gestattet.
Quelle: http://abgs-gmbh.de/2015/03/02/fachartikel-neue-betriebssicherheitsverordnung/#more-3289
(nach oben)
Barthauer: In Zürich steht die Stadtentwässerung vor vielfältigen Herausforderungen
Die kontinuierliche Siedlungsentwicklung und topografisch stark ausgeprägten Strukturen erfordern exakte hydraulische Berechnungen. Das Ziel ist eine optimale Entwässerung und ein möglichst naturnaher Wasserhaushalt. BaSYS HydroCAD für die hydrodynamische Kanalnetzberechnung ermöglicht hier eine gezielte Analyse von Schwachstellen. Maßnahmen, um die negativen Auswirkung der Siedlungsentwicklung auf den natürlichen Wasserhaushalt zu minimieren, können sinnvoll geplant werden. Die größte Stadt der Schweiz Zürich ist mit ca. 396.000 Einwohnern die größte Stadt der Schweiz und ihr wichtigstes wirtschaftliches, wissenschaftliches und gesellschaftliches Zentrum. Die Stadt ist geprägt von einer dynamischen Stadtentwicklung: In den letzten 50 Jahren sind die Siedlungsfl ächen mit enormer Geschwindigkeit bis ins Umland der Stadt gewachsen. Viele neue Baugebiete entstanden, teilweise auch in Gegenden in Hanglage und mit starkem Gefälle. Nach den Vorgaben des Generellen Entwässerungsplanes (GEP, in der Schweiz die offi zielle Planungsrichtlinie für das öffentliche Gemeinwesen) hat ERZ Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) die Aufgabe, die negativen…mehr:
http://www.barthauer.de/fileadmin/Aktuelle_Dateien/PDF-Dateien/Referenzen/Referenzstory_Z%C3%BCrich_V1.pdf
(nach oben)
SÜLZLE Gruppe: Spannender Auftrag – SÜLZLE liefert Anlagen zur Klärschlammverwertung an Stadtentwässerung Koblenz
Kläranlagen gehören zu den größten kommunalen Energieverbrauchern – rund 20 Prozent des Strombedarfs von Kommunen gehen auf ihr Konto. Ziel des „SusTreat“-Projekts der Stadtentwässerung Koblenz ist es, dass die örtliche Kläranlage diese Energie in Eigenregie erwirtschaftet. Dabei setzt der Betreiber auf das hohe Potenzial des anfallenden Klärschlamms: Dieser enthält große Mengen von Kohlenstoff, der sich durch Vergasung in Energie umwandeln lässt. Pionier dieser Technologie ist die SÜLZLE KOPF SynGas GmbH & Co. KG mit Sitz in Tübingen, ein Unternehmen der SÜLZLE Gruppe.
Bevor der Klärschlamm energetisch genutzt werden kann, muss man ihn jedoch trocknen. Auch dafür kommt in Koblenz eine Anlage von SÜLZLE zum Einsatz: Die Entwässerungs-und Trocknungs -Spezialisten der SÜLZLE KLEIN GmbH aus dem Rheinland-Pfälzischen Niederfischbach liefern dafür einen Bandtrockner vom Typ Pro-Dry 4/2. Dieser bringt den Klärschlamm auf einen Trockenrückstand von 90 bis 96 %. Dabei entsteht ein festes Granulat, das der Klärwerksbetreiber in einem Lagersilo zwischenspeichert. SÜLZLE KLEIN installiert auch die Abluftbehandlung sowie die Strom- und Wärmezufuhr der Anlage.
Die KOPF SynGas-Anlage vergast das Granulat anschließend bei einer Temperatur von rund 850 Grad Celsius. Organische Gifte wie Medikamentenrückstände, Hormone und Bakterien werden dabei vollständig zerstört. Es entsteht ein brennbares Gas, das dann in mehreren Stufen von weiteren belastenden Stoffen wie Schwermetallen, Teeren und Schwefel gereinigt wird. Anschließend lässt sich das Gas in einem angeschlossenen Blockheizkraftwerk zur Wärmegewinnung oder in einem Gasmotor zur Stromerzeugung nutzen. Die SynGas-Anlage ist dabei so flexibel ausgelegt, dass sie je nach Bedarf nur Wärme, nur Strom oder beides erzeugen kann.
Kombiniertes Know-how für nachhaltige Prozesskette
Die bei der Vergasung entstehende Asche ist mineral- und phosphathaltig. Sie lässt sich als Düngemittel in der Landwirtschaft oder zur Rückgewinnung des wertvollen Phosphats weiterverwerten. Das hohe Nutzungspotenzial des Klärschlamms wird damit vollständig ausgeschöpft. Das überzeugte auch in Koblenz: „Das kombinierte Know-how von SÜLZLE KOPF SynGas und SÜLZLE KLEIN ermöglicht ein ausgefeiltes und nachhaltiges Energiekonzept, bei dem sämtliche Elemente der Prozesskette optimal ineinandergreifen“, erklärt Dr. Stephan Mey, Geschäftsführer von KOPF Syngas. Hinzu kommt die geographische Nähe: „Bei Bedarf sind wir in einer Stunde vor Ort“, ergänzt Björn Wunderlich, Geschäftsführer von SÜLZLE KLEIN. „Damit können wir das Projekt intensiv betreuen und schnell reagieren.“ Startschuss für die Montage ist im Dezember 2014. Bis 2016 sollen die einzelnen Anlagenteile nach und nach in Betrieb gehen.
http://suelzle-kopf.de/news/
(nach oben)
Hölscher Wasserbau: Kosten sparende und flexible Löschwasseraufbereitung
Individuelle Wasseraufbereitung für kontaminiertes Löschwasser Haren (Ems)
Für diese Art der Kontamination gab es keine Erfahrungswerte: Zur Aufbereitung von knapp 1.000 m3 Löschwasser aus der Bekämpfung eines Chemiefabrik-Brandes entwickelte das Unternehmen Hölscher Wasserbau eine mobile Reinigungsanlage. Die große Herausforderung lag in der Konzeption eines Verfahrens zur Sanierung des Löschwassers, welches mit einem Cocktail an Schadstoffen vermischt war. Im Herbst 2014 kam es bei einer Chemiefabrik in Ritterhude bei Bremen zu einer schweren Explosion mit anschließendem Großbrand, die das mit Entsorgung befasste Unternehmen weitgehend zerstörte. Ein Teil des Löschwassers zur Brandbekämpfung gelangte in den Schmutzwasserkanal, konnte jedoch aufgefangen und bis zur Reinigung in einem separaten Tank gespeichert werden. Der für die Abwasserreinigung zuständige Betreiber zweier Kläranlagen, hanseWasser Bremen, stand vor der schwierigen Aufgabe, ein geeignetes Verfahren für diese spezielle Löschwasser- Sanierung zu finden. Das Löschwasser war mit einem regelrechten Cocktail aus gesundheitsgefährdenden Schadstoffen belastet: Unter anderem Kohlenwasserstoffe (KW), Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTX), Perfluorierte Tenside (PFT) sowie ein sehr großer Lösemittelanteil. Eine Entsorgung des kontaminierten Wassers mittels thermischer Verbrennung hätte sehr hohe Kosten zur Folge gehabt, da extrem hohe Temperaturen von mindestens 1.200 °C nötig gewesen wären, um die Entstehung toxischer Dioxine zu vermeiden. Alternativ suchten die Verantwortlichen nach einer Möglichkeit zur physikalischen Abreinigung, für die es jedoch keine Erfahrungswerte gab.
Hölscher Wasserbau: Langjährige Kompetenz in der Wasseraufbereitung
Auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung gilt das Unternehmen Hölscher Wasserbau aus Haren (Ems) als ein erfahrener Spezialist für effiziente und ausgereifte Verfahrenstechnik. Aufgrund jahrelanger Zusammenarbeit des Kläranlagen-Betreibers mit dem Betrieb wurde die Fachabteilung Umwelttechnik hinsichtlich einer individuellen Lösung angefragt. Auf der Basis von gelieferten chemischen Werten und ergänzender Eigenanalytik mithilfe eines externen akkreditierten Labors konzipierte Hölscher Wasserbau eine maßgeschneiderte Sanierungsanlage in modularer Bauweise. Das Funktionsprinzip basiert auf einem mehrstufigen Verfahren, welches durch in Reihe geschaltete Filtereinheiten eine maximale Adsorptionsleistung erzielt. In einem Mehrlagen-Schichtfilter werden im ersten Schritt Sedimente und Trübstoffe herausfiltriert. Im zweiten Schritt durchströmt das belastete Löschwasser zwei in Reihe geschaltete und individuell für die Art der Kontamination konzipierte Wasser-Aktivkohle-Filter, von denen der erste als Arbeitsfilter und der zweite als Polizeifilter dient. Ein Polizeifilter sorgt für die Aufnahme von Überresten und nimmt nach der Sättigung des Arbeitsfilters dessen Position ein, während ein neuer Polizeifilter nachgeschaltet wird. Das Schüttvolumen der Aktivkohle-Filter beträgt je 2,5 m3.
Ausgereifte Verfahrenstechnik
Auf die Empfehlung von Hölscher Wasserbau hin wurde das kontaminierte Wasser anfangs mit atmosphärischem Sauerstoff angereichert. Dieser erzeugt ein für Bakterienkulturen positiv aerobes Milieu. Durch die teilweise Zersetzung organischer Verbindungen durch Bakterien blieben größere Aktivkohle- Volumina frei für die Adsorption der Tenside (PFT). Auf diese Weise konnten die Standzeiten der Aktivkohle-Filteranlagen um ein Vielfaches erhöht werden. „Unsere Anlage zur Aufbereitung des Löschwassers bot die Möglichkeit, immensen Entsorgungskosten alternativlos entgegenzutreten“, resümiert Projektleiter Josef Teiken, der die Fachbereiche Umwelttechnik sowie Forschung und Entwicklung bei Hölscher Wasserbau leitet und für die Entwicklung der Anlage verantwortlich zeichnet. Teiken konzipierte beispielsweise die erforderliche Beladekapazität bzw. die Volumina der Filter und die hydraulische Berechnung, so dass eine ausreichende Kontaktzeit der Schadstoffe gewährleistet war. Mit diesem Verfahren konnten 95 % der gesamten Schadstoffe eliminiert werden. Das gereinigte Löschwasser wurde anschließend durch den Schmutzwasserkanal dem normalen Abwasserreinigungsprozess in der Kläranlage zugeleitet.
Schnelle und flexible Anlageninstallation zur Grundwassersanierung
Dank des großen Lagers an Filtertürmen sowie eigener Transportkapazitäten von Hölscher Wasserbau konnte die Grundwasseraufbereitung in kürzester Zeit abgewickelt werden. Nur drei Tage nach der Beauftragung wurde die mobile Anlage vor Ort installiert. Nach eintägigem Aufbau wurde die Schadstoff- Adsorption innerhalb von einer Woche erfolgreich durchgeführt. Für Hölscher Wasserbau ist das gelungene Projekt ein erfolgreicher Einstieg in den Bereich der Löschwasseraufbereitung. Individuelle Lösungen auf dem Gebiet der Grundwasseraufbereitung, Altlastensanierung sowie Deponie-Technik gehören zu den Hauptkompetenzen des Unternehmens. Mit dem langjährigen Know-how und den umfangreichen Kapazitäten für die Anlageninstallation kann das Unternehmen zum Beispiel bei Unfällen mit Schadstoffaustritten schnell reagieren und Maßnahmen in die Wege leiten. Projektleitung: Josef Teiken, Fachbereich Umwelttechnik/Forschung und Entwicklung
Weitere Informationen zum Unternehmen: www.hoelscher-wasserbau.de
http://hoelscher-wasserbau.de/cms/media/kunde_hoelscher/upload/2015-03/2242_2015_03_12_PM_Hoelscher_Wasserbau_Loeschwasseraufbereitung.pdf
(nach oben)
Sanierung der Belebtschlammqualität mit Easyflock
Problemstellung:
In Folge immer höherer Anforderungen an die Reinigungsleistung von Kläranlagen wird auch die Qualität der Feststoffabscheidung im Nachklärbecken immer wichtiger für die Ablaufqualität. Aufgrund der strömungstechnischen Bedingungen in Nachklärbecken wirken sich erhöhte Feinanteile und viele Fadenbakterien sehr nachteilig aus und führen zu vermehrtem Flockenabtrieb mit erhöhten CSB- und P-Ablaufkonzentrationen.
Um diesen beiden Störfaktoren zielgenau und praxistauglich entgegen zu wirken, wurde Easyflock entwickelt. Es handelt sich um ein pulvriges Produkt, das trocken in die Belebungsbecken von Kläranlagen gegeben werden kann.
Folgende Wirkungen werden erzielt:
• Beseitigung von Schwimmschlamm und Schaum (verursacht durch Fadenbakterien wie Microthrix, Chloroflexi und Nocardia) auf Belebungs- und Nachklärbecken.
• Sofortige Einbindung des Feinanteils in die Belebtschlammflocken und dadurch signifikante Erhöhung der Sichttiefe im Nachklärbecken.
• Mittelfristig (nach 1-2 Monaten wöchentlicher Zugabe) deutliche Verbesserung des Schlammabsetzverhaltens (Schlammindex und/oder Sinkgeschwindigkeit).
• Stabilisierung des biologischen Abbaus durch Sicherung des notwendigen Schlammalters für die Nitrifikation und/oder die Elimination schwer abbaubarer Verbindungen (z.B. Reinigungsmitteln, Ölen, Fetten).
• Abbau von Übersättigungen in kolloidalen Lösungen.
Dosierstrategie:
Die empfohlene Dosierstrategie richtet sich nach den Ursachen der festgestellten Probleme:
• Bei einmaliger Zerstörung der Belebtschlammstruktur (z.B. durch extremen Streusalzeinsatz oder durch giftige Einleitungen) genügt eine 1-3 malige Dosierung innerhalb von ca. 2 Wochen, um die Belebtschlammstruktur wieder in Ordnung zu bringen.
• Bei dauerhaft auftretenden, schädlichen Einflüssen auf die Belebtschlammqualität -meist infolge industrieller Einleitungen – sollte eine wöchentliche Zugabe erfolgen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
• Zur Bekämpfung von Fadenbakterien ist ebenfalls eine wöchentliche Dosierung zu empfehlen.
http://www.bioserve.info
(nach oben)
SÜLZLE KOPF: Die Lösung bei Mikroschadstoff-Elimination von SÜLZLE KOPF Anlagenbau
Rosenfeld: Abwasser ist immer stärker mit Mikroverunreinigungen wie Chemikalien oder Medikamentenrückständen belastet. Dies stellt die Betreiber von kommunalen Klärwerken vor eine große Herausforderung. Denn viele Spurenstoffe können durch konventionelle Reinigung nicht eliminiert werden und gelangen daher auch in das Trinkwasser.
SÜLZLE KOPF Anlagenbau, ein Unternehmen der SÜLZLE Gruppe, bietet mit dem Aktivkohle-Lager- und Dosiersystem AK-DOS eine innovative Lösung. Als Vierte Reinigungsstufe in Kläranlagen eingesetzt, adsorbiert die hochgenau dosierte Pulveraktivkohle Mikroschadstoffe und erhöht dadurch die Wasserqualität erheblich.
Im September 2015 treten europaweit strengere Grenzwerte für Mikroschadstoffe in Gewässern in Kraft. Diese sind in den vergangenen Jahren vor allem durch den steigenden Konsum von Medikamenten sowie deren unsachgemäße Entsorgung in die Höhe geschossen: Mehrere tausend Tonnen von biologisch hoch wirksamen Verbindungen gelangen jährlich über die sanitären Einrichtungen in das Abwasser. Diese zu eliminieren ist Aufgabe der kommunalen Kläranlagen. Viele sind damit jedoch technisch überfordert – die Arzneimittelrückstände gelangen in den Wasserkreislauf und damit ins Trinkwasser. Dies verursacht ein erhebliches Umwelt- und Gesundheitsrisiko und nicht abzusehende Langzeitfolgen.
Um die anthropogenen Spurenstoffe zu beseitigen, setzen Klärwerksbetreiber vermehrt auf die Vierte Reinigungsstufe mit Pulveraktivkohle (PAK). Diese wird dem bereits konventionell gereinigten Abwasser beigemischt, wo sie die Schadstoffe bindet und sich anschließend absetzt oder gefiltert wird. In einem Sedimentationsbecken wird die Kohle mit dem restlichen Klärschlamm abgezogen. Die Vierte Stufe mit PAK verbessert die Wasserqualität und reduziert den Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) der Kläranlage.
Für einen sicheren und effizienten Einsatz dieses Verfahrens hat SÜLZLE KOPF Anlagenbau das Lager- und Dosiersystem für pulverförmige Aktivkohle AK-DOS entwickelt. Dieses dosiert auf Basis von Analysedaten die Kohle zulaufabhängig, kontinuierlich und grammgenau auf die anlagenspezifisch notwendige Menge. Der Betreiber erreicht damit eine verlässliche Elimination von Schadstoffen und kann gleichzeitig die Verbrauchskosten für die Aktivkohle minimieren. AK-DOS ist somit ökologisch nachhaltig und wirtschaftlich zugleich. Zudem läuft das System vollautomatisch und ist äußerst wartungsarm. Das senkt die Betriebs- und Instandhaltungskosten. SÜLZLE KOPF liefert AK-DOS in mehreren Baugrößen als schlüsselfertiges System. Der Installationsaufwand beläuft sich daher auf ein Minimum.
„Mit unserem System AK-DOS leisten wir einen aktiven Beitrag zu einer höheren Wasserqualität“, betont Peter Althaus, Vertriebsleiter bei SÜLZLE KOPF Anlagenbau. „Wir haben die erste Anlage 2011 im baden-württembergischen Sindelfingen in Betrieb genommen.“ AK-DOS bietet nicht nur eine sichere Abwasserreinigung bei geringen Kosten, es ist auch zu 99,99 Prozent verfügbar und damit sehr zuverlässig. Mit ihrem für die jeweiligen Gegebenheiten optimierten Flächenbedarf sind die Anlagen äußerst kompakt, so dass sie problemlos in bestehende Klärwerke integriert werden können. Das umfangreiche Explosionsschutz-Konzept sorgt für höchste Sicherheit. Dazu gehört auch, dass Glimmbrände rechtzeitig erkannt und gelöscht werden können.
http://www.b4bbaden-wuerttemberg.de/nachrichten/region-neckar-alb-_artikel,-Die-Loesung-bei-Mikroschadstoff-Elimination-von-SUeLZLE-KOPF-Anlagenbau-_arid,137679.html
(nach oben)
Sessil: Getauchtes belüftetes Festbett Rütgers Deutschland GmbH
Aufgabenstellung
Die Rütgers Deutschland GmbH produziert am Standort Castrop-Rauxel diverse
Aromatenverbindungen, für die Teeröle die Rohstoffe darstellen. Die Festbett-
anlage dient der biologischen Vorbehandlung der Abwässer aus der Destillation
und der Weiterverarbeitung dieser Teeröle.
Verfahrenstechnische Lösung
Für die Vorbehandlung der Abwässer wurde das Verfahren des getauchten, belüfteten Festbettes gewählt, da insbesondere bei den vorliegenden, schwer behandelbaren, Abwässern die vollen Vorteile dieses Verfahrens zum Tragentragen kommen.
Die folgende Belastung wurde für die Erstellung der Anlage zugrunde gelegt:
Zufluss zur Vorbehandlung 1.250.000 m3/a
CSB Fracht 1.600 to/a
Stickstoff Fracht 175 to/a
Die Auslegung der biologischen Reinigungsstufe erfolgte dabei auf der Basis von Pilotversuchen.
Anlagentechnik
Für die großtechnische Ausführung der Anlage wurde eine Festbettanlage, bestehend aus 12 Kaskaden, mit einem Gesamtvolumen von 4.000 m3 Füllmaterial gewählt. Die Kaskaden für den Kohlenstoff- und Stickstoffabbau werden dabei mittels einer Zwischenklärung getrennt, um die Leistungsfähigkeit der Nitrifikation zu erhöhen.
Als Füllmaterial wurde ein speziell für diese Anlage entwickeltes BIO-NET® mit einer spezifischen Oberfläche von 150 m2/m3 eingesetzt.Das BIO-NET® wird dabei mittels Zugstangen auf einem Edelstahl-Auflagerost gelagert. Die Belüftung erfolgt durch Rohrbelüfter aus Keramik.
Ablaufwerte
Die Ablaufwerte der Anlage liegen für den CSB bei einer mittleren Flächenbelastung von 14,5 g/m2*d bei ca. 90 %.
Bei der Stickstoffeliminierung werden ebenfalls ca. 90 % erreicht, wobei die Flächenbelastung im Mittel bei 2,1 g/m2*d liegt.
Mit diesen Ablaufwerten übertrifft die Anlage die an sie gestellten Erwartungen.
Mittellasttropfkörper Kriebethal
Aufgabenstellung
Die Abwasserbehandlungsanlage Kriebethal hat eine Ausbaugröße von 45.000 EGW.
Das zu behandelnde Abwasser stammt zum überwiegenden Teil aus der ortsansässigen Papierfabrik und soll gemeinsam mit den kommunalen Abwässern sowie Fäkalien biologisch behandelt werden. Um die heutigen Anforderungen zu erfüllen, wurde die Anlage auf eine vollständige Stickstoffelimination ausgelegt.
Verfahrenstechnische Lösung
Die Behandlungsanlage ist nach der Vorklärung als zweistraßiges und zweistufiges System geplant. Die erste Stufe bilden zwei parallel betriebene Tropfkörper, die bei einer maximalen Raumbelastung von 2 kg BSB5/(m3 d) eine Abbauleistung von mindestens 45% erreichen müssen. Der Ablauf der Tropfkörper einschließlich des Überschußschlammes wird ohne Zwischenklärung in eine nachgeschaltete konventionelle Belebung, die in Form einer dreistufigen Kaskade ausgeführt ist, geleitet.
Anlagentechnik
Die beiden Tropfkörper wurden mit dem Trägermaterial SESSIL® bestückt. Dieses Tropfkörpermaterial besteht aus Folienstreifen, die an einen Tragrost unterhalb der Wasserverteilung abgehängt werden.
Technische Daten der Tropfkörper:
Volumen V = 1.610 m3
Füllhöhe h = 6,0 m
Durchmesser D = 18,50 m
Spezifische Oberfläche des SESSIL® Aspez= 100 m2/m3
Ablaufwerte
Die Leistung der Tropfkörper wird vom Betreiber als optimal angesehen. Die Abbauleistung lag während der bisherigen Betriebszeit trotz starker Zulaufschwankungen stabil bei 63% und liegt damit deutlich über der geforderten Reinigungsleistung.
Denitrifikationstropfkörper Leudelsbach
Aufgabenstellung
Das Gruppenklärwerk Leudelsbach hat eine Ausbaugröße von 35.000 EGW. Die biologische Reinigung der Abwässer erfolgte bisher in einer einstufigen Tropfkörperanlage.
Um die heutigen Anforderungen zu erfüllen, wurde die Anlage auf eine vollständige Stickstoffelimination umgerüstet.
Verfahrenstechnische Lösung
Die verfahrenstechnische Auslegung der Anlage erfolgte in Anlehnung an die wissenschaftlichen Untersuchungen durch die Universität Stuttgart. Für die gezielte Stickstoffelimination werden zwei parallel betriebene Denitrifikationstropfkörper eingesetzt. Die Tropfkörper sind dazu mit GFK-Kuppeln abgedeckt.
Um die Leistungsfähigkeit der Nitrifikation, die ebenfalls in einer Tropfkörperanlage erfolgt, nicht zu beeinträchtigen, wird der Überschußschlamm aus der Denitrifikation in einer Zwischenklärung abgeschieden.
Anlagentechnik
Die beiden Denitrifikationstropfkörper wurden mit der Tropfkörpervariante des Trägermaterials SESSIL® ausgerüstet.
Technische Daten der Denitrifikationstropfkörper:
Volumen V = 1.445 m3
Füllhöhe h = 4,6 m
Durchmesser D = 20,00 m
Spezifische Fläche des eingeb. Materials Aspez= 120 m2/m3
Ablaufwerte
Kohlenstoffabbau mit folgenden Grenzwerten:
CSB = 90 mg/l
BSB5 = 20 mg/l
http://www.sessil.com/Beispiele.aspx
(nach oben)
Armatec FTS : hat die Pumpenlösungen für Kläranlagen
Energieautarke Kläranlage für biogene Reststoffe in Österreich
Modernste Technologie zur Energiegewinnung und Gasverwertung sind auf der Kläranlage des
Abwasserverbandes Reither Ache in Going, Österreich vorzufinden. Dem Abwasserverband sind 4
Gemeinden (Reith, Kirchberg, Going und Kitzbühel) angeschlossen und wurde im Jahre 1982 ins Leben
gerufen. Hier werden nicht nur sämtliche Abwässer gereinigt (> 2 Mio m³/a) und anschließend mit
einem höchstmöglichen Reinigungsgrad wieder an die Reither Ache – und damit an die Natur zurück
gegeben, sondern auch Speisereste und Bioabfälle aus den Gemeindegebieten aufbereitet und zu
Klärgas umgewandelt.
Im Bereich der Energieoptimierung liegt heute auch der Schwerpunkt, erklärt Herr Erich Wallner,
Betriebsleiter der AWV Kläranlage in Going am Wilden Kaiser. In den letzten Jahren wurde investiert
in energiesparende Technologien bei den einzelnen Aggregaten sowie in Microgastechnologie zur
Klärgasverstromung, mit dem Ziel eine energieautarke Kläranlage zu betreiben. Die Gasverwertung
wird in 2 Microgasturbinen mit 65 kW und 30 kW elektrischer Leistung und 120 kW und 70 kW
thermischer Leistung durchgeführt. Pro Jahr werden ca. 620.000 kWh Strom erzeugt, bei einem
Eigenstromverbrauch von 500.000 kWh. Die Größe des Doppelmembran Gasspeichers beträgt 570 m³.
Insgesamt fallen 1.000 m³ Klärschlamm an mit einem TS Gehalt von 30%. Dieser Klärschlamm ist mit
Fremdstoffen vermischt. Zu finden sind Steine, Papier- und Verpackungsfetzen sowie Metalle (Nägel,
Reste von Besteck etc.). Diese bereiten Herrn Wallner und seinem Team seit Jahren Kopfzerbrechen.
Die Aufgabe für die Pumpen ist es den Brei mit einem TS Gehalt von ca. 15 % aus dem 32 m³
Übernahmetank (= Aufnahmetank für Klärschlamm sowie Fremdstoffe) in den 1.700 m³ Faulturm
(Ø15m) in eine Höhe von ca. 13 m zu befördern. Die ersten Versuche wurden mit
Exzenterschneckenpumpen durchgeführt, welche jedoch an den Fremdstoffen scheiterte. Danach
wurden Drehkolbenpumpen eingesetzt. Hier mussten aus denselben Gründen – Verschleiß durch
Steine, Metalle und Fetzen – die Kolbenpaarungen jede Woche ausgetauscht werden. Es entstanden
wöchentlich Kosten in Höhe von € 500,–, was im Jahr stolze € 26.000 verursachte.
Herr Wallner wurde nun auf die Fa. Armatec FTS aufmerksam, da während eines Besuches auf der
Messe Agritechnica in Hannover 2013 die Balgpumpe entdeckt wurde. Mit ihr ist es möglich, so
berichtet Herr Rudi Paflitschek, Vertriebs- und Marketingleiter dieses Unternehmens, auch Feststoffe
wie Steine zu pumpen. Ein anschließender Besuch beim Kunden vor Ort hatte zur Folge dass die
Balgpumpe mit 3 kW Leistung und bis zu 20 m³/h Förderleistung bestellt wurde.
ARMATEC Balgpumpe, 3 kW, 63 U/min, ca. 2 bar Förderdruck, bis zu 20 m³/h Fördermenge, 5″ Anschlüsse
Im April diesen Jahres konnte sich Herr Paflitschek von der Leistungsfähigkeit dieser Pumpe
überzeugen. Herr Wallner schwärmte davon, dass er nun endlich keinerlei Service- und
Wartungsarbeiten mehr seit 5 Monaten habe und enorme Betriebskosten einspare. Alle
Pumpaufgaben wurden gelöst und das bei niedrigem Stromverbrauch. „Hier hat Armatec eine Lösung
für alle Kläranlagen Betreiber geschaffen“, so berichtet Herr Wallner voller Stolz, endlich eine Lösung
gefunden zu haben.
Abwasserverband Reither Ache
www.awv-reitherache.net
Armatec FTS GmbH & Co. KG
Friedrich-List-Strasse 7
D – 88353 Kisslegg
Tel. +49 7563 90902 180
Fax +49 7563 90902 299
www.armatec-fts.de
eMail: paflitschek@armatec-fts.de
(nach oben)
Rohrleitungssanierungsverband: Grundstücksentwässerungsanlagen – Ein Fachbeitrag zur GEA
Ein Kreis von Experten traf sich erstmalig im November 2013, um über zentrale Fragen der
Instandhaltung von Grundstücksentwässerungsanlagen zu diskutieren. Der Expertenkreis
GEA ist sich u. a. darüber einig, dass nicht nur aus der Beratungsverpflichtung enorme
Aufgaben auf die Kommunen zukommen, die zielgerichtet auszugestalten und umzusetzen
sind. In diesem Beitrag wird das Umsetzungskonzept der Stadt Lünen vor dem Hintergrund
des rechtlichen Rahmens der neuen Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO
Abwasser NRW) vorgestellt.
Überwachungsfristen in NRW
Aus der neuen Gesetzes- und Verordnungslage in NRW zur Überprüfung der Zustands- und
Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen haben sich neue Anforderungen ergeben.
Danach sind Abwasserleitungen industriell und gewerblich genutzter Grundstücke in
Wasserschutzgebieten bis zum 31. Dezember 2015 erstmalig auf Zustand und Funktion zu
prüfen, soweit die Leitungen vor 1990 errichtet worden sind. Außerhalb von
Wasserschutzgebieten gilt der 31. Dezember 2020 als spätester Prüftermin.
Auch Eigentümer bebauter Grundstücke sind betroffen. Die neuen Regelungen verpflichten
Grundstückseigentümer in Wasserschutzgebieten dazu, ihre Abwasseranlagen bis Ende
2020 erstmals prüfen zu lassen, soweit nur häusliches Abwasser abgeleitet wird und diese
Anlagen nach 1965 errichtet worden sind. Ältere Abwasserleitungen sind erstmalig bis zum
31. Dezember 2015 zu prüfen. Für außerhalb von Wasserschutzgebieten gelegene private
Abwasserleitungen werden keine landesrechtlichen Prüftermine mehr vorgegeben, jedoch
bleibt die Pflicht zur Überwachung auch dieser privaten Abwasserleitungen bestehen. Hier
hat der Grundstückseigentümer insbesondere die Vorgaben der DIN 1986-30 zu beachten.
Hier können die Kommunen per Satzung entsprechende Regelungen beschließen.
Hervorzuheben ist weiter, dass Kommunen Kraft der neuen Verordnung künftig zur Beratung
der Eigentümer bebauter Grundstücke verpflichtet sind.
Aktuell arbeiten viele Kommunen, vor allem in NRW, an Handlungskonzepten, die in
politischen Gremien abzustimmen sind. Exemplarisch wird nachfolgend beispielhaft das
Konzept der Stadt Lünen vorgestellt.
Umsetzungsbeispiel Stadt Lünen
Zentrales Element für das Lünener Konzept ist der Umgang mit privaten
Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Raum. Auf Basis des § 53c LWG, NRW wird
im ersten Schritt eine Teilprüfung der Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen
Verkehrsraum gebührenfinanziert durchgeführt.
Der SAL-Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR führt dazu aus: „Jeder
Grundstückseigentümer wird über das Ergebnis dieser Teilprüfung informiert. Die
öffentlichen und privaten Leitungen bewerten wir einheitlich, setzen aber unterschiedliche
Schwerpunkte. Bei Schadensfreiheit einer Grundstücksanschlussleitung gehen wir aufgrund
unserer praktischen Erfahrungen von einer Schadensfreiheit der gesamten privaten
Entwässerungsanlage aus. Im Vorfeld informieren wir die Bürger über unser Vorgehen. Sie
können die Zustandsprüfung mitverfolgen und bei einem Schadensbefund der
Anschlussleitung die weiteren Leitungsbereiche auf dem Grundstück im Rahmen einer
privaten Beauftragung itbefahren lassen. Das ist nicht nur praktischer, sondern auch
kostengünstiger, als eine separate private Beauftragung zur öffentliche Kanalnetzbetreiber
ist beteiligt und dies gibt Sicherheit.
Die konkrete Bewertung wird anhand eines dreistufigen Aussiebverfahrens durchgeführt. Die
Grundstücksentwässerungsanlagen werden vorher in verschiedene Schadensgruppen
eingeteilt (hoch, mittel oder gering). Nur Anlagen mit gravierenden Schäden müssen
umgehend saniert werden (der gegenwärtige Erfahrungswert liegt hier bei rund 17% der
geprüften Grundstücke).
In Stufe 2 erfolgt eine individuelle Risikoermittlung nach Sanierungsklassen. Die örtliche und
die hydraulische Situation, die Lage der Abwasserleitungen im Verkehrsraum sowie örtliche
Probleme im öffentlichen Kanalnetz werden berücksichtigt. Nach dem Ampelprinzip erhält
jedes Grundstück eine Sanierungsklasse. In Stufe 3 werden die Sanierungsnotwendigkeit
beurteilt und Fristen zur Sanierung festgelegt: Dabei bedeutet Grün, dass keine Sanierung
erforderlich ist. Bei Gelb werden eine Sanierung und eine entsprechende Frist als
Empfehlung ausgesprochen. Bei Rot liegen schwere Schäden vor, die eine Sanierung
innerhalb einer Fristvorgabe erfordern. Für eine dringend erforderliche Sanierung sprechen
Indikatoren, wie etwa permanenter Fremdwasserfluss Rattenbefall. Nicht zu sanierende
Grundstücksentwässerungsanlagen werden bei Widerholungsprüfung neu bewertet.
Die hochwertige individualisierte Beratung ist eine gesetzlich verankerte Pflicht der
Kommunen (§ 53, 1e LWG, §§ 60 und 61 WHG). Sie ist innerhalb der Verwendung der
Abwassergebühren als inkludierter Kostenpunkt vorgesehen (§ 53c LWG). In Lünen setzt
man deshalb auf „Mündigkeit statt Zwang“ und Verbraucherschutz – und somit zentral auf
eine fundierte, zielgruppengerechte und individuelle Beratung.
Die neuen Gesetze zur privaten Grundstücksentwässerung stellen Bürger nicht länger unter
Generalverdacht, legen erstmals Regeln der Technik fest und räumen den Kommunen mehr
Mitbestimmungsrechte ein. Daraus ergibt sich für den Einzelfall die Möglichkeit, auf
spezifische örtliche Randbedingungen besser einzugehen. Die Mitarbeiter der SAL freuen
sich über diese Entwicklung und haben unser Beratungssystem vor dem Hintergrund der
Gesetzesnovellierung noch weiter verfeinert. Die Grundstücksanschlussleitung dient uns
dabei als „Kontaktleitung“ zwischen Kommune und Grundstückseigentümer.“
Es wird deutlich, dass der SAL-Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR ein rundum
positives Fazit aus den Umsetzungsmöglichkeiten der neuen gesetzlichen Anforderungen
zieht.
Ausblick
Für den nächsten Fachbeitrag werden Informationen über die
Grundstücksentwässerungsanlagen in Gewerbe und Industrie vorbereitet.
Zum Expertenkreis GEA-Gipfel gehören aktuell:
Dipl.-Ing. Dirk Bellinghausen, Güteschutz Grundstücksentwässerung, Hennef
Dipl.-Ing. Mario Brenner, Ingenieurbüro Brenner, Hennef
Dipl.-Ing. Claus Externbrink, SAL-Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR, Lünen
Dr.-Ing. Marco Künster, Güteschutz Kanalbau, Bad Honnef
Gerhard Treutlein VDRK – Verband der Rohr- und Kanal-Technik-
Unternehmen e.V., Kassel
Dr.-Ing. Michael Scheffler, Sachverständigen- und Ingenieurbüro für
Gebäude- und Grundstücksentwässerung, Kassel
Dipl.-Ing. Marco Schlüter, IKT-Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen
Dipl.-Volkswirt Horst Zech, RSV-Rohrleitungssanierungsverband, Lingen (Ems)
Skizze: SAL – Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR
Skizze: SAL – Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR
RSV – Rohrleitungssanierungsverband e.V.
Eidechsenweg 2
49811 Lingen (Ems)
E-Mail : rsv-ev@t-online.de
Internet : www.rsv-ev.de
(nach oben)
HACH LANGE: CSB ist immer noch einer der wichtigsten Parameter bei der Abwasseranalyse – für die Abwasserbeurteilung und die Kontrolle der Abwasseraufbereitungsanlagen.
Die Bestimmung von CSB mit dem Küvettentestsystem bietet zahlreiche Vorteile.
Den informativen Praxisbericht finden Sie unter:
http://www.hach-lange.de/medias/sys_master/8853762506782/DE_20023.pdf
(nach oben)
HACH LANGE: Die TOC-Küvettentests von HACH LANGE verfügen über die einzigartige Methode des automatischen Schüttlers zum Austreiben des TIC.
Das spart Zeit und eliminiert das Risiko von Anwendungsfehlern und Verunreinigungen.
Lesen Sie den Praxisbericht unter:
http://www.hach-lange.de/medias/sys_master/8853762441246/DE_00405.pdf
(nach oben)
Grundfos: Modulares Technologie-Konzept erweitert den Fokus von der Pumpe auf das System
Wer eine neu zu installierende Pumpe auslegt oder eine Pumpe im Bestand optimiert, darf sich nicht allein auf die Pumpentechnik fokussieren. Stets sollte der Planer oder Betreiber das System, die gesamte Umgebung der Pumpe mit im Blick haben. Je relevanter die Förderaufgabe für den Betreiber ist – sei es in der Gebäudetechnik, in der Industrie oder in der Wasserwirtschaft – desto höhere Aufmerksamkeit erfordert der Systemansatz. Denn die praktische Erfahrung lehrt: Die gemäß Systemansatz ausgelegte und betriebene Pumpe arbeitet in aller Regel zuverlässiger, neigt weniger zu Störungen.
Grundfos nennt den ganzheitlichen Systemansatz für Pumpenanlagen ‚iSolutions‘. Es geht dabei um die Verschmelzung selbst entwickelter und gefertigter Komponenten (Hydraulik, Antriebslösungen, Sensoren, Steuerungs- und Sicherungsmodule sowie Mess- und Datenübertragungseinheiten) zu einem intelligenten Hybridsystem, das sich den Anforderungen unterschiedlicher Applikationen anpasst. Wichtig: Praktisch alle Komponenten entwickelt und produziert Grundfos in eigener Regie speziell für den Einsatz mit Pumpen, was einen zuverlässigen Pumpenbetrieb ohne hohen Spezifikations-Aufwand sicherstellt.
Der modulare Ansatz, der den iSolutions zugrunde liegt, stellt einen präzisen Abgleich zwischen den Anlagenanforderungen und den verwendeten elektronischen Bauteilen sicher. Beispielsweise erbringen Pumpen mit integriertem Frequenzumrichter exakt die Leistung, die das Lastprofil und die Betriebsdaten der Anlage vorgeben. Das spart Energie ein. Darüber hinaus sorgen intelligente Regelungsmodi für eine gesicherte Integration in die relevanten Standardanwendungen der Gebäudetechnik, der Industrie und der Kommunalwirtschaft.
Beispielsweise wurde die 3. Generation des MGE-Motors, derzeit bis 2,2 kW Leistung erhältlich, speziell für den Pumpenbetrieb und eine optimierte Drehzahlregelung entwickelt und bietet mit einem besseren Wirkungsgrad als von IE4 gefordert eine ausgezeichnete Energieeffizienz.
Ein besonderer iSolutions-Baustein ist die AutoAdapt-Funktion: Sie sichert eine präzise Konfiguration der Anlage und damit maximale Energienutzung. Dazu analysiert die Pumpe kontinuierlich die Anlagenanforderungen auf Veränderungen und nimmt anschließend zur Sicherung der Gesamtanlageneffizienz eine Leistungsanpassung vor.
Sozusagen das Herzstück jeder iSolutions-Lösung sind zuverlässige und robuste Sensoren, die für eine präzise Übertragung der Anlagendaten sorgen. Integrierte Sensoren sind als Durchfluss-, Differenzdruck- und Relativdrucksensoren in Kombination mit einer Temperaturmessung verfügbar. Deren patentierte Silicoat-Beschichtung ermöglicht einen direkten Kontakt mit dem Medium im Dauereinsatz; das gewährleistet eine kurze Ansprechzeit auf schnelle Temperaturänderungen in der Anlage.
Mit einem umfassenden Kommunikationsportfolio sowohl für das Remote-Management als auch für die Systemintegration kann der Anwender auf Steuerungs- und Überwachungsfunktionen zugreifen, die den Aufwand zur Datenerhebung und für Wartungsarbeiten erheblich reduzieren:
• CIM/CIU-Steuerungsmodule und -geräte stellen eine Energieverbrauchsoptimierung sicher und verarbeiten Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen.
• ‚Grundfos Go‘ ist als mobiles Fernbedien- und Diagnosegerät so konzipiert, dass es mit allen E-Pumpen von Grundfos kompatibel ist. In größeren Anlagen lassen sich mit der Funktion ‚Clone Pump Settings‘ ganze Pumpengruppen schnell konfigurieren.
Im Ergebnis sichern iSolutions eine hohe Energieeffizienz, niedrige Fehlerraten und kürzere Ausfallzeiten, verbunden mit einer nahtlosen Anlagenintegration und vorteilhaften Regelungs-Routinen. Kurz: Sie sind präzise für den gewünschten Einsatzzweck konzipiert. Martin Palsa, Geschäftsführer der Grundfos GmbH, bringt es so auf den Punkt: „Mit iSolutions bieten wir Lösungen mit einer konsequenten Kostenbremse an.“
http://de.grundfos.com/about-us/news-and-press/news/grundfos-isolutions.html
(nach oben)
Ratten in der Kanalisation
Mit geballtem Sachwissen werden die Mitarbeiter/innen von KASSELWASSER zukünftig den Ratten in der Kanalisation zu Leibe rücken.
Die gesetzlichen Anforderungen an die Ausbildung und die notwendigen
Risikominimierungsmaßnahmen beim Einsatz von Rodentiziden sind ab dem
01.07.2014 für alle berufsmäßigen Anwender bindend.
Arno Bauer, Sachgebietsleiter Netzbetrieb hat für diese Sachkundeschulung das IHS – Ingenieurbüro
für Hygieneplanung und Schädlingsprävention – engagiert. „Nach 2010 ist dies nun bereits die
zweite Sachkundeschulung, die wir in Kassel in dieser Form für die Mitarbeiter durchführen. Die
Vorteile von Team-Schulungen im eigenen Haus, liegen für uns klar auf der Hand: Alle Mitarbeiter im
Team haben anschließend den gleichen Wissenstand und können sich bei der Planung und
Durchführung der Arbeiten gut unterstützen. Das zeigen auch unsere langjährigen guten Ergebnisse
bei der Schadnagerbekämpfung im Kanal“, so Arno Bauer, der sich auch selber ein Bild von der
Tagesveranstaltung machte.
Wanderratten sind hochsoziale Rudeltiere und wahre Überlebenskünstler. Sie passen sich ihrem
Lebensumfeld schnell und effizient an. In der Kanalisation wird ihnen neben einer exzellenten
Infrastruktur von Röhren und Gängen gleichzeitig eine optimale und schier endlose Nahrungsquelle
geboten. Wer da nicht an Vermehrung denkt?
Neben den vielen Informationen zur Biologie, zum Verhalten und zur Vermehrung von Ratten ging
der Referent Rainer Neuber auch auf die neuen rechtlichen Regelungen zur Bekämpfung von
Nagetieren ein.
Neben der Sachkunde nach dem Tierschutzrecht (§4) ist ab dem 01.07.2014 für die Anwendung aller
Rodentizide der 2. Generation auch eine Sachkunde nach der Biozidverordnung notwendig.
Hier geht es im Wesentlichen um die Anwenderbeschränkungen, die Anwendungsbereiche, die gute
fachliche Anwendung (GFA) und die Risikominimierungsmaßnahmen (RMM) beim Einsatz von
Rodentiziden.
Diese Maßnahmen sind EU weit notwendig geworden, da bei einer Neubewertung und Neuzulassung
der Rodentizide die Wirkstoffe der 2. Generation als besorgniserregende Stoffe eingestuft wurden
und nur mit Auflagen und Beschränkungen zugelassen werden konnten.
Einen wichtigen Teil der Fortbildung widmete der Referent der Prävention und den alternativen
Bekämpfungsmöglichkeiten, dem eigentlichen Hauptarbeitsfeld von Neuber und seinen Mitarbeitern,
die beratend und ausführend u.a. für Kommunen und Klärwerke tätig sind.
Neben vollelektronischen Schlagfallen wurden der Einsatz von Sperrklappen, Rattentrichtern und
Fallen demonstriert. „ Mit diesen technischen Hilfsmitteln kann man die Tiere aus der
Hauskanalisation einfach fern halten und manch böser Überraschung in der Toilette vorbeugen….“
schmunzelt der Praktiker aus Borgholzhausen.
Mehr Informationen unter:
IHS – Ingenieurbüro für Hygieneplanung und Schädlingsprävention
Hans-Rainer Neuber
Dipl.-Ing. agr. – Freier Sachverständiger
Staatl. gepr. Desinfektor & Schädlingsbekämpfer
Landweg 8 – 33829 Borgholzhausen
Telefon 05425-5529 – Mobil 0163-1424849
Fax 05425-954280-E-mail:info@neuber-ihs.de
(nach oben)
Eurodos: Maßgeschneiderte Dosierstationen für jeden Anwendungsfall
Dosiertechnik: Eurodos liefert maßgeschneiderte Polymerlösestation nach Bad Tölz
Der Fall ist gelöst
Eines haben TV-Kommissar Benno Berghammer – der legendäre „Bulle von Tölz“ – und der Dosiertechnik-Spezialist Eurodos gemeinsam: Es wird so lange getüftelt, bis jeder Fall gelöst ist. Das hat die VTA-Tochterfirma nun auch in Bad Tölz bewiesen.
In der Kläranlage der oberbayerischen Kurstadt wurde die Schlammentwässerung erneuert. Die Aufbereitung des Polymers für die neue Schneckenpresse sollte eine vollautomatische Löse- und Dosiermittelstation übernehmen. Hier konnte Eurodos seine Kompetenz voll ausspielen, wenn es darum geht, nicht nur Standardanlagen zu liefern, sondern Spezialwünsche der Kunden schnell und punktgenau umzusetzen.
Gefragt war in Bad Tölz eine Zweikammer-Pendelanlage…mehr unter:
http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=182
(nach oben)
VTA: MicroTurbine auch für kleinere Kläranlagen wirtschaftlich interessant
Kraft-Wärme-Kopplung: Dank MicroTurbine auch für kleinere Kläranlagen interessant
Nicht nur für die Großen
Noch immer nützen Kläranlagen der Größenklasse 4 (10.001 – 100.000 EW) Klärgas, das in der Faulung anfällt, nach wie vor bloß zum Heizen. Tatsächlich produzieren kleine Faulungsanlagen bisweilen zu wenig Gas, um eine herkömmliche Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wirtschaftlich betreiben zu können. Oft erweist sich aber auch der zusätzliche Arbeitsaufwand als Hemmschuh. Hauptaufgabe der Klärwerkmitarbeiter ist und bleibt die Reinigung des Abwassers; sich auch noch um eine Anlage zur Stromerzeugung zu kümmern, ist bei dünner Personaldecke vielfach nicht drin.
Die innovative Technologie der MicroTurbine von VTA macht eine Kraft-Wärme-Kopplung aber auch für kleinere Klärwerke attraktiv und wirtschaftlich: Fast die Hälfte der mehr als 70 MicroTurbinen, die mittlerweile in Deutschland und Österreich im Einsatz sind, arbeiten auf Kläranlagen, in denen das Faulgas zuvor nur für Heizzwecke verwendet wurde. Der Arbeitsaufwand (Wartung) für die Turbinen ist äußerst gering – im Vergleich zu konventionellen KWK-Anlagen ein entscheidender Vorteil.
Stromkosten um 40 % gesenkt
Ein aktuelles Vorzeigeprojekt in dieser Hinsicht ist das Klärwerk Nersingen im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm. In der 15.000-EW-Anlage wurde das Klärgas bisher lediglich zum Beheizen von Betriebsgebäuden und Faulbehälter genutzt. Nun ist dort eine MicroTurbine…mehr unter:
http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=185
(nach oben)
VTA: Klärschlamm: Erste Desintegrationsanlage in ganz Irland kommt von VTA
Erfolg in Ost und West
Auch auf der Grünen Insel hält nun die GSD-Technologie von VTA Einzug: In der Kläranlage von Swords nahe Dublin geht im Frühjahr eine GSD-Anlage in Betrieb – die erste Klärschlamm-Desintegrationsanlage in Irland überhaupt.
Das Klärwerk von Swords, einem Vorort nördlich der Hauptstadt, wird derzeit auf eine Kapazität von rund 100.000 EW erweitert und an den Stand der Technik angepasst. Auf der Suche nach einem Verfahren, mit dem sich die Schlammfaulung verbessern und die Biogas-Ausbeute steigern lässt, wurden die Investoren auf die patentierte Ultraschall-Technologie von VTA aufmerksam. Beste Referenzen und das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugten schließlich ebenso wie die Möglichkeit, die GSD-Anlage ohne zusätzliche Baumaßnahmen in den Bestand zu integrieren.
Zwei neue VTA-Anlagen in Polen
Nicht nur in Westeuropa realisiert VTA neue GSD-Projekte, sondern auch in Polen, wo bereits mehrere solcher Anlagen erfolgreich laufen. Eine weitere steht nun in Chelm, einer Stadt in Südostpolen nahe der rumänischen Grenze. Dort wird die städtische Kläranlage mit einem Investitionsvolumen von rund 13 Millionen Euro erweitert und modernisiert.
In Chelm soll der Überschussschlamm mittels Desintegration behandelt werden. Die VTA-Anlage umfasst zwei Reaktoren in Serie, die nach der Überschussschlamm-Eindickung in einem bestehenden Gebäude installiert wurden. Auftraggeber ist Inżynieria Rzeszów S.A., einer der führenden Anlagenbauer Polens, der das Klärwerk…mehr unter:
http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=186
(nach oben)
VTA: Kanalgeruch: Dank VTA Aufatmen in der Oberpfalz
Probleme mit Kanalgeruch: Wenn nichts mehr hilft – dann hilft VTA
Aufatmen in der Oberpfalz
Man muss kein Chemiker sein, um Schwefelwasserstoff sofort zu erkennen: Die widerliche Duftnote fauler Eier verrät das Gas H₂S schon in geringsten Mengen. Davon weiß man in Ursensollen ein Lied zu singen. Jahrelang kämpfte die 3700-Einwohner-Gemeinde im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach mit hartnäckiger Geruchsentwicklung aus dem Kanalnetz.
Das Grundproblem wird mit einem Blick auf die Topographie der weitläufigen Gegend rund um den Naturpark Hirschwald rasch klar. Das Ursensollener Gemeindegebiet erstreckt sich über stolze 73 Quadratkilometer und umfasst 38 Ortschaften.
Rund 80 Prozent der Gebäude sind an das Kanalnetz …mehr unter:
http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=181
(nach oben)
NIVUS: Optimaler Mitteleinsatz in der Fremdwassermessung
Thomas Schäfer (NIVUS GmbH) vergleicht den Mittelaufwand und die Ergebnistiefe bei Einzelmessungen und Kurzzeitmessungen für Fremdwassermessungen. Der Artikel ist in der wwt März 2014 erschienen:
www.wwt-online.de
Quelle: https://www.nivus.de/presse/optimaler-mitteleinsatz-in-der-fremdwassermessung
(nach oben)
Grundfos: bietet einen neuen Ansatz für die fehlende Abwasserklasse IE3.
Technische Analyse der IEC-Motoreffizienz-Standards bei Abwasseranwendungen
Heutzutage machen Pumpen nicht weniger als 10 % des weltweiten Stromverbrauchs aus und zwei Drittel aller Pumpen verbrauchen bis zu 60 % zu viel Strom. Wenn jedes Unternehmen auf hocheffiziente Pumpensysteme umsteigen würde, könnten 4 % des gesamten Stromverbrauchs weltweit gespart werden. Oder anders gesagt: ein Anteil vergleichbar mit dem Haushaltsstromverbrauch von einer Milliarde Menschen, wie der globale Pumpenhersteller Grundfos angibt. Folglich hat die Senkung von Energiekosten durch die Entwicklung effizienterer Elektromotoren für Endverbraucher, Umweltgesetzgeber, Regierungen und Hersteller oberste Priorität angenommen.
Während des letzten Jahrzehnts wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die weltweit verschiedenen Prüf- und Klassifizierungsstandards sowie die entsprechenden Kennzeichnungsregelungen zu harmonisieren. Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) hat mit der NEMA, dem CEMEP, dem IEEE und anderen internationalen Organisationen zusammengearbeitet. Das Ergebnis dieser Arbeit war die Veröffentlichung zweier wichtiger Standards:
• IEC 60034-2-1 (Ed. 1.0): Drehende elektrische Maschinen – Teil 2-1: Standardverfahren zur
Bestimmung der Verluste und der Effizienz aus Prüfungen (ausgenommen Maschinen für Schienen- und Straßenfahrzeuge,
2007), das Methoden beschreibt, die zur Bestimmung des Motorwirkungsgrads verwendet werden.
• IEC 60034-30: Drehende elektrische Maschinen – Teil 30 (Ed. 1.0): Wirkungsgradklassen von eintourigen, dreiphasigen Motoren mit Käfigläufer (IE-Code), der Energieklassen für Induktionsmotoren definiert.
„Es gibt zwei Wege, um den Wirkungsgrad eines Elektromotors zu bestimmen“, erklärt Mikael Nedergaard, Global Product Manager von Grundfos Holding A/S. „Die eine Möglichkeit ist ein direkter Test, der darauf beruht, die Aufnahmeleistung auf Basis der Spannung und des Stroms und die Abgabeleistung auf Basis der Drehzahl und des Drehmoments zu berechnen. Die andere, indirekte Methode besteht in der Messung der Aufnahmeleistung und der Berechnung der gesamten Verluste, indem die individuellen Verlustkomponenten berechnet und addiert werden. Dieser indirekte Test kann nur bei dreiphasigen Motoren angewendet werden.“
Der gegenwärtige Klassifizierungsstandard IEC60034-30 für eintourige, dreiphasige Induktionsmotoren und Motoren mit Käfigläufer legt drei Energieeffizienzklassen fest:
• IE3 – Premium Efficiency (höchster Wirkungsgrad, gleichwertig mit NEMA Premium)
• IE2 – High Efficiency (hoher Wirkungsgrad, gleichwertig mit NEMA Energy Efficient)
• IE1 – Standard Efficiency (Standard-Wirkungsgrad, gleichwertig mit dem früheren CEMEP EFF2)
Im Jahr 2014 wird der neue IEC60034-30-1 die vierte Effizienzklasse festlegen – IE4 Super Premium Efficiency. Dieser Standard wird den aktuellen Standard IEC 60034-30 ersetzen.
„Die Effizienzklasse IE2 wurde im Juni 2011 von der Ökodesign-Richtlinie ins Leben gerufen. Ab Januar 2015 soll kein Motor mit einer Nennleistung von 7.5 bis 375 kW unter der Effizienzklasse IE3 liegen bzw. der Effizienzklasse IE2 entsprechen, soweit er mit einem drehzahlgeregelten Antrieb ausgestattet ist“, erklärt Robert Bork Hansen, Global Product Specialist bei Grundfos Holding A/S. „Diese Anforderungen gelten für 2-, 4- und 6-polige, eintourige, dreiphasige Induktionsmotoren mit einer Bemessungsspannung bis zu 1000 V und mit Dauerbetrieb. Wichtig ist: Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden und/oder vollständig in ein Produkt eingebaute Motoren, deren Energieeffizienz nicht unabhängig von diesem Produkt erfasst werden kann, werden nicht dazu gezählt.“
Dabei muss die Frage gestellt werden, ob eine Pumpe mit integriertem Motor, die für das Eintauchen in Wasser ausgelegt ist, wie z. B. eine Abwasserpumpe, als IE2- oder IE3-effizient beschrieben werden kann. Da der Motor nicht unabhängig von der Pumpe geprüft werden kann, vor allem weil es keine standardisierte Verbindung, kein festgelegtes Kühlsystem und auch keine anerkannte Prüfmethode gibt, muss die Antwort „Nein“ lauten.
„Theoretisch sollte es relativ einfach sein, den Motor einer Abwasserpumpe zu testen, da der Motor eine Welle enthält, die auf Drehmoment und Leistung geprüft werden könnte“, sagt Leo Andersen, Regionaler Programm Manager bei Grundfos Holding A/S. „Doch jeder Prüfvorgang müsste Probleme angehen wie Kühlung und Lüftung, zusammen mit der Leistung, die genutzt wird, um den Motor zu kühlen. Zwei weitere Elemente, die sich auf die Leistungsanforderungen der Motorwelle auswirken, sind Reibungsverluste der Gleitringdichtung und Lagerreibungsverluste, die durch die Nutzung von Schräglagern entstehen. Abwasserpumpen nutzen üblicherweise eine doppelte Gleitringdichtung, um Leckagen des Fördermediums in den Motor zu verhindern.“
Leo Andersen erklärt weiter: „Außerdem ist noch die Frage der Installation zu bedenken. Wird der gleiche Motor z. B. an feuchten und trockenen Aufstellungsorten verwendet, wird der Wirkungsgrad verschieden sein. Alles in allem sind es also alle Verluste im System, die ein eindeutig definiertes Prüfverfahren erfordern, doch dafür müssten die Aufstellungsbedingungen der Anlage nachgebaut werden.“
Einzelberichte von Grundfos-Kunden aus der Abwasserindustrie offenbaren, dass Betriebssicherheit und größere Effizienz die wichtigsten Fragen sind, die die Kunden beschäftigen. Ist die Pumpe einmal installiert, wollen die Anwender sie nicht erneut anrühren; sondern sie sind bereit, ein gewisses Maß an Energieeffizienz zu opfern, wenn es dafür zu weniger Ausfällen kommt. Effizienz ist eine Frage, die jeden Pumpenanwender in der Abwasserindustrie betrifft und sie gewinnt bei einem größeren Pumpenmotor sogar noch an Bedeutung. Die höchste Energieeffizienz bei allen seinen Abwasserpumpen zu bieten, ist das Ziel von Grundfos.
“
Wenn in einer Ausschreibung verlangt wird, dass die Abwasserpumpen der IE3 entsprechen müssen, kann kein Hersteller eine solche Pumpe liefern, weil es keinen anwendbaren Standard gibt.
FOTO: Die Leistungskennlinien der Grundfos SL/SE 1.95.150.220.4.52 H Abwasserpumpe, einschließlich der Gesamtwirkungsgradkennlinie (Eta 1). Die Eta-2-Kennlinie zeigt den hydraulischen Wirkungsgrad.
Die Grundfos-Lösung
Da es unmöglich ist, zu behaupten, dass eine Abwasserpumpe, die einen integrierten Motor enthält, den Standard IE2 oder IE3 erfüllt, bietet Grundfos eine Lösung, die aus dessen Sicht das Problem der Pumpen- und Motoreffizienz angeht. Die Grundfos-Abwasserpumpen SE1/SEV und SL1/SLV enthalten jetzt elektrische Innenteile, d. h. Rotor und Stator, des IE3-Motors im Pumpengehäuse.
„Was den Motor der Abwasserpumpe von einem herkömmlichen IE3-Motor unterscheidet, sind die Lager, Gleitringdichtungen und das Fehlen einer Gebläsekühlung wie oben beschrieben“, erklärt Robert Bork Hansen. „In feuchten Installationen wird die Kühlung über die Flüssigkeit geliefert, in die die Pumpe eingetaucht ist. Die Rotoren und Statoren des Grundfos IE3-Motors sind typgeprüft und zertifiziert in Übereinstimmung mit dem TEFC-Motorstandard und werden durch Messprotokolle gestützt, sodass es sich in jeder Hinsicht um einen IE3-konformen Motor handelt. Durch das Austauschen der Lager, das Hinzufügen einer Gleitringdichtung und durch die Kühlmethode wird die IE3-Konformität des Motors jedoch zunichte gemacht.“
Der Hauptgrund dafür, dass bis jetzt noch kein Effizienzstandard für Abwasserpumpen eingeführt wurde, könnte die Tatsache sein, dass Hersteller, Gesetzgebung und Normungsgremien Motoren von Abwasserpumpen als getrennte Einheit ansehen und nicht als eine in die Pumpe integrierte Einheit. Deshalb haben sie Schwierigkeiten damit, die Reibungsverluste des Motors und den Wirkungsgrad zu definieren.
Pumpenhersteller, die behaupten, dass ihre Abwasserpumpen IE3-konform sind, machen sich der Irreführung von Beratern und Endverbrauchern schuldig. Wenn in einer Ausschreibungsunterlage verlangt wird, dass die Abwasserpumpen IE3-konform sein müssen, kann kein Hersteller eine solche Pumpe liefern, weil es keinen anwendbaren Standard bezüglich der Effizienz von Abwasserpumpen mit integriertem Motor gibt.
Die Verwendung der elektrischen Komponenten eines IE3-Motors und ihr Einbau in eine Abwasserpumpe liefern einige Informationen über die Effizienzklasse der gesamten Motoreinheit. Was dadurch aber nicht geliefert wird, ist ein bestimmter Wert, da die Reibungsverluste in einer Abwasserpumpe sich von denen in einer Standardpumpe unterscheiden und diese Verluste nicht berücksichtigt werden. Auch hinsichtlich der Hydraulik, wo die besseren Möglichkeiten für Effizienzgewinne liegen, werden somit keine Informationen geliefert.
„Um den höchsten Wirkungsgrad in einem Pumpensystem zu erreichen, muss die ausgewählte Pumpe über einen Wirkungsgrad-Bestpunkt verfügen, der dem Betriebspunkt entspricht“, sagt Mikael Nedergaard. „Der Wirkungsgrad-Bestpunkt hängt vor allem von den Charakteristiken der Pumpe ab; dazu gehören Leistung, Fluss und Förderhöhe. Es handelt sich dabei um den Punkt auf der Pumpenkennlinie, an dem die Pumpe am effizientesten arbeitet. Dabei darf nicht vergessen werden, dass der Wirkungsgrad der Pumpe deutlich abnimmt, wenn die Pumpe nicht auf dem ausgelegten Wirkungsgrad-Bestpunkt arbeitet.“
Grundfos ist der Ansicht, dass Hersteller, Berater und Endverbraucher sich nicht ausschließlich auf den Motorwirkungsgrad konzentrieren sollten, sondern stattdessen auf den Gesamtwirkungsgrad der Pumpe, wie er in der ISO 9906 festgelegt ist: Standard von 2012 „Leistungsabnahmeprüfung für Kreiselpumpen“ oder Standard ANSI/HI 11.6.2012 „Leistungsabnahmeprüfung für Kreiseltauchpumpen“, wenn über Abwasserpumpen und Pumpen mit Unterwassermotor diskutiert wird. Genauso wichtig für den Motorwirkungsgrad ist die Pumpenhydraulik, da hier die Möglichkeiten zur Verbesserung des Pumpenwirkungsgrads weit größer sind. Solange ein geeigneter Energieeffizienzstandard für die Pumpe fehlt, ist es unvermeidlich, dass Hersteller und Verkäufer die Verbindung zum IE3 betonen. Diese Situation beginnt sich zu wandeln und Europump diskutiert Vorschläge für einen geeigneten Pumpenstandard. Der Anstoß für die Schaffung eines angemessenen Standards kann nicht ausschließlich von den Pumpenherstellern kommen, sondern muss auch von Politikern und Regulierungsstellen vorangetrieben werden.
„In den letzten Jahren wurde ein Energiestandard für kleine Umwälzpumpen geschaffen, bei denen, wie bei Abwasser- und Unterwasserpumpen, der Motor und die Welle in einem einzigen Gehäuse enthalten sind und nicht separat geprüft werden können“, kommentiert Mikael Nedergaard. „Wie von der EU empfohlen, besteht der Standard, der von der Europump, dem Fachverband der Pumpenhersteller, und den Pumpenherstellern entworfen wurde, aus sieben Energiesparklassen. Der Energieeffizienzindex (EEI) einer Pumpe wird gemäß dem jährlichen Lastprofil berechnet und die Pumpe wird entsprechend ihrer Energieeffizienz gekennzeichnet. Durch die Einführung einer Energieeffizienzkennzeichnung kann der Endverbraucher Produkte vergleichen und die geeignetste Pumpe bzw. Pumpen für seine Installation auswählen.“
Wenn dies für Umwälzpumpen erreicht werden kann, folgt daraus, dass auch für Abwasserpumpen ein international anerkannter Energiestandard geschaffen werden kann. Da die Abwasserbehandlungsindustrie sich stufenweise hin zu größeren und effizienteren Aufbereitungsanlagen bewegt, die größere Pumpen benötigen, werden Energiekosten immer wichtiger werden. Die Pumpenindustrie sowie die Regulierungsstellen werden entsprechend reagieren müssen und in ein Prüfsystem investieren, das den Endverbrauchern die Informationen liefert, die sie benötigen.
Artikel von Bryan Orchard
http://de.grundfos.com/about-us/news-and-press/news/Grundfos-offers-approach-to-missing-IE3-wastewater-class.html
Verweise:
Grundfos Fakten zu Pumpen und Energie
Hintergund des Grundfos Blueflux® Energielabels
Internationale Elektrotechnische Kommission
Publikationen zum TC2-Arbeitsprogramm für rotierende Maschinen (14)
National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
Europump
Richtlinie der Europump zum Pumpenwirkungsgrad von einstufigen Kreiselpumpen
Richtlinie der Europump über die Anwendung der Regelung 640/2009/EC für Elektromotoreffizienz – Mai 2011
Vorbereitende Ökodesignstudien für Pumpen (ENER Lot 28: Abwasserpumpen)
(nach oben)
Convitec: Bemessung der Belüftungstechnik in Klärwerken
Es ist nicht weiter verwunderlich, dass man der Belüftungstechnik in sowohl häuslichen als auch industriellen Abwasseranlagen besondere Bedeutung schon deswegen beimisst, weil an dieser Stelle in den Kläranlagen die meiste Energie verbraucht wird. Es ist daher von Bedeutung, die Belüftung weitgehend zu optimieren.
Folgende Bemessungskriterien werden heute in der Regel angewandt:
●● spezifischer Sauerstoff-Ertrag in g O2/ Nm³ x m
●● spezifischer Energieverbrauch in kg O2/kWh
●● Verstopfungsanfälligkeit
●● Dauerbeständigkeit der eingesetzten Materialien
●● Investitionskosten
Meistens erschöpften sich die Argumentationen der Belüftungstechnik anbietenden Firmen im spezifischen O2-Ertrag. Man kann aber davon ausgehen, dass die führenden Unternehmen auf diesem Gebiet heute Belüfter anbieten, die technisch durchaus gleichwertig sind. So darf ein spezifischer Ertrag in der Größenordnung von 25–28 g O2/Nm³ x m als gängig und in aller Regel erreichbar angesehen werden. Es ergibt also wenig Sinn, heute noch nach besonders leistungsfähigen Belüftern Ausschau zu halten, da die technischen Möglichkeiten in dieser Richtung zumindest von den führenden Unternehmen voll ausgenutzt worden sind und eine weitere Verbesserung in diese Richtung nicht mehr zu erwarten ist. Es kommt vielmehr darauf an, dass die Belüfter in einer vernünftigen Weise beaufschlagt werden. Es geht hier um Werte, die bei etwa 2–6 Nm³/m x h liegen. Beachtet werden muss auch die Anordnung der Belüfter im Beckenbereich, da selbst eine geringfügige Abweichung von der optimalen Verteilung schon zu drastischen Veränderungen in der Leistungsfähigkeit der Belüftungstechnik beitragen kann. In der Regel darf gelten, dass die Belüftungstechnik umso besser arbeitet, je dichter die Belüfter angeordnet sind und je geringer andererseits die Beaufschlagung gewählt wurde. Ein sehr wichtiger Parameter ist natürlich der spezifische Energieverbrauch in kg O2/kWh. Membran-Rohrbelüfter können hier mit Werten in der Größenordnung von 3–4 kg O2/kWh aufwarten. Bei Plattenbelüftern mit großer Membranfläche bedarf es eines vergleichsweise hohen Differenzdrucks an der Membran, um überhaupt eine gleichmäßige Blasenverteilung erreichen zu können. Somit muss bei großflächigen Belüftern mit einer deutlichen Erhöhung des spezifischen Energiebedarfs gerechnet werden. Auch muss bedacht werden, dass ein höherer Differenzdruck bei vergleichsweise großflächigen Membranen zu hohen Kräften in den Einspannungen führt. Zu wenig Beachtung wurde bisher der Tatsache gewidmet, dass Belüfter möglichst nahe am Beckenboden montiert sein sollten, um so eine maximale Verweilzeit der Luftblasen bei voller Ausnutzung der überdeckenden Wassersäule zu gewährleisten. Aus diesem Grunde beispielsweise sind Ecoflex-Belüfter dazu geeignet, unterhalb der Beckenverteilleitungen montiert zu werden, sodass man eine Anordnung fast in Höhe des Beckenbodens erreicht. Im Vergleich zu Belüftern, die oberhalb der zuführenden Druckluftleitungen angeordnet sind, können somit Verweilzeiten von bis zu 10 % mehr erreicht werden, was unmittelbar zu einer Ertragssteigerung in entsprechender Größenordnung führt. Die sinnvolle Montage von Belüftern unterhalb der Luftverteilleitung löst auch einwandfrei das Problem der System-Entwässerung, da zum Beispiel gebildetes Kondensat durch die Belüfter leicht nach unten ohne Verwendung von Entwässerungsleitungen ausgetragen wird. Wenn man die hier getroffenen Feststellungen berücksichtigt, so ergibt es wenig Sinn, Belüfter in speziellen Becken unter ganz besonderen Bedingungen auf ihre Leistungsfähigkeit hin zu testen oder verschiedene Fabrikate miteinander zu vergleichen. Natürlich ist es richtig, für die endgültige Arbeitsweise Feldversuche zu unternehmen, um die jeweils garantierte Leistungsfähigkeit der Belüftungstechnik unter Beweis zu stellen.
Dr. Ing. Hans-Joachim Schmidt-Holthausen (Bietigheim-Bissingen)
www.convitec.eu
(nach oben)
Kronos: Bericht zum Workshop „Abwasservorbehandlung in der milchverarbeitenden Industrie“ am 9. und 10.10.2013 in Aurich
Zum inzwischen vierten Workshop trafen sich Abwasserspezialisten aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern in der ostfriesischen Stadt Aurich.
Nach der Begrüßung der Gäste im Hotel „Köhlers Forsthaus“ stellte Verkaufsgebietsleiter Thomas Simon das Unternehmen KRONOS und die Herstellung der Eisensalze vom Abbau des Ilmenit – Erzes bis zum Endprodukt vor.
Dipl.-Ing. Joachim Thunert (Anwendungstechnik) berichtete über die Eigenschaften der marktüblichen Fällungs- und Flockungsmittel im Rahmen der Abwasserbehandlung in der Lebensmittelindustrie. Dr. Friedrich Kramer, Gütersloh, referierte über die Vorteile der ‚intelligenten‘ Flotation gegenüber konventionellen Verfahren. Das Verfahren hat sich nach der fleischverarbeitenden Industrie auch im Bereich der milchverarbeitenden Industrie etabliert. Durch den Einsatz von Ishigaki – Schneckenpressen kann der Flotatschlamm weitgehend entwässert werden und ist so auch für weitere Transportwege interessant.
Über die außergewöhnlich gute Reinigungsleistung der Auricher Flotation berichtete Herr Dipl.-Ing. Thomas Kann-Dehn, Norden. So eliminiert die Anlage nicht nur 74 % des CSB und 94 % des Phosphors sondern auch 66 % des Stickstoffes. Diese Werte liegen weit über den bisher aus der Fachwelt publizierten Ergebnissen und stellen den Einsatz der Flotationstechnik in ein ganz neues Licht. Die Entlastung der Biologie durch die Flotation sowie die energetische Nutzung des Flotatschlammes haben in Aurich zu einem Anstieg der Eigenstromerzeugung der kommunalen Kläranlage auf 125 % geführt. Damit ist die Kläranlage Aurich komplett energieautark.
Besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der Stadt Aurich für Ihre Unterstützung bei der Besichtigung der Flotationsanlage am Donnerstag.
Nähere Informationen geben wir Ihnen gerne :
http://www.kronosecochem.com/ehome_de.nsf/index?OpenFrameset
(nach oben)
ZWT: BIOCOS Kläranlagen
Was ist BIOCOS?
Das BIOCOS-Verfahren ist eine einfache und wirkungsvolle Weiterentwicklung des klassischen Belebtschlammverfahrens und der Einbeckentechnologie. Das beim konventionellen Belebungsverfahren übliche Nachklärbecken mit Räumeinheit und Rücklaufschlammpumpwerk und den dafür erforderlichen Rohrleitungen wird beim BIOCOS-Verfahren durch zwei Sedimentations- und Umwälzbecken ersetzt…
BIOCOS Kläranlagen Broschüre – hier klicken:
http://www.zwt.de/unterseiten_downloads_D/biocos/biocos.html
(nach oben)
Alltech: Alles andere als Käse: für die Modernisierung der betriebseigenen Kläranlage setzt die Hochland Deutschland GmbH Dosiertechnik von Alltech ein
Das Werk Schongau der Hochland Deutschland GmbH ist eine Fertigungsstätte für Frischkäse und Weichkäse. In der werkseigenen Kläranlage werden Produktionsabwässer mit einer Schmutzfracht von ca. 38000 EW gereinigt.
Der erste Kontakt zwischen Hochland und Alltech fand im Jahr 1999, kurz nach der Inbetriebnahme des damals neu errichteten Werkes statt. Für die Schlammentwässerung lieferte Alltech eine Aufbereitungs- und Dosieranlage CONTINUFLOC 2000 und für die Nachfällung eine CONTINUFLOC 1000. Da beide Anlagen über all die Jahre störungsfrei in Betrieb waren und eine optimale Produktqualität bei Polymerkonzentrat lieferten, lag es für den Leiter der Kläranlage Hochland, Herrn Richard Schuster, nahe, sich auch für den Umbau der Phosphatfällungsanlage im Mai 2012 mit Alltech in Verbindung zu setzen.
Eisen fällt die im Produktionsabwasser der Molkerei vorhandenen Phosphate chemisch aus. Für die Phosphatfällung wird Eisen-III-Chlorid-Sulfat in einem 30 m³ – Tank gelagert. Alltech hat diesen vorhandenen Tank mit einer neuen Saugleitung inklusive automatischer Ansaughilfe nachgerüstet.
Dies hat für das Kläranlagenpersonal den Vorteil, dass fortan deutlich weniger Inspektions- und Bedienungsaufwand besteht – bei erhöhter Betriebssicherheit.
Das Behälterentnahmesystem auf dem Lagerbehälter ist komplett in ein Schutzgehäuse eingebaut und somit auch in der „kalten Jahreszeit“ vor Frost und Witterung geschützt.
Das Platzangebot für die Dosierstation war mit 2 auf 2 Meter begrenzt. Die vorhandenen Platzverhältnisse und die Vorgabe, die vorhandene Steuerung nach wie vor zu nutzen, führten dazu, dass Alltech eine „maßgeschneiderte“ Anlage lieferte.
Die Dosierstation ist mit den robusten Kolben-Membran-Dosierpumpen der Baureihe FKM ausgerüstet. Die Überdruckventile sind bei dieser Pumpentype bereits in die Hydraulik integriert. Diese Dosierpumpen erfüllen die hohen Anforderungen an Betriebssicherheit und Genauigkeit.
Die Reaktionsprodukte der Fällung werden mit dem Klärschlamm aus der Kläranlage entfernt und verwertet.
Die Produktionsabwässer von Hochland werden mit einem Wirkungsgrad von über 99 %
bezüglich der organischen Inhaltsstoffe und der Nährstoffe gereinigt und direkt in den Lech
eingeleitet.
Autor: Ines Weller
Alltech Dosieranlagen GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 2
D-76356 Weingarten
Tel.: ++49 – (0)7244 – 7026 – 23
Fax: ++49 – (0)7244 – 7026 – 50
Web: www.alltech-dosieranlagen.de
Email: weller.i@alltech-dosieranlagen.de
(nach oben)
FlocFormer zur Konditionierung des Klärschlammes auf einer Kläranlage, Dekanter
Testergebnisse und Amortisationsrechnung
Zusammenfassung
In der Testperiode im Juli 2013 konnte im Durchschnitt ein höherer TR-Gehalt von 26,59% (plus 3,99%) gegenüber der Periode vor dem Test (22,6%) ermittelt werden. Daraus ergibt sich eine jährliche Einsparung (nach Einrechnung von Zinsen, Betriebs- und Wartungskosten) von 95.611 Euro/a, zusätzlich kann bei Einsatz des Polymers 35H 1 kg je t TR eingespart werden. Daraus würde sich für die derzeit auf der KA entwässerte Schlammmenge eine Amortisation von 1,1 Jahren errechnen. Die beiden folgenden…
http://www.aquen.de/downloads/de/Test_Report_KA_Juli2013.pdf
(nach oben)
FlocFormer zur Konditionierung des Klärschlammes auf einer Kläranlage, Kammerfilterpresse
Testergebnisse und Amortisationsrechnung
Zusammenfassung
In der Testperiode im Juni 2013 wurde mit Hilfe des FlocFormer 3L e in um 3,17% höherer TR – Gehalt gegenüber dem Durchschnitt der parallel betriebenen Kammerfilterpresse 2 erzielt. Daraus ergibt sich für die fünf besten gefundenen FlocFormer – Einstellungen eine Verringerung der Entsorgungs menge von durchschnittlich 500 Tonn en bzw. ein Einsparpotenzial von durchschnittlich 23.673 Euro jährlich. Die folgenden…
http://www.aquen.de/downloads/de/Test_Report_KA_Juni2013.pdf
(nach oben)
Einige schaffen es sicher :Der Weg zur energieautarken Kläranlage
Interview: Prof. Hartmut Eckstädt über den Weg zur energieautarken Kläranlage
❯❯❯ Herr Professor Eckstädt, Kläranlagen zählen zu den größten kommunalen Energieverbrauchern. Daher wird seit einiger Zeit über energieautarke Kläranlagen diskutiert und die Betriebsoptimierung forciert. Welches Potenzial steckt tatsächlich in Abwasserreinigungsanlagen?
Das größte Potenzial für Energieeinsparungen gibt es in der Planungsphase von Anlagen. Aber auch in bestehenden Anlagen werden die Möglichkeiten bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Schätzungen besagen, dass in deutschen Kläranlagen lediglich ein Fünftel der Energie selbst erzeugt wird.
❯❯❯ Welche Möglichkeiten sehen Sie, um diesen Anteil deutlich zu steigern?
Nutzt man etwa die Faulgasenergie in einer Kraft-Wärme-Kopplung, erhöht dies den Wirkungsgrad gegenüber einer rein thermischen Verwertung. Es gibt Anlagen, die auf diese Weise bereits Energieautarkie erreicht haben, allerdings werden dort nicht nur die Schlämme aus der Kläranlage zur Faulung gebracht.
Es gibt aber auch viele andere Wege wie die Nutzung von Wasserkraft in Kläranlagen, Abwasserwärme, Geothermie oder Windkraft. Man kann auch vorhandene Flächen in der Kläranlage für Photovoltaik nutzen. Natürlich spielen im Hinblick auf eine möglichst hohe Eigenversorgung aber auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle.
❯❯❯ Ist Energiesparen erst ab einer gewissen Anlagengröße sinnvoll?
Grundsätzlich hat jeder Betreiber die Aufgabe, Potenziale für Energieeinsparungen zu erkennen und zu nutzen. Untersuchungen der Universität Rostock zeigen, dass insbesondere auch in ländlichen Regionen bei kleinen und mittleren Kläranlagen durch schrittweise Anpassung an den aktuellen Bedarf nennenswerte Einsparungen möglich sind. In großen Anlagen sind diese Potenziale prinzipiell größer, wenngleich diese in der Regel zielgenauer geplant und bedarfsgerechter gefahren werden. Kleinere Kläranlagen müssen robuster ausgestattet werden, um gegen Störungen besser gewappnet zu sein.
❯❯❯ Wo wird in Kläranlagen die meiste Energie verbraucht?
Der Energieverbrauch wird in erster Linie durch die in der Praxis auftretende Belastung bestimmt, hängt aber auch vom Reinigungsverfahren, den topografischen Gegebenheiten und nicht zuletzt von den Reinigungsanforderungen ab. Im Allgemeinen sind die Belüftungssysteme die größten Energieverbraucher. Man rechnet mit bis zu 50 Prozent des Gesamtverbrauchs bei Anlagen mit Schlammfaulung; bei aerober Schlammstabilisierung sind Werte bis zu 80 Prozent möglich.
Die weiteren Plätze beim Energieverbrauch belegen kontinuierlich betriebene Pumpen und Rührwerke. Teilweise Überdimensionierung von Anlagen, unterschiedliche Regelungs- und Schaltkonzepte sowie Wirkungsgrade unterhalb der Optima bewirken, dass mehr Energie verbraucht wird, als theoretisch erforderlich ist. Besonders deutlich wird die Notwendigkeit von Energiesparmaßnahmen dort, wo weitergehende, oft energieintensive Reinigungsverfahren wie Membranbelebungsverfahren, Ozonisierung oder KV-Behandlung eingesetzt werden.
❯❯❯ Welche Betriebsprozesse sollte man bezüglich Energieeinsparung besonders genau unter die Lupe nehmen?
Schon Grobanalysen mit Ist-Werten und Vergleichsdaten können erste Aufschlüsse liefern. Zweckmäßig für Feinanalysen sind Zulaufpumpwerk und mechanische Vorreinigung, mechanisch-biologische Abwasserreinigung, Eindickung, Stabilisierung und Entwässerung des Schlamms.
❯❯❯ Welche Maßnahmen halten Sie für besonders geeignet, um den Energieverbrauch zu senken und die Anteile der Eigenerzeugung zu steigern?
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und differenzierte Wertung würde ich nennen: Planung beim Neubau, Maßnahmen im Belüftungssystem und bei den Rührwerken sowie bei der Regelung der Rücklaufschlammströme, Schlammbehandlung, Energieverbrauchsmanagement zur Vermeidung von Spitzenbelastungen, Steuerungsveränderungen bei ständig laufenden Aggregaten, Austausch von Aggregaten (zum Beispiel Pumpen) mit ungünstigem Wirkungsgrad, Nutzung der Abwasserwärme und Bau von Gasspeichern zur Entkopplung von Klärgasanfall und -verbrauch.
❯❯❯ Was kann konkret bei der Schlammbehandlung getan werden?
Ziel muss die Optimierung durch das Steigern der Gasproduktion sein. Eine Möglichkeit dazu ist die Klärschlammdesintegration, zum Beispiel durch Ultraschallverfahren. Durch Schlammeindickung lässt sich die Verweilzeit im Faulturm vergrößern und der Energieeinsatz beim Aufwärmen verringern. Dabei ist jedoch die Rückbelastung des Abwassers im Hauptprozess zu beachten. Auch die Co-Fermentation mit geeigneten Substraten ist eine Variante.
❯❯❯ Wie wird die Entwicklung in punkto Energieautarkie weitergehen?
Nicht jede Kläranlage wird Energieautarkie erreichen können, aber dazu fällt mir ein Spruch eines meiner Lehrer ein: „Man muss Unmögliches fordern, damit Mögliches geleistet wird!“ Manche Kläranlage wird in Zukunft sicher sogar überschüssige Energie ins Netz einspeisen können. Höhere Energiepreise, bessere technische Möglichkeiten, Fortschritte der Wissenschaft und die Kreativität aller beruflich mit dem Abwasser Befassten werden dies für einige Kläranlagen möglich machen.
Planer, Betreiber und Mitarbeiter von Verwaltungen tragen dabei eine große Verantwortung. Für ihre Aus- und Weiterbildung ist daher Sorge zu tragen, denn ihre Motivation entscheidet über den Erfolg der Bemühungen. Bei all diesen Überlegungen und Maßnahmen darf das Hauptziel der Abwasserreinigung – nämlich der Schutz der Gewässer – nicht außer Acht gelassen werden. Wenn dabei gleichzeitig weniger Energie verbraucht wird, ist der Umwelt doppelt geholfen.
Quelle: http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=159
(nach oben)
Aquen: Das Fachmagazin gwf – Wasser|Abwasser berichtet in der Ausgabe 5´2013 über unsere Bohrschlammentwässerung geoCLEAN.
Hier der Beitrag:
http://www.aquen.de/downloads/de/gwf_5_2013.pdf
(nach oben)
ABEL: „SCHNELLER ENTLEERT“ ABEL PUMPEN IN DER PVC-HERSTELLUNG
Veröffentlichung in der Fachzeitschrift „Verfahrenstechnik, Ausgabe 05.2013“
mehr unter:
http://www.abel.de/de/PDF/ABEL-Pumpen-in-der-PVC-Herstellung_WEB-Version.pdf
(nach oben)
Vega: Keep it simple
Bis zur Jahrtausendwende herrschten bei Feldgeräten babylonische Verhältnisse: Jeder Hersteller entwickelte für nahezu jedes Messprinzip ein eigenes Gehäuse, eine eigene Elektronik und eine eigene Software. Und fast jedes Gerät hatte seine eigene Installations-, Inbetriebnahme- und Bedienphilosophie. In den Betrieben verursacht dies bis heute einen hohen Aufwand für Schulung, dazu kommen Probleme durch Bedienfehler. Aber auch auf der Seite der Hersteller verursacht die Variantenvielfalt einen hohen Aufwand, der sich schließlich auch in den Herstellkosten der Geräte niederschlägt.
Anfang des Jahrtausends beschloss deshalb der Füllstand- und Druckmessgerätehersteller VEGA dies zu ändern: Mit dem vor zehn Jahren vorgestellten plics®-Konzept setzte der Anbieter eine Plattformstrategie um, die inzwischen eine beeindruckende Erfolgsstory geworden ist …
Lesen Sie den vollständigen Artikel aus der CHEMIE TECHNIK 4/2013 und das Interview von Geschäftsführer Günter Kech „Kontinuität ist enorm wichtig“.
http://www.vega.com/de/News-Artikel_50481.htm
(nach oben)
KEMIRA: Prävention von Struvitablagerungen bei anaerober Vergärung
Während einer anaeroben Klärschlammvergärung wird Magnesium, Ammonium und Phosphat von der Festphase in Ionenform in der Flüssigphase umgewandelt. Die Phosphat-Umwandlung tritt insbesondere bei der Vergärung von Belebtschlamm aus Kläranlagen auf, die mit Verfahren der erhöhten biologischen Phosphorentfernung (EBPR) betrieben werden. Die erhöhte Konzentration dieser Spezies führt zur Bildung und Fällung des Minerals Struvit (MgNH4PO3*6H2O). Hierbei ist es wichtig, zwischen Struvit-Fällung und Struvit-Ablagerungen zu unterscheiden. Die Bildung und Fällung von Struvit ist nicht immer unbedingt negativ. Die in den Schlammfeststoffen eingelagerten Struvitkristalle werden bei der Schlammentwässerung entfernt. Struvitablagerungen sind dagegen immer problematisch. Struvitablagerungen bilden sich am häufigsten in Rohren und auf Oberflächen in Prozessen und Systemen, die der Vergärung nachgelagert sind, wie Schlammstapelbehälter, Pumpen, Wärmetauscher, Schlammentwässerungsanlagen und Systeme zur Zentrataufbereitung. Struvit ist unter neutralen und alkalischen Bedingungen schwerlöslich, die Löslichkeit erhöht sich jedoch im sauren Bereich. Die pH-Abhängigkeit von Struvit wird durch die Tatsache, dass Magnesium unter der Kohlendioxid- Atmosphäre eines Faulbehälters Carbonat-Komplexe bildet, weiter verkompliziert. Wird anaerober Faulschlamm in Nachbehandlungsprozessen normaler Atmosphäre ausgesetzt, erfolgt eine Freisetzung von CO2, die zu einer Erhöhung des pH-Werts führt. Zeitgleich nimmt das Löslichkeitsprodukt stark ab – der Schlamm wird mit Struvit übersättigt. Dadurch erklärt sich die häufige Struvit-Bildung
den ganzen Bericht lesen Sie unter: http://www.kemira.com/regions/germany/SiteCollectionDocuments/Broschüren%20Water/KemWasserSpiegel%202012.pdf
http://www.kemira.com/regions/germany
(nach oben)
Erfolgreiche Beseitigung und dauerhafte Verhinderung von MAP-Ablagerungen in der Abwasserbehandlungsanlage der Molkerei Zott
Die Genuss-Molkerei Zott (Gründung 1926) ist ein selbständiges Familienunternehmen, dessen Name für eine zukunftsorientierte Unternehmensphilosophie, eine verbraucherorientierte Markenpolitik, für Investitionsbereitschaft und eine gelebte nachhaltige Partnerschaft mit Milcherzeugern und Handel steht. Neben dem Stammwerk der Unternehmensgruppe in Mertingen (Bayern) gibt es weitere Produktionsstandorte in Günzburg und Opole (Polen), wo unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards zahlreiche renommierte Joghurt-, Dessert- und Käsespezialitäten hergestellt werden. Mit einem Konzernumsatz von 815 Mio. EUR, einer jährlichen Milchverarbeitung von 861 Mio. kg und 1.810 Mitarbeitern zählt Zott heute zu den führenden Molkereien Europas. Zur Reinigung des anfallenden Produktionsabwassers betreibt die Molkerei Zott eine Abwasserbehandlungsanlage, die in den letzten Jahren aufgrund des gestiegenen Produktionsvolumens und der damit verbundenen höheren Abwassermengen auf 100.000 EW erweitert wurde. Nach einer mechanischen Reinigung…mehr:
http://www.kemira.com/regions/germany/SiteCollectionDocuments/Broschüren%20Water/KemWasserSpiegel%202012.pdf
(nach oben)
AQUEX: Die AQUEX Technologien
Ein Meilenstein in der Entwicklung der Abwasseraufbereitung
I. Einleitung, der Stand der Technik
Kommunale Abwässer
Die kommunale Abwasseraufbereitung hat eine etwa 150-jährige Geschichte. Sie hat sich aus der Notwendigkeit entwickelt, Abwässer einer immer mehr verdichtet lebenden Menschheit umweltgerecht zu entsorgen. Die Entwicklung begann natürlich nur mit den primitivsten Verfahren und Einrichtungen die jedoch immer weiter verfeinert wurden da es sich herausgestellt hatte, daß die vorhandenen Methoden die erhöhten Erwartungen nicht erfüllten.
So ist die heute bekannte Technologie der Abwasserreinigung entstanden, die in der Lage ist die Abwässer derart zu reinigen, dass diese ohne Nachteile für die Umwelt in die Flüsse geleitet werden können. Das Kanalwasser passiert zuerst einem Grobrechen um dort die gröbsten Verunreinigungen (Lappen, Präservative, Obstschalen usw.) abzutrennen und dann einen Sandfang, wo die schwersten, hauptsächlich anorganischen Teile (z.B. Sand) abgetrennt werden. Der Sand wird von dem Boden des Beckens abgesaugt und zusammen mit Resten von Fäkalien auf Deponien gefahren.
Das Abwasser fließt in das mechanische Absetzbecken weiter, wo sich in einem etwa sechsstündigen Aufenthalt die absetzbaren Feststoffe absetzen. Die in Emulsionsform vorhandenen Verschmutzungen werden in dem nächstfolgenden Becken, der sog. Biologie mit Hilfe von Bakterien und Sauerstoff, der aus dem Durchblasen des Wassers mit einer Überdosis von Luft beschafft wird, abgebaut.
In einer weiteren Stufe werden die Nitrate und Phosphate eliminiert. So gelingt das Abwasser endlich in das Nachklärbecken, wo noch vorhandenen Feststoffe abgesetzt werden, bevor das Wasser in die Flüsse entlassen wird.
Je gründlicher die Abwasserreinigung ist umso mehr Reststoffe werden zurückgehalten, die in Form von Schlamm aus allen Becken abgezogen und eingedickt werden. Dieser Schlamm wird in die sog. Faultürme gepumpt und dort bei einer Temperatur von 37°C unter Ausschluss von Sauerstoff in 20 bis 30 Tage anaerob ausgefault. Damit wird ein Teil des organischen Anteils des Schlammes zum Methangas umwandelt, das Schlammvolumen reduziert und die nachfolgende mechanische Entwässerung des Schlammes wird leichter.
Das erzeugte Methangas wird in Blockheizkraftwerken verbrannt und damit Strom erzeugt. Die Abfallwärme wird in die Faultürme zurückgeführt, um dort die ständig erforderliche Temperatur von 37°C zu erhalten.
Der mit Zentrifugen, Siebbandpressen oder Kammerfilterpressen auf im Schnitt 27 % Trockensubstanz entwässerte Schlamm wird entweder in die Landwirtschaft entsorgt oder muss nach der neuesten Gesetzgebung unter Zugabe von Zusatzenergie verbrannt werden.
Industrieabwässer
Es gibt kaum ein Gewerbe, wo kein Abwasser entsteht. Diese sind teilweise enorm hoch belastet und dürfen oft nicht direkt in die Kanalisation geleitet werden weil damit die kommunalen Kläranlagen zu hoch belastet wären. Diese Betriebe haben eigenen Kläranlagen, wo das Abwasser notdürftig gereinigt wird um dieses nachher in die Kanalisation oder in die Flüsse leiten zu können. Dafür zahlen die Betriebe dem Träger der Kläranlage oder dem Umweltamt je Höhe der verbliebenen Belastungen eine sog. Einleitgebühr, die u.U. astronomischen Höhen erreichen kann.
II. Kritik an der vorhandenen Technologie
Die vorhandenen Technologien sind zwar ausgefeilt und führen zu zufriedenstellenden Lösungen, sind aber enorm teuer. Wir haben uns aber damit abgefunden und bezahlen die Kosten mit unseren Wasser- und Abwassergebühren tagtäglich. Es ist eine lethargische Betrachtung entstanden und die Kosten werden als gottgewollte Strafe für unsere Sünden angesehen, die wir am Tisch tagtäglich mit Messer und Gabel vollbringen.
Die hohe Gebühren entstehen aus den hohen Investitionskosten, die der Bau der Sammler und der Kläranlagen verursachen. Da sich Kläranlagen erst ab einer bestimmten Größenordnung lohnen, werden kleinere Ortschaften durch teure Abwasserleitungen verbunden. Diese kilometerlangen Rohrnetze sind oft teurer als die eigentliche Kläranlage. Hohe Wartungsd- und Personalkosten sind die Folge. Das Verfahren ist kompliziert und erfordert deshalb auch hohe Betriebskosten. In vielen Kommunen sind die Leitungssysteme an der Grenze der Leistungsfähigkeit und durch Überalterung und fehlende Wartung und Instandsetzung kurz vor dem Zusammenbruch.
Eine Kläranlage konventioneller Art erfordert ein sehr großes Grundstück, welches gerade in Ballungszentren, wo die größten Kläranlagen gebaut werden müssen, entsprechend teuer ist.
Die Schlammaufbereitung in Faultürmen ist als Wildwuchs in der Entwicklungsgeschichte anzusehen. Wir bauen riesige Faultürme, um den organischen Anteil des Schlamms zu reduzieren obwohl die damit erzeugte Energie im Verhältnis zu gering und bei weitem nicht kostendeckend ist.
Die Abfallwärme aus der Verbrennung des Methangases dient für den Selbstzweck, nämlich zur Aufrechterhaltung der Temperatur des Faulturmes und ist im Winter nicht einmal ausreichend so, dass die fehlende Energie aus den sehr teueren Energieträgern Heizöl oder Erdgas ersetzt werden muss.
Auf dies Weise wird ein wesentlicher Anteil der Energie des Schlammes vernichtet, Der Rest bringt auch keinen Energiegewinn, weil der mit den herkömmlichen Entwässerungsaggregaten entwässerte Schlamm nur durch Zugabe von Primärenergien verbrannt werden kann.
Dabei ist der Klärschlamm viel besser als sein Ruf: Als organischer Schlamm ist er ausgetrocknet ein ausgezeichneter Energieträger, der im Verbrennungswert der Braunkohle gleichgesetzt werden kann. Da aber heutzutage keine wirtschaftliche Trocknung bekannt ist, wäre die Austrocknung des Schlammes für Zwecke der Energiegewinnung unwirtschaftlich.
III. Die AQUEX Technologie
Die AQUEX Technologie geht auf die Kernaufgabe zurück, nämlich auf die Notwendigkeit, Abwässer umweltgerecht aufzubereiten und den Schlamm wirtschaftlich zu nutzen. Dabei sind wir auf neuen Wegen gegangen und auch nicht von der Schlachtung von heiligen Kühen zurückgeschreckt.
Aus der Erkenntnis, daß die größten Belastungen des Abwassers an CSB und BSB (Chemischer bzw. Biologischer Sauerstoff Bedarf) aus den Feststoffen stammen, ist der „AQUEX RAPID Sedimenter“ (= Schnellabsatzbehälter) entwickelt worden. Mit Hilfe des Schnellabsetzbehälters können kommunale und industrielle Schlämme in großen Mengen, kontinuierlich und schnell sehr gründlich mechanisch gereinigt werden, in dem die Feststoffe durch reine Gravitation (Hydro- Dynamische Medientrennung) aus dem Wasser abgetrennt werden.
AQUEX RAPID SEDIMENTER (Schnellabsatzbehälter)
Die hydro-dynamische Medientrennung nutzt die unterschiedlichen Massen von Wasser und Feststoff. Dies wurde
erstmals 1996 vom Patentamt veröffentlicht.
Das Schmutzwasser wird mit hoher Geschwindigkeit durch eine Düse gepumpt. Durch die Querschnittsveränderung in der Düse wird das Wasser weiter beschleunigt. Nach dem Austritt aus der Düse wird die Strömungsgeschwindigkeit des Wasserstromes deutlich verringert, da sich der Querschnitt erweitert.
Die schwereren Bestandteile des Wassers haben ein größeres Beharrungsvermögen, sie bewegen sich weiter nach unten und sammeln sich in der Spitze des Schnellabsatzbehälters. Dort werden sie abgesaugt und anschließend mechanisch eingedickt.
Das so gereinigte Wasser kann bis zu 99,9% frei von Feststoffen sein. Durch diese nahezu vollkommene Abtrennung der Fremdstoffe ist das Wasser für die meisten Einsatzzwecke schon genügend aufbereitet. Ist eine weitere Bearbeitung notwendig, ist diese erheblich einfacher und kostengünstiger.
So können z.B. noch in Emulsionsform vorhandenen Verschmutzungen anschließend in einem Bioreaktor eliminiert werden. Hier wird das mechanisch gereinigte Abwasser von oben in einen, mit Trägermedien gefüllten stehenden Zylinder eingeleitet. Mit Hilfe von Bakterien und mit dem Sauerstoff der Luft, die in Gegenstromrichtung durch den Bioreaktor geblasen wird, werden die CSB und BSB Belastungen abgebaut.Durch die Hydro – Dynamische Medientrennung wird sowohl der technische wie auch der Kostenaufwand erheblich reduziert. Der Schnellabsatzbehälter ist das Herzstück der AQUEX Abwasseraufbereitung.
Das AQUEX Verfahren geht auch bei der Schlammaufbereitung auf neuen Wegen. Auf einen Faulturm, als Energievernichter wird verzichtet und der Rohschlamm aufbereitet. Dadurch verbleibt die volle Energie des Schlammes erhalten.
Der aus dem Schnellabsetzbehälter abgesaugte Schlamm wird in einem Vorentwässerungs- und Voreindickungszylinder durch Schwerkraft vorentwässert. Hier werden schon Trockensubstanzen erreicht, die die Ergebnisse von Zentrifugen übertreffen. Durch weiteres Nachpressen in Siebbandpressen oder Gummiballonpressen werden Spitzenergebnisse in der Schlammentwässerung erzielt.
Die Gummiballonpresse ist ebenfalls eine eigene Entwicklung. Mit Hilfe der Presse können kommunale Faulschlämme in 1,25 Stunden bis zu 50 % TS entwässert werden. Ein Ergebnis, welches bis heute von niemand in der Welt erreicht wurde.
Ziel der hohen mechanischen Entwässerung ist die Pelletierung des Schlammes als unabdingbare Voraussetzung einer wirtschaftlichen Trocknung. Auch bei der Pelletierung geht das AQUEX Verfahren neue Wege. Wo alle sonstigen Versuche zur Pelletierung des kommunalen Schlammes durch Extrudieren wegen Verstopfung der Düsenplatte stets mit einem Flop endeten, ist bei dem AQUEX Verfahren die Verstopfung kein Thema.
Die erreichten hohen Werte bei der Entwässerung in der Gummiballonpresse erlauben sogar die Pelletierung des Presskuchens ohne Rückbeimischung von Trockenpulver.
Der von der AQUEX Technologie entwickelte Trockner ist ebenfalls der Wirtschaftlichste der Welt. Der pelletierte Schlamm rieselt von oben durch den Trockner und wird dabei mittels Warmluft getrocknet.
Ein weiterer Vorteil des Trockners ist, dass für die Trocknung jede Abfallwärme, auch die Rauchgase der Industrie direkt verwertet werden können. So erfolgt die Trocknung mittels Abfallwärme, anstatt teure und endliche Primärenergie in Anspruch nehmen zu müssen.
Das Endprodukt der Schlammaufbereitung ist ein auf 8 mm Durchmesser pelletiertes, staub- und geruchsfreies, hygienisiertes Material mit 95-98 % TS, welches, je nach Art des Schlammes, vorzüglich als Naturdünger, Brennmaterial, Tierfutter, wieder verwertbares Material in der Industrie usw. genutzt werden kann.
IV. Vorteile des AQUEX Verfahrens
Das AQUEX Verfahren arbeitet mit einfachen, logischen und deshalb wirtschaftlichen Mitteln und erreicht für einen Bruchteil der bisherigen Kosten der Abwasseraufbereitung dieselbe Leistung.
Die Entwicklung der sog. „Alternativen Kläranlage“ revolutioniert die Abwasseraufbereitung und löst das bisherige starren System ab, das bezüglich Weiterentwicklung und Möglichkeiten zur Kostenreduzierung in einer Sackgasse steckt.
Für eine „Alternative Kläranlage“ reicht etwa nur 5-10 % der bisher erforderlichen Grundstücksfläche. Durch Ausnutzung der Schwerkraft in mehreren Phasen des Verfahrens wird eine Energie mobilisiert, die überall vorhanden ist und kein Geld kostet.
Die Entwicklung des AQUEX RAPID Schnellabsetzbehälters ermöglicht eine kontinuierliche, schnelle und gründliche Abtrennung der Feststoffe. Versuche mit Waschwasser aus Kohlegruben ergaben eine mechanische Reinigung von 99,93%. Somit eröffnet dieses Verfahren die Möglichkeit einer schnellen restlichen Reinigung in Bioreaktoren. Dadurch werden die großflächigen und teuren Absetzbecken und die Biologie der Kläranlage erspart.
Durch Schwerkraftentwässerung in Vorentwässerungs- und Voreindickungszylinder werden so hohe Trockenheitsgrade erreicht, dass diese für die meisten Einsatzfälle ausreichen und den Kauf von teueren Entwässerungsaggregaten ersparen.
Die Entwicklung der Gummiballonpresse erlaubt eine mechanische Schlammentwässerung in bisher unerreichter Qualität
Die Art der reibungslosen Pelletierung ermöglicht die wirtschaftliche Trocknung des Schlammes in einem Schachtrieseltrockner. Daraus wiederum resultiert ein praktisch absolut trockenes Material, welches durch Verbrennen, Vergasen oder Verdieselung in einer KDV-Anlage die volle Energie des Schlammes mobilisiert.
Mit der Verbrennungswärme kann Strom erzeugt werden. Danach werden die noch immer heißen Gase durch den Trockner geführt und damit der Schlamm ausgetrocknet. Nach der Trocknung erfolgt die Abluftreinigung mit Abluftwäscher und Biofilter, wo ebenfalls noch Abfallwärme anfällt, die für verschiedenen Zwecke genutzt werden kann.
Durch das durchdachte System der AQUEX „Alternativen Kläranlage“ wird die volle Energie des Klärschlammes sinnvoll genutzt und dieses gleich dreimal hintereinander:
• zur Stromerzeugung
• zur Trocknung
• zur innerbetrieblichen Nutzung der Wärme
Auf den Faulturm als Energie- und geldfressende Anlage wird völlig verzichtet.
Das Verfahren kann sowohl im kommunalen- wie auch im industriellen Bereich eingesetzt werden.
Durch seinen modularen Aufbau der Anlage kann das Verfahren in beliebigen Stufen an die Bedürfnisse jedes Interessenten angepasst werden. Einzelne Stufen des Verfahrens herauszugreifen geht reibungslos.
V. Erschließung der Märkte
Kläranlagen sind groß, aufwendig in der Technik, teuer in der Erstellung und teuer im Betrieb. Aus diesen Gründen wurde bisher die Abwassertechnik zentralisiert.
Dabei werden die Abwasserrohre oft über große Entfernungen zu den Kläranlagen geführt. Dieses ist teilweise nur mit hohem technischen und finanziellem Aufwand möglich, da oft nur mit aufwendigen Hebeanlagen das notwendige Gefälle erreicht werden kann. Hohe Kosten für die Aufbereitung des Abwassers sind die Folge.
Mit der AQUEX Technik gehören diese teuren und aufwendigen Systeme der Vergangenheit an. Die Anlagen sind so klein und kostengünstig, dass sie dezentral eingesetzt werden können. Die Anlagen rechnen sich allein schon durch die Einsparungen im Abwasserrohrleitungsbau.
Dennoch wird die Erschließung der Märkte nur über spezialisierte Ingenieurbüros gehen. Bis auf wenige Ausnahmen werden die Planung und die Ausführung von kommunalen Abwasseranlagen jeder Größe durch solche Büros durchgeführt. Diese verfügen zu guten Kontakten zu den betreuten Kommunen und können am ehesten Änderungen oder Neuerungen durchsetzen. Auch in die neuen EU-Beitrittsländer bestehen meistens schon gute Kontakte.
Anreize für eine Umstellung der Technik gibt es viele:
um bis zu 90% geringerer Flächenbedarf
deutlich niedrigere Gestehungskosten
deutlich geringere Folgekosten
Möglichkeit, kleinere Einheiten dezentral zu bauen
Einsparung langer Rohrsysteme mit geringeren Wartungskosten
kein Energiebedarf sondern Energiegewinn
VI. Perspektiven
Die einzelnen Anlagenteile des AQUEX Verfahrens sind in Prototypen bereits gebaut und ausprobiert worden. Die damit erreichte Ergebnisse, die auch von neutralen Stellen untersucht und protokolliert wurden löste lebhaftes Interesse sowohl im In- wie auch im Ausland aus. In Süd Korea werden z.B. bereits mehrere Anlagen in der Gülle- und Speisereste-Aufbereitung mit bestem Erfolg praktiziert.
Schwierigkeiten bereitet der Umstand, dass eine komplette „Alternative Kläranlage“ noch nicht aufgebaut ist. In Korea wird die Gülle und Speisereste nur durch Vorentwässerungs- und Voreindickungszylinder entwässert. Der Schlamm wird mit 24-26 % TS als Naturdünger auf die Felder gefahren. Die Flüssigphase wird mittels Schnellabsetzbehälter und Bioreaktor gereinigt.
Es wäre dringend notwendig z.B. in einer Kommunalen Kläranlage oder Papierfabrik eine komplette „Alternative Kläranlage“ zu bauen, die allen Branchen zugänglich gemacht und vorgeführt werden kann. Dadurch könnten Zögernde, die bereits heute überlegen einen Auftrag zu erteilen entscheidend beeindruckt werden.
Darüber hinaus ist notwendig die Anlage weiter zu entwickeln oder noch vorhandene, mehrheitlich kleine technische Fehler zu korrigieren. Besonders bezieht sich dies auf die Weiterentwicklung der Gummiballonpresse.
http://home.arcor.de/merai/deutsch/sewagetreatmentplant.html
(nach oben)
Endress+Hauser: Online-Messtechnik für die 4. Reinigungsstufe
Praxisreport
Die Ergänzung von Verfahren zur Entfernung organischer Spurenstoffe aus dem Abwasser ist auf dem besten Wege, Stand der Technik zu werden. Obwohl bislang noch keine Grenzwerte in der Abwassergesetzgebung in Deutschland festgeschrieben sind, werden in großtechnischen Pilotprojekten Anlagen mit den Stufen ausgestattet. Endress_Hauser bietet Messtechnik für Standardparameter, die es dem Betreiber ermöglichen, den laufenden Betrieb seiner Stufen kontinuierlich zu kontrollieren. Dabei kann bei der Messung auf Sensoren mit Memosens-Technologie und auf die Vorteile der einheitlichen Liquiline-Plattform
Den ganzen Artikel lesen Sie In der Korrespondenz Abwasser Heft 3 -2013 ab Seite 223
Autor
Dr. Christoph Wolter
Produktmanager Analyse
Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG
79576 Weil am Rhein
(nach oben)
Separchemie: Flockungshilfsmittel trifft Filter
Einleitung:
Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie oder ein Flockmittelvertreter aus Schlamm und Polymer
wundervolle Flocken generiert haben, unzerstörbar und schön groß. Dann haben Sie diesen
konditionierten Schlamm z.B. auf eine Siebbandpresse gegeben oder einen anderen Filter und das
Gemisch aus Flocken und Wasser steht auf dem Band und läuft einfach nicht durch?
Damit Sie mir glauben, dass das nicht nur graue Theorie ist. Hier sehen Sie ein paar schwarze Flocken,
mit zwei verschiedenen Flockungshilfsmitteln behandelt.
Darum soll es im diesjährigen Vortrag gehen:
Was sind die Gründe für eine schlechte Filtration und welche Möglichkeiten gibt es, diese zu
beseitigen. Aber erwarten Sie bitte nicht, dass ich jetzt eine große Matrix entwickle, welcher
Schlamm mit welchem Polymer auf welchem Entwässerungsaggregat bei welcher Temperatur sich
wie schnell filtrieren bzw. entwässern lässt. Das geht gar nicht, aber ich will Ihnen ein paar
Zusammenhänge aufzeigen, die Hinweise auf mögliche Probleme geben bzw. Lösungen anbieten
können. Und so kam der Titel zustande: Flockungshilfsmittel trifft Filter.
Teil 1: Flockungshilfsmittel
Was passiert, wenn ein Flockungshilfsmittel auf einen passenden Schlamm trifft? Dabei gehe ich
davon aus, dass jemand festgestellt hat, welche Ladung zum Schlamm passt, hier soll es also nur
darum gehen, festzustellen, ob eher ein niedermolekulares oder eher ein hochmolekulares
Flockungshilfsmittel eingesetzt werden kann. Eigentlich geht man ja davon aus, dass das
Flockungshilfsmittel vom Schlamm gebunden wird. Aber scheinbar wird es nicht ganz gebunden,
dann wäre der Einfluss auf die Filtration wohl kaum zu bemerken. Zumindest, wenn man wie im
Experiment eine große Oberfläche bei wenig Schlamm im Wasser anbietet.
Wenn Sie sich einmal vor Augen halten, dass ein gestrecktes Polymer‐Molekül mehrere Meter lang
ist, also in gestreckter Form von meinem Kollegen bis zu mir reichen würde, dann kann man eher
verstehen, dass auf dieser Schnur nicht alle Andockplätze belegt sind. Immerhin charakterisiert man
Polymere durch die Angabe wie viele Mio. Dalton es an Molgewicht hat. Auch in einer noch so
verdünnten Lösung liegen also immer verknäulte Moleküle vor.
Vielleicht kann man es sich so vorstellen:
Habe ich einen feinteiligen Schlamm aus starren Partikeln, z.B. aus einem Steinmetzbetrieb oder
einen Hydroxidschlamm aus einer Galvanik, dann reihen sich viele Partikel auf einer Leine…mehr:
http://www.separchemie.de/fileadmin/site_content/Artikel/FHM_trifft_Filter-L%C3%B6nsberg_korrigiert_2012.pdf
(nach oben)
Steinzeug: Die Münchner Stadtentwässerung baut weiter auf Steinzeug
Sanierung der Abwasserkanäle in Pasing-Obermenzing im EDS-Verfahren. Die Münchner Ortsteile Pasing, nördlich der Bahnanlage, und Obermenzing gehören zu den „guten Wohnstuben“ der bayerischen Landeshauptstadt. Sie liegen westlich des Nymphenburger Schlossgartens und wurden im Wesentlichen in der Nachkriegszeit abwassertechnisch erschlossen. Nach MSE-Regulativ dienten hierzu Sammelkanäle aus Steinzeugrohren DN 250 bis DN 350 der damaligen Produktion, d.h.: vor 1965 mit Rohrverbindungsdichtungen aus Vergussmassen, danach zunehmend mit Rohrverbindungsdichtungen Steckmuffe K. Die nach gültigem Umweltrecht durchgeführten Kanalinspektionen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung des Freistaates Bayern führten zur Erkenntnis, dass die ca. 50 Jahre alten Kanäle durchweg statisch und auch hydraulisch funktional…mehr:
http://www.steinzeug.com/CMS/upload/EDS_Sonderdruck_web_6123.pdf
Autoren:
Dipl.-Ing. Hans-Joachim. Purde 1,
Dipl.-Ing. Volker Pankau 2
(nach oben)
Aquen: Flocken erster Güte
Flockungs- und Schlammentwässerungseigenschaften in Entwässerungsprozessen qualitativ erfassen
In der Abwasserbehandlung wie in der Papierindustrie gibt es geflockte flüssige Medien, die entwässert werden. Doch die Entwässerbarkeit kann nur anhand des Flockenbilds bewertet werden. Daher rückt die Flockenbildung als zentraler Prozessbestandteil ins Blickfeld der Industrien. Die Flockenstruktur ist nun online mit einem Sensor bewertbar.
Ein System zur Online-Bewertung von geflockten Partikelsystemen hat in der hier vorgestellten Technologie und Messschärfe bislang nicht zur Verfügung gestanden. Entwässerungsprozesse durch Überwachen und Steuern zu optimieren, war daher nicht oder nur schwer realisierbar. Andererseits kann die Entwässerbarkeit eines geflockten flüssigen Mediums qualitativ nur anhand des Flockenbildes bewertet werden. Um nun die Flockengüte zu beurteilen, sind hauptsächlich die Flockengrößenverteilung und deren zeitliche Änderung sowie die Scherstabilität der Flocken interessant. Die Flockengüte oder die Flockenausprägung wirkt schließlich auf:
• die Effektivität von Flockungshilfsmitteln – das heißt, die Menge und Qualität des Einflusses auf die Flockenbildung;
• die Entwässerbarkeit der geflockten Schlämme – also die Erhöhung der Trockensubstanz (TS) und der Entwässerungsgeschwindigkeit;
• die Trennqualität der nachgeschalteten Entwässerungsstufe – zur Minimierung der Restschwebstoffe im Trennwasser.
Ergebnis: Mit Kenntnis und optimierter Flockengüte vor der Entwässerungsstufe ist eine höhere Entwässerungsleistung bei reduziertem Einsatz von Polymer sicher möglich.In der Abwasserbehandlung sind polymerinitiierte Eindick- und Entwässerungsprozesse seit langer Zeit ein zentraler Bestandteil der Verfahrensführung. In jüngerer Zeit werden Flockungsprozesse auch zunehmend in anderen Bereichen genutzt, um aus einem Medium bestimmte Inhaltsstoffe abtrennen zu können, so zum Beispiel in der Papierindustrie. Geschichtlich bedingt lag das bisherige Augenmerk primär auf den Separationsmaschinen selbst. Im Regelfall wurde wenig beachtet, die optimale Flocke für den Separations-/Trennprozess zu erzeugen. Mit neuen Erkenntnissen und einem neuen Augenmerk, die Trennstufe als letzten Prozessschritt zu optimieren, hat sich das nun gravierend geändert. Damit rückt die Flockenbildung als ein der Trennstufe vorgeschalteter Schritt und zentraler Prozessbestandteil in das Blickfeld. Eine optimale und reproduzierbare Flockenstruktur ist aber ohne messtechnische Erfassung nur sehr schwer realisierbar.
Mit Auflicht und Spülung besser sehen
Der photooptische Flockungssensor ist ein Online-Messgerät, das zur Größen- und Strukturcharakterisierung von dispergierten und nichtdispergierten Feststoffsystemen dient. Er arbeitet als Reflexionsmessgerät, wobei die Messfläche durch ein Auflichtverfahren beleuchtet wird. Das zu untersuchende Gut wird durch ein Sichtfenster aufgenommen und analysiert. Die Sauberkeit dieses Sichtfensters wird durch sporadisch einschaltbare Spüldüsen – Wasser oder Luft – garantiert. Eine CCD-Zeilenkamera (Charge Coupled Device) misst aufrecht und quer zur Strömungsrichtung das Partikelsystem. Der Messbereich für die Flockendimensionen ist 50μm bis 2,9cm. Die Auswertung ist eindimensional und sehnenlängenorientiert, daher robust und wenig störanfällig. Die Berechnung von spezifischen Merkmalen basiert auf Sehnenlängen-Anzahldichte und -summenverteilungen. Diese werden durch das Messsystem sehr schnell in hoher Zahl berechnet, sodass zeitnah statistisch abgesicherte Partikel- oder Strukturmerkmale vorliegen.Aus den Rohdaten des Sensors werden in einer nachgeschalteten Recheneinheit die relevanten Prozessgrößen berechnet, normierte Werte können an Steuerungs- und Regelungssysteme übergeben werden. Die errechneten Werte sind prozessspezifisch und können für jeden speziellen Anwendungsfall kalibriert werden.
Prozesse mit Flockungssensor regeln
Neben einer Messwerterfassung, zum Beispiel zur Qualitätskontrolle der Flockung, ist eine Prozessregelung durch den Flockungssensor möglich. Durch den Sensor werden verschiedene spezifische Flockenmerkmale wie Flockengröße und Strukturmerkmale getrennt erfasst. Eine Regelung von einzelnen Aktoren eines struktur- oder formgebenden Systems kann somit realisiert werden. Anhand von Installationen konnte nachgewiesen werden, dass ein Flockungssensor die Güte der Konditionierung zur optimalen Entwässerungsfähigkeit des behandelten Schlamms ermitteln kann. Die Korrelation der Sensorberechnungen zu den tatsächlich erreichten Entwässerungskennwerten liegt bei > 0,95 – eine hohe Vorhersagekraft. Das Messsystem ist sowohl für die stationäre Anwendung im Prozess wie auch als Laborapplikation verfügbar:
• Prozessanwendung:
Im stationären Einbau arbeitet der Sensor in situ, er kann sowohl direkt in eine bestehende Förderleitung beziehungsweise Förderung eingebaut, als auch im Bypass betrieben werden. Für diesen Einsatzfall sind Betriebsdrücke bis maximal 6,5bar zulässig.
• Laboranwendung:
In der Laboranwendung können zum Beispiel die Flockengrößenverteilungen oder die Scherstabilität in Abhängigkeit von den eingesetzten Flockungshilfsmitteln im Glas analysiert werden. Somit kann ein reproduzierbares Polymerscreening durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind gut auf den großtechnischen Einsatz übertragbar.
http://www.pua24.net/pi/index.php?StoryID=41&articleID=215369
Kontaktdaten
aquen aqua-engineering GmbH
Lange Strasse 53
38685 Langelsheim
Deutschland
(nach oben)
Hydro-Ingenieure: Außergewöhnlicher Starkregen – Möglichkeiten der Risikobewertung und der daraus abgeleitete Objektschutz
Den Fachvortrag zum Thema Starkregen
Vom 13. Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium
am 17. und 18.10.2012
Lesen Sie unter:
http://www.hydro-ingenieure.de/news_mit_vortrag_starkregen.html
„Außergewöhnlicher Starkregen – Möglichkeiten der Risikobewertung und der daraus abgeleitete Objektschutz“ lautet der Titel eines Vortrages von unserem Herrn Dipl.-Ing. Ralf Bosbach, der aufgrund aktueller und zahlreicher Projekterfahrungen am 17.10.2012 auf dem 13. Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium aus der Praxis berichten wird.
Autor: Ralf Bosbach (Hydro-Ingenieure)
(nach oben)
Schlammfaulung mit Faulgasverwertung auf kleineren Kläranlagen
Kurzinhalt
Abwasser und der bei der Abwasserbehandlung anfallende Klärschlamm stellen in vielen Fällen ein
noch ungenutztes Energiepotenzial dar. Die Quantität und vor allem die Qualität dieses
Energieträgers ist weitestgehend bekannt. Im Vergleich zu anderen Energien, wie z. B. Wind- und
Sonnenenergie, ist diese Energie kalkulierbar und steht demzufolge für die Nutzbarmachung
kontinuierlich zur Verfügung. Insbesondere lohnt es auch auf kleineren Kläranlagen über eine
Schlammfaulung nachzudenken. Das entstehende Faulgas ist speicherbar und zur Stromerzeugung….
Den ganzen Vortrag lesen Sie unter
http://www.siekmann-ingenieure.de/files/12-09-27_dwa_magdeburg_vortrag.pdf
(nach oben)
Früher konnten wir nie sicher sein, alle NH4-Spitzen abzufangen
PRAXISBERICHT: OPTIMIERUNGSLÖSUNGEN ZUR ABWASSERBEHANDLUNG WTOS N/DN-RTC
Energieoptimierung ist seit vielen Jahren ein zentrales Thema in der Kläranlage Kornwestheim (nahe Stuttgart). Die Sauerstoff-Sollwerte in der Belebung wurden gesenkt und die Sandfangbelüftung wurde optimiert. Nur die Stickstoff-Fracht im Ablauf verringerte sich nicht entsprechend, die Unsicherheit bei Ammoniumspitzen blieb und Prozesswassertage mit hoher Stickstoff-Belastung ließen sich nicht ausregeln.
Seit Anfang 2011 entscheiden zwei WTOS N/DN-RTC auf der zweistraßigen Anlage über die Belüftungszeiten in den Belebungsbecken. Sie richten sich…mehr unter:
http://www.hach-lange.de/view/HlPDFDownloadController;jsessionid=E86871FB314145DA3459221AEA8B501D.worker2?mediaCode=90752
(nach oben)
Endress+Hauser: Abwasser, Strom, Gas, Wasser und Fernwärme
Die Stadtwerke Neuwied und die Servicebetriebe Neuwied nutzen Messtechnik, Software und Systeme von Endress+Hauser zur Unterstützung der Instandhaltung Seit über 150 Jahren gibt es die Stadtwerke Neuwied. Heute sorgen über 300 Mitarbeiter täglich für die sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung sowie für beste Trinkwasserqualität in Neuwied und den zugehörigen Stadtteilen. Neuwied zählt zu den attraktivsten Wirtschaftsstandorten am Mittelrhein. Sichere Versorgung hat höchste Priorität „Die sichere Ver- und Entsorgung der über 65.000 Einwohner mit Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Abwasser steht bei uns an oberster Stelle“, sagt Holger Jungen von den Stadtwerken Neuwied. Er ist Teamleiter in der EMSR-Instandhaltung und sichert mit vier Mitarbeitern die Verfügbarkeit der Versorgungsanlagen. „Wir sehen uns als bestes Versorgungsunternehmen der Region und haben hohe Ansprüche an die Qualität unserer Leistungen. Gleiche Ansprüche haben wir auch an unsere Lieferanten. Unser Partner für die Messtechnik in allen Gewerken ist nach einer Präqualifikation der Komplettlieferant Endress + Hauser. Neben der optimalen Messtechnik und den Systemlösungen profitieren die Stadtwerke Neuwied im Tagesgeschäft vor allem von der einfachen Bedienbarkeit der Geräte, der vereinheitlichten Dokumentation und den Online Tools. Der Online Shop wird zum Beispiel für die Auswahl und Auslegung der Messtechnik und der Vorbereitung der Bestellungen für den Einkauf genutzt. Das W@M Portal erleichtert die Verwaltung der installierten Geräte in den Anlagen und bietet per Mausklick den Zugriff auf Dokumentation, Ersatzteile und Lebenszyklusinformationen. „Wir sehen den Vorteil hier vor allem in der automatischen Informationsbereitstellung der Endress+Hauser Geräte im W@M Portal“ sagt Stefan Heinrich, Mitarbeiter der EMSR-Instandhaltung. Er ist verantwortlich für die Pflege der Instandhaltungsdatenbank…mehr:
http://endress.softwerk.de/eh/sc/europe/dach/de/resourceadditional.nsf/imgref/D_CS01288W11DE_0112_Stadtwerke_Neuwied.pdf/$FILE/CS01288W11DE_0112_Stadtwerke_Neuwied.pdf
(nach oben)
Endress+Hauser: Applicator – Auswahl und Auslegungstool für Ihren Planungsprozess
Vereinfachen Sie Ihre täglichen Engineering-Aufgaben
Sie möchten schnell und einfach das für Ihre Anwendung am besten geeignete Produkt finden? Applicator ist ein komfortables Auswahl- und Auslegungstool zur Bestimmung und Auswahl des für die jeweilige Messaufgabe richtigen Messgerätes. Geben Sie einfach Ihre bekannten Prozessdaten ein, und Applicator ermittelt eine zuverlässige Auswahl geeigneter Geräte.
Applicator ist als Online-Tool und als CD zur Installation auf Ihrem PC oder Laptop erhältlich
http://www.de.endress.com/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/#products/applicator
(nach oben)
Inocre: Energetische Optimierung von Kläranlagen durch Ko-Fermentation
Autoren: Fr. Breier & Fr. Groißmeier
Den Beitrag, der im Umweltmagazin erschienen ist, lesen Sie unter:
http://www.inocre.com/media/archive1/presseartikel
/UMW_MAG_62012_EnergetischeOptimierungbezahlteVErsionfrHo.pdf
(nach oben)
KRONOS ecochem: Berechnung der biologischen Phosphateliminierung
Der überwiegende Teil der Kläranlagen betreibt eine biologische und chemische Phosphateliminierung, die sogenannte Simultanfällung.
Es ist interessant zu ermitteln, welchen Anteil an der Phosphateliminierung die Mikroorganismen leisten und für welchen Anteil man ein Fällmittel verwendet.
Dazu stellen wir Ihnen die „Berechnung des Anteils an biologischer Phosphateliminierung Ihrer Kläranlage“ als PDF-Datei zur Verfügung.
Wir empfehlen die Verwendung des kostenlosen Acrobat Reader ab Version 10
Zur einwandfreien Funktion laden Sie sich diese PDF-Datei bitte auf Ihr Endgerät herunter.
Nähere Informationen geben wir Ihnen gerne auf Anfrage!
http://www.kronosecochem.com/ehome_de.nsf/index?OpenFrameset
(nach oben)
Endress+Hauser: Baumann Federn überlässt beim Abwasser nichts dem Zufall
Die Betriebskosten senken und der Umwelt dienen
Die Firma ‚Baumann Federn‘ zählt zu den führenden Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von Federn und Stanzteilen.
Im Zuge einer Modernisierung der Abwasservorbehandlung wurde die gesamte Anlage optimiert. Endress+Hauser lieferte als Komplettanbieter unter anderem die pH- und Füllstandmesstechnik sowie neue Dosierpumpen für die Chemikalienzugabe.
Die Anlage wurde auf den neusten Stand gebracht und die Prozesse optimiert. Positiver Nebeneffekt: Die Kosten ließen sich nachhaltig senken.
Lesen Sie den Fachartikel unter:
http://endress.softwerk.de/eh/sc/europe/dach/de/resourceadditional.nsf/imgref/D_polyscope_7_12_S26-28.pdf/$FILE/polyscope_7_12_S26-28.pdf
(nach oben)
Deammonifikation von Prozessabwässern
Besonders auf Kläranlagen mit einem hohen Anteil an Abwasser aus lebensmittelverarbeitenden Betrieben – insbesondere aus der Fleischverarbeitung – ist die Rückbelastung an Ammoniumstickstoff aus der Schlammbehandlung ein großes Problem. Die Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG betreibt am Standort Rheda einen Schlachthof. Die dort anfallenden Abwässer werden zur
Zentralkläranlage Rheda geleitet und dort entsprechend dem Stand der Technik gereinigt. Zur Behandlung der hohen Rückbelastung aus der Schlammentwässerung betreibt die Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG auf dem Gelände der Zentralkläranlage Rheda eine Schlammwasserbehandlungsanlage. Die Anlage wurde bisher zweistufig (Nitritation / Denitritation) nach dem Panda-Verfahren …mehr:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1412/2012_Wasserlinse_final_6_Deamonifikation.pdf
Autorin:
Dipl.-Ing. Kerstin John
E&P Anlagenbau GmbH
Mariannenstr. 38
12209 Berlin
(nach oben)
Cyklar: EssDE® steht für die energieautarke Kläranlage (Energy self sufficient by DEMON®).
Die grössten Kostenfaktoren und Probleme der Abwasserreinigung sind:
• Die Oxidation von CSB und Stickstoff verbraucht sehr viel Sauerstoff / Energie
• Die chemische Energie des CSB wird bei der Oxydation metabolisiert
• CSB wird für die Denitrifikation benötigt
Beim EssDe®-Verfahren wird der grösste Teil des Kohlenstoffs durch Adsorption fixiert und unmittelbar in die Faulung gegeben. Es wird nicht nur (Belüftungs-)Energie gespart, indem der Aufbau von Belebtschlamm und endogene Atmung vermieden wird, es wird gleichzeitig sehr viel mehr Faulgas und damit Energie gewonnen.
Das beschriebene Konzept ist als AB-Verfahren seit vielen Jahren bekannt und vielfach grosstechnisch realisiert worden. Der entscheidende Nachteil des Verfahrens bestand darin, dass in der schwachbelasteten B-Stufe nicht mehr ausreichend Kohlenstoff für die Denitrifkation zur Verfügung stand. Mit dem DEMON®-Verfahren ist jetzt das Werkzeug verfügbar, mit dem das Maximum an Energie gespart bzw. gewonnen werden kann und gleichzeitig eine weitestgehend Stickstoffelimination gelingt.
Eine Umwandlung bestehender Anlagen in das Konzept EssDe® ist mit geringem Aufwand möglich. Die Vorklärungen sind i.d.R. überdimensioniert und mindestens 2-strassig ausgelegt. Nutzt man eine der Strassen als hochbelastete biologische Stufe, so ist ein grosser Teil des Konzeptes bereits umgesetzt.
Die Argumente:
• Maximaler Energieüberschuss dank minimiertem Sauerstoffverbrauch und maximierter Faulgasproduktion
• Effiziente Stickstoffelimination dank DEMON® im Neben- und Hauptstrom
• Weniger Schlammanfall
• Deutlich bessere Schlammentwässerung
• Umrüstung unter Nutzung der vorhandenen Substanz möglich
• Alle Einzelkomponenten des Systems sind grosstechnisch vielfach erprobt
Schmutzstoffe im Abwasser werden künftig nicht mehr als Problem sondern als Energiequelle gesehen
Quelle: http://www.cyklar.ch/de/essde/auf_einen_blick_44.html
(nach oben)
Archimedische Schneckenpumpen von SPECO®: Der robuste Klassiker für kosteneffizientes Wasser- und Abwassermanagement
Schneckenpumpen basieren auf dem Prinzip der archimedischen Schraube, das im 3. Jahrhundert v. Chr. von dem griechischen Mathematiker und Ingenieur Archimedes entwickelt wurde. Eine der Kernanwendungen der klassischen, schraubenförmigen Schnecke war und ist die Hebung von Wasser auf ein höheres Niveau zur Be- und Entwässerung. Die altbewährte Technik wird heute in einer Vielzahl unterschiedlicher Bereiche eingesetzt, wo sie höchste Anforderungen erfüllt – vor allem in der Abwasserbehandlung kommunaler Klärwerke und der Prozesswasseraufbereitung in industriellen Produktionsbetrieben.
Die Vorteile von Schneckenpumpen ergeben sich vor allem aus ihrer einfachen robusten Konstruktion, die kaum verschleißanfällig ist und eine sehr hohe Betriebssicherheit gewährleistet. Sie erzielen eine hohe Lebensdauer ohne dass größere Wartungsarbeiten notwendig sind oder Störfälle auftreten. Durch ihre Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen, Verzopfungen und Abrasion beträgt die Wartungszeit normalerweise nur wenige Stunden pro Jahr, selbst wenn die Pumpe das ganze Jahr 24 Stunden täglich im Einsatz ist. Der sehr hohe Wirkungsgrad von Schneckenpumpen bleibt auch bei wechselnden Durchflussmengen über lange Zeiträume hinweg konstant. Die Kombination aus Betriebssicherheit, geringe Betriebskosten sowie konstant hohe Wirkungsgrade und Förderleistungen bewirkt, dass Schneckenpumpen nach wie vor sehr gefragt sind.
Für weiterführende Informationen zu Schneckenpumpen oder anderen Produkten von SPECO® lohnt sich der Besuch auf der WAM-Homepage www.wamgmbh.de/SPECO
(nach oben)
WAM: Abwasservorreinigung für kleine und mittlere Kläranlagen: SPECO® Kompaktanlagen der WAM trennen Feststoffe, Sand und Fette zuverlässig ab
Ob kommunales Rohabwasser oder industrielles Prozessabwasser – die erste Phase in der Abwasserbehandlung ist stets die mechanische Vorreinigung. Sie beinhaltet die Fest-Flüssigtrennung, Verdichtung und Entwässerung von Feststoffen, außerdem die Sedimentation, Förderung und Entwässerung von Sand oder anderen Sinkstoffen, sowie das Abschöpfen flottierender Substanzen wie z.B. Fette. Die SPECO® Kompaktanlage TSF vereinigt die Prozesse dieser ersten Vorreinigung in einer einzigen Anlage und zählt damit zu den leistungsfähigsten, zuverlässigsten und wirtschaftlichsten Lösungen im Zulauf kommunaler Kläranlagen. TSF Kompaktanlagen erreichen einen hohen Abscheidegrad unerwünschter Feststoffe, wodurch die nachgeschaltete biologische Stufe erheblich entlastet wird.
Das unbehandelte Rohabwasser gelangt mittels Freispiegelgefälle oder Pumpstationen über die Kanalisation zum Einlaufbereich der Kläranlage. Hier wird das Rohabwasser zunächst mechanisch vorgereinigt, indem feste und unlösbare Abwasserinhaltsstoffe mit einem Sieb oder Rechen abgetrennt werden. Neben Spaltsieben werden oft auch Lochsiebe eingesetzt, um Faserstoffe deutlich besser abscheiden zu können.
Im zweiten Schritt gelangt das vorgesiebte Abwasser in den Sandfang, der idealerweise belüftet sein sollte, um eine Verschlammung der Einrichtung zu vermeiden. Im Sandfang führt die Volumenvergrößerung zur Reduzierung der Fließgeschwindigkeit des einströmenden, vorgesiebten Abwassers. Ein extern aufgestellter Kompressor versorgt über Rohrleitungen das Belüftungssystem des Sandfangs. Durch Injektion feiner Gasblasen in das Abwasser wird im Sandfang eine Luftwalze erzeugt, die quer zur Fließrichtung organische (z.B. Fäkalien, Fette) von mineralischen Inhaltsstoffen (z.B. Sand) trennt. Freigesetzte Fette haften sich an die feinen Luftbläschen, flotieren an die Oberfläche und scheiden sich automatisch im Fettfang ab, bevor sie zeitgesteuert aus dem System mittels Oberflächenräumeinrichtung entfernt werden. Freigesetzte Sinkstoffe nutzen ebenfalls beruhigte Zonen, um zu sedimentieren. Am Grund des Sandfangbehälters werden die angehäuften Sedimente geräumt, gesammelt und ausgetragen. Alle anderen gelösten und ungelösten Inhaltsstoffe (meist organisch), bleiben durch die Belüftung und aufgrund ihres spezifischen Gewichts in Schwebe und gelangen so in die nachgeschaltete biologische Stufe, die nach den zuvor beschriebenen Vorreinigungsprozessen deutlich entlastet wird.
Heute sind Kompaktanlagen in der Lage, alle Verfahrensschritte in einem Bauteil auf kleinster Fläche parallel durchzuführen. Statt der konventionellen Betonbauweise (Rechengebäude mit nachgeschaltetem Langsandfang), werden von SPECO® eigene Kompaktanlagen aus hochwertigem Edelstahl angeboten. Im Zulauf der TSF-Kompaktanlage kommt die seit Jahrzehnten bewährte WAM – Siebschneckentechnik zum Einsatz. Die robusten und wellenlosen Siebschnecken sind mit einer mehrstufigen Siebgutwäsche sowie einer Siebgutkompaktierung ausgerüstet, wodurch das anfallende Siebgut in einem Arbeitsschritt optimal gereinigt und entwässert wird. Eine separate Rechengutwaschpresse ist somit überflüssig und spart Anschaffungskosten. Der integrierte Langsandfang mit Rahmenkonstruktion ist modular aufgebaut. Er wird entweder als komplett montiertes Bauteil geliefert oder kann aus einzelnen Modulen im Rechengebäude vor Ort einfach zusammengesetzt werden. Im Sandfang befindet sich eine Sandräumspirale, die anfallende Sedimente dem Sandaustragsförderer übergibt. Von dort gelangen die Sedimente entwässertet in einen Container zur Verwertung oder können – je nach anfallender Menge – mittels einer SPECO® – Sandwäsche wirtschaftlich nachbehandelt werden.
Oben aufschwimmende, im Fettfang gesammelte Fette und andere Schwimmstoffe werden über eine neuentwickelte selbstjustierende Fettfangräumeinrichtung abgeschöpft und sicher aus der TSF Kompaktanlage geführt. Das Abwasser wird danach einer weiterführenden biologischen, oder falls notwendig, einer chemisch/ physikalischen Behandlung unterzogen, während die separierten Feststoffe verwertet oder entsorgt werden.
SPECO-Kompaktanlagen TSF sind nach DWA (ATV) – Richtlinien ausgelegt. Sie sind platz- und ressourcensparend und reduzieren deshalb signifikant die Kosten für den Aufbau von Infrastruktur.
Für weiterführende Informationen zu TSF Kompaktanlagen oder anderen Produkten von SPECO® lohnt sich der Besuch auf der WAM-Homepage www.wamgmbh.de/SPECO
(nach oben)
Noch wenig bekannt: WAM liefert modernste Siebschneckentechnik der Marke SPECO® für die kommunale und industrielle Abwassertechnik
SPECO® Siebschnecken für kommunale Kläranlagen sind für den Gerinneeinbau oder den Einbau im mitgelieferten Edelstahlbehälter (Beschickung über Pumpen) ausgelegt. Durch Spalt- oder Lochsiebtechnik werden ungelöste organische oder nicht organische Bestandteile aus dem Rohabwasserstrom mechanisch entfernt. Dabei ist die Wahl der Siebgröße genauso entscheidend wie die Wahl der richtigen Sieböffnung. Im kommunalen Einsatz kommen bei konventioneller Betriebsweise Lochsiebe zum Einsatz, die besonders zuverlässig bei der Abtrennung von Faserstoffen sind. Dadurch werden Störungen wie Verzopfungen oder mangelnder Sauerstoffeintrag in der nachgeschalteten biologischen Stufe deutlich reduziert.
SPECO® Siebschnecken werden überwiegend auf Kläranlagen mit bis zu 10.000 EW erfolgreich eingesetzt. Dabei kann der Einsatz im Hauptgerinne als Einzel-, Doppel- oder Mehrfachausführung realisiert werden. Auch der Einsatz im Notumlaufgerinne ist denkbar. Weitere Vorteile bietet die integrierte mehrstufige Siebgutwäsche, die wertvolle Organik im Siebgut wieder dem Kläranlagenbetrieb zuführt. Die nachgeschaltete Presszone reduziert dabei deutlich die abgetrennten Stoffe und spart somit Entsorgungskosten.
Auch in der industriellen Abwassertechnik werden SPECO® Siebschnecken erfolgreich in der Prozess- oder Abwasseraufbereitung eingesetzt und erfüllen gerade hier höchste Anforderungen hinsichtlich Trennschärfe, Material und Bedienfreundlichkeit. In der Prozesswasseraufbereitung wird das anfallende Waschwasser oft nach einer mechanischen Vorbehandlungsstufe weiterbehandelt. Zur Abtrennung ungewünschter Sinkstoffe (z.B. Sand, Glas, Steine, Metallpartikel) bietet die Verfahrenskombination mit einem SPECO® Sandabscheider – entweder vor- oder nachgeschaltet – viele Vorteile.
In der Industrie finden die Siebschnecken z.B. in der Verarbeitung von Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch oder Geflügel, aber auch bei der Herstellung von Getränken und Papier oder dem Recycling Verwendung.
SPECO® Siebschnecken bestehen aus einem speziell gefertigten Siebkorb, einem Transportrohr mit Förderspirale, einer Antriebseinheit und einem Verdichtungs- und Abwurfmodul. Im ersten Schritt wird das in die Siebschnecke eingeleitete Abwasser mit Hilfe des geöffneten Siebkorbes von Feststoffen befreit, indem die innenliegende Spirale die separierten Stoffe entlang des Siebkorbes mit einer Drehbewegung aus dem unteren Gerinnebereich nach oben in den Kompaktierbereich fördert. Im Verdichtungsmodul, das SPECO® als Ausstattungsoption anbietet, wird das Siebgut zusätzlich entwässert und kompaktiert, wodurch eine Volumenreduzierung von 40 – 60% bei einem Trockengehalt von bis zu 35 % erreicht wird. Während des Betriebs wird der Siebkorb kontinuierlich von in Segmenten angeordneten Spezialbürsten gereinigt, die auf der Rückseite des Spiralblattes der Förderspirale angebracht sind und dadurch eine lange Standzeit erzielen.
Für weiterführende Informationen zu Siebschnecken von SPECO® lohnt sich der Besuch auf der WAM-Homepage www.wamgmbh.de/SPECO
(nach oben)
HUBER: Effektive und nachhaltige Schwallspülreinigung von Abwasserkanälen mit HUBER Power Flush®
Ablagerungen in Abwasserkanälen stellen heutzutage eine der wesentlichen Probleme im Betrieb von Entwässerungssystemen dar. Während des Trockenwetterabflusses sowie die Entleerung von Stauraumkanälen bleiben Sedimente aus organischen und anorganischen Bestandteilen auf der Kanalsohle liegen und führen zu erheblichen negativen Erscheinungen. Mit Hilfe der Schwallspülung können diese Ablagerungen entfernt und dauerhaft beseitigt werden. Die Reinigung von Abwasserkanälen hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Eine Vielzahl von Ursachen ist für die Ablagerungen auf der Kanalsohle verantwortlich, welche stetig anwachsen und sich negativ auf den laufenden Kanalbetrieb auswirken. Insbesondere im Mischsystem entstehen infolge geringer Fließgeschwindigkeiten und während der Speicherphase in Staukanälen Ablagerungen, welche zusätzlich ein großes Potential an organischen Stoffen beinhalten können. Weitere Folgen sind ein reduzierter, hydraulischer Querschnitt sowie eine damit verbundene verringerte, hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanals. Eine erhöhte Anzahl an Entlastungsereignissen und damit einhergehender hydraulischer und stofflicher Stress für die Gewässer sind ebenso zu nennen wie Stoßbelastungen für die Kläranlagen. Für einen bestimmungsgemäßen Betrieb der Kanäle müssen diese Ablagerungen jedoch wieder entfernt werden.
Zur Lösung dieses Problems http://www.huber.de/fileadmin/08_HUBER_Report/03_nach_Ausgabe/de_Report_2012-01.pdf?PHPSESSID=95795795010d1f759f8293c3c23e6f9b
(nach oben)
Warum Kanalsand teuer entsorgen?
Kanalspülsand ist mit Sicherheit eines der heterogensten Stoffgemische die bei der Abwassersammlung und -ableitung anfallen. Vom äußerlichen Aussehen hat dieses Material leider oft nicht allzu viel mit einem körnigen Sand zu tun, denn je nach Kanalsystem und Gepflogenheiten der angeschlossenen Bürger, findet sich eigentlich fast alles in diesem Feststoff. Deshalb schwankt auch der organische Anteil zwischen 5 und 80 %, wobei der Mittelwert ungefähr bei 20 % liegt. Rein rechtlich wird Kanalsand als „Abfall bei der Kanalreinigung“ bezeichnet und trägt die Abfallschlüsselnummer 200306. Sehr oft wird heutzutage die Kanalreinigung und die Entsorgung der anfallenden wässrigen Sedimente an Dienstleister übergeben. Die Kommune oder der Abwasserverband bezahlt dabei einen Komplettpreis, der zum einen die Kosten für die Kanalreinigung und zum anderen die Entsorgungskosten der Spülwässer / Sedimente beinhaltet. Immer mehr stößt aber diese “doppelte Kalkulation” bei vielen Kunden auf Unverständnis, weil die anfallenden Spülwässer / Sedimente genauso gut auf der eigenen Kläranlage, mit dem Sand aus dem Sandfang, behandelt können werden. In diesem Zusammenhang bieten wir seit längerem komplexe Behandlungsverfahren für große Kommunen und Abwasserverbände an. Für kleine bis mittlere Jahresmengen (50 – 500 t/a) waren bisher die Investitionskosten in keinem Verhältnis zur Einsparung der Entsor- gungskosten. Mit dem neuen, kompakten Behandlungsverfahren kann nun auch dieser Markt optimal bedient werden. Das Verfahren besteht dabei aus einem Annahmebunker mit Dosierschnecke, einer Waschtrommel und einem Sandabscheider mit integrierter Sandwaschanlage. Die gesamte Anlage wurde dabei so konzipiert, dass neben dem Kanalsand auch Straßenkehricht (Streusplitt) und Sinkkasteninhalte behandelt werden können. Natürlich kann auch ungewaschener, vorklassierter Kläranlagensand verarbeitet werden, so dass auch mehrere kleine Kommunen ihren mineralischen Abfall an einer zentralen Kläranlage kostengünstig behandeln. Herzstück des gesamten Verfahrens ist unsere patentierte Sandwaschtechnologie mit dem Wirbelbett. Um bestmöglichste Reinigungserfolge zu erzielen und eine Standzeit von > 15 Jahren zu gewährleisten, wird vor dem Sandwäscher das kontaminierte Rohmaterial in einer ROTAMAT® Waschtrommel ordentlich gewaschen und bei 10 mm separiert. Die speziell für das Verfahren neu entwickelte Waschtrommel wird frequenzgesteuert betrieben, so dass aufgrund der geringen Drehzahl völlig verschleißfrei gearbeitet werden kann. „Gefüttert“ wird die Waschtrommel vollautomatisch aus dem Annahmebunker mittels einer robusten Förderschnecke. Der Annahmebunker kann dabei an die Erfordernisse des Kunden angepasst werden. Das ablaufende, mit Sand beladene Waschwasser der Trommel, strömt im Freispiegel in einen unbelüfteten Langsandfang. Dort wird der Sand bis zu einer Korngröße von 200 μm abge- Kompaktanlagen mit komplettem Notumlauf 3 Kompaktanlagen für maximal 600 l/s Aufgabe des “Abfall-Rohmaterials” in den Annahmebunker trennt und diskontinuierlich dem Sandwäscher mittels horizontaler Schnecke zugeführt. Zur Effizienzsteigerung kann zusätzlich auch das Sand- / Wasser-Gemisch aus dem Sandfang des Klärwerks in die Anlage gegeben werden. Weitere Aggregate zur Sandklassierung oder Sandwäsche sind somit nicht mehr nötig. Die Vorteile im Überblick:
MEHR: http://www.huber.de/fileadmin/08_HUBER_Report/03_nach_Ausgabe/de_Report_2012-01.pdf?PHPSESSID=95795795010d1f759f8293c3c23e6f9b
(nach oben)
Kappeler Umwelt Consulting: Betriebsoptimierung von Kläranlagen
Fällmittel – Phosphatelimination und gleichzeitige Blähschlamm- und Schwimmschlammbekämpfung –
Erfahrungen aus der Schweiz
Dr. Jürg Kappeler
Kappeler Umwelt Consulting AG
Die Vortragspräsentation finden Sie unter:
http://kuc.ch/wpress/wp-content/uploads/2010/06/Vortrag-03.2008-Fällmittel-Phosphatelimination-und-gleichzeitige-Schwimmschlammbekämpfung-Erfahrungen-aus-der-Schweiz.pdf
(nach oben)
Lagersysteme professionell planen – mit Mall
Zur Unterstützung von Planern und Ingenieuren bei der Auslegung von Heizungsanlagen hat Mall mit dem technischen Planerhandbuch „Unterirdische Lagersysteme für Biomasse, Pellets und Wärme“ eine umfangreiche Broschüre mit vielen Projektzeichnungen und technischen Hilfsmitteln aufgelegt.
Bei kommunalen und gewerblichen Heizungsmodernisierungen, aber auch beim Bau von Wohngebäuden sind erneuerbare Energien und heimische Rohstoffe immer öfter erste Wahl. Bei großen Lagervolumina bietet sich dabei der unterirdische Einbau des Speichers im Außenbereich an. Auf insgesamt 40 Seiten zeigt das Handbuch mit detaillierten Projektzeichnungen die Möglichkeiten der Einbindung in die Gebäudetechnik und enthält darüber hinaus Hilfsmittel wie Kabelzuglisten, Begriffserklärungen sowie einen Kostenvergleich zwischen Kellerlagerung und Erdeinbau. Mit Hilfe von Projektfragebögen für Pellet- und Pufferspeicher ermitteln die Experten bei Mall den richtigen Behälter. Das Handbuch ist unter info@mall.info kostenlos erhältlich
(nach oben)
EUROPHAT®: ELEKTRO-PHOSPHATFÄLLUNG (elektro-chemisches Verfahren)
Was bewirkt das elektro-chemische Verfahren?
Mit der Entwicklung der ELEKTRO-PHOSPHATFÄLLUNG (EPH-Fällung) wird eine äußerst umweltschonende und zudem kostengünstige Richtung der Wasserreinigung eingeschlagen:
Die Phosphatentfernung erfolgt durch eine Veränderung der chemischen Prozesse im Wasser bzw. Abwasser.
Dazu werden mehrere Elektroden, die direkt ins Wasser oder Abwasser eintauchen, vom ELEKTRO-PHOSPHATFÄLLER mit entsprechender elektrischer Gleichspannung versorgt, was zu einer Ionenwanderung und pH-Wert-Verschiebung führt. Dadurch wird z.B. Phosphat als Salz (Kalzium- bzw. Magnesium-Ammonium-Phosphat) gebunden und kann mit dem Überschussschlamm abgezogen werden.
Um in kommunalen Abwasserreinigungsanlagen die Phosphatbelastung im Abwasser zu reduzieren (auf regional verschieden vorgegebene Grenzwerte von 0,3 – 2 mg/l ges. P), werden hauptsächlich chemische Substanzen verwendet. Es handelt sich dabei teilweise um Abfallstoffe aus der Industrie (z.B. Eisen- und Aluminiumsalze). Diese chemische Fällung ist kostenintensiv und belastet zusätzlich unsere Gewässer durch Aufsalzen der Vorfluter. Weiters belasten die enthaltenen Fällmittelschwermetalle zusätzlich den Klärschlamm.
Unsere Technologie wurde auf der Kläranlage Pregarten, OÖ …mehr:
http://www.europhat.at
(nach oben)
Roediger: Auswertung der Lebensdauer und Betriebszustände der Bauteile der NoMix-Toiletten
Präsentation von Hans-Christian Rüster (RoedigerVacuum):
Februar 2012 – Roediger Betriebstagebuch NoMix-Toiletten (3 MB)
Die Präsentation finden Sie unter: http://saniresch.de/images/stories/downloads/T9_R%C3%BCster_Betriebstagebuch_NoMix.pdf
(nach oben)
KRONOS: Entlastungsflockung mit Eisensalzen
Durch gezielten Einsatz von KRONOS Eisensalzen kann die Reinigungsleistung von Abwasserreinigungsanlagen signifikant gesteigert werden. Die Wirkung basiert auf der Ausflockung und Abscheidung von feinstverteilten und kolloidal gelösten Abwasserinhaltsstoffen. Der Wirkungsgrad von mechanischen Klärstufen kann damit mehr als verdoppelt und die nachfolgende biologische Klärung bzw. der Vorfluter deutlich entlastet werden.
Für die Entlastungsflockung kommt vorzugsweise FERRIFLOC Eisen-III-chloridsulfat-Lösung zum Einsatz. FERRIFLOC bewirkt eine schnelle und höchst effektive Ausflockung der Trübstoffe. Die Anwendungsgebiete der Entlastungsflockung sind:
1. Sanierung überlasteter biologischer Kläranlagen durch Vor- oder Nachflockung
2. Vorreinigung hochbelasteter Industrieabwässer
3. Verbesserung der Reinigungsleistung von mechanischen Kläranlagen durch Direktflockung
4. Unterstützung der Nitrifikation durch Vorflockung
Die erforderliche …mehr:
http://www.kronosecochem.com/ehome_de.nsf/index?OpenFrameset
(nach oben)
Kronos-Praxisbericht: Geruchsbindung in Abwassersammlern
Literatur-Nr. DS2066
Geruchsbelästigungen aus Abwasserkanälen sind – vornehmlich in warmen Klimazonen der Erde – ein bekanntes Problem. Aber auch in Nordeuropa kommt es immer häufiger zu Geruchsemissionen aus Kanalschächten. Grund hierfür ist die zunehmende Zentralisierung der Abwasserreinigung und die damit einhergehende Ausweitung des Sammlersystems, aber auch die Reduzierung der Abwasserströme.
Die Geruchsemissionen werden in aller Regel durch Schwefelwasserstoff verursacht, der bei der anaeroben Zersetzung von schwefelhaltigen Abwasserinhaltsstoffen entsteht. Das Austreten dieses „nach faulen Eiern stinkenden“ Gases kann durch den Einsatz von Eisensalzen schnell und wirksam verhindert werden (Einzelheiten hierzu siehe TI 3.09 ).
Exemplarisch werden zwei erfolgreiche Bekämpfungsmaßnahmen …den ganzen Bericht lesen Sie unter:
http://www.kronosecochem.com/ehome_de.nsf/index?OpenFrameset
(nach oben)
KRONOS: Chemische Schlammkonditionierung mit Eisensalzen
Literatur-Nr. DS2072
Die maschinelle Klärschlammentwässerung setzt eine Vorbehandlung des Klärschlammes voraus. Diese wird als Konditionierung bezeichnet und sie wird, je nach Verfahren, mit anorganischen und organischen Flockungsmitteln durchgeführt.
Die KRONOS Konditionierungsmittel sind:
• FERROFLOC Eisen-II-chlorid-Lösung,
• KRONOFLOC Eisen-II-chlorid-Lösung und
• FERRIFLOC Eisen-III-chloridsulfat-Lösung.
Das Haupteinsatzgebiet für die KRONOS Produkte ist die klassische Starkentwässerung mittels Kammerfilterpressen nach einer Eisen-Kalk-Konditionierung. Dabei wird der Schlamm zunächst mit Eisensalz-Lösung und anschließend mit Kalkmilch versetzt. Die Zugabemengen betragen pro m3 Nassschlamm 5 – 10 kg Eisensalz-Lösung und 10 – 25 kg Weißkalkhydrat.
Abhängig von den Schlammeigenschaften und Steuerungsmöglichkeiten kann die Starkentwässerung unter bestimmten Voraussetzungen auch mit der Eisen-Polymerkonditionierung… mehr:
http://www.kronosecochem.com/ehome_de.nsf/index?OpenFrameset
(nach oben)
KRONOS: Das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht in der biologischen Abwasserreinigung
Durch gezielten Einsatz von KRONOS Eisensalzen kann die Reinigungsleistung von Abwasserreinigungsanlagen signifikant gesteigert werden. Die Wirkung basiert auf der Ausflockung und Abscheidung von feinstverteilten und kolloidal gelösten Abwasserinhaltsstoffen. Der Wirkungsgrad von mechanischen Klärstufen kann damit mehr als verdoppelt und die nachfolgende biologische Klärung bzw. der Vorfluter deutlich entlastet werden.
Betriebsstörungen durch Blähschlamm, Schwimmschlamm oder Schaum hängen oft mit einer verstärkten Kohlensäureproduktion und -anreicherung zusammen. Zwischen dem Kohlensäuregehalt und der Säurekapazität in Wässern besteht ein von pH-Wert und Temperatur abhängiges chemisches Gleichgewicht. Dieses Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht, bekannt aus der Trinkwasseraufbereitung, spielt auch für die biologischen Prozesse in der Abwasserreinigung eine wichtige Rolle.
In der neuen Technischen Information 3.05 wird grundlegend …mehr:
http://www.kronosecochem.com/ehome_de.nsf/index?OpenFrameset
(nach oben)
Effiziente Tauchwandlösungen
Vortrag von Oliver Cuntz, Biogest AG
Anlässlich der Jahrestagung 25. und 26. August 2011
in
Lahnstein, Stadthalle
Finden Sie unter:
http://www.bwk-hrps.de/Veranstaltungen/Fachtagung2011/Cuntz_BIOGEST_Tauchwandloesungen.pdf
(nach oben)
Eisenmann: Klärschlammverbrennung in der kommunalen Abwasserbehandlung
Die Firmenpublikation der Firma Eisenmann finden Sie unter:
http://www.eisenmann.com/data/assets/produktinformationen/de/Kl%C3%A4rschlammverbrennung/docFile/Klaerschlammverbrennung_de.pdf
(nach oben)
Energieketten-System statt Kabeltrommel
Seit fünf Jahren reibungsloser Betrieb an Kläranlage
Wie führt man dem beweglichen Räumer eines Klärbeckens am besten Energie zu? Der
Aggerverband entschied sich gegen die konventionelle Lösung mit Kabeltrommel und für eine
Energiezuführung aus dem LBT Flizz-System von igus. Das Ergebnis: Das System an der Kläranlage
Waldbröl-Brenzingen arbeitet seit fünf Jahren ohne Ausfälle.
Die Kläranlage Waldbröl-Brenzingen, die Anfang 1970 gebaut und 1991 wesentlich erweitert wurde, ist eine von 38 Kläranlagen, die der Aggerverband im Bergischen Land betreibt. Sie reinigt die Abwässer, die
in großen Teilen der Stadt Waldbröl anfallen, und ist für 10.200 Einwohnerwerte ausgelegt.
Die Abwässer gelangen zunächst …
Mehr: http://www.igus.de/_WPCK/pdf/global/FA0206-D.pdf
(nach oben)
BUCHER: Team-Play beim Klärschlamm Entwässern
Bei der mechanisch-biologischen Abwasserbehandlung fällt stets Klärschlamm und somit ein Abfall an. Um die Kosten für die Entsorgung zu vermindern, hat zum Beispiel der Käppala- Verband in Stockholm/Schweden ein chemisches Behandlungsverfahren mit hydraulischen Filterpressen kombiniert. Das gute Zusammenspiel ermöglicht TS-Gehalte von 50 %. Die Diskussion um den „richtigen“ Verwertungsweg von Klärschlamm beschäftigt Abwasserexperten und Politiker hierzulande schon seit Jahren. Unabhängig davon, ob in erster Linie der Nutzen der im Schlamm enthaltenen Nährstoffe für Pflanzen oder die Gefahr der Schwermetallbelastung gesehen wird, kommt es in beiden Fällen darauf an, die Klärschlammmenge und somit vor allem die Kosten für den Transport und die Verwertung zu verringern.
Zusammenspiel zweier Verfahren führt zu besserer Entwässerung So hat die Kläranlage Käppala mit 700 000 EW im Nordosten von Stockholm ihre eigene effiziente Form der Klärschlammaufbereitung gefunden, indem sie 2008 zwei Verfahrensschritte von Kemira und Bucher Unipektin …mehr:
http://www.bucherdrytech.com/download/Literatur/11_04_07_UWM_03030032.pdf
(nach oben)
Polymermischer im Flockungsprozess: Standardanwendung mit Nutzenpotential
In der Abwasserbehandlung sind polymer-initiierte Flockenbildungs- und Entwässerungssysteme seit langer Zeit ein zentraler Bestandteil der Schlammentwässerung. Der Flockenformung wurde bisher zwar auch schon Beachtung geschenkt, im Fokus liegt sie allerdings erst seit ein paar Jahren.
Inzwischen können auch hier wesentliche Verbesserungen gemeldet werden.
Der Wettbewerb der Polymerhersteller ist bekannt.
Neben dem Polymer ist ein Element/Baustein in der Flockenbildung der Polymer-Mischer. Bisher eher als eine Standardanwendung betrachtet, läßt sich inzwischen auch beim Prozessschritt Polymerbeimischung eine Verbesserung erreichen. Konstruktiv und verfahrenstechnisch verbesserte Mischerausführungen zeigen hier ihre Stärken und bessere Ergebnisse.
http://www.aquen.de/newsletter/White_Paper_3.pdf
(nach oben)
Süd-Chemie: Kompakt und komfortabel
Auch kleinere Kläranlagen benötigen immer häufiger Phosphatfällungsanlagen. Müssen diese kleinen Anlagen deshalb auf Komfort und Wertbeständigkeit verzichten? Zwei Beispiele belegen, wie mit individuell angepasster intelligenter Dosiertechnik eine wirtschaftliche, störungsfreie P-Fällung für kleine Anlagen realisiert werden kann. Gerade auf kleineren Kläranlagen, die nicht ständig besetzt sind, ist der störungsfreie und stabile Betrieb einer Phosphatfällung besonders wichtig. Mit „Einfachstlösungen“ werden hier nur vordergründig Kosten gespart, die im Betriebsalltag durch Störungen und Probleme schnell wieder anfallen. Nicht am Konzept sparen „Unser Ziel ist es, P-Fällungsanlagen zur Verfügung zu stellen, die einfach funktionieren, ausreichend flexibel sind und dabei kaum Wartungsaufwand verursachen!“, betont Andreas Melcher, Leiter des Bereichs Anlagentechnik der Industriegruppe Kommunale Abwasserbehandlung der Süd-Chemie AG. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die Wünsche der Betreiber detailliert aufgegriffen und mit dem Anlagenkonzept umgesetzt. Die Gemeinden Langenpreising mit 3.600 EW und Loiching mit 3.000 EW wurden im Jahr 2010 mit neuen Phosphatfällungsanlagen ausgestattet. In beiden Beispielen handelt es sich um ähnliche Konzepte. Auf der bauseitig vorbereiteten Fundamentplatte steht ein 10 m³ Lagerbehälter mit Auffangwanne inkl. der erforderlichen Überwachungseinrichtungen (Überfüllsicherung, Leckageüberwachung und Füllstandsmessung). Die Steuerungs- und Dosiertechnik ist im witterungsbeständigen Schutzschrank direkt neben dem Lagerbehälter installiert. Eine Membrandosierpumpe fördert das Fällmittel zur Dosierstelle. Die zweite Pumpe ist bei beiden Anlagen als Anlagentechnik Stand-by-Pumpe vorgesehen und bereits voll funktionsfähig in die Steuerung und Verrohrung eingebunden. Die Pumpen wurden mit einem Druckhalteventil, Manometer mit Membrandruckmittler und einem Spülanschluss ergänzt. Neben der teilweise vorhandenen Steuerungselektronik in den verwendeten Membrandosierpumpen wurde eine kompakte Steuerung eingesetzt. Durch Softwareänderungen sind damit Anpassungen der Dosieranlagensteuerung problemlos und bis zur Inbetriebnahme häufig ohne Mehrkosten möglich. Kläranlage Langenpreising Auf der Kläranlage Langenpreising, die nach dem Biocos- Verfahren arbeitet, erfolgt die Phosphatfällung während des Rührzyklus, mit individuell einstellbarer Nachlaufzeit. Herr Richter, der die Kläranlage im Auftrag der Firma Sedlmeier Umwelttechnik GmbH betreut, hat hier seine langjährige Erfahrung eingebracht. Herrn Richter gelang es so binnen kurzem durch intelligent gesteuerte Fällmitteldosierung den Schlammvolumenindex von über 170 ml/g auf unter 110 ml/g zu senken. Dies erlaubt die gesicherte Einhaltung eines niedriger erklärten P-Grenzwertes, und ermöglicht damit die Verrechnung der P-Fällstation mit der Abwasserabgabe. Kläranlage Loiching In Loiching wurde in Absprache mit dem Klärwärter Herrn Huber und dem betreuenden Ingenieurbüro Stelzenberger + Scholz eine individuelle Steuerungsvariante ausgeführt. Der Kläranlagenzulauf erfolgt über ein Pumpwerk, welches mit verschiedenen Füllstandsmeldern ausgestattet ist. Die Dosierung des Fällungsmittels erfolgt in den Rücklaufschlamm. Bei Überschreiten eines minimalen Füllstandes im Pumpwerk des Kläranlagenzulaufs beginnt die Dosierung des Fällungsmittels. Die Dosiermenge ist frei wählbar. Wird durch zunehmenden Füllstand (z.B. Mischwasserzulauf aus einem Rückstaukanal) der maximale Füllstand erreicht, erhöht sich die Dosiermenge des Fällmittels auf die vorher festgelegte Menge. Die Anlagen wurden vor der Inbetriebnahme von einem zugelassenen Sachverständigen geprüft. Reibungslose Inbetriebnahme und Übergabe Die Montage der Anlagen, Inbetriebnahme inkl. Erstbefüllung mit SÜDFLOCK® K2 und Einweisung, war nach wenigen Tagen abgeschlossen. Eine umfangreiche Dokumentation mit allen Zulassungen, einer detaillierten Softwarebeschreibung, den Schaltplänen und der Konformitätserklärung entsprechend der EG-Maschinenrichtlinie wurde den Betreibern übergeben. Beide Anlagen arbeiten seitdem zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten.
Quelle: http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1311/wl13_06.pdf
Autor:
Andreas Melcher
Süd-Chemie AG
Industriegruppe Kommunale Abwasserbehandlung
(nach oben)
Süd-Chemie: Schluss mit alten Zöpfen!
Zweite Generation der elektrokinetischen Desintegrationsanlage erfolgreich getestet Das elektrokinetische Desintegrationsverfahren ist ein kostengünstiges und bewährtes Verfahren zur Desintegration von Schlämmen zur Erhöhung der Biogasausbeute. Bisher stellte die teilweise notwendige Aufbereitung des Schlammes durch eine Vorzerkleinerung (Mazerator) einen erheblichen Nachteil dar. Bauartbedingt konnten faserige und verzopfungsfördernde Stoffe ohne diese Vorzerkleinerung nicht behandelt werden. Diese Vorzerkleinerung erhöhte damit neben den Investitionskosten auch die Betriebskosten (Strom, Wartung und Verschleiß) der elektrokinetischen Desintegration. Hier hat die Süd-Chemie AG ihr bewährtes System der elektrokinetischen Desintegration nun weiterentwickelt. Neben der nicht mehr benötigten Vorzerkleinerung wurde auch das elektrische Feld deutlich verstärkt, von bisher 100 KV auf nunmehr 200 KV. Des Weiteren liegt nun ein lineares elektrisches Feld vor, welches gegenüber dem radial anliegenden Feld in der 1. Generation eine deutliche Erhöhung der Desintegrationsleistung mit sich bringt. Unabhängig von der Lage des Schlammpartikels in der Desintegrationseinheit befindet sich dies stets in einem gleich starken elektrischen Feld. Durch zwei um 180 Grad gedrehte Felderzeuger setzt man den Schlamm durch die Fließgeschwindigkeit zudem einem sehr langsamen „Wechselfeld“ aus.
Vorteile:
• Verstopfungsfrei
• Keine verfahrensbedingte
Vorzerkleinerung notwendig
• Reduktion des Stromverbrauchs
• Geringere Anzahl von
Desintegrationseinheiten
pro m³ Schlamm
Autor:
Andreas Zacherl
Süd-Chemie AG
Quelle: http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1311/wl13_05.pdf
(nach oben)
Frachtermittlung im Kanalnetz
Mit Hilfe modernster Messtechnik besteht heutzutage die Möglichkeit, Online-Frachtbestimmungen nicht erst im Kläranlagenzulauf, sondern bereits an verschiedensten Punkten im Kanalnetz vorzunehmen. Am Beispiel einer Messung beim „Gäubodenfest“ in Straubing sollen Möglichkeiten, Anforderungen und Lösungen für eine solche Frachtmessung aufgezeigt werden.
Die Schmutzfracht erst im Zulauf der Kläranlage zu ermitteln reicht heutzutage oftmals nicht mehr aus. Für eine moderne Kanalnetzbewirtschaftung kann die Belastung aus einzelnen Kanalsträngen bis hin zur Indirekteinleiterüberwachung von großem Interesse sein. Aber auch an Regenentlastungen spielt die abgeschlagene Schmutzfracht bzw. Stoffkonzentration eine immer größer werdende Rolle. Um den gesteigerten Anforderungen im Hinblick auf Genauigkeit, zeitlicher Auflösung und auch EX-Sicherheit gerecht werden zu können, bedarf es für solch anspruchsvolle Aufgaben modernster Messtechnik. Im nachfolgend beschriebenen Anwendungsfall kam für die Durchflussmessung ein Gerät vom Typ OCM Pro CF der Firma NIVUS, welches nach dem Prinzip der Ultraschall- Kreuzkorrelation arbeitet, zum Einsatz. Für die Ermittlung der Stoffkonzentration wurde eine optische Spektrometersonde vom Typ spectro::lyser, der Firma s::can verwendet. Aus dem Produkt der Stoffkonzentrationen einzelner Parameter multipliziert mit dem Durchfluss lässt sich mit diesem System die Schmutzfracht hochaufgelöst und ohne zeitliche Verzögerung angeben. Rahmenbedingungen einer Frachtmessung im Kanal Mit der genannten Messtechnik stehen Messgeräte zur Verfügung, welche die gesteigerten Anforderungen für eine Frachtermittlung in vollem Umfang erfüllen. Aber nicht nur die geeignete Messtechnik, sondern auch die Auswahl eines geeigneten Messplatzes, die sachgerechte Installation und die individuell angepasste Wartung der Messungen sind wesentliche Kriterien für das Erzielen aussagekräftiger Messergebnisse. Bei der Auswahl des Messplatzes sind Kriterien wie z.B. eine gute Zugänglichkeit zur Vergleichsbeprobung, Wartung, evtl. Sensorreinigung u.ä. zu beachten. Aber auch die Bereitstellung einer Spannungsversorgung mit 230 V ist unumgänglich, da die Spektrometermessung aktuell nicht über Akkuversorgung betrieben werden kann. Im Hinblick auf die Installation der Messtechnik muss sichergestellt werden, dass der Messspalt der Analysesonde immer komplett vom Medium überdeckt ist. Lediglich bei einer Ereignismessung an einer Abschlagskante ist die Überdeckung nur im Ereignisfall erforderlich. Des Weiteren ist in unmittelbarer Nähe zum Messspalt die Vergleichsbeprobung per Probenehmer oder durch manuelle Schöpfproben zu gewährleisten. Von Vorteil wäre auch ein kontinuierlicher Abfluss an der Messstelle. Sitzt die Analysesonde im Rückstau oder in einer Pumpenvorlage, ist mit einer Vergleichmäßigung der Stofftransporte zu rechnen. Die Abflussmessung wird möglichst auch in einem kontinuierlich durchflossenen Kanal eingebaut. Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten wird die Sensorik der Q-Messung abgestimmt. Die erforderlichen Wartungsintervalle richten sich individuell nach den Bedingungen an der jeweiligen Messstelle. Ausschlaggebend ist die Abwasserzusammensetzung. Umstände wie z.B. stark fetthaltige Abwässer oder ein hoher Anteil an verzopfungsfähigem Material können den Wartungsaufwand deutlich erhöhen. Entsprechend müssen individuelle Maßnahmen ergriffen werden. Je sorgfältiger diese aufgelisteten Kriterien im Vorfeld berücksichtigt werden, desto reibungsloser….mehr:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1311/wl13_08.pdf
Fazit
——————————————–
Idealerweise erfolgt eine solche Frachtermittlung im
Kanalnetz in Zusammenarbeit zwischen dem örtlichen
Kanalbetreiber, der die lokale Einleitersituation bestens
kennt, und evtl. einem Dienstleister, der die entsprechende
Messtechnik und Erfahrung im Hinblick auf Messkampagnen
mitbringt.
Autor:
Bernd Hoffmann
Projektleiter – Abteilung Stadthydrologische Messungen
NIVUS GmbH
Tel. +49 (0)7262 9191-826
bernd.hoffmann@nivus.com
www.nivus.com
(nach oben)
Süd-Chemie:Wo d_r Woi _neilauft … (Wo der Wein hineinläuft …)
Durch den Wechsel von einem reinen Eisenprodukt auf das Aluminium- Eisen-Mischprodukt SÜDFLOCK®-K2 konnte die entgleiste Biologie der Kläranlage Haldenbach wieder auf die richtige Bahn gebracht werden. Schwimmschlamm auf der Belebung und geringe Sichttiefen im Nachklärbecken gehören seither der Vergangenheit an. Die Gemeinde Kernen im Remstal entstand durch die badenwürttembergische Gebietsreform im Jahr 1975 durch Zusammenfassung der Gemeinden Stetten und Rommelshausen. Bereits seit dem 14. Jahrhundert wird im Gemeindebereich nachweislich Weinanbau betrieben. Aufgrund der hügeligen Lage wird das Abwasser der Gemeinde derzeit auf die drei Kläranlagen Beibach, Krättenbach und Haldenbach verteilt. Die zum Ortsteil Stetten gehörende Kläranlage Haldenbach wurde im Jahr 1964 errichtet und im Jahr 1983 großzügig erweitert. Seither wurde die Belüftung von Oberflächenbelüftung auf Plattenbelüftung umgerüstet und eine Fällmitteldosieranlage errichtet. Bei einer Ausbaugröße von 12.000 EW ist die Anlage mit ca. 10.000 EW gut ausgelastet und hält ihre geforderten Ablaufwerte ein. Trotzdem kämpfte man dort schon seit Jahren mit Schwimmschlamm auf der Belebung und stabilen, schwimmenden Schlamminseln auf dem Nachklärbecken. Bei starker hydraulischer Belastung kam es hier auch regelmäßig zu dramatischen Abnahmen der Sichttiefe bis in einen Bereich von unter 60 cm. Ein ungünstiges C:N:P-Verhältnis begünstigt Fadenbildner Eine mikroskopische Untersuchung des Rücklaufschlammes wies zunächst eine Fädigkeitskategorie von Stufe 4 auf. Verantwortlich hierfür war die Ansammlung diverser fadenbildender Bakterien im Belebtschlamm. Dominant traten hier vor allem Fäden auf, die unter dem Sammelbegriff „Nostocoida-limicola-ähnliche“ zusammengefasst werden. Diese sind ein Indikator für ein ungünstiges C:N:P-Verhältnis in Kombination mit leicht abbaubaren Substraten, wie sie vor allem in der Nahrungsmittelindustrie zu finden sind. Meist finden sie sich auf Kläranlagen mit angeschlossenen Brauereien, Likörverarbeitern oder Schnapsbrennereien, wie sie auch hier in Stetten anzutreffen sind. Weiterhin fanden sich untergeordnet nocardioforme Actinomyceten. Sie besitzen ein breites Nahrungsverwertungsspektrum, bevorzugen allerdings Fette im Abwasser. Dies deutet auf einen erhöhten Fettgehalt im Abwasser sowie ein relativ hohes Schlammalter hin. Durch seine unangenehme Eigenschaft, sich oberflächlich zu hydrophobieren und somit in der Belüftungsphase aufzuschwimmen, reichern sich die nocardioformen Actinomyceten vor allem an der Oberfläche des Belebungsbeckens an und bilden eine Schwimmschlammschicht, in der sie sich vermehren können. Auch diese wies eine Fädigkeitskategorie von Stufe 4 auf. Eine Aluminiumanreicherung bringt den schnellen Erfolg Vor dem Fällmittelwechsel befand sich ein reines Eisenprodukt im Einsatz. Trotz permanenten Überschussschlammabzugs konnte aufgrund des hohen Schlammindex und des relativ kleinen Schlammstapelbehälters die Trockensubstanz in der Belebung kaum unter 6 g/l gebracht werden. Durch den Einsatz von SÜDFLOCK® K2 änderten sich die Verhältnisse jedoch maßgeblich. Eine Stoßbehandlung mittels Aluminiumanreicherung auf ca. 1 g Aluminium je kg Trockensubstanz über einen begrenzten Zeitraum von ein bis zwei Schlammaltern bekämpfte effektiv die fadenbildenden Bakterien. Durch diesen Gehalt an Aluminium kann das Wachstum der Fadenbildner entscheidend gehemmt werden. Innerhalb weniger Wochen sank der spezifische Schlammindex von 110 auf 90 ml/g, während sich die Entwässerbarkeit des Überschussschlamms deutlich verbesserte. Parallel dazu konnte die Trockensubstanz durch vermehrten Schlammabzug in der Belebung auf Werte unter 4 g/l gesenkt werden, was sich durch Erhöhung der Schlammbelastung wiederum positiv auf die Biozönose und die flockenbildenden Bakterien in der Belebung auswirkte. Nach dieser Stoßbehandlung konnte die erhöhte Fällmitteldosierung von ca. 200 l/Tag auf ca. 140 l/Tag zurückgeregelt werden. Freie Sicht bis in die Tiefe Bereits nach 3-4 Wochen sind sowohl die Schwimmschlammschicht auf der Belebung als auch die schwimmenden Inseln auf der Nachklärung Geschichte. Eine abschließende Belebtschlammuntersuchung zeigt eine deutlich kompaktere, kleine Flocke mit wenigen Vernetzungen. Die Fädigkeitskategorie liegt mittlerweile zwischen Stufe 2 und 3. Während nocardioforme Actinomyceten immer noch häufig – allerdings nicht mehr dominant – vorkommen, sind Nostocoida-limicolaähnliche Fäden praktisch kaum mehr auszumachen. Der vor der Stoßbehandlung nur untergeordnet vorkommende Typ 0041/0675 liegt mittlerweile dominant vor. Dieser hat jedoch deutlich bessere Sedimentationseigenschaften und bereitet im Betrieb keine Probleme. Seither läuft die Anlage stabil mit einer nie dagewesenen Sichttiefe im Nachklärbecken. Auch das veränderte Nahrungsangebot im Zuge der Weinlese und die mehrfache Schneeschmelze des Winters zeigten keine negative Auswirkung auf den Anlagenbetrieb. Der Gesamtphosphatgehalt im Ablauf der Kläranlage liegt zuverlässig konstant unter 0,5 mg/l.
Quelle:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1311/wl13_titel.pdf
Autor:
Tobias Kahr
Süd-Chemie AG
Industriegruppe Kommunale Abwasserbehandlung
D-85368 Moosburg
(nach oben)
Aquen: Flockenbehandlung im Klärprozess, der Schlüssel zur Effizienssteigerung in der Entwässerung um bis zu 30%
Einleitung: Das Klärschlammaufkommen aus den ca. 10.000 kommunalen und gewerblichen Kläranlagen in Deutschland beträgt ca.2,5-3 Mioto pro Jahr. Der Klärschlamm besteht aus Trockenmasse (TS) und Wasser. Eine beeindruckende Menge die da jährlich zu entsorgen ist, alternativ entweder auf landwirtschaftlich genutzten Flächen oder durch Verbrennung. Nach dem Ende der Deponierung verliert nun aber auch die Freiflächenaufbringung an Grundlage, bleibt also mittelfristig nur noch die (kostentreibende) Verbrennung in Anlagen (Mono- oder Mitverbrennung). Eine Firma im Harz (aquen aqua-engineering GmbH, eine Ausgründung des Institutes CUTEC / TU Clausthal) hat ein patentrechtlich geschütztes Verfahren zur Produktionsreife entwickelt. Dieses Verfahren/dieses Aggregat entzieht dem Klärschlamm zusätzlich Wasser und reduziert damit die Klärschlammabgabemenge der Kläranlagen um mehr als 20%. Die Trenngüte ist besser, das Wasser ist am Entstehungsort leichter entsorgbar. In Summe ein betriebswirtschaftlich ökonomischer wie gesellschaftlich ökologischer Nutzen. Das Verfahren / der Nutzen: Voraussetzung für eine hohe Trennleistung bei Schlämmen ist die Konzentration und das möglichst vollständige Zusammenfügen der abzutrennenden Inhaltsstoffe in mechanisch belastbare und somit gut ausfiltrierbare Flockenstrukturen. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf das Einbinden von Feinstpartikeln mit in die Flockenstruktur gelegt, sie sollen mit gebunden werden und nicht im Wasser abgehen. Tenor: „Das Restwasser muss klar sein.“ Konventionelle Konditionierungstechnik ist nicht in der Lage, dieser Anforderung zu genügen, auch wenn es oft versprochen wird. Durch den Einsatz des Zwischengliedes ´FlocFormer´ können die bestimmenden Faktoren der Konditionierung gezielt gesteuert werden. Mit dem neuartigen zweistufigen Flockungsverfahren besteht nun die Möglichkeit, die Teilprozesse ´Flockenentstehung´ und ´Flockenausprägung ´ separat zu beeinflussen und für den nachfolgenden Trennschritt zu optimieren. Der Flockungsreaktor im Prozess, die Technik Der Flockungsvorgang wird in einem kompakten, zweistufigen Reaktor (Bild 1) durchgeführt. Bild 1: Prozessbild FlocFormer Zunächst wird in einem Turbo-Mischer das Flockungshilfsmittel (hier: Polymer) homogen unter turbulenten Bedingungen in das Medium eingebracht. Es findet eine Totalflockung statt. Anschließend werden die zu diesem Zeitpunkt großvolumigen und Copyright: aquen aqua-engineering GmbH www.aquen.de Lange Straße 53 D-38685 Langelsheim Tel.+49 (0) 5326-929770 scherinstabilen Flocken in einem Flockenformungsreaktor gezielt erodiert, kompaktiert und für die Separation optimiert ausgeprägt. Als Flockenformungsreaktor dient ein modifizierter Kegelrührer (Bild 2). Ein innerer Kegel rotiert koaxial in einer äußeren Kegelschale. Die Strömungsverhältnisse im Kegelspalt sind nicht konstant, sondern ändern sich mit der axialen Position im Kegel. An der Kegelbasis treten aufgrund des größeren Durchmessers höhere Umfangsgeschwindigkeiten auf als in der Nähe der Kegelspitze. Der Betriebspunkt des Rührers kann durch Änderungen der Rotationsgeschwindigkeit und der Spaltweite bewusst beispielsweise an höhere Volumenströme oder Massenströme angepasst werden. Ein optimiertes Strömungsregime wird somit sichergestellt. Durch das Abrollen der Flocken auf den Flächen der Kegel werden lokale, ungleichmäßige, äußere mechanische Kräfte auf die Flocken aufgebracht, die somit verdichtet werden. Die Endprodukte der zweistufigen Konditionierung sind Flockenpellets. Diese Pellets lassen sich sehr gut entwässern oder separieren. Optional kann ein Flockungssensor zur Charakterisierung der Flockenstruktur eingesetzt werden. Der photooptische Sensor berechnet aus einer Flockengrößenverteilung spezifische Parameter, die Rückschlüsse auf die Separationseigenschaften des geflockten Mediums ermöglichen. Die Ergebnisse Aufgrund dieser neuartigen, gezielt zweistufigen Konditionierung, wird die Abtrennleistung auf den filtrierenden Maschinen (Bandfilter, Trommelsiebe, Kammerfilterpressen, Schneckenpressen, Zentrifugen etc.) signifikant erhöht. Durch die bereitgestellte kompakte Flockenstruktur findet die Filtration sehr viel schneller statt, und durch die robuste Struktur der Flocken kann während der Filtration oder des Pressens lange Zeit aus dem Filterkuchen Hohlraumwasser abgegeben werden. Als zusätzlicher Effekt ist eine Reduzierung der eingesetzten Polymermenge möglich, da im vorgestellten Konditionierungsreaktor das Polymer besser mit dem Medium vermengt wird, in Kontakt gebracht wird. Ganz gleich welchen Ausgangswert die heutige Trennstufe leistet, mit dem FlocFormer wird eine bessere Trennleistung und eine höhere stoffliche Trenngüte erzielt. Das Ergebnis: Abhängig vom Anwendungsfall ist eine Erhöhung der Separationsleistung bzw. Entwässerungsleistung zwischen 10 bis 30 % und eine Reduzierung der Polymermenge um bis zu 25 % erreichbar. Die neuartige Konditionierungstechnik hat sich bis heute in mehr als 40 Betriebsversuchen bewährt. Der Schwerpunkt der bisherigen Anwendungen lag in der Abwassertechnik. Im kommunalen Klärschlammbereich konnten die Entwässerungsleistungen von Kammerfilterpressen, Trommelsieben, Schnecken-pressen, Bandfilterpressen, Bucherpressen und Dekantern verbessert werden. Neben der Erhöhung der Entwässerungsleistung kann im Regelfall der Polymerverbrauch signifikant reduziert werden. Einsatzmöglichkeiten Weitere Anwendungen sind überall dort denkbar, wo durch Polymere geflockt wird. Mehr:
http://www.aquen.de/downloads/de/Pressemitteilung_aquen_FlocFormer_082010.pdf
(nach oben)
Aquen: Ein neues Verfahren zur optischen Erfassung und Bewertung von Flockungseigenschaften in Klärprozessen (Prozess- und Laboranwendung)
Die Ausgangssituation: Ein System zur online-Bewertung von geflockten Partikelsystemen (Flocken) stand in der hier vorgestellten Technologie und Messschärfe bislang nicht zur Verfügung. Eine Überwachung und Steuerung zur Optimierung von Entwässerungsprozessen war daher nicht bzw. nur schwer realisierbar. Andererseits kann aber die Entwässerbarkeit eines geflockten Systems qualitativ nur anhand des Flockenbildes bewertet werden. Zur Beurteilung der Flockengüte sind hauptsächlich interessant: – Die Flockengrößenverteilung und deren zeitliche Änderung – Die Scherstabilität der Flocken Die Flockengüte (Flockenausprägung) wirkt auf: – Die Effektivität (Menge und Qualität) von Flockungshilfsmitteln (Einfluss auf die Flockenbildung) – Die Entwässerbarkeit der konditionierten Schlämme (Erhöhung der Trockensubstanz TS und der Entwässerungsgeschwindigkeit) – Die Trennqualität der nachgeschalteten Entwässerungsstufe (zur Minimierung der Restschwebstoffe im Trennwasser) Das Ergebnis: Mit Kenntnis der Flockengüte im Prozess ist eine höhere Entwässerungsleistung bei reduziertem Polymereinsatz sicher möglich. Der Entwässerungsprozess In der Abwasserbehandlung sind polymer-initiierte Eindick- und Entwässerungsprozesse seit langer Zeit ein zentraler Bestandteil der Verfahrensführung. In jüngerer Zeit werden Flockungsprozesse auch zunehmend in anderen Bereichen genutzt, um aus einem Medium bestimmte Inhaltsstoffe abtrennen zu können, so zum Beispiel in der Papierindustrie. Geschichtlich bedingt lag das bisherige Augenmerk primär auf den Separationsmaschinen selbst. Im Regelfall wenig Beachtung fand jedoch die Erzeugung der optimalen Flocke für den Separationsprozess. Mit dem neuen Augenmerk auf eine Optimierung der Trennstufe als letzten Prozessschritt hat sich das nun gravierend geändert. Damit rückt die Flockenbildung als ein zentraler Prozessbestandteil in das Blickfeld. Eine optimale und reproduzierbare Flockenstruktur ist aber ohne messtechnische Erfassung nur sehr schwer realisierbar. Der Flockungssensor Der photooptische Flockungssensor ist ein online-Messgerät, das zur Größen- und Strukturcharakterisierung von dispergierten und nichtdispergierten Fest-stoffsystemen dient. Der Sensor arbeitet in situ, er kann sowohl direkt in eine bestehende Förderleitung bzw. Förderung eingebaut als auch im Bypass betrieben werden. Der Flockungssensor arbeitet als Reflexionsmessgerät, wobei die Messfläche durch ein Auflichtverfahren beleuchtet wird. Das zu untersuchende Gut wird durch ein Sichtfenster aufgenommen und analysiert. Eine CCD-Zeilenkamera misst aufrecht und quer zur Strömungsrichtung das Partikelsystem. Der Messbereich erstreckt sich von 50 μm bis 2,9 cm. Die Auswertung ist eindimensional und sehnen-längenorientiert, daher robust und wenig störanfällig. Die Berechnung von spezifischen Merkmalen basiert auf Sehnenlängenanzahldichte und -summenverteilungen. Diese werden durch das Messsystem sehr schnell in hoher Zahl berechnet, so dass außerordentlich zeitnah statistisch abgesicherte Partikel- bzw. Strukturmerkmale vorliegen. Aus den Rohdaten des Sensors werden in einer nachgeschalteten Recheneinheit die relevanten Prozessgrößen berechnet und optisch dargestellt. Normierte Werte können an Steuerungs- und Regelungssysteme übergeben werden. Für den Leser ist es sicher hilfreich ein Beispiel zu betrachten. Schlecht entwässerbare Gut entwässerbare Flockung: Flockung: – hohe Anzahl an Kleinstflocken – Gute Flockenpellettierung – Restwasser trüb – Restwasser klar Die zugehörigen Messkurven, aufgenommen mit dem Flockensensor: Die linke Grafik zeigt die hohe Anzahl von Kleinstflocken und Schwebstoffen (Peak bei sehr kleinen Flockenlängen), die rechte eine gut erkennbar „grobe“ Pelettierung der Flocken, Voraussetzung für leicht entwässerbaren Klärschlamm. Die Software der Bildauswertung ist modular und skalierbar aufgebaut, so dass die Auswertungsroutinen an verschiedenste Stoffsysteme angepasst werden können. Die errechneten Werte sind prozessspezifisch und können für den speziellen Anwendungsfall kalibriert werden. Neben einer Messwerterfassung, z.B. zur Qualitätskontrolle der Flockung…Mehr:
http://www.aquen.de/downloads/de/Pressemitteilung_aquen_FlocSens_022011.pdf
Pressemitteilung
Copyright: aquen aqua-engineering GmbH www.aquen.de
Lange Straße 53
D-38685 Langelsheim
Tel.+49 (0) 5326-929770
(nach oben)
E+H: Grenzwertüberwachung von TOC/TC in Produktionsabwässern der Chemieindustrie
Kundennahe Endress+Hauser Entwicklung des TOCII CA72TOC
Die Fachabteilung Prozessanalysentechnik
der ALISECA GmbH, einem Unternehmen
der LANXESS Gruppe mit Sitz im Chempark
Leverkusen, ist verantwortlich für die Online-
Analytik in Lanxess-Produktionsbetrieben.
Zur Überwachung von Prozessabwässern aus
den Produktionsanlagen, die in der Kläranlage
des Chemparks Leverkusen behandelt werden,
werden vorwiegend TC/TOC (NPOC)-
Geräte eingesetzt, um unzulässige Abgaben
von organischen Schadstoffen zum Schutz der
Kläranlage zu erkennen.
Eine weitere Messaufgabe ist die Überwachung
der Oberflächenwässer, welche direkt
in den Rhein eingeleitet werden.
Diese Messaufgaben stellen unterschiedliche
Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik.
Dabei stehen die Messwertverfügbarkeit,
Betriebssicherheit sowie Wartungs- und
Betriebskosten im Fokus.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden,
hat Endress+Hauser in Zusammenarbeit
mit der Fachabteilung Prozessanalysentechnik
der ALISECA GmbH das Gerät TOCII
CA72TOC entwickelt.
Aufgabenstellung
Um die Eignung des Gerätes TOCII
CA72TOC im rauen Betriebsalltag zu bestätigen,
wurde eine komplexe Messstelle ausgewählt:
der Ablauf eines LANXESS eigenen
Produktionsbetriebes.
Diese anspruchsvolle Messstelle hat folgende
Eigenschaften:
• Schwankende pH-Werte von 1.0 – 13.0
• Hohe Salzfrachten
• Hoher Feststoffanteil
• Starke Schwankungen der TOCKonzentrationen
• Substanzen, welche Weichmacher
aus Kunststoffen lösen
• Korrosive Umgebungsluft
am Aufstellungsort
Unter diesen schwierigen Bedingungen lassen
sich TOC-Analysatoren normalerweise nur
mit einem sehr hohen Wartungsaufwand
und den damit verbundenen hohen Kosten
betreiben.
Ziel ist es, mit dem Analysator TOCII
CA72TOC ein Gerät zur Verfügung zu stellen,
welches ein hohes Maß an Verfügbarkeit
und Betriebssicherheit bietet und gleichzeitig
den Wartungsaufwand und die Betriebskosten
signifikant reduziert. Durch einen modularen
Aufbau werden auch einfachere Applikationen
(z.B. Oberflächenwasser- oder Kühlwasserüberwachung)
kostengünstig gelöst.
Endress+Hauser hat diese Herausforderung
angenommen und gelöst!
Die Kundenanforderungen
Hohes Maß an Verfügbarkeit und Betriebssicherheit
bei geringem Wartungsaufwand
und minimalen Betriebskosten
Lösung
Im sechsmonatigem Dauerbetrieb hat der Analysator seine Eignung für
industrielle Anwendungen an der beschriebenen Messstelle bestätigt.
Hohe Verfügbarkeit
Die eingesetzten Materialien wurden auf ihre chemische Beständigkeit
optimiert, um möglichst lange Standzeiten zu erreichen (z.B. Probenaufbereitung
und medienberührende Geräteteile).
Der optimale Umgang mit hohen Salzfrachten wurde mit einer beheizbaren
Salzfalle und einem leicht wechselbaren Verbrennungsofen
gelöst. Diese Maßnahmen und kurze Kalibrierintervalle konnten die
Verfügbarkeit auf > 95% erhöhen.
Hohe Betriebssicherheit
Geräteinterne Überwachungseinrichtungen sorgen für maximale
Transparenz und damit Betriebssicherheit. Dazu gehören:
1. pH-Wert gesteuerte Entfernung des anorganischen Kohlenstoffs,
um zusätzlichen Salzeintrag vermeiden
2. Überwachung der Probenströme und des Gasdurchflusses innerhalb
des Gerätes (Verschmutzungserkennung)
3. Überwachung der CO2-Basislinie/ Nullwertes, um Drifteffekte
zu kompensieren
4. Zuschaltung einer Prüflösung (z.B. ausgelöst von der Messwarte),
um schnell Informationen über die Empfindlichkeit des Analysators
zu bekommen („Prüfpeak“)
Verringerter Wartungsaufwand und Kosten
Ein übersichtlicher Aufbau und eine gute Zugänglichkeit der zu
wartenden Baugruppen sorgen für hohe Akzeptanz bei den Gerätebetreibern.
Weiterhin erleichtern ein klarstrukturierter Verfahrensaufbau
und die menügestützte Wartungsführung die durchzuführenden
Tätigkeiten.
Durch Vereinheitlichung der Bauteile werden Lager- und Instandhaltungskosten
gesenkt.
Eignung für unterschiedlichste Applikationen
Ausgehend vom Grundgerät, können je nach Applikation verschiedene
Module (Wechselofenaufbereitung; Vorverdünnungseinheit; TC oder
TOC (NPOC)-Version, spezielle Materialen oder auch das Messverfahren
wie z.B. Batch-Betrieb oder kontinuierlicher Betrieb) ausgewählt
werden. So gut wie nötig, so kostengünstig wie möglich.
Während der Entwicklung des TOCII CA72TOC wurden fünf Patente
angemeldet.
http://endress.softwerk.de/eh/sc/europe/dach/de/resourceadditional.nsf/imgref/Download_u20_CS064C.pdf/$FILE/u20_CS064C.pdf
(nach oben)
E+H: Prosonic S FDU90
Füllstandmessung in der Polymerstation mit Ultraschall-Füllstandsensor
In Kläranlagen fallen bei den unterschiedlichen Reinigungsvorgängen
des Abwassers jährlich riesige Mengen
Klärschlamm an. Da dieser kostenpflichtig über eine
Deponie oder Verbrennung entsorgt werden muss, wird
versucht, einen möglichst trockenen Restschlamm zu erzeugen.
Damit das Abfallprodukt das Klärwerk mit einem hohen Trockengehalt
verlässt, wird eine Polymerlösung als Flockungshilfsmittel
zugegeben.
Durch den Einsatz einer Ansetz- und Dosieranlage kann die
Schlammentwässerung optimiert und eine hohe Entwässerungsrate
erzielt werden. Durch eine hohe Entwässerungsrate reduzieren
sich somit entsprechend die Schlammentsorgungskosten.
Zuverlässige Füllstandmessung in der Polymerstation
Anwendung Polymerstation
In der Polymerstation wird Polymer zur Herstellung von Flockungsmittel mit Wasser
vermischt. Das Flüssigpolymer wird als Konzentrat angeliefert und muss vor der eigentlichen
Dosierung in den Klärschlammstrom mit Wasser aufbereitet werden. Die wässrige
Lösung wird unter Rühren auf die erforderliche Gebrauchskonzentration verdünnt. Das
Flockungsmittel wird dann dem überschüssigen Schlamm zum Wasserentzug zugeführt.
Durch die Entwässerung des Schlamms steigt der Feststoffgehalt und ermöglicht die
Reduzierung des Volumens bzw. der Masse des zu entsorgenden Klärschlamms.
Lösung Prosonic S
Für eine optimale Produktion wird der Füllstand in der 1,3 m hohen Polymerstation mit
Rührwerk kontinuierlich gemessen.
Auswertegerät FMU90 mit Anzeige und sechs Relais zur Steuerung der Pumpen
Sensor FDU90 mit mit frontseitigem G 1-1/2″ Gewinde für eine optimale Prozessadaption
••Vorteile mit Prosonic S
Messbereich bis zu drei Meter in Flüssigkeiten
Frontbündige Montage mit G1-1/2″ Gewinde oder direkte Deckenmontage mit
G1″ Gewinde bzw. Laschen ohne zusätzlich notwendiges Zubehör
Niedrige Bauhöhe und geringe Blockdistanz von 7 cm ermöglichen den Einsatz in
beengten Einbauverhältnissen
Optionale Überflutungshülse, die die Sensormembran vor Verschmutzungen schützt
und eine sichere Auswertung von Überflutungsereignissen in Verbindung mit dem
Auswertegerät Prosonic S FMU90 ermöglicht„Mit dem Sensor Prosonic S FDU90 haben wir die optimale
Lösung zur Füllstandmessung in der Polymerstation gefunden.
Die bisher eingesetzte Drucksonde musste aufgrund
von Ansatzbildung monatlich gereinigt werden. Der FDU90
eignet sich bestens für Füllstandmessungen mit kleinen
Messbereichen und schnellen Füllstandänderungen. Durch die
geringe Blockdistanz von 7 cm kann sehr nahe an den Sensor
gemessen werden.“
http://endress.softwerk.de/eh/sc/europe/dach/de/resourceadditional.nsf/imgref/Download_u20_CS00095Fde.pdf/$FILE/u20_CS00095Fde.pdf
(nach oben)
VTA: Probleme mit Microthrix
Nanofloc überzeugt auf 80.000-EW-Anlage in Brandenburg
Wasser ist in der Uckermark allgegenwärtig. Deutschlands flächenmäßig größter Landkreis im Nordosten von Brandenburg ist übersät mit fast 600 Seen, die ihre Entstehung dem Zurückweichen der Eismassen nach der letzten Eiszeit verdanken.
An einem der größten dieser Gewässer, dem Unteruckersee, liegt Prenzlau. Das 1997 modernisierte Klärwerk der Kreisstadt ist auf 80.000 EW ausgebaut und aktuell mit rund 55.000 EW belastet. Hier werden die Abwässer aus Prenzlau und einigen benachbarten Dörfern behandelt, ebenso der Inhalt vieler Senkgruben aus dem Umland, denn die Uckermark ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands.
Erhöhte Fettmenge im Zulauf
Von besonderer Bedeutung für den Anlagenbetrieb sind aber die beiden größten Indirekteinleiter, ein Milchwerk und ein Eiswerk. Eine Umstellung in der Produktion dieser Betriebe – weniger Speiseeis, dafür mehr Butter – war es wohl auch, die die acht Klärwerksmitarbeiter im Vorjahr vor neue Herausforderungen stellte. Dazu kam, dass durch den Verschleiß von Belüftungskerzen in der Belebung eine gleichmäßige Sauerstoffverteilung nicht mehr gewährleistet war. Beide Faktoren zusammen begünstigten offensichtlich das Wachstum von Fadenbakterien, der Schlammindex stieg an.
Dieser ungünstigen Entwicklung mochte der stellvertretende Anlagenleiter Klaus Willecke nicht tatenlos zusehen – in weiser Voraussicht nahmen die Stadtwerke Prenzlau Kontakt mit VTA auf. „Wir hatten im ,Laubfrosch‘ schon viel darüber gelesen, wie effizient VTA-Produkte wirken und wie gut Service und Beratung sind“, so Willecke, der für Prozessanalyse und Abwasseroptimierung zuständig ist.
Gefahr von Schlammabtrieb
Der Weitblick erwies sich als goldrichtig, denn ab Jahresbeginn 2010 spitzte sich die Lage zu: Die Fadenbakterien (durch mikroskopische Analysen von VTA-Biologinnen als Microthrix parvicella identifiziert) breiteten sich in der Biologie der Prenzlauer Anlage zusehends aus; das Schlammvolumen legte derart zu (Index teils über 180 ml/g), dass der Schlamm zeitweise in die Nachklärung austrieb. Die Gefahr von Schlammabtrieb wuchs bedrohlich an.
Zu diesem Zeitpunkt hatte VTA die Problemlage aber längst gründlich analysiert und stand mit der richtigen Lösung Gewehr bei Fuß: Nanofloc sollte die hydraulische Stabilität der Anlage wieder herstellen.
Hydraulische Stabilität erreicht
Das Systemprodukt auf Nanotechnologie-Basis überzeugte mit ebenso schneller wie nachhaltiger Wirkung: „Der Schlammindex ging seit Dosierbeginn kontinuierlich nach unten, die Sichttiefe erhöhte sich rasch“, bestätigt Klaus Willecke: „Das ,Zeug‘ wirkt tatsächlich so, wie immer wieder beschrieben wird!“ Dies belegen auch Willeckes´ äußerst detaillierte Auswertungen, die er regelmäßig vornimmt, darunter jede Woche eine Tiefenanalyse, die alle relevanten Daten vollständig erfasst. Durch diese umfangreiche Analytik wurde Nanofloc während der gesamten Einsatzdauer „auf Herz und Nieren“ geprüft, und es hat den Test mit Bravour bestanden: „So gut hatten wir´s schon lange nicht mehr“, erklärt der stellvertretende Anlagenleiter.
Die genaue Auswertung ist für ihn übrigens keine Fleißaufgabe, sondern unerlässlich: „Es ist wichtig zu wissen, wie die eigene Anlage läuft. Das erlaubt es, rechtzeitig zu reagieren und nicht erst, wenn das Kind schon im Brunnen ist.“ Das sei im Sinne des Umweltschutzes und des Steuerzahlers wichtig.
Für alle Fälle: Nanofloc auf Vorrat
Derzeit ist der Anlagenbetrieb stabil, eine Dosierung von Nanofloc ist im Moment nicht notwendig. Das kann sich aber durchaus wieder ändern: Zum einen hat das Milchwerk noch freie Produktionsreserven, die es bei Bedarf ausschöpfen kann, zum anderen planen die Stadtwerke, eine der beiden Belebungsstraßen vorübergehend außer Betrieb zu nehmen, um die Belüftungskerzen zu wechseln. Daher hat das Klärwerk Prenzlau ständig eine gewisse Menge an VTA-Nanofloc vorrätig, um für alle Fälle gerüstet zu sein.
Mehr:
http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=91
(nach oben)
Wandeln auf Rasierklinge
Interview: Prof. Harald Kainz über neue Messverfahren in der Abwassertechnik
Herr Professor Kainz, an Ihrem Institut an der TU Graz werden laufend die neuesten Messgeräte für abwassertechnische Fragestellungen untersucht. Welche Innovationen sind hier besonders Erfolg versprechend?
Was hydraulische Messungen betrifft, geht es derzeit vorrangig um die Weiterentwicklung von Radarmessgeräten zur Bestimmung der Abflussmenge anhand von Wasserspiegel und Oberflächengeschwindigkeit. Bei den Qualitätsparametern verspricht die UV/VIS-Spektroskopie sehr viel. Wir haben gemeinsam mit der Wiener Universität für Bodenkultur und der TU Wien eine Messstation für den kontinuierlichen Praxiseinsatz an Fließgewässern, im Kanal und auf Kläranlagen entwickelt, die inzwischen marktreif ist.
Was kann dieses Gerät?
Es sendet alle drei Minuten einen „Blitz“ aus UV-Licht und sichtbarem Licht aus und misst anschließend das Reflexionsspektrum. Dessen Zusammensetzung gibt Aufschluss über zahlreiche Parameter, z. B. Nitrat, Feststoffe und CSB-Äquivalent. Der große Vorteil ist, dass sich das Gerät mitten im Gewässer oder Abwasser befindet und durch die Messung im Minutenabstand einen kontinuierlichen Gang der Messwerte liefert. Das ist wichtig, weil sich Verunreinigungen im Abwasser rasch ändern können.
Wie genau sind diese kontinuierlichen Messungen?
Die Abweichungen gegenüber Labormessungen liegen bei 10 bis 15 Prozent. Der große Vorteil ist nicht die Genauigkeit, sondern die hohe zeitliche Auflösung, die eine sehr gute Kalibration mathematischer Modelle erlaubt. Insbesondere können kurzfristige Schwankungen erfasst werden, die bisher nicht verifizierbar waren. Das liefert dem Kanalisations- und Kläranlagenbetreiber deutlich mehr Know-how über das eigene System.
Die Wartung dieser Messstation kann teilweise mittels Fernbedienung über den Computer erfolgen, also vom Schreibtisch aus. Eine derartige Messstation ist seit acht Jahren im Grazer Kanalnetz im Einsatz. In Wien wurde ein derartiges System ebenfalls über Jahre betrieben. Aktuell wird mit der Universität für Bodenkultur und der TU Wien ein Forschungsgebiet in Baden bei Wien mit derartigen Messstationen für Rohabwasser, Kläranlagenablauf und Oberflächengewässer ausgestattet.
Ein solches Messsystem eignet sich auch für spezielle Fragestellungen. So kann etwa eine Online-Chlorid-Sonde für die Messung von Straßenabwässern im Winter relevant sein. Die neue Qualitätszielverordnung Oberflächengewässer ist bei schwachen Vorflutern im Winter bei Salzstreuung schwer einzuhalten. Dies gilt besonders für Vorfluter von Autobahnen.
Der Online-Messtechnik gehört also die Zukunft?
Wir verfügen heute über das Instrumentarium, um viele prozessrelevante Parameter zur Optimierung des Anlagenbetriebs zu erfassen und online darauf zu reagieren. So entfallen das Entnehmen von Proben und deren Übermittlung zur Untersuchung im Labor, was beides ja hohen Aufwand bedeutet. Zusätzlich entfällt die Fehlergefahr bei der Probenahme. Online-Systeme, auch mit mehreren Sonden, sind reif für die Praxis, zuverlässig und mit vernünftigen Wartungs- und Kalibrierungsintervallen zu betreiben. Zur Optimierung des Betriebs von Kläranlagen haben wir in der Steiermark Ammonium- und Nitrat-Sonden installiert, um die Stickstoffelimination und die Ablaufwerte zu optimieren.
Das ist ja nicht zuletzt auch eine wirtschaftliche Frage.
Richtig, es geht nicht nur um bessere Ablaufwerte, sondern auch um Einsparungen bei den Betriebskosten. Stabile Online-Systeme erlauben nicht nur eine Steuerung, sondern auch eine Regelung. Das heißt, dass innerhalb eines bestimmten Bereichs kein „händisches“ Eingreifen mehr nötig bzw. möglich ist. Aktuell arbeiten wir zusammen mit VTA an einem quantitativen Verfahren zur optimalen Dosierung von Flockungshilfsmitteln bei der Schlammvorentwässerung.
Muss das Kläranlagenpersonal da nicht fürchten, eines Tages überflüssig zu werden?
Im Gegenteil, Mastermind bleibt der Betriebsleiter! Technik kann ihn nur unterstützen, aber niemals ersetzen. Die Erfahrung zeigt: Je höherwertiger die Mess- und Regeltechnik, umso wichtiger ist hochqualifiziertes Betriebspersonal. Je mehr Informationen verfügbar sind, umso wichtiger ist es, diese richtig zu interpretieren. Wir werden also in zehn Jahren noch höher qualifizierte Mitarbeiter auf den Kläranlagen brauchen als heute. Auch auf mittelgroßen Kläranlagen wird es bald Diplomingenieure geben. Der Bedarf an Fortbildung ist groß. Dabei leistet VTA enorme Unterstützung.
Noch mehr Technik, noch besser qualifizierte Mitarbeiter – ist das wirtschaftlich überhaupt machbar?
Der hohe Qualitätsstandard in der Abwasserreinigung hat auch ein Umdenken bei den Entscheidungsträgern, also in der Politik, ausgelöst. Kläranlagen sind heute herzeigbare Hightech-Betriebe und nach dem Straßenbau die größte Investition einer Gemeinde. Bei Kosten zwischen 30 und 40 Millionen Euro für die Kläranlage einer durchschnittlichen Bezirkshauptstadt und einer Abschreibungsdauer von 25 Jahren ergibt sich eine Abschreibung von mindestens einer Million Euro pro Jahr. Fehler, die im Abwasserbereich gemacht werden, verringern die Nutzungsdauer der Anlage und kosten viel Geld. Dabei ist der tägliche Anlagenbetrieb oft ein Wandeln auf einer Rasierklinge: Einhaltung der Emissionswerte bei wirtschaftlichem Betrieb. Hohe Mitarbeiterqualifikation und Prozessoptimierung sind entscheidend, um Kosten und Energie zu sparen. Bei den betrieblichen Prioritäten kommen diese Einsparungen freilich erst an dritter Stelle: Ganz vorn stehen stabile Abwasserreinigung und sichere Schlammentsorgung. Das bleiben die obersten Aufgaben einer Kläranlage, und das sollte man vor lauter Sparen nicht vergessen.
INFOBOX:
Vizerektor an der TU Graz
Univ.-Prof. DDipl.-Ing. Dr. techn. Dr. h. c. Harald Kainz ist Vizerektor der TU Graz – jener Universität, an der 1977 seine akademische Laufbahn begann (Studium Bauingenieur- sowie Wirtschaftsingenieurwesen). Als Geschäftsführer der Umwelttechnik Wien GmbH war er für internationale Großprojekte im Bereich Abwasser- und Abfallwirtschaft (z. B. Hauptkläranlage Wien) verantwortlich. Im Jahr 2000 wurde Kainz als Universitätsprofessor an das Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftswasserbau der TU Graz zurückberufen. 2004 bis 2007 war er Dekan der Fakultät für Bauingenieurwissenschaften.
http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=101
(nach oben)
Desintegration tipptopp
Schlammfaulung: VTA-GSD-Anlage wird in der Schweiz Bestergebnis bescheinigt
Ganz hervorragend fällt die Leistungsbilanz einer Desintegrationsanlage von VTA im ersten Betriebsjahr auf einem Schweizer Klärwerk aus. Zu diesem Schluss kommt ein unabhängiges Ingenieurbüro in seiner Beurteilung. Demnach wurden dank der VTA-GSD bislang um 24 % mehr Gas bzw. Strom produziert. Außerdem reduzierte sich die Schlammmenge, die entsorgt werden muss, um 15 %. Die von VTA abgegebenen Garantiewerte wurden damit nicht nur eingehalten, sondern zum Teil sogar übertroffen.
Störungsfrei seit dem ersten Tag
Mitte 2009 beauftragte der Gemeindeverband ARA Moossee-Urtenenbach aus Hindelbank (nahe Bern) das renommierte Ingenieurbüro „BG Ingenieure & Berater AG“ aus Bern, eine Klärschlamm-Desintegration auszuschreiben. Mit einem schlüssigen Konzept, glaubwürdigen Garantiewerten und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis konnte sich VTA gegenüber den Mitbewerbern durchsetzen.
Dank der reibungslosen Zusammenarbeit aller Beteiligten war eine VTA-GSD-5 sehr einfach und schnell in den Kläranlagenbetrieb integriert und konnte schon Anfang Februar 2010 starten. Seither läuft sie ohne Unterbrechung störungsfrei – 24 Stunden am Tag.
Der gesamte Überschussschlamm wird direkt vom Vorlagebehälter abgezogen und im Durchlaufbetrieb durch den Desintegrationsreaktor befördert. Nach der Ultraschall-Behandlung kommt der Schlamm in den Vorlagebehälter zurück und wird gemeinsam mit dem unbehandelten Primärschlamm in die Faulung gepumpt. Um Kurzschlussströme zu verhindern, wurde der Vorlagebehälter durch eine Holzbohlenwand räumlich abgetrennt.
Garantiewerte übertroffen
In der Ausschreibung wurde ein Evaluierungszeitraum von mindestens einem halben Jahr definiert. Das begleitende Ingenieurbüro sollte also nach sechs Betriebsmonaten der VTA-GSD prüfen, ob sie die Garantiewerte erreicht. Da die ARA Moossee-Urtenenbach über hervorragendes Datenmaterial verfügt, war der direkte Vergleich spezifischer Parameter (z. B. Gasanfall pro Kilogramm in die Faulung zugeführter Organik, produzierte Kilowattstunde Strom) möglich.
Der spezifische Gasanfall betrug in den vergangenen Jahren ohne Desintegration im Mittel 326 l/kg oTRzu. VTA garantierte in der Ausschreibung eine 20-prozentige Steigerung (391 l/kg oTRzu).
Nach acht Betriebsmonaten lag der Gasertrag schließlich bei 400 l/kg oTRzu, das entspricht einer Mehrausbeute von 24 % – der Garantiewert wurde also deutlich übertroffen. Somit erhöhte sich auch die Stromproduktion von 1700 auf 2100 kWh pro Tag.
Was die Menge des zu entsorgenden Schlamms betrifft, empfiehlt sich naturgemäß, über ein gesamtes Jahr zu bilanzieren. In der ARA Moossee-Urtenenbach zeigt allerdings schon ein Vergleich von zehn Monaten, dass durch die Desintegration eine deutliche Verringerung erzielt wird: Von Jänner bis Oktober 2009 fielen rund 6820 Kubikmeter Schlamm zur Entsorgung an. Im gleichen Zeitraum 2010, also mit VTA-GSD, waren es 5780 Kubikmeter – das entspricht einer Reduktion von beachtlichen 15 %.
INFOBOX:
VTA-GSD: „Sie läuft und läuft und läuft“
Beat Oberer, Betriebsleiter der ARA Moossee-Urtenenbach, über seine Erfahrungen mit der Ultraschall-Desintegration von VTA.
Herr Oberer, wie kamen Sie auf das Desintegrationsverfahren von VTA?
Diverse Fachzeitschriften wie der „Laubfrosch“ oder die „gwa“ weckten unser Interesse an dieser Technologie. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war schlussendlich ein sehr positiv verlaufener Langzeitversuch mit der VTA-Desintegration in einer benachbarten Abwasserreinigungsanlage.
Wie beurteilen Sie Abwicklung bzw. Umsetzung des Projektes?
Ich bin sehr zufrieden! Alle Beteiligten, angefangen vom Ingenieurbüro über das VTA-Technologie-Team bis hin zur ARA-Betriebsmannschaft, haben von Anfang an sehr professionell und unkompliziert zusammengearbeitet. Sämtliche Arbeitsschritte wurden gut geplant, die Anlage wurde problemlos und termingerecht installiert.
Entspricht die bislang erbrachte Leistung der VTA-Anlage Ihren Erwartungen?
Ja! Man muss sich nur die Auswertung ansehen. Die Garantiewerte, die VTA abgegeben hat, wurden übertroffen. Da kann man mehr als zufrieden sein.
Wie wirkt sich der Einsatz der VTA-GSD-5 in der Kläranlage aus – sowohl verfahrenstechnisch als auch wirtschaftlich?
Durch die Ultraschallbehandlung wird die Struktur des Überschussschlamms verändert, das wirkt sich auch bei seiner weiteren Behandlung aus. Die Viskosität des Schlammes ist geringer, dadurch ist er deutlich leichter zu pumpen. Der Wärmeübertrag vom Wasser-Schlamm-Wärmetauscher ist besser, und durch den Zellaufschluss wird der Schlamm in der Faulung besser abgebaut. Das wirkt sich sehr positiv bei der Gasproduktion und der Schlammentsorgung aus. Daraus lässt sich ein direkter Kostenvorteil ableiten.
Hatten Sie zusätzlichen Arbeitsaufwand durch den Betrieb der VTA-Anlage?
Nein, seit der Inbetriebnahme ist kein zusätzlicher Arbeitsaufwand für das Kläranlagenpersonal angefallen. Die Anlage läuft und läuft und läuft.
Ihr vorläufiges Gesamturteil betreffend VTA-Ultraschalldesintegration?
Sehr gut!
Quelle:
http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=108
(nach oben)
Kreisläufe haben Zukunft
Abwasserentsorgung: Prof. Max Dohmann plädiert für Strategien mit Nachhaltigkeit
Herr Professor Dohmann, wie sehen die größten Aufgaben in der Abwasserentsorgung in den nächsten Jahren aus?
Ging es bei der Abwasserentsorgung bis vor einigen Jahren fast ausschließlich um den Gewässerschutz, so spielen zunehmend Aspekte der Ressourcennutzung, der Gesundheitsvorsorge sowie der Anpassung an demografische und klimatische Veränderungen eine Rolle. Natürlich wird es dabei auch in Zukunft um technologische Innovationen gehen. Von Bedeutung erscheint mir, welche politische Relevanz der Abwasserfrage zugemessen wird. Und nicht zuletzt stellt sich die ökonomische Frage: Was ist leistbar?
Welche technologischen Entwicklungen sind besonders zukunftsträchtig?
Große revolutionäre Sprünge, was die Technologie betrifft, sind für mich nicht zu erkennen. Klar ist, dass die Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, und dieser Trend wird sich verstärken. Nachhaltiges wird sich durchsetzen. Entscheidend wird das Denken in Kreisläufen…
…was ja genau die Firmenphilosophie von VTA ist…
Ja, und es ist ganz allgemein ein umfassender Prozess. Man muss die Stoffkreisläufe beachten. Früher ging es in der Abwasserwirtschaft ja bloß darum, etwas loszuwerden. Das hat sich massiv geändert. Nehmen Sie nur das Thema Phosphorrecycling aus Abwasser. Da sind die Kosten zwar heute noch drei bis vier Mal so hoch wie bei der Gewinnung aus Rohphosphat, aber das wird nicht so bleiben. Das deutsche Forschungsministerium fährt dazu seit vier Jahren ein großes Programm, bei dem ich das Gutachtergremium leite.
Wird in Zukunft mehr oder weniger Abwasser anfallen?
Wir werden aus Umweltgründen, aber auch aus ökonomischen Gründen dazu kommen, weniger Wasser zu verbrauchen. Das heißt, das anfallende Schmutzwasser wird konzentrierter. Das betrifft natürlich auch die Spurenstoffe im Abwasser, besser gesagt deren Elimination. Speziell dazu sehe ich für die Ozonierung gewisse Perspektiven, während die Membrantechnik in diesem Bereich aus Kostengründen zumindest in Europa weniger Bedeutung haben wird. In China wird dagegen auch weiterhin in Membrantechnik investiert.
Wird Abwasser in den nächsten Jahren schon in den Haushalten getrennt werden?
Die Trennung der häuslichen Schmutzwässer – also Faeces, Urin, Grauwasser und Regenwasser – ist technologisch machbar und erscheint aus dem Blickfeld der Kreislaufwirtschaft sinnvoll. Die zukünftige Bedeutung einer Stoffstromtrennung wird aber nicht nur durch die vorteilhaften Aspekte der stofflichen Nutzung, sondern auch durch die ökonomischen Bedingungen bestimmt. In Gebieten mit vorhandener zentraler Abwasserinfrastruktur, wie beispielsweise in Mitteleuropa, sind deshalb der häuslichen Schmutzwassertrennung enge Grenzen gesetzt.
Welchen Stellenwert wird das Thema Energie in der Abwasserentsorgung von morgen haben?
Das Thema Energie behält weiterhin einen besonderen Stellenwert. Zum einen betrifft dies die Minimierung des Energieverbrauchs auf Kläranlagen, vor allem durch den Einsatz der Steuer- und Regelungstechnik. Der zweite große Bereich ist die energetische Nutzung des Abwassers. Dabei geht es um die Nutzung der hydrostatischen Energie bei entsprechenden Höhenunterschieden im Entsorgungssystem, über die thermische Energie, die vor allem durch das Warmwasser ins Abwasser verlagert wird, bis hin zur Nutzung der chemischen Energie des Abwassers, die jährlich 175 kWh je Einwohner beträgt. Eine völlige Energieautarkie auf Kläranlagen ist aber nicht zu gewährleisten, außer durch den Einsatz externer Substrate im Rahmen einer Co-Fermentation.
VTA ist ja Spezialist für die Optimierung von Kläranlagen. Wie schätzen Sie die Bedeutung dieses Bereichs ein?
Bei einer solchen Optimierung spielen bekanntlich sowohl verfahrenstechnische, steuer- und regelungstechnische als auch personelle Maßnahmen eine Rolle. In Europa werden sich die Optimierungsbemühungen auch künftig fortsetzen, während in anderen Teilen der Welt dem Kläranlagenbetrieb bisher keine entsprechende Rolle zukommt. In China zum Beispiel ist die Betrachtung von Jahreskosten noch nicht angekommen, da stehen nur Investitionen im Blickpunkt. Eine angemessene Ausbildung des Anlagenpersonals gibt es dort noch nicht.
Wie sehen Sie die Zukunft der Abwasserentsorgung angesichts der Tatsache, dass in den öffentlichen Etats der Sparstift regiert?
Es ist zu beklagen, dass die Abwasserentsorgung seit langem keine besondere Aufmerksamkeit in Politik, Medien und Öffentlichkeit erhält. Dazu erscheint mir zunächst wichtig, ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass die zur Abwasserentsorgung gehörende Infrastruktur nur eine begrenzte Nutzungsdauer hat und die Erneuerung von Anlagenteilen immer wieder hohe Kosten verursacht. Es wird darauf ankommen, attraktive und innovative Entwicklungen der Abwassertechnik noch deutlicher in den Medien zu artikulieren.
Eine Möglichkeit dazu bieten die Fragen der Stadtentwässerung. In Deutschland wird seit Jahren auch die Grundstücksentwässerung als elementarer Teil der Abwasserinfrastruktur außerhalb der öffentlichen Zuständigkeit betrachtet. Den 550.000 km öffentlichen Abwasserkanälen stehen weit mehr als 1.000.000 km Leitungen der Grundstücksentwässerung gegenüber. In der Fachwelt ist unbestritten, dass mehr als zwei Drittel dieser Leitungen undicht und zumindest mittelfristig zu sanieren sind. Entscheidend für die Umsetzung solcher Maßnahmen wird die Akzeptanz seitens der betroffenen Bürger sein. Die Fachwelt bleibt also gefordert, die Bedeutung bzw. den Wert unserer Abwasserentsorgung noch wirkungsvoller nach außen zu vermitteln.
INFOBOX:
Berufung nach China
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Max Dohmann leitete von 1987 bis 2004 als Direktor das Institut für Siedlungswasserwirtschaft der Rheinisch-Westfaelischen Technischen Hochschule Aachen. Aufgrund seiner Fachkenntnis und seines Engagements für den Umweltschutz berief ihn die deutsche Bundesregierung in den Sachverständigenrat für Umweltfragen. Seit seiner Emeritierung ist Max Dohmann Vorstandsmitglied mehrerer Forschungsinstitute, u. a. des FIW in Aachen. Er lehrt an mehreren Universitäten in China und wurde im September 2010 als einer von sechs ausgewählten Wissenschaftlern an die Sichuan-Universität in Chengdu berufen, gemeinsam mit Forschern aus Japan, Großbritannien und den USA. Außerdem ist Dohmann wissenschaftlicher Leiter des Sino-German Research Center for Water Management (SiGeWa) in Chengdu.
http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=103http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=103
(nach oben)
Insituform: Sanieren wo andere Urlaub machen – Kanalsanierung in Innsbruck
Die Sanierung des Kanalnetzes in der historischen Innsbrucker Altstadt mit dem „Insituform-Verfahren“ ermöglichte es, knapp 1.750m Kanal DN 250-450 zu sanieren, ohne die Touristenströme aus aller Welt bei der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten Innsbrucks spürbar zu beeinträchtigen. Das Lösungswort hierfür: grabenlose Kanalsanierung. Bereits seit 2004 vertrauen die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) bei der Modernisierung ihres teilweise über 100 Jahre alten Kanalnetzes neben der klassischen Variante –Neuverlegung in offener Bauweise – auch auf die Sanierung mit innovativen Methoden der grabenlosen Kanalsanierung. Hierbei greifen die IKB immer häufiger auf die Linersanierung als wirtschaftliche Gesamtrenovierungsmaßnahme ganzer Kanalhaltungen zurück. Im Jahr 2008 stand nun, nach einer vorhergegangenen TV-Untersuchung und Zustandsbewertung, die Sanierung des Kanalnetzes im Altstadtbereich Innsbrucks an. Die Innsbrucker Altstadt ist mit ihren historischen Häusern aus dem 15. Jahrhundert ein wahres Schmuckstück, welches jährlich hunderttausende Touristen anzieht. Besonders beliebt ist das Wahrzeichen von Innsbruck, das „Goldene Dachl“: ein mit 2.657 feuervergoldeten Kupferschindeln gedeckter Prunkerker, der im Auftrag des Kaiser Maximilian I. an das bestehende Haus angebaut wurde. Zudem besteht die Altstadt aus einer Vielzahl kleiner Gässchen, die links und rechts von der Hauptstraße, der Herzog-Friedrich-Straße, abzweigen und teilweise nur zu Fuß zu erreichen sind. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte (und der ausreichend groß dimensionierten Kanäle) waren sich die Verantwortlichen bei der IKB, Dipl.-Ing. Bernhard Zit und dem zuständigen Ingenieurbüro INGUTIS, Dipl.-Ing. Andreas Beuntner schnell darüber einig, dass hier der Einsatz der grabenlosen Kanalsanierung aufgrund der geringen Beeinträchtigung von Anwohnern, Gewerbe und Tourismus ideal geeignet ist. Zumal sich dadurch auch noch ein großer Teil der Kosten gegenüber der Erneuerung der Kanäle in offener Bauweise einsparen ließ. Den Zuschlag für die Maßnahme und somit den Auftrag zur Sanierung der insgesamt ca. 1.750m Abwasserkanal DN 250-450 erhielt die Fa. Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH, Niederlassung München. Das Sanierungsprogramm stellte für die Spezialisten der Fa. Insituform, als Marktführer für grabenlose Kanalsanierung in Deutschland, keine besondere Problematik dar. Wohl aber waren bei diesem Projekt einige Randbedingungen zu beachten, die es von alltäglichen Baustellen abhoben. Spezielle Randbedingungen Dass der Sanierungsbereich innerhalb einer Fußgängerzone liegt, die ab 10:30 Uhr (von 06:00 Uhr bis 10:30 Uhr ist der Lieferverkehr zugelassen) nicht mehr von Fahrzeugen aller Art befahren werden darf, mag zunächst sehr positiv klingen. Die Realität sah aber leider anders aus: Die autofreien Flächen des spärlich vorhandenen Platzangebotes nach 10:30 Uhr waren innerhalb kürzester Zeit von den Ständen und Tischen der anliegenden Geschäfte und Gastwirtschaften blockiert. Und da dies, besonders in den Sommermonaten, eine wichtige Einnahmequelle darstellt, war ein großes Maß an Aufklärungs- und Abstimmungsarbeit notwendig, um die Einschränkungen sowohl für den Gaststätten- als auch für den Baubetrieb so gering als möglich zu halten. In Zusammenarbeit mit dem Obmann der Kaufleute und der Gaststätten sowie der Magistratsabteilung für Straßen- und Verkehrsrecht der Stadt Innsbruck wurde deshalb ein Bauablaufplan erstellt, der die Interessen aller Beteiligten berücksichtigte. Dieser sah auch mehrere Inversionen während der Nacht an den besonders sensiblen Stellen vor. Eine weitere besondere Randbedingung: die große Anzahl an einleitenden Betrieben.
http://www.insituform.de/uploads/tx_nxttcontentadditionalfields/Innsbruck_bi-UmweltBau_1-10_118-119.pdf
(nach oben)
ProMinent: Schlammreduzierung durch Ozon mit ProLySys
Wenig Schlamm = Geringe Kosten
Der Aufwand zur Entsorgung von Schlamm, der in Klärwerken anfällt wird, beträgt über 30 Prozent der gesamten Klärwerkskosten. Mit dem neuen, von ProMinent patentierten Verfahren Prolysys lässt sich die Desintegration von Überschussschlamm mit Ozon erheblich verbessern. Das Ergebnis ist eine deutliche Kosteneinsparung durch Reduzierung der zu entsorgenden Schlammmengen. Im Vergleich zu anderen Verfahren wird auch der Ozonverbrauch auf ein Minimum verringert.
Der Heidelberger Hersteller stellt das neue Verfahren auf der diesjährigen IFAT ENTSORGA in Halle A3 Stand 425/526 erstmals vor.
Bereits seit Jahren wird Ozon als chemisches Verfahren weltweit zur Reduzierung des Klärschlamms eingesetzt. Die Behandlung des Schlamms mit Ozon fördert die Lyse, sprich den Zerfall einer Zelle durch Schädigung oder Auflösung der äußeren Zellmembran. Diese Desintegration des Klärschlammes, bei der Schlammflocken zerstört und danach zelluläre Bestandteile freigesetzt werden, führt in der Abwasserreinigung zu einer stabilen Prozessführung. Die Erhöhung der Gasentwicklung bei der anaeroben Schlammstabilisierung kann genutzt und die biologische Abbaubarkeit verbessert werden. Beide Vorgänge tragen zur Reduzierung der Trockenmasse bei.
Bei den eingesetzten, herkömmlichen Verfahren wird das Ozon aus reinem Sauerstoff generiert. Dieses Verfahrens ist durch das Bereitstellen des reinen Sauerstoffs, durch sein Handling und den Transport der Sauerstoffflaschen sehr kostenintensiv.
Ozon aus Luft
Im Gegensatz dazu erzeugt das von ProMinent patentierte System Prolysys Ozon aus der Umgebungsluft. Hier wird der Sauerstoffanteil der Luft durch Corona-Entladung in Ozon umgewandelt. Durch das Verfahren des Heidelberger Herstellers werden das Handling mit reinem Sauerstoff, sowie die Lagerung der Sauerstoffflaschen vermieden.
Dank des speziellen hydraulischen Konzeptes mit patentierter Mehrfachdosierung (Mehrpunktdosierung) und Mikroblasen-Reaktor lässt sich die spezifische Ozondosierung reduzieren.
Es gibt weitere Vorteile, die auf Ozon-Effekte zurückzuführen sind, wie beispielsweise der Abbau störender Wasserinhaltsstoffe durch Oxidation. Gleichzeitig bleibt das Niveau der Bakterientätigkeit unverändert, so dass es für die nachfolgende biologische Oxydation verwendet werden kann.
Diese Synergieeffekte lassen sich mit herkömmlichen Verfahren nicht erzielen.
Das ProLySys System steht je nach Einsatzort – ob im Abwasserkreislauf, im Schlammkreislauf oder in beiden Kreisläufen verwendet – in vier Versionen für den direkten Einsatz im Prozess zur Verfügung.
Resumee
Das neue Verfahren von ProMinent führt durch Nutzung der Umgebungsluft und gezielter Dosierung zu einer Reduzierung anfallender Schlammmengen bei minimalem Ozonverbrauch. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren kann mit dem Prolysys- System die dazu notwendige Ozonmenge um rund 50% reduziert werden. Betriebskosten lassen sich dadurch einsparen – gleichzeitig wird das Lagern und Hantieren von reinem – hochexplosivem – Sauerstoff vermieden.
System ProLySys zur Behandlung von Überschussschlamm mit Ozon. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren kann mit dem Prolysys- System die dazu notwendige Ozonmenge um rund 50% reduziert werden.
Touch Panel des ProLySys zur einfache Bedienung und Überwachung
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
ProMinent Dosiertechnik GmbH, Michael Birmelin,
Im Schuhmachergewann 5-11, 69123 Heidelberg,
Tel. +49 6221 842-270, Fax +49 6221 842-432,
eMail: m.birmelin@prominent.de
Quelle: http://www.prominent.de/Portaldata/1/Resources/_transfer/2010/20100727_7983_100727_PI_Prolysys_Ozon_G.doc
(nach oben)
E+H: Automatisierungslösungen für die Wasser- und Abwasserwirtschaft
In der Informationsbroschüre „Mit System zum Erfolg“ erhalten Sie einen umfassenden Überblick über unsere Lösungen für die Wasser- und Abwasserwirtschaft. Gewässermonitoring, Trinkwasser-
aufbereitung, industrielle Abwasseraufbereitung und kommunale Abwasserbehandlung sind die Schwerpunkt-Themen dieser neuen Broschüre. Ergänzt werden diese Inhalte durch Informationen zur erhöhten Anlagenverfügbarkeit während des gesamten Lebenszyklus der Anlage sowie Serviceleistungen rund um die Automatisierungslösungen.
Die Broschüre finden Sie unter:
http://www.de.endress.com
(nach oben)
UAS Messtechnik: Ein Fall für Edelstahl
Geldmangel in Kommunen und Gemeinden kann heute immer öfter beobachtet werden. Dies könnte in Zukunft vermehrt dazu führen, dass anstatt kostspieliger Neubaumaßnahmen verfahrenstechnisch durchdachte Optimierungen an Kläranlagen vorgenommen werden. Denn mit wenigen Einbauten aus Edelstahl in bereits vorhandene Becken und dem Verlegen einiger neuer Leitungen lässt sich unter Umständen die Funktionalität ganzer Anlagenteile komplett umkrempeln. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Anfang des Jahres durchgeführte Umbau der Kläranlage Landshut. Dort wurde der vorhandene Schlammeindicker zum Terra-D-Becken umgebaut. Optional sollte es auch als Terra-N®-Becken genutzt werden können. In diesem von der SÜDCHEMIE AG entwickelten Verfahren wird mit einer Hochleistungsbiologie gearbeitet. Diese kann unter anderem das Ammonium in stark mit dieser Stickstoffverbindung belasteten Abwässern zu Nitrit oxidieren. Sie arbeitet ähnlich wie das Belebungsverfahren mit Belebungsbecken, Nachklärbecken und Schlammrückführung, nutzt dabei aber eine Biofilmtechnologie. Der Biofilm wächst auf sich frei im Becken bewegenden Teilchen aus Bentonit. Die Trägersubstanz wird durch die Belüftung in Schwebe gehalten. Anschließend soll dann im Terra-D-Becken das im bereits bestehenden Terra-N®-Becken erzeugte Nitrit mit Ammonium zu elementarem Stickstoff reagieren (siehe dazu Wasserlinse 10/2009: Turbo in der Abwassertechnik – Terra-N®- Verfahren nutzt Deammonifikation). Im Terra-D-Becken werden die Bentonitteilchen durch den Einsatz einer Mischeinrichtung am Absetzen gehindertDer Grund für den Einsatz dieses Verfahrens ist die Behandlung des anfallenden Zentratwassers im Teilstromverfahren. Das hoch mit Ammonium- Stickstoff belastete Prozesswasser wird also nicht unbehandelt in den Anlagenkreislauf zurückgeführt, sondern separat im Teilstrom behandelt und dann in die Hauptstrombiologie zurückgeführt. Dazu musste der Schlammeindicker in eine Art Belebungsbecken …mehr:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1110/wl11_05.pdf
Kontakt:
UAS Messtechnik GmbH
Verfahrenstechnik, Wasser-, Abwasserbehandlung
(nach oben)
Südchemie: Teilstrombehandlung auf dem Klärwerk Landshut
Von der Nitrifikation zur Deammonifikation mit dem Terra-N-Verfahren
Die Teilströme aus den Nacheindickern und der Schlammentwässerung werden
auf dem Klärwerk Landshut seit dem Jahr 1998 separat behandelt, um die Stickstoffbelastung
im Hauptstrom zu reduzieren. Die Teilstrombehandlung erfolgte
bisher durch das bentonitgestützte Terra-N-Verfahren. Dabei wird die NH4-
Fracht bis zum Nitrat bzw. Nitrit oxidiert. Nach einer Reihe von Versuchen konnte
nun eine Weiterentwicklung hin zu einer vollständigen Stickstoffelimination
über den Prozess der aeroben Deammonifikation erzielt werden. Die eigens
dafür konzipierte großtechnische Anlage nimmt derzeit (April 2010) ihren Betrieb
auf.
In den Jahren 1999 bis 2001 waren erste Aufälligkeiten hinsichtlich eines Wechsels von einer vollständigen Nitrifikation zur Nitrititation und umgekehrt im provisorischen Terra-NBecken bemerkt worden. Im Oktober 2001 wurde die neue großtechnische Terra-N-Anlage mit geplanter vollständiger Nitrifikation in…mehr:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1110/wl11_04.pdf
(nach oben)
Sera: Effektive Bekämpfung unangenehmer Gerüche
Im Zuge eines Projektes zur Neutralisation von Schwefelwasserstoff im Kanalnetz einer mittelgroßen Gemeinde, hat sera im September 2008 mehr als zehn innovative Dosieranlagen in Betrieb genommen.
In Zusammenarbeit mit einem international tätigen Wassertechnikunternehmen gelang es, eine wirkungsvolle Problemlösung zu entwickeln.
Eine nordrhein-westfälische Gemeinde mit rund 50.000 Einwohnern hatte buchstäblich die Nase voll. Die Belastung durch unangenehme Gerüche aus dem Kanalnetz, insbesondere in der Nähe der lokalen Kläranlage, entwickelte sich zu einem erheblichen Störfaktor.
Das problematische Element
Zahlreiche Abwasserkanal-Netze in Deutschland sind für deutlich höhere Volumina ausgelegt, als inzwischen tat-sächlich benötigt werden.
Geringer Wasserverbrauch und längere Verweilzeiten des Abwassers im Kanalnetz sind allerdings ein idealer Nährboden für die Entstehung von gasförmigem Schwefelwasserstoff – in den Kanalnetzen ebenso wie in Pumpwerken und Druckrohrleitungen. Denn aus schwefelhaltigen Abwasserinhaltstoffen entstehen durch chemische Reaktion hohe Sulfidkonzentrationen – und damit der gasförmige Schwefelwasserstoff.
Der „Gestank“ nach faulen Eiern ist bereits bei einer geringen Konzentration von unter 0,15 ppm wahrnehmbar. Zusammen mit der auftretenden Korrosion an der Bausubstanz sind diese „Nebenwirkungen“ zwar unangenehm aber noch nicht lebensbedrohlich. Ab 300 ppm
besteht allerdings akute Lebensgefahr.
Im Abwasser eliminierte Sulfide behindern zudem den Prozess der Abwasserbehandlung (Störungen der Biozönose),denn das erhöhte Vorkommen von Schwefelbakterien kann spezielle Fadenbakterien begünstigen und Betriebsprobleme (Flotation) verursachen.
Die besondere Herausforderung
Abhilfe gegen die negativen Auswirkungen von H2S kann mit mehreren Metallsalzlösungen geschaffen werden. Der Betreiber vor Ort entschied sich nach einigen Testmonaten für den Einsatz einer Eisen-II-Chlorid-Lösung – mit dem Wirkstoff FE 2+ und einem pH-Wert von 1.
Weil diese Chemikalie als wassergefährdender Stoff eingestuft wird, waren für den sicheren und sorgsamen Einsatz im bewohnten Gebiet besondere Maßnahmen notwendig.
Betreiber und Kommune legten besonderen Wert auf eine hochwertige und sichere Anlagentechnik, die auch extremen äußeren Einflüssen standhält.
Nebenbei sollte sich die Anlage „unsichtbar“ für die Anwohner in das Landschaftsbild einfügen. Auch dieser Herausforderung hat sich sera gestellt.
Das intelligente System
Die Dosieranlagen wurden komplett und anschlussfertig geliefert. Durch das bewährte sera-Plug & Dose-System waren sie nach kurzem Anbinden sofort einsatzbereit. Die Anlagen wurden in einen speziellen Outdoorschrank eingebracht, der sich unauffällig ins Landschaftsbild einfügt.
Die eingebaute Dosierpalette ist mit der neuesten Dosierpumpen-Generation von sera ausgerüstet und mit einer Tropfwanne sowie einer Leckagemeldung ausgestattet.
Eines der Hauptanliegen des Betreibers war die einfache Handhabung und Veränderung des Osterprogrammes. Neben der hochwertigen Motormembrandosierpumpe ist der integrierte Schaltschrank daher mit einer via Key programmierbaren Zeitschaltuhr versehen. Über die einfach zu bedienende Software und den Key, kann die neue Zeitsteuerung im Büro per Computer programmiert werden. Anschließend kann die Software über den Key vor Ort auf die Zeitschaltuhr übertragen werden.
Somit lassen sich die Anlagen optimal an veränderliches Abwasserverhalten anpassen, wodurch teure Chemikalien eingespart werden. Das Eisen-II-Chlorid wird im Pumpenschacht direkt unterhalb der Abwasservorlage durch ein Dosierventil eingegeben, so dass es direkt am Ort der H2S-Entstehung reagieren kann.
Gespeist werden die Anlagen aus im Boden vergrabenen Erdtanks mit 2m³ Volumen. Diese Menge deckt in etwa den Jahresbedarf. Die Erdtanks werden regelmäßig gewartet, sind somit vor Leckagen geschützt und sind mit befahrbaren Deckeln ausgestattet.
Über Schwefelwasserstoff:
Schwefelwasserstoff (H2S) ist ein Gas, das aus der Verbindung von einem Teil Wasserstoff und zwei Teilen Schwefel besteht. Bei der Zersetzung von Proteinen aus schwefelhaltigen Aminosäuren entstehen Fäulnis- und Schwefelbakterien, die den spezifischen strengen Geruch von Schwefelwasserstoff bewirken. Schwefelwasserstoff ist brennbar, stark giftig und kaum in Wasser löslich.
Quelle: http://www.sera-web.com/default.asp?ln=de&UID=4&PID=Q001/1001/1003
(nach oben)
VWS-Aquantis: Sedimentationsverfahren ermöglicht Wiederverwendung von biologisch behandeltem Abwasser
Andreas Probst, Jürgen Barthel, Michael Witt
Am Standort eines der größten Werke für Recyclingkarton in Europa werden Faltschachtelkarton für die Verpackungsindustrie und Gipskarton für die Baustoffindustrie hergestellt. Die jährliche Produktionskapazität beträgt 600 000 t, wobei ca. 3,5 m³ Abwassermenge pro Tonne hergestellten Karton anfielen, die nach einer intensiven Reinigung in das Gewässer eingeleitet wurden. Als Direkteinleiter verfügt die Kartonfabrik über eine vollbiologische Abwasserreinigungsanlage. Diese besteht aus einer anaeroben Vorreinigung nach dem UASB-Verfahren mit Biogasgewinnung und einer aeroben Nachbehandlungsanlage. Die Reinigungskapazität der Abwasseranlage liegt bei etwa 50 t CSB pro Tag. Weig-Karton betreibt in Mayen zwei moderne Kartonmaschinen: auf der KM 6 wird Recyclingkarton für die Gipsplattenindustrie sowie Testliner für die Wellpappenindustrie produziert; auf der KM 3 wird Recyclingkarton für die Faltschachtelindustrie hergestellt. Der Standort in Mayen nutzt den Fluss Nette, ein Gewässer zweiter Ordnung mit geringer Wasserführung, zur Wasserentnahme sowie zur Einleitung des biologisch vollgereinigten Abwassers. Da eine Erhöhung der Frischwasserentnahme aus der Nette aus behördlichen Gründen nicht möglich war, musste nach einem Weg gesucht werden, bei dem biologisch gereinigtes Abwasser so aufbereitet wird, dass es in den Wasserkreislauf der Stoffaufbereitungen der beiden Kartonmaschinen zurückgeführt werden kann. Zwei Kriterien bildeten die Voraussetzung für den Einsatz des gereinigten Abwassers…mehr:
http://www.vws-aquantis.com/lib/aquantis/Publikationen/14400,2009-11,WLB-Wasser-Luft-Boden,Acti.pdf
(nach oben)
Online-Messung von Schwefelwasserstoff im Abwasser
Sulfide stellen eine hoch problematische Stoffgruppe
in Abwassersystemen dar. Die Messung des Sulfidgehalts
in Echtzeit war bis vor kurzem nur unzureichend
oder aber gar nicht möglich. Im folgenden
wird eine Online-Spektrometersonde vorgestellt, mit
der Sulfidionen in der flüssigen Phase und daraus
resultierende Schwefelwasserstoffgehalte zuverlässig
bestimmt werden können. Korrosion von Kanälen, Geruchsbelastung
und Toxizität: Sulfide sind eine der Hauptursachen, die vielen
Betreibern von Kanalisationssystemen Kopfzerbrechen bereiten. Online-
und in-situ-Messungen sind ein wichtiges Werkzeug, um negative
Auswirkungen dieser Stoffgruppe unter Kontrolle zu haben. Dieser Beitrag
beschreibt ein spektrometrisches Verfahren …mehr:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1110/wl11_10.pdf
(nach oben)
VWS-Aquantis: Biogasgewinnung aus Brauereiabwasser
Anaerobe Vorbehandlung von Abwässern mit hohen CSB-Frachten
Brauereiabwasser eignet sich auf Grund seiner Zusammensetzung sehr gut für biologische Abwasserbehandlungsverfahren. Durch den Einsatz von anaerober Hochlasttechnologie, wie z. B. dem Biobed® Reaktor, werden 70 % bis 85 % der gesamten CSB-Fracht effi zient aus dem Abwasser entfernt und in energiereiches Biogas umgewandelt. Das erzeugte Biogas kann im Kessel der Brauerei zur Gewinnung thermischer Energie oder in einem separaten BHKW zur kombinierten Gewinnung von elektrischer und thermischer Energie genutzt werden. Die in diesem Artikel beschriebenen Anwendungsbeispiele für Biobed® Technologie aus Portugal, Lettland und den USA erreichen einen durchschnittlichen Abbau des gesamten CSB um 75 % bis 80 %.
Einleitung
Die anaerobe Behandlung von Brauereiabwasser ist ein bewährtes und energieeffi zientes Verfahren. Ein niedriger Energieverbrauch, kleine Reaktor Aufstellfl ächen, geringer Chemikalienverbauch und der Wegfall von Schlammbehandlungskosten sind Vorteile dieser Technik gegenüber aeroben Alternativen. Des Weiteren wird durch die anaerobe Abwasserbehandlung Biogas erzeugt, welches in der Brauerei als erneuerbare Energiequelle genutzt werden kann, um einen Teil der fossilen Energieträger zu ersetzen. In diesem Artikel werden drei Fallbeispiele von Brauereien aus verschiedenen Erdteilen beschrieben, die sich für anaerobe Hochleistungstechnologie als Abwasserbehandlungsverfahren entschieden haben.
Biologische Behandlung von Brauereiabwasser
In Brauereien fallen ca. 2–6 hl Abwasser pro hl produziertem Bier an. Der Chemische Sauerstoff bedarf (CSB) des Abwassers schwankt zwischen 2000 und 6000 mg/L mit einem BSB (Biochemischer Sauerstoff bedarf)/CSB Verhältnis von 0,5–0,7. Der CSB besteht überwiegend aus leicht abbaubaren organischen Verbindungen wie Zucker, Ethanol und löslicher Stärke. Auf Grund der guten biologischen Ab – baubarkeit sind biologische Verfahren…mehr
http://www.vws-aquantis.com/lib/aquantis/Publikationen/15432,2010-02,gwf-wasser_Abwasser,Artike.pdf
(nach oben)
Zuverlässige Überwachung der Hauptparameter in einer Kläranlage
Die Messwerte pH und Leitfähigkeit sind in einer Kläranlage wichtige Parameter für die nachfolgende biologische Abwasserbehandlung und müssen deshalb kontinuierlich erfasst und überwacht werden. Um sichere Messwerte zu erhalten, ist die richtige Wahl des Sensors und der Messmethode wichtig.
Abwasserbehandlung
Die Abwasserbehandlung geschieht in Kläranlagen. Dort werden neben mechanischen auch biologische und chemische Verfahren eingesetzt. In der Rechenanlage wird ein großer Teil der groben Stoffe abgefangen. Die aufgefangenen Stoffe nennt man Rechengut oder Siebgut. Im Sandfang sollen schwere Stoffe wie mitgeführte Sandpartikel absinken. Das Wasser fließt hier nur sehr langsam, damit diese Partikel zu Boden sinken können. Die letzte Station der mechanischen Reinigungsstufe sind die Vorklärbecken. Alle im Abwasser noch vorhandenen leichteren Stoffe, die im Sandfang nicht entfernt wurden, sinken hier auf den Boden des Beckens und bilden den sogenannten „Rohschlamm“. Während das vorgereinigte Wasser weiter zum Belebungsbecken geleitet wird, wird der Rohschlamm in die Faultürme befördert. Die biologische Reinigung von Abwasser findet in sogenannten Belebungsbecken statt. Bevor das Abwasser in diese Becken gelangt, wird es mit Belebtschlamm versetzt. Dieser beinhaltet eine Unzahl von Mikroorganismen, z. B. Bakterien, die in der Lage sind, die im Abwasser gelösten und fein zerteilten organischen Schmutzstoffe (Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphorverbindungen) abzubauen. In Nachklärbecken setzt sich der Belebtschlamm ab und wird im unteren Bereich gesammelt. Der gesammelte Schlamm wird abgezogen und gelangt zum Teil als Rücklaufschlamm zurück in das Belebungsbecken, der Rest wird als Überschussschlamm in die Faultürme befördert. Faulung ist die letzte Station der biologischen Reinigungsstufe. Im Faulturm wird der Schlamm stabilisiert. Unter Stabilisierung versteht man den weitestgehend anaeroben Abbau von organischen Verbindungen mithilfe spezieller Bakterien. Diese Bakterien wandeln die organischen Bestandteile des Faulschlamms in Biogas um. Die Messergebnisse der Hauptparameter werden vor Ort angezeigt und ins Prozessleitsystem übertragen. Für die Messung der relevanten Parameter werden Messumformer eingesetzt. Hier eignen sich besonders der JUMO AQUIS 500 pH und der induktive Leitfähigkeitsmessumformer CTI-500 mit entsprechenden Messeinrichtungen.
pH-Messung in den Kläranlagen
Der pH-Wert ist einer der wichtigsten Parameter für die Überwachung einer Kläranlage. Er wird elektrochemisch mit einer Glaselektrodenmesskette gemessen. Diese pH-Einstabmesskette besteht aus einer pH-sensitiven Glaselektrode und einer Referenzelektrode. Im Kläranlagenzulauf können Öle und Fette vorkommen. Hohe Salzfrachten nach Einsatz des Winterdienstes oder Schmutz und Biowachstum setzen insbesondere der Referenzelektrode einer pH-Einstabmesskette zu. Deshalb haben sich Elektroden mit offenem Ringspalt- oder PTFE-Ring-Diaphragma als Standard der Technik durchgesetzt. Die pH-Messung in der Kläranlage erfolgt mit JUMO tecLine pH-Elektroden mit Ringspalt- oder PTFE-Ring-Diaphragma in Kombination mit dem Messumformer/Regler JUMO AQUIS 500 pH.
Der JUMO AQUIS 500 pH stellt der Leitwarte des Klärwerks den aktuellen pH-Wert. Zusätzlich zur Messfunktion für diesen Wert besitzt das Gerät einen zweiten Messeingang für die Temperatur, welche dann zur Temperaturkompensation der Hauptparameter herangezogen wird. Sie kann mittels Pt100/Pt1000 erfasst und, wenn gewünscht, auch überwacht werden. Der Messumformer/Regler JUMO AQUIS 500 pH kann mit bis zu zwei galvanisch getrennten analogen Istwert-Ausgängen 0(4) … 20 mA bzw. 0(2) … 10 V bestückt werden. Diese Ausgänge sind auch als Reglerausgänge konfigurierbar.
Zwei weitere Ausgänge sind mit Umschaltrelais aufrüstbar. Diese Relais erlauben die einfache Grenzwertüberwachung der Kläranlage genauso wie die anspruchsvolle PID-Regelung. Die Ansteuerung von in der Analysenmesstechnik üblichen Steilgliedern (z. B. Ventilen, Magnet-Dosierpumpen) ist problemlos möglich. Dank der Klartextbedienung in Verbindung mit Grafikdisplays ist der Einsatz des Geräts nahezu ohne Betriebsanleitung möglich. Eine Klartextanzeige informiert das technische Personal bei Bedarf über den Zustand der angeschlossenen Elektroden. Der Messverstärker wird in Kläranlagen meist in der Nähe der Messstelle installiert. Deshalb ist ein Vor-Ort-Gehäuse mit entsprechender Schutzart (mindestens IP 67) sinnvoll.
Leitfähigkeitsmessung in den Kläranlagen
Neben dem pH-Wert ist die elektrolytische Leitfähigkeit die häufigste Messgröße in einer Kläranlage. Die Leitfähigkeitsmessung im Kläranlagenzulauf soll eine rechtzeitige Warnung ermöglichen, wenn größere Salzfrachten oder Säuren/Laugen versehentlich den Weg zur Kläranlage gefunden haben. Sie können das empfindliche Biosystem der Anlage behindern und eine Behandlung des Abwassers wäre nicht mehr möglich. Wie bei der pH-Messung können bei der herkömmlichen konduktiven elektrolytischen Leitfähigkeitsmessung durch Schmutzfrachten Messfehler oder Sensorausfälle auftreten. Hier spielt es keine Rolle, ob es sich um das konduktive Zwei- oder Vier-Elektroden-Messverfahren handelt. Idealerweise setzt man daher heute das induktive Messverfahren ein. Es erlaubt eine weitgehend wartungsfreie Erfassung der spezifischen Leitfähigkeit auch bei schwierigsten Mediumsverhältnissen. Im Gegensatz zum konduktiven Messverfahren treten Probleme wie Elektrodenzersetzung und Polarisation praktisch nicht auf. Der induktive Leitfähigkeitsmessumformer JUMO CTI-500 mit einem integrierten Temperatursensor ist besonders geeignet für den Einsatz in Kläranlagen.
Der JUMO CTI-500 ist ein induktiver Leitwert- und Temperaturmessumformer. Zwei integrierte Schaltausgänge können frei zur Grenzwertüberwachung von Leitfähigkeit/Konzentration und/oder Temperatur programmiert werden. Außerdem können Alarm- und Steuerungsaufgaben zugeordnet werden. Für den Einsatz in offenen Behältern oder Gerinnen stehen Eintauchversionen bis maximal 2000 mm Länge mm zur Verfügung. Das Gerät arbeitet praktisch wartungsfrei, es enthält keine Verschleißteile. Der Messumformer CTI-500 ist für den Einsatz vor Ort konzipiert. Ein robustes Gehäuse schützt die Elektronik und die elektrischen Anschlüsse vor aggressiven Umgebungseinflüssen (IP 67). Seine Bedienung erfolgt entweder über Folientastatur und Klartext-Grafikdisplay (Bediensprache umschaltbar) oder über ein komfortables PC-Setup-Programm.
Fazit
Der pH-Wert und die Leitfähigkeit sind in einer Kläranlage wichtige Parameter für die nachfolgende biologische Reinigung, sie müssen deshalb kontinuierlich erfasst und überwacht werden. Die Messergebnisse werden vor Ort angezeigt und ins Prozessleitsystem übertragen. Für den Einsatz in Kläranlagen bietet JUMO eine Vielzahl an Lösungen für die unterschiedlichsten Parameter.
JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda
Tel.: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-500
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net
(nach oben)
„Desi“ bringt faulen Schlamm auf Touren
Auf dem Klärwerk der Marktgemeinde Bruckmühl wurde im Dezember 2009
eine elektrokinetische Desintegration (kurz „Desi“ genannt) in Betrieb genommen.
Damit wird Überschussschlamm vorbehandelt, um den Wirkungsgrad der
anaeroben Stabilisation im Faulturm zu erhöhen. Die nun vorliegenden ersten
Betriebsergebnisse haben die Erwartungen mehr als erfüllt.
Das Klärwerk Bruckmühl ist eine mechanisch- biologische Kläranlage mit anaerober Schlammstabilisierung, Schlammentwässerung und anschließender Schlammtrocknung. Bisher wurde der anfallende Überschussschlamm aus der biologischen Stufe über ein Siebband mechanisch entwässert und zusammen mit dem Primärschlamm aus der Vorklärung über einen Voreindicker in die Faulbehälter gepumpt. Seit der Inbetriebnahme der elektrokinetischen Desintegration sind die beiden Schlammvolumenströme getrennt, der Primärschlamm aus der Vorklärung wird direkt in die Faulbehälter gepumpt, während der mechanisch eingedickte Überschussschlamm zur weiteren Behandlung in den Voreindicker gelangt. Aus dem Voreindicker wird der eingedickte Überschussschlamm mit einer Exzenterschneckenpumpe auf die Desintegrationseinheit gepumpt. Diese besteht aus drei hintereinandergeschalteten Aggregaten, von denen aus der Schlamm wieder zurück in den Voreindicker geführt wird. Dadurch ist eine mehrmalige Desintegrations- Behandlung des Schlamms gewährleistet, die den Aufschlussgrad nochmals erhöht. Ist das Füllstandsmaximum im Voreindicker erreicht, wird der elektrokinetisch desintegrierte Schlamm in den Faulbehälter gepumpt. Schon alleine der optische Eindruck des behandelten Schlamms hat sich deutlich verändert, aus der flockigen Struktur ist eine homogene Masse entstanden, ein Beweis dafür, dass Flockenverbände aufgebrochen werden. Ebenfalls hat sich der Geruch des Schlamms deutlich verändert, vom üblichen „Belebtschlammgeruch“ zu einer „stinkenden Brühe“, ebenfalls ein Zeichen dafür, dass Zellinhaltsstoffe aus der Zelle ausgetreten sind.
Quelle: http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1110/wl11_09.pdf
Autor:
Andreas Zacherl
SÜD-CHEMIE AG
D-85368 Moosburg
(nach oben)
Schachtsiebanlage RoK 4 heute weltweit bereits über 400 Mal im Einsatz
Pumpwerke bzw. Hebeanlagen können oftmals die Wirtschaftlichkeit eines Entwässerungssystems entscheidend verbessern, da diese verstreut liegende Zuflüsse sammeln und in eine zentrale Kläranlage fördern. Alternativ werden diese Anlagen dort eingesetzt, wo Abwasser auf ein höheres Niveau angehoben wird, damit es anschließend im Freispiegelabfluss weitergeleitet werden kann.
Jedoch führen die im Abwasser enthaltenen Feststoffe oftmals zu unerwünschten Nebenerscheinungen, wie z. B. Verstopfung der eingesetzten Förderaggregate und zur Verzopfung der zusätzlich vorhandenen Einbauten im Pumpenschacht. Aus diesem Grunde wurde von HUBER bereits vor vielen Jahren die bewährte und patentierte Schachtsiebanlage RoK 4 entwickelt, welche sich heute bereits über 400-fach im weltweiten Einsatz befindet. Diese Siebanlage schützt die vorhandenen Förderaggregate und garantiert somit einen störungsfreien Betrieb der entsprechenden Pumpwerke.
Für einen völlig neuartigen Einsatzfall dieser Schachtsiebanlage sorgte eine Anfrage des Ingenieurbüros Raunecker aus Burghausen, dem die Planung für einen Austausch des vorhandenen Kletterrechens auf der Kläranlage Reischach oblag. Dieser, über 20 Jahre alte Rechen, sollte nun kurzfristig gegen einen möglicherweise neuen Kletterrechen ausgetauscht werden. Als Randbedingungen waren eine Gerinnebreite von 500 mm, ein Spaltabstand von 6 mm sowie eine Zulaufmengenbegrenzung von 16 l/sec gegeben. Im Rahmen der Vorplanung wurden dem Ingenieurbüro Raunecker seitens HUBER verschiedene Vorschläge für den Einsatz von bewährten Zulaufrechen mit entsprechender Peripherie unterbreitet, welche für diesen Einsatzfall zweckdienlich erschienen. Die nachfolgende Funktionalausschreibung, in welcher der wesentliche Leistungsumfang beschrieben wurde, konnte nebst der konventionellen Lösung durch einen Alternativvorschlag erfüllt werden. Als Alternativlösung …mehr:
http://www.huber.de/de/huber-report/ablage-berichte/rechen-und-siebe/schachtsiebanlage-rok-4-heute-weltweit-bereits-ueber-400-mal-im-einsatz.html?popup=1
(nach oben)
Huber: Kompaktanlage Ro 5HD: Aus der Praxis, für die Praxis
ROTAMAT® Kompaktanlage mit Hydro-Duct Ro 5HD
Die vor 3 Jahren in den Markt eingeführte und mittlerweile patentierte ROTAMAT® Kompaktanlage Ro5 HD mit dem „Hydro-Duct“-System hält, was sie verspricht. Vorteile, welche dem Kundennutzen und somit direkt dem Betreiber dienen, wurden intelligent in diese Anlage gepackt.
Kompaktanlagen sind standardisierte Systeme zur mechanischen Abwasser-behandlung und vereinen Rechenanlage, Rechengutbehandlung, Sandfang, Sandklassierung und Fettfang in einer Anlage. Grundsätzlich werden diese konfektionierten Systeme in Werkstoff Edelstahl gefertigt und kommen vor allem in kleinen und mittleren Kläranlagen zunehmend zum Einsatz.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
• geringe Investitionskosten
• kleiner Footprint, d.h. geringe Aufstellungsfläche
• kein Einfluss der Witterung (Frost)
• keine Geruchsemissionen in die Atmosphäre
• geringe Kosten für Infrastrukturmaßnahmen
• keine zusätzliche Sandklassierung
• geringe Wartungs- und Instandhaltungskosten
Der Abwasserzulauf erfolgt generell immer 90° versetzt zum Sandfangsystem, um eine günstige Anströmung des Sandfanges zu ermöglichen. Als Rechen werden dabei generell die bewährten ROTAMAT®-Systeme eingesetzt. Die Behandlung des abgeschiedenen Rechengutes wird mit der 1000-fach erprobten integrierten Rechengutauswaschung (IRGA) durchgeführt. Nachfolgend wird das Rechengut im ROTAMAT®-System gepresst. Standardmäßig ist vor dem Rechen ein Notüberlauf integriert. Außerdem kann zu Wartungszwecken das gesamte Abwasser über eine Notumgehung komplett an der Anlage vorbeigeführt werden.
Installierte Ro 5HD: „Einfach eine saubere Sache“
Das nachfolgende „Hydro-Duct“-System ist eine Kombination aus einem belüfteten und einem unbelüfteten Sandfang und nützt alle Vorteile beider Sandfangtypen aus. Aufgrund des innovativen „Hydro-Duct“-Systems kann deshalb zur Erzielung einer effektiven Abscheideleistung …mehr:
http://www.huber.de/de/huber-report/nach-produkten/rechen-fein-und-feinstsiebe.html
(nach oben)
Passavant: Optimierungs-Ressourcen erschließen
Steuerung der Klärschlammentwässerung mit Filterpressen
Die Entwässerung von Klärschlamm zählt zu den kostenintensiven Verfahrensstufen
der Abwasserbehandlung und der erreichte Entwässerungsgrad
beeinflusst außerdem die Entsorgungskosten maßgeblich. Daraus resultiert
die Notwendigkeit einer verfahrenstechnisch optimalen Prozessführung
des jeweiligen Trennverfahrens. Dies gilt besonders für Kammerfilterpressen,
um deren Vorteile bezüglich Trennschärfe und Polymerverbrauch
auch wirtschaftlich auszunutzen.
Kammerfilterpressen sind diskontinuierliche
Druckfilter. Die Erzeugung der notwendigen
Druckdifferenz erfolgt über externe
Pumpen. Durch die anwachsende Kuchenschicht
muss dabei ein zunehmender hydraulischer
Widerstand überwunden werden.
Daraus resultiert ein Druckanstieg, der nur
bei relativ gut filtrierbaren Produkten dem
spontanen Selbstlauf, d. h. der ungeregelten
Pumpenkennlinie, überlassen werden kann.
Bei vielen Anwendungen ist es dagegen
erforderlich, den Druckanstieg im Prozessverlauf
nach einer Anfangsphase zu begrenzen,
vor allem bei Schlämmen, die
hoch kompressible Filterkuchen bilden, eine
Flockenstruktur mit begrenzter Festigkeit
aufweisen sowie eine breite, heterogene
Primär-Korngrößenverteilung zeigen. Typische Beispiele für derartige Stoffsysteme
sind polymerkonditionierte Klärschlämme.
Bei zu schnellem Druckanstieg lösen
sich Primärteilchen aus den Flocken und es
vollziehen sich innere Teilchenumlagerungen
in der abgelagerten Flockenschicht.
Das Ergebnis ist eine interne Porenverstopfung
und damit klebende und schlecht entwässerte
Filterkuchen.
Bei der Entwässerung polymerkonditionierter
Klärschlämme mit Kammerfilterpressen
ist somit eine Kompromisslösung zu
finden. Eine zu schnelle Beschickung der Filterpresse
führt zu unbefriedigenden Trennergebnissen
als Folge eines progressiven
Druckanstiegs. Eine zu langsame Befüllung
hingegen verlängert die Filtrationszeit und
begrenzt somit die Durchsatzkapazität. Unter
Beachtung dieser gegenläufigen Einflussfaktoren
steuern und überwachen moderne
Beschickungsrechner den Füllvorgang
von Filterpressen.
Anforderungen
Bei der Entwicklung des Passavant-Beschickungssystems
„Fill-Control“ sind langjährige
Erfahrungen als Pressenhersteller, Kundenhinweise
und wissenschaftliche Grundlagen
berücksichtigt worden. Die Beschickungssteuerung
erfolgt als Kombination
mehrerer Füllvarianten:
Bereich I Beschickung bei konstantem
Durchsatz
Im anfänglichen Niederdruckbereich ist die…mehr:
http://www.passavant-geiger.de/data/pool/d544916207.pdf?PHPSESSID=1b183514f03e29f57eda6c7216a8191d
(nach oben)
Genauigkeit von Durchflussmessungen in der Praxis
Ein Erfahrungsbericht
Durchflüsse zu messen ist ein in der betrieblichen
Praxis schon immer vorhandener, aber in Zeiten der
Prozessoptimierung und Energieeffizienz aus Abrechnungs-
oder Kostengründen ein immer häufiger
geforderter Punkt. Im ersten Moment scheinbar kein
Problem, finden sich doch dazu bei der Suche im Internet
schnell über 100.000 Einträge. Auch in puncto
Genauigkeit scheinen keine Wünsche offen zu bleiben.
Von verschiedenen Herstellern werden ganz allgemein
Genauigkeiten offeriert, die schnell im 0,..%
Bereich liegen. „Eine feine Sache, da kann ja nichts
mehr schief gehen“ – denkt der Kunde …. und irrt
leider viel zu oft!
mehr unter:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1110/wl11_06.pdf
(nach oben)
ARA Mühlbachl: Neuer Weg der Abwasserreinigung
Die Zeichen der Zeit erkennen und auf neue Technik setzen
Die auf der ARA Mühlbachl vorhandene mechanische Vorreinigung konnte die Anforderungen, aus heutiger Sicht und verfahrenstechnischer Notwendigkeit nicht mehr erfüllen. Aus diesem Grunde wurde im Jahr 2000 das Ingenieurbüro Sprenger Altrans durch den AWV unteres Wipptal – ARA Mühlbachl beauftragt, die Abwasserbehandlung mit einer zeitgemäßen Anlage zu planen, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befindet.
Nach Umsetzung der Planungsarbeiten sowie Erstellung der Ausschreibungen wurden nachstehende Aggregate der Fa. HUBER AG in die Konzeptionierung aufgenommen:
• Siebanlage 1000/3. Mechanische Abwassersiebung mit 3mm Spaltweite unter Berücksichtigung der besonderen Zulaufsituation, d. h. Mischwasserzulauf mit sehr hohen Fett-, Sand-, Splittanteilen.
• Auswaschung und Entwässerung des anfallenden Rechengutes
• Sandwaschanlage
• Schlammeindickungungsanlage
Im Jahr 2001 erhielt unser Unternehmen auf Grundlage der Ausschreibung den Auftrag für die Lieferung und Montage der Maschinen- und elektrotechnischen Ausrüstung. Für die vorgenannte Aufgabenstellung haben wir folgende Anlagenkomponenten eingesetzt:
1. HUBER ROTAMAT® Siebanlage Ro 2
Zur mechanischen Vorreinigung wurde eine leistungsstarke ROTAMAT® Siebanlage Baugrösse 1000 mit 3 mm Spaltweite eingesetzt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass hier im Vorfeld schon eine Siebanlage Ro 2 1000/2 mm Spaltweite seit dem Jahr 1994 im Einsatz war. Diese Anlage, welche schon über 22.000 Betriebsstunden problemlos betrieben wurde, wird nun als Stand-by Gerät eingesetzt. Die eingesetzte Siebanlage bietet durch die Verwendung eines Spaltsiebes und die konstruktive Einbaulage des Siebkorbes höchste Sicherheit in puncto Abscheideleistung. Ferner bietet dieses System neben dem besonderen niedrigen hydraulischen Widerstand auch noch den Vorteil einer berührungslosen, so?mit einer nahezu verschleißfreien Siebräumung. Diese Konstruktionsmerkmale machen die ROTAMAT®-Siebanlage auch bei Einsatzbedingungen mit Sand-, Splitt-, und hohen Rechengutbelastungen zu einem sicheren Siebsystem, das dauerhaft zuverlässig und störungsfrei arbeitet.
Weiter ist die Siebanlage selbstverständlich mit einer integrierten Rechengutwäsche (IRGA) und einer automatisch integrierten Rechengutpresse ausgestattet. Die integrierte Rechengutwäsche besteht aus Feinspülung im Steigrohr sowie einer Grobspülung im Siebkorbbereich. Die Rechengutpresse befindet sich vor dem Auswurfbereich und ist ausgestattet mit einer automatischen Presszonenspülung.
Ergebnisse:
– Zulaufmenge 150 l/s
– Entwässerung des Rechengutes ca. 40 % TR
– Organischer Auswaschgrad=>95 %.
2. HUBER- COANDA- Sandwaschanlage RoSF 4
Die leistungsstarke Anlage, welche nach dem Coandaprinzip sowie Aufstromverfahren arbeitet und so im Rundsandfang abgesetzte Kanalsande problemlos verarbeitet. Die Anlage überzeugt durch die kompakte Bauweise sowie durch die Kombination Sandklassierer und Sandwäsche in einer Maschine.
Die Funktionstüchtigkeit sowie Erbringung der garantierten Werte untermauern die weit über 600 in Betrieb befindlichen Anlagen.
Leistungsdaten:
– Durchsatzleistung 8 l/s für max. 1 t/h Rohmaterial
– Glühverlust des gewaschenen Sandes <2 %
– Abscheideleistung vom Sand Korngrösse 0,2 mm > 95 %
– Trockensubstanz des ausgetragenen Sandes > 90 % TR.
Mit diesen Ergebnissen werden die Anforderungen für eine Deponierung bzw. die Vorraussetzung für Wiederverwertung und damit zur Nutzung als Rohstoff geschaffen. Darüber hinaus werden die Entsorgungskosten erheblich reduziert.
3. ROTAMAT® Scheiben-Eindicker RoS 2S
Die innovative Neuentwicklung zur Schlammeindickung.
Die Einfachheit und Effizienz des Systems begeistert die Betreiber. Besonders ist hier zu beachten, dass ohne besonderen Wartungsaufwand ein problemloser 24 Stundeneinsatz möglich ist. Aus nachfolgend dargestellten Betriebsergebnissen ist ersichtlich, dass der anfallende Überschussschlamm mit minimalsten Verbrauchsmitteln betrieben werden kann. Beim System Scheiben-Eindicker handelt es sich um eine schräg installierte, sich langsam drehende Filterscheibenkonstruktion. Die Filterscheibe ist in einem geschlossenen Edelstahlbehälter eingebaut. Die Filterscheibe unterteilt den Behälter in einen Arbeitsbereich Feststoffaufkonzentrierung des Schlamm / Flockengemisch und in einen Filtratsammelbereich. Der vorgeflockte Schlamm fliesst aus dem Flockungsreaktor auf die Oberfläche der Filtratscheibe. Das freigesetzte Filtratwasser dringt durch das Maschengewebe von 0,25 mm und fliesst frei ab.
Die verbleibenden Schlammflocken konzentrieren sich durch die Drehbewegung sowie eingebauten Schikanen zu der verbleibenden Feststofffracht, welche im oberen Bereich des Scheiben-Eindickers per Abstreifsystem in den Dickschlammvorlagebehälter transportiert wird. Der Hauptvorteil des Systems Scheiben-Eindicker besteht im Wesentlichen …mehr:
http://www.huber.de/de/huber-report/nach-loesungen/klaeranlagen.html
(nach oben)
HUBER Abwasserwärmetauscher als Beckenversion RoWinB
Der HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin ist in seiner Art einzigartig. Er vereint auf geniale Weise einen hervorragenden Wärmeübergang mit einer automatischen Abreinigung der Wärmeaustauscherfläche und sorgt durch eine Räumschnecke selbst-ständig für den Austrag von Sedimen-ten. Er ist daher für alle denkbaren Abwässer einsetzbar. Hierbei sei kommunales Abwasser als die häufigste Art erwähnt. Die Entnahme dieses „Rohstoffes“ findet direkt am Kanal bzw. nach der mechanischen Reinigung auf der Kläranlage statt.
Die Wärmeenergie des Abwassers geht auf einer Kläranlage aber keineswegs verloren. Zwar steht das Abwasser in diversen Becken mit kalter Umgebungsluft in Kontakt, erfährt aber durch verschiedene Prozesse ebenso eine Erwärmung. Allgemein betrachtet kann also davon ausgegangen werden, dass das gereinigte Wasser mit einer verhältnismäßig hohen Temperatur dem Vorfluter zugeleitet wird.
Aufgrund der biologischen Stufe ist im Zulauf eines Klärwerks noch eine gewisse Mindesttemperatur einzuhalten. Im Auslauf hingegen ist eine geringe Temperatur sogar erwünscht, da der Eintrag von Wärme in das Vorflutersystem einen nicht unerheblichen Beitrag zur Eutrophierung leistet. Daher sind im Auslauf einer Kläranlage einem hohen Energieentzug keine Grenzen gesetzt. Was liegt daher mehr auf der Hand als die Energie des Abwassers im Ablauf einer Abwasserbehandlungsanlage zu entziehen.
Selbstverständlich ist der HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin auch dieser Aufgabe gewachsen. Aber eine Sedimentaustragschnecke scheint hier nicht nur dem geschulten Blick eines Fachmannes fehl am Platze. Auf diese kann deshalb bei einer Nutzung des Kläranlagenauslaufes verzichtet werden.
Selbst wenn der Auslauf der Kläranlage alle erforderlichen Parameter betreffend seiner Inhaltsstoffe einhält, is…
mehr: http://www.huber.de/de/huber-report/ablage-berichte/energie-aus-abwasser/huber-abwasserwaermetauscher-als-beckenversion-rowinb.html?popup=1
(nach oben)
Belüftungsregelung mit SC 1000: Energie -20 % und Nges <5 mg/l
„Wenn wir abends nach Hause gehen, wollen wir auch das Gefühl haben,
erfolgreich für die Umwelt gearbeitet zu haben“, sagt Harald Heins,
Betriebsleiter der Kläranlage in Harsefeld (Niedersachsen, Deutschland). Bei
Nges <5 mg/l und einem CSB von 30 mg/l im Ablauf darf er auch mit einem
guten Gefühl nach Hause gehen. Seit Frühjahr 2007 reduziert seine Belüftungsregelung
auf SC 1000-Basis zudem die Betriebsstunden der
Belüftungswalzen um bis zu 20 %. „Obwohl wir in den nächsten Jahren ein
Prozess-Leitsystem installieren werden, bleibt es bei dieser kleinen, funktionierenden
Einheit. Warum sollten wir daran etwas ändern?“
Vom Anfang bis zum SC 1000 Drei Bauabschnitte in den Jahren 1975, 1988 und 2000 erlebte die Kläranlage in Harsefeld. Zunächst für 9.000 Einwohner-Gleich-Werte (EW) ausgelegt, durchlief das Abwasser rasch die Rechenanlage, einen Rund-Sandfang und ein Belebungsbecken mit anschließender Nachklärung. 1988 mussten 16.000 EW gereinigt werden und es wurden ein Lang-Sandfang, eine vorgeschaltete Denitrifikation und ein zweites Nachklärbecken nötig. Erst im Jahre 2000 erreichte diese Anlage ihre heutige Größe mit Vorklärung, einem dritten Nachklärbecken und vollständiger Schlammbehandlung bis hin zum Block- Heiz-Kraft-Werk. Mit einer Auslastung von 23.000 EW – knapp unterhalb der Maximalbelastung – stieß die Leistungsfähigkeit der Belüftungsregelung 2007 an ihre Grenzen. Zwar waren die Ablaufwerte von Ammonium (1–2 mg/l NH4-N) und Nitrat (5–7 mg/l NO3-N) ausreichend niedrig, aber…
mehr unter: http://www.hach-lange.de/shop/action_q/download%3Bdocument/DOK_ID/14786594/type/pdf/lkz/DE/spkz/de/TOKEN/zDmAZpMxKLp4UUNfuyp6xGFjs7o/M/U2Ji3A
(nach oben)
Ensola Systems: Niedrig Energie Desintegration mittels Hochspannung
Die Hochspannungs – Desintegration ist ein Verfahren, bei dem mittels Hochspannungsimpulsen von bis zu 30‘000 V die Zellwände im Klärschlamm zerstört werden. Durch elektro – hydraulische Vorgänge (Druck- / Schockwellen) die sich durch den elektrischen Durchschlag in schlecht leitenden Medien – wie einer Schlammsuspension – bilden, wird die Zellmembran perforiert und die Zellflüssigkeit tritt aus. Der Aufschlussgrad richtet sich nach der Kontaktzeit zwischen den Elektroden
Das Verfahren wird mittels Elektrode zur Schlammdesintegration eingesetzt und verspricht einen höheren Abbau von organischer Substanz. Einige Anlagen werden erfolgreich in Deutschland betrieben.
Die Hochspannungsdesintegration verändert die Schlammstruktur und verbessert die Entwässerbarkeit des Faulschlamms.
Die Methode gilt als besonders Kostengünstig. Die Investition ist deutlich günstiger als alternative Verfahren mittels Ultraschall, Kavitation oder Temperatur. Zudem sind die Betriebskosten bei einem Bruchteil aufgrund des schonenden Ressourceneinsatz von einigen hundert Watt.
Installation und Einsatzort werden durch Ensola Techniker optimal geplant.
Leistung
Durch die Desintegration erhöht sich der Abbau der organischen Substanz. Dadurch werden folgende vorteile erzielt:
• Erhöhung der Biogasausbeute
• Verringerung der zu entsorgenden Schlammenge
• Einsparung and Flockungsmitteln
• Reduzierung von Schaum sowie Schwimm- und Blähschlamm, durch den Zerschlag fadenförmiger Mikroorganismen
• Verringerung der Viskosität des Schlamms – Verbessertes Handling
Quelle: http://www.ensola.com/cms/index.php/de/systems/96
(nach oben)
Eko-plant: Neue Klärschlammvererdungsanlage in Lumda steht kurz vor der Inbetriebnahme
Bepflanzung als letzten Schritt durchgeführt
Bereits im Jahr 2007 wurde die Entscheidung gefällt, die Klärschlammbehandlung der Kläranlage Lumda des Abwasserverbandes Ohm-Seenbach zu modernisieren. Sie ist für die Grünberger Stadtteile Lumda – Stangenrod und Beltershain sowie für den Mücker Ortsteil Atzenhain zuständig.
Der Grund für diese langfristige Investition waren die steigenden Anforderungen bei der Klärschlammbehandlung und -verwertung, insbesondere im Hinblick auf Kostenstabilität und Verwertungssicherheit vor dem Hintergrund der Diskussion über die Zukunft der landwirtschaftlichen Ausbringung von Klärschlamm. Mit dem sowohl umweltfreundlichen als auch wirtschaftlichen Verfahren der Klärschlammvererdung wurde letztendlich die passende Lösung für die Zukunft gefunden.
Am 19. Juni 2009 erfolgte nun als eine der letzten notwendigen Maßnahmen vor Inbetriebnahme der neuen Anlage der Beginn der Bepflanzung der drei 0,75 ha großen Beete. Der Vorsteher des Abwasserverbandes Ohm-Seenbach Herr Bürgermeister Weitzel der Gemeinde Mücke sowie dessen Stellvertreter Herr Bürgermeister Ide der Stadt Grünberg haben an diesem Tag mit Unterstützung von Sabine Bork, der Geschäftsführerin des Abwasserverbandes, Projektsteuerer Armin Uhrig und Karl-Toni Zöller von der ausführenden Firma Eko-Plant symbolisch die ersten Pflanzen gesetzt.
Die Vorgeschichte
Bei der Reinigung von Abwasser entsteht Klärschlamm mit einem hohen Wasseranteil. Seit 2006 fielen in der Kläranlage Lumda im Schnitt 2.200 m³ dieses Nassschlamms mit einem Wassergehalt von 94-98% an. Durch das geringe Lagervolumen der vorhandenen Behälter war es nicht möglich, die gesamte Schlammmenge landwirtschaftlich in nasser Form auszubringen. Deshalb musste rund die Hälfte des anfallenden Schlamms zum Pressen nach Nieder-Ohmen transportiert werden. Der so entwässerte Schlamm wurde wiederum in der Landwirtschaft verwertet. Die gesamten Bruttokosten für dieses Verfahren betrug im Jahre 2007 32.344,13 Euro. Davon entfielen 19.072,13 Euro auf die Verwertung von 1.100 m³ Nassschlamm in der Landwirtschaft, 9.654,40 Euro auf den Transport von 1.228 m³ Nass-schlamm nach Nieder-Ohmen und 3.617,60 Euro auf dessen Weiterverarbeitung und Verwertung in der Landwirtschaft.
Vor diesem Hintergrund hat sich der Abwasserverband Ohm-Seenbach bereit 2005 entschlossen, sich über eine Studie Möglichkeiten aufzeigen zu lassen, die zu einem kostengünstigeren und verwertungssichereren Weg für die Zukunft führen. Dazu wurden einerseits durch das Ingenieurbüro Olsen verschiedene Möglichkeiten berechnet, mehr Schlamm landwirtschaftlich zu verwerten, um den Transport nach Nieder-Ohmen zu minimieren. Andererseits hat die Firma Eko-Plant den konventionellen Schlammbehandlungsmethoden den Bau einer Klärschlammvererdungsanlage gegenübergestellt. Nachdem die Verbandver-sammlung im April 2007 zwei Referenzanlagen besichtigt hat, stimmte sie im Mai 2007 der Systematik „Klärschlammvererdung“ zu. Mit Hilfe eines Projektsteuerers, der Ingenieurgesellschaft Müller aus Schöneck, sowie einer angesehenen Anwaltskanzlei wurde das komplizierte Vergabeverfahren durchgeführt und der Auftrag im Oktober 2008 letztendlich an die Firma Eko-Plant für einen Pauschalbetrag von 583.100 Euro vergeben, nachdem im Mai 2008 nach der Genehmigungsplanung durch das Ingenieurbüro Infu der Landrat des Kreises Gießen die Baugenehmigung erteilt hatte.
Ab Mitte 2009 wird nun der Klärschlamm der Kläranlage Lumda in die bepflanzten Schilfbeete eingeleitet statt wie bislang direkt landwirtschaftlich ausgebracht. Für diesen Entwässerungsprozess werden natürliche Kräfte genutzt, die auch bei einer Kompostierung wirken. Die Vorgänge laufen jedoch in großem Maßstab und technisch gesteuert ab.
Der flüssige Schlamm verteilt sich in den Beeten und sickert dabei langsam durch die Wurzelschicht, über der die Feststoffanteile zurückgehalten werden. Durch Sonneneinstrahlung und die Verdunstungsleistung des Schilfs wird der Entwässerungsvorgang zusätzlich gesteigert. Gleichzeitig versorgt das Schilf die Bodenorganismen mit Sauerstoff, die den Schlamm langsam zu Klärschlammerde umbauen. Durch den Abbau von organischen Anteilen im Klärschlamm weist dieses Verfahren eine im Vergleich zu anderen Schlammbehandlungsverfahren deutlich verringerte Restmenge auf. Darüber hinaus ist Klärschlammerde geruchsneutral und bietet höchstmögliche Verwertungssicherheit für den Betreiber.
Quelle: http://www.eko-plant.com/cms/content/view/142/106/lang,de/
(nach oben)
Mikroschadstoffe im Focus der Abwasserreinigung
Gelöster Sauerstoff wird radikal
Die allgegenwärtige Präsenz von anthropogenen Spurenstoffen in unserer Umwelt
und vor allem in aquatischen Systemen, ist besorgniserregend. Die Problematik
trifft mittlerweile in der Öffentlichkeit auf breites Interesse und wird
in einer Vielzahl von Seminaren, Tagungen und Fachzeitschriften thematisiert.
Zudem haben Fachverbände, Universitäten und Unternehmen Untersuchungen
und Forschungsvorhaben ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Mikroschadstoffe
primär zu vermeiden bzw. aus Wasser- und Abwasser zu entfernen. Auch die
SÜD-CHEMIE AG engagiert sich beim Thema Spurenstoff-Entfernung mit einem
eigenen Forschungsprojekt.
Aktuelle Situation
In Deutschland wurden in den letzten
Jahrzehnten enorme Fortschritte
in der Abwasserreinigung erreicht.
Besorgnis erregen derzeit jedoch vor
allem anthropogene Spurenstoffe,
die zunehmend in der aquatischen
Umwelt gefunden werden, wie
Pestizide
Veterinär- und Humanpharmaka
Komplexbildner (EDTA)
Röntgenkontrastmittel
PFT
Viele dieser Substanzen sind nicht
nur in Oberflächengewässern, sondern
auch im Trinkwasser nachweisbar.
Zwar kann das Trinkwasser in
Deutschland noch bedenkenlos aus
dem Wasserhahn gezapft werden,
trotzdem sehen Fachleute Handlungsbedarf.
So können heute schon im
Trinkwasser u. a. Diclofenac, Röntgenkontrastmittel,
Ibuprofen, Blutfettlipidsenker
und Antirheumatika nachgewiesen
werden. Mit dem Fortschritt
der modernen instrumentellen Analytik
werden auch immer mehr Substanzen
entdeckt und analytisch greifbar
– und rücken damit in das Interesse
der Öffentlichkeit.
Breite Resonanz in der
Öffentlichkeit
Aktuell wird in einer Vielzahl von Seminaren,
Tagungen und Fachzeitschriften
gerade diese Problematik
thematisiert. So fand sich beispielsweise
im März dieses Jahres ein Themenblock
mit der Überschrift „Mikroschadstoffe
in der aquatischen Umwelt“
als Schwerpunkt …den ganzen Bericht lesen Sie unter:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1009/wl10_sauerstoff.pdf
Essener Tagung für Wasser- und Abfallwirtschaft
Autor:
Dr. Franz Xaver Müller
SÜD-CHEMIE AG
(nach oben)
Kläranlage Hutthurm: Bayerns größte Membranbelebung in Betrieb
Im September 2008 nahm der Markt Hutthurm mit seiner Kläranlage die derzeit größte und modernste Membranbelebung des Landes in Betrieb. Bis zu 22.000 EW können aktuell von der Kläranlage bewältigt werden.
Auch in Punkto Kläranlagensteuerung setzt Hutthurm auf neue Entwicklungen und entschied sich für die H2Ortner Steuerung NiDeEco die von der Firma Meusel Elektrotechnik eingebaut wurde. Ziel ist es mit der NiDeEco die Stickstoff Ablaufwerte zu optimieren und das bei möglichst niedrigem Energiebedarf.
So liefert H2Ortner in Zusammenarbeit mit der Firma Meusel Elektrotechnik in Passau einen Baustein zum Sonderprogramm der bayerischen Staatsregierung für eine saubere …mehr unter:
http://www.h2ortner.com/index.php?rubrik=news&seite=news_lang&action=uebersicht&id=70&kurz=Die Kläranlage Hutthurm nimmt Bayerns größte Membranbelebung in Betrieb.
(nach oben)
Optimierung der Klär- und Biogaserzeugung durch Desintegration im elektrischen Feld
Bei der anaeroben Behandlung von Schlämmen in Kläranlagen ist es besonders
wichtig, auch die Zellinhaltsstoffe zur Faulgasgewinnung zu nutzen – vor allem
bei Überschussschlämmen und Substraten für Biogasanlagen. Das Verfahren
der Desintegration im elektrischen Feld macht das möglich. Seit kurzem wird
diese innovative Technologie von der SÜD-CHEMIE AG angeboten, die ersten
Desintegrationsaggregate befinden sich bereits im Einsatz.
Effektive Schlammverwertung und Kostenreduzierung
Durch die biologische Aktivität kann
nur ein Teil der Zellinhaltsstoffe zur
Faul- oder Biogaserzeugung genutzt
werden. Auf Grund der Struktur beziehungsweise
Beschaffenheit der Zellmembranen
ist oftmals ein biochemischer
Aufschluss nicht oder nur
nach langer Behandlungsdauer möglich.
Somit steht das in der Zelle gebundene
Substrat zur Gaserzeugung
nicht zur Verfügung.
Durch die Desintegration im elektrischen
Feld werden Zellmembranen
mechanisch geschwächt und porös,
Zellverbände werden aufgetrennt
eine größere Angriffsoberfläche für
die biochemischen Reaktion steht zur
Verfügung.
Damit kann dann der Zellinhalt zur
Gaserzeugung genutzt werden. Darüber
hinaus reduziert die Behandlung
den Schlammanfall (Output),
was sich im Gesamtsystem „anaerobe
Schlammbehandlung – Biogaserzeugung“
positiv auf die Kosten für
Transport und Entsorgung auswirkt… den ganzen Bericht lesen Sie in:www.die-wasserlinse.de Ausgabe 10/2009
Weitere Informationen zum aktuellen
Stand der Tests sowie zu den Einsatzkonditionen
erfahren sie beim Autor
bzw. über die SÜD-CHEMIE AG.
Autor:
Andreas Zacherl
SÜD-CHEMIE AG
Quelle: http://www.sud-chemie.com/scmcms/web/content.jsp?nodeId=7516⟨=de
(nach oben)
Turbo in der Abwassertechnik – Terra-N -Verfahren nutzt Deammonifikation
Bereits in den 80er Jahren wurden Bakterien entdeckt, die heute den klassischen Stickstoffabbau in Klärwerken revolutionieren – anaerobe Ammonium- Oxidierer wie z.B. das Bakterium Candidatus Brocadia anammoxidans. Bisher muss in Klärwerken der im Abwasser enthaltene Ammoniumstickstoff (NH4-N) unter hohem Energieaufwand zunächst zu Nitritstickstoff (NO2-N) und dann zu Nitratstickstoff (NO3-N) oxidiert werden – um anschließend durch Zugabe von Kohlenstoff zu elementarem Stickstoff (N2) umgewandelt werden zu können . Die dazu nötige Energie beziehungsweise die dadurch anfallenden Betriebskosten sind erheblich. Anammox-Reaktion senkt Prozesskosten und CO2-Emissionen, Anammox senkt Sauerstoffbedarf, Stromverbrauch und letztlich Prozesskosten. Die Betriebskosten in der Teilstrombehandlung zur Stickstoffelimination könnten durch den Einsatz der sogenannten Anammox-Reaktion um bis zu 90 % gesenkt werden. Denn der Stromverbrauch (und damit die CO2-Produktion) durch die benötigte Belüftung in der Nitrifikationsstufe beziehungsweise die Kohlenstoffveratmung in der Denitrifikationsstufe sinken deutlich. „Anammox“ ist ein Kunstwort, das sich aus den Begriffen „Anaerobe“ und „Ammoniak-Oxidation“ zusammensetzt. Die anaerobe Ammoniak- Oxidation ist ein biologischer Vorgang aus dem Bereich des Stickstoffkreislaufes. Wie der Begriff schon andeutet, ist die Anammoxidation ein Oxidationsvorgang, der ohne Sauerstoff (anoxisch) abläuft. Dabei wird Ammonium (NH4 ) mit Nitrit (NO2 ) unter anaeroben Bedingungen zu molekularem Stickstoff (N2) umgesetzt. Verantwortlich für diesen Vorgang ist in unserem Beispiel das bisher wenig beachtete Bakterium Candidatus Brocadia anammoxidans. Neben diesem Bakterium wurde der Anammox-Prozess bisher aber auch bei den Süßwasserorganismen Kuenenia stuttgartiensis und den Meeres…den ganzen Bericht lesen Sie unter:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1009/wl10_terraN.pdfen
(nach oben)
Mit bedarfsgerechten Beratungsleistungen den Kläranlagenbetrieb stärken
Um den Anforderungen einer ordnungsgemäßen und gleichzeitig wirtschaftlichen
Abwasserreinigung gerecht zu werden, greifen immer mehr
Betreiber von Kläranlagen auf das KnowHow von Spezialisten zurück.
AWS GmbH verfügt über die Erfahrung aus mehr als einem Dutzend Betriebsführungen
und bietet Praxis orientierte Unterstützung an, in den
Bereichen Verfahrenstechnik, Organisation und Kostenoptimerung. Dabei
stehen die Bedürfnisse des Kunden im Vordergrund. Den ganzen Bericht lesen Sie unter: http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_1009/wl10_beratungsleistungen.pdf
Autor:
Stefan Hurzlmeier AWS GmbH
(nach oben)
Grabenlose Verlegung von Vakuumleitungen
Historische oder jüngst ausgebaute Straßen, Alleen mit wertvollem Baumbestand, Autobahn-, Gleis- oder Bundesstraßenquerungen, Natur-, Landschaftsund Trinkwasserschutzgebiete, Botanische Gärten und andere verlangen oft schonende Bauweise bei der Verlegung von Leitungen. Das Arbeitsblatt DWA-A 125 beschreibt im Wesentlichen das hier infrage kommende HDD-Verfahren als ein steuerbares Nassbohrverfahren. Dieses Verfahren bietet die für die Verlegung von Vakuumleitungen erforderliche Bohrgenauigkeit. Das Bohrgerät führt dabei während der Arbeiten eine permanente 3D-Messung mittels elektromagnetischem Feld durch. Ein Empfänger über Grund hält permanent Kontakt zum Sender im Bohrkopf. Die Intensität des magnetischen Feldes nimmt dabei logarithmisch mit zunehmender Bohrtiefe ab und damit entsprechend auch die Messgenauigkeit, die mit 2 % bezogen auf die Bohrtiefe definiert ist. Entsprechend beträgt die Ungenauigkeit in 1 m Tiefe _ 2 cm, und in 2 m Tiefe sind noch _ 4 cm erreichbar. Darüber hinaus gibt auch DWA-A 125 maximal zulässige Toleranzen für den Bau von Abwasserleitungen vor, die für diesen Einsatzbereich ca. _ 20 mm vertikal und _ 25 mm horizontal entsprechen. Bei Vakuumleitungen sind seitliche Abweichungen unbedeutend, da ohnehin keine geraden Haltungslängen wie bei Freispiegelleitungen realisiert werden müssen. In der Praxis sind gute Bohrergebnisse aber auch noch von weiteren Einflüssen abhängig. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Bodenbeschaffenheit.
Den ganzen Artikel lesen Sie in der KA Heft 12-2009 ab Seite 1284
Quelle: Roediger Vacuum GmbH 63450 Hanau
(nach oben)
Videos über die Durchfluss-Messtechnik
– Messprinzip der Vortex-Durchflussmessung
http://www.de.endress.com/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/contentview/2E2ED2A74543BAA2C125764A003024C8?Open&popup
– Messprinzip der Coriolis-Massedurchflussmessung
http://www.de.endress.com/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/contentview/2E6931B586BD9E8AC125764A002FC425?Open&popup
– Messprinzip der thermischen Massedurchflussmessung
http://www.de.endress.com/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/contentview/B7E0BFB345FEA11DC125764A00304283?Open&popup
– Messprinzip der Differenzdruck-Durchflussmessung
http://www.de.endress.com/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/contentview/3140397CA7B0617DC125764A0031C25C?Open&popup
– Messprinzip der magnetisch-induktiven Durchflussmessung (MID)
http://www.de.endress.com/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/contentview/D3781EA8E684E9AAC125764A0031DED8?Open&popup
– Messprinzip der Ultraschall-Durchflussmessung
http://www.de.endress.com/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/contentview/A1114C0CB3BDE0F9C125764A0031FF8C?Open&popup
(nach oben)
Schwimmschlammreduktion mit AQUAREL_ HN554 am Beispiel einer Stabilisierungsanlage
Vorgehensweise von H2Ortner
Die Produktauswahl zu dem geeigneten AQUAREL_
Produkt erfolgt über eine Datenbewertung
(Anlagendaten, Zu- und Ablaufkonzentrationen und –
mengen, Reinigungsziel) und einer mikroskopischen
Untersuchung, die vor Ort durchgeführt wurden. Die
Begleitung ist über den Einsatzeitraum durch
Anlagenbesuche und telefonische Kontakte mit dem
Klärmeister sichergestellt. Die Anlagendaten werden
regelmäßig bewertet und besprochen um etwaige
Anpassungen durchzuführen. Die Untersuchung
umfasst die kritische Jahreszeit von August 2006 bis
Januar 2007.
Einsatzablauf
Aufgrund der Vorauswahl kommt das Produkt
AQUAREL_ HN554 zum Einsatz. Die Zusammensetzung
dieses AQUAREL… mehr unter:
http://www.h2ortner.com/deutsch/news/acp/uploader/uploads/pdfs/Schwimmschlammreduktion_mit_Aquarel_HN554.pdf
(nach oben)
Kunststoffrohre für die Galvanikanlage bei Knorr-Bremse in Aldersbach
Knorr-Bremse ist der weltweit führende Hersteller von kompletten
Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Als
technologischer Schrittmacher ist das Unternehmen seit über
100 Jahren maßgeblich beteiligt an der Entwicklung, Produktion
und dem Vertrieb modernster Bremssysteme für unterschiedlichste
Anwendungen im Schienen- und Nutzfahrzeug-Bereich.
Der internationale Konzern hat seinen Hauptsitz in München
und ist mit über 60 Standorten in 25 Ländern vertreten. Laut
Unternehmensangaben haben über 13.000 Mitarbeiter welt –
weit im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von 3,38 Mrd.
Euro er wirtschaftet.
Bremssysteme des Unternehmensbereichs Knorr-Bremse Sys –
teme für Schienenfahrzeuge kommen weltweit zum Einsatz
in Hochgeschwindigkeitszügen wie dem ICE ebenso wie in
zahlreichen Güter- und Nahverkehrszügen sowie Straßenund
U-Bahnen in aller Welt.
Im Nutzfahrzeugbereich ist Knorr-Bremse in Lkws und Zug –
maschinen, Anhängern und Bussen vertreten. Die Produktpalette
reicht von Luftbeschaffungs- und Luftaufbereitungsanlagen
über Brems- und Fahrwerksteuerungssysteme (ABS,
ESP oder EBS) bis hin zu Radbremsen. Steigende Produktionszahlen bei Knorr-Bremse im Werk Al –
dersbach erforderten die Erweiterung der Anodisieranlage
zur Galvanisierung von Elektronikkomponenten für Nutz –
fahr zeuge. Zudem musste die Anlage den neuen Markt
Anforderungen angepasst werden. Für die Galvanikstraße wurden sechs neue Lagertanks aus PP
mit entsprechender Mediumskühlung installiert. Die weite re
Mediumsverteilung mit einer Leitungslänge von ca. 500 m
wurde in PP-H, PVC-U und PVC-C in den Dimensionen DN 40
bis DN 90 ausgeführt. Für die Schwefelsäure wurde auf
Grund der guten chemischen Beständigkeit gegenüber Säu –
ren der Werkstoff PVC-C in Kombination mit dem säurebestän
digen Klebstoff Dytex gewählt. Die Mediumsverteilung
der gelösten Metallsalze wurde mit PP-H realisiert.
Eine innovative Anlagensteuerung regelt die automatisierten
Armaturen und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb al –
ler Anlagenteile.
Die innerbetrieblichen Kühleinrichtungen, an die auch eine
Wasserstrahl-Entgratungsanlage angeschlossen ist, wurden
kostengünstig in PVC-U ausgeführt.
Zur Optimierung der Kühlwirkung wurde ein neuer Plat ten –
wär metauscher auf dem Hallendach installiert, hier kam der
bewährte Werkstoff PE 100 zum Einsatz .Mehr unter:
http://www.krv.de/images/stories/docs/krv-nachrichten_1-2009.pdf
Von: Dipl.-Ing. Klaus Schmid, Georg Fischer GmbH, Albershausen
(nach oben)
PE 100-RC-Rohre im Horizontal Spülbohrverfahren verlegt
Baustellenbeschreibung
Im Sommer 2007 verlegte die Firma Richter-Bau GmbH &
Co. KG in Klingenberg am Main je eine Abwasser-, Gasund
Trink wasserleitung (Bild 1). Das verwendete Rohr und
die Baumaßnahme sind nachfolgend beschrieben. Zum Ein –
satz kam bei allen drei Medien ein dreischichtiges PE-Rohr –
system mit integrierten Schutzeigenschaften. Die Einbautener
folgten im Horizontal-Spülbohrverfahren.
Rohrwerkstoffe
Das im vorliegenden Fall verwendete Rohr TSDOQ von Wa vin
besteht aus dem riss- und punktlastbeständigen Werk stoff
PE 100-RC (Resistance to Crack). Dank seiner integrierten
Schutz eigenschaften eignet sich dieses Rohrsystem für extreme
Be lastungen und grabenlose Verlegeverfahren wie Berst –
li ning oder Spülbohrverfahren.
Besonders bei sogenannten „ Black-Box-Verfahren“, wie z.B.
dem Spülbohrverfahren, werden die PE Rohre hohen, kurzzeitigen
und langfristigen Belastungen ausgesetzt. Dies kann
zu Kerben und Riefen an der Rohroberfläche und später im
eingebauten Zustand zu eventuellen Punktlasten mit den entsprechenden
Zugspannungen an der Rohrinnenseite führen.
Rohre mit einem hohen Widerstand gegen langsames Riss –
wachstum sind hier von Vorteil.
Bauablauf
Die in Klingenberg gelieferten Rohre mit Außendurchmesser
von 180 mm bis 355 mm, SDR 11, wurden in 12-Meter-Län –
gen angeliefert, stumpf vorgeschweißt und hinter dem Auf –
weit kopf …mehr unter:
http://www.krv.de/images/stories/docs/krv-nachrichten_1-2009.pdf
Von: Dipl.- Ing. Ralf Glanert, Wavin GmbH, Twist
(nach oben)
Eine ingenieurtechnische Betrachtung des Projekts Steinhäule
Einleitung
Neue Reinigungsverfahren zur Abwasseraufbereitung ma –
chen es heute möglich und notwendig, die Abwässer noch
besser als bisher zu reinigen. Künftig wird vor allem die Rück –
haltung der schwer abbaubaren und ökologisch kritischen
Rest stoffe, wie Arzneimittelrückstände, Chemikalien usw., im
Mittelpunkt der angestrebten Qualitätsverbesserungen stehen.
Eine große Rolle spielen in Zukunft auch die Vorgaben der
Eu ropäischen Union, die eine einheitliche europäische Regel –
ung im Bereich des Gewässerschutzes und der Anlagen ge –
neh migung vorsieht.
Um diese Aufgaben technisch und qualitativ bewältigen zu
können, bedarf es einer Kapazitätsausweitung der bisherigen
Betriebsfläche beim Zweckverband „ Klärwerk Stein –
häule“. Es werden weitere Klärbecken und eine Filteranlage
benötigt, die dem Zweckverband den Ausbau des Klärwer –
kes entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik ermöglichen
[1].
Frei verlegte Druckrohrleitungen mit einem Innendurchmes –
ser von DN 1000 bis DN 1400 für die unterirdischen Deni –
trifikationsbecken mit vielen Sonderbauteilen erforderten ei –
ne detaillierte technische Vorplanung hinsichtlich der statischen
Auslegungen und der konstruktiven Gestaltung der
Rohr leitungen.
In Zusammenarbeit mit einer Verlegefirma und Ingenieur bü –
ros wurden für dieses Anwendungsbeispiel gewickelte Groß –
rohre aus PE 1000 zur Abwasseraufbereitung verlegt.
Zweckverband Klärwerk Steinhäule im Kurzportrait
Einzugsgebiet der Kläranlage
Unweit der Donau, unterhalb des Kraftwerks „ Böfinger Hal –
de“, im sogenannten „ Steinhäule“ auf Pfuhler Gemarkung,
be findet sich das Klärwerk, das nach seiner Lage benannt
wurde. Träger ist der Zweckverband „ Klärwerk Steinhäule“,
zu dem sich die Städte Ulm, Neu-Ulm, Senden und Blau –
beuren sowie die Gemeinden Berghülen, Blaustein, Dorn –
stadt, Illerkirchberg, Illerrieden, Schnürpflingen und Staig zu –
sammengeschlossen haben. Das aus dem Einzugsgebiet zu –
geleitete Abwasser wird – gemäß den gesetzlichen Vor –
schriften und behördlichen Entscheidungen – behandelt, ge –
rei nigt und dem Wasserkreislauf durch Ableitung in die Do –
nau wieder zugeführt [1].
Seit 1957 eine gemeinsame Kläranlage
Erst beim Bau des Donaukraftwerks „ Böfinger Halde“ ergaben
sich klare Vorstellungen zum Standort der Kläranlage. Die genaue Lage konnte nur unterhalb der Wehranlage bzw.
der aufgestauten Donau sein, wo mit Hilfe des neuen Zulei –
ters ein Betrieb mit natürlichem Gefälle möglich war. So kam
es zu dem für die Entwicklung der Städte so günstigen Stand –
ort im „ Steinhäule“. 1957 ging – nach zweijähriger Bauzeit
– die gemeinsame mechanische Sammelkläranlage für Ulm
/Neu-Ulm in Betrieb.
Klärwerk Steinhäule – Eine wichtige Aufbereitungsanlage in der Region
Die Anlage umfasst eine Fläche von 11 Hektar. Das Abwas –
ser von rund 400.000 Einwohnerwerte im Einzugsgebiet
des Zweckverbands Klärwerk Steinhäule fließt täglich durch
die Kanalisation in das Klärwerk an der Donau. Eine Was –
ser menge von rund 80.000 bis 100.000 m³ ist pro Tag zu
rei nigen. Rund 40 Prozent davon stammen aus Industrie und
Gewerbe. Beim Klärprozess fallen täglich ca. 20 – 40 Ton –
nen Schlamm (Trockensubstanz) an, die der thermischen Ver –
wertung zugeführt werden. Der Reinigungsprozess vom Ab –
wasserzulauf bis zum Ablauf des geklärten Wassers dauert
rund zehn Stunden. Zum Vergleich: Die Donau würde dazu
mit ihren Selbstreinigungskräften etwa zehn Tage benötigen.
Anforderungen an die Baumaßnahme – Projektbeschreibung
Der Neubau von Denitrifikationsbecken umfasste acht Kas –
ka den mit Zu- und Ablaufkanälen. Jede Kaskade hatte ein
Vo lumen von 2.400 m³ aufzuweisen.
Folgendes Anforderungsprofil lag für das frei verlegte und
unterirdische Rohrleitungssystem vor:
_ Druckrohrleitungen mit einem Innendurchmesser von
DN 1000 bis DN 1400 für eine flexible Wasserführung
und -verteilung
_ Die unterirdischen Rohrleitungen beinhalteten Sonder bau –
tei le wie Abzweigungen, Schieber, Wandeinbindungen
und Reduktionen
_ Durchflussleistung: 55 bis 70 m3/min
_ Betriebstemperaturen: 5 und 20 °C
_ zulässiger Betriebsdruck/Systemdruck: max. 1,5 bar
_ Nutzungsdauer: 50 Jahre.
Den ganzen Bericht lesen Sie unter:
http://www.krv.de/images/stories/docs/krv-nachrichten_1-2009.pdf
Von:
Thomas Böhm, LyondellBasell Industries, Frankfurt am Main
Matthias Haese, Frank & Krah Wickelrohr GmbH, Wölfersheim
Jochen Obermayer, FRANK GmbH, Mörfelden-Walldorf
(nach oben)
Die Kläranlage der Zukunft mit Ozon!
Mikroverunreinigungen im Wasserkreislauf
Die Beseitigung von Mikroverunreinigungen aus unserem Wasser ist eine Herausforderung, der sich immer mehr verantwortungsbewusste Ver- und Entsorger stellen müssen. Während biologische Aufbereitungsverfahren keine vollständige Entfernung erreichen, stellt sich die Oxidation mit Ozon als eine der effizientesten Methoden heraus.
Pharmazeutika helfen vielen Menschen und Tieren bei der Bekämpfung von Krankheiten, der Erhaltung der Gesundheit oder der Verbesserung der Lebensqualität. Jedoch gelangt ein hoher Anteil der pharmazeutischen Wirkstoffe durch Ausscheidungen des Körpers über das Abwasser in die Umwelt. Die Haupteintragspfade oder „Hot Spots“ von persistenten Spurenstoffen in Oberflächengewässer sind kommunale Kläranlagen, Abläufe aus der pharmazeutischen Industrie, Tierzuchtanlagen oder medizinische Zentren.
Obwohl sie dort kein unmittelbares Risiko darstellen, werden gerade Langzeitgefahren immer deutlicher. Die Effekte von Mikroverunreinigungen bzw. von Arzneistoffen in Oberflächengewässern wurden bereits mehrfach in groß angelegten Studien nachgewiesen und führen im Ökosystem zu negativen Veränderungen und damit zu Problemen.
Problem I: Persistenz
Nicht alle zugelassenen Substanzen im Bereich der Pharmazie, Landwirtschaft und Industrie wie im Bereich des täglichen Bedarfs sind biologisch vollständig abbaubar. So können sie mit konventioneller Kläranlagentechnik nicht vollständig entfernt werden. Folglich findet eine schleichende Anreicherung von Kontaminanten in unserem Wasserkreislauf und seinen Nutzern statt (Bioakkumulation).
Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen bedeutet das für die Zukunft eine stetige Zunahme der Verunreinigung im Wasser und weitere negative Auswirkungen für die aquatische Umwelt.
Problem II: Endokrine Wirkung
Einige Mikroverunreinigungen (z.B. der Wirkstoff der Pille (Ethinylestradiol)) wirken auf das Hormonsystem von Mensch und Tier. Diese sogenannten endokrinen Substanzen (EDCs) sind schon in kleinsten Konzentrationen wirksam und werden von der Wissenschaft als besonders kritisch eingestuft. In Zusammenhang mit negativen Umwelteinflüssen auf Lebewesen werden mittlerweile EDCs als Auslöser in Betracht gezogen:
Es werden negative Wirkungen auf die Fortpflanzung von bestimmten Fischarten beobachtet (u.a. „Verweiblichung“ von männlichen Fischen)
Die Verringerung der Zeugungsfähigkeit bei Mensch und Tier durch verminderte Spermienqualität nimmt zu
Die Zunahme bestimmter Krebsarten, die mit einer Störung des Hormonsystems zusammen hängen könnte
Der Spezialagent Ozon
Die Auswirkungen von endokrinen Substanzen und persistenten Spurenstoffen auf unser Ökosystem machen eine weitergehende Reinigung notwendig. Mit bestehender Reinigungstechnik stoßen viele Klärwerke an ihre Grenzen, um die Stoffe in ausreichenden Umfang zu beseitigen. Zahlreiche Pilottests mit Ozon als weitere Reinigungsstufe haben gezeigt, dass Ozon ein geeignetes Mittel für die Beseitigung persistenter Stoffe ist. So können mit ökologisch und ökonomisch sinnvollen Ozondosen die im Wasser vorhandenen Spurenstoffe effektiv entfernt werden.
How does OZONE work?
Ozon ist eines der stärksten, technisch herstellbaren, gasförmigen Oxidationsmittel. Es reagiert schnell mit einer Vielzahl von Verbindungen, entweder durch direkten Angriff des Ozonmoleküls oder indirekt durch entstehende Hydroxyl Radikale. Das Ozon wird durch den Reaktionsprozess in der Regel vollständig verbraucht. Es zerfällt oder wird mittels Restozonvernichter am Ende des Prozesses wieder zu Sauerstoff zerlegt.
Quelle: http://www.wedeco.com/index.php?id=91034&Lang=1&langID=44&tx_ttnews[tt_news]=6&tx_ttnews[backPid]=91030&cHash=f0077369a2
(nach oben)
UMSTIEG AUF DAS KODIERSYSTEM DER DIN EN 13508-2
ANFORDERUNGEN UND AUFGABEN
Die bautechnische Zustandserfassung von Kanälen und Leitungen sowie Schächten und
Inspektionsöffnungen durch optische Inspektion in Form von Kamerabefahrung, Begehung oder
Inaugenscheinnahme, sowie die Dokumentation der Feststellungen durch entsprechende
Kodiersysteme ist ein, in Deutschland und Europa, seit Jahren erprobtes und etabliertes
Verfahren. Hierbei kamen in Deutschland bislang diverse Kodiersysteme zum Einsatz, die sich
entweder parallel entwickelt haben oder aufeinander aufbauten. Beispielhaft hierfür seien an
dieser Stelle genannt:
• ISYBAU 1996, 2001 (Arbeitshilfen Abwasser für Liegenschaften des Bundes)
• DWA-M 149-2: 1999
• Lokale Systeme der Netzbetreiber (z.B. Berliner Wasserbetriebe)
Mit der Veröffentlichung der DIN EN 13508-2 „Zustandserfassung von Entwässerungssystemen
außerhalb von Gebäuden – Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion“ im Mai 2003 erfolgte
im Rahmen der europäischen Harmonisierung von nationalen Regelwerken der Startschuss für
ein neues Zeitalter in der optischen Inspektion.
Im September 2003 wurde die DIN EN 13508-2 durch das DIN in das nationale Regelwerk
übernommen. Die eingeräumte Übergangsfrist zur verbindlichen Einführung und die damit
verbundene Zurücknahme entgegenstehender nationaler Regelwerke endete im Mai 2006. Seit
diesem Zeitpunkt sind, formal betrachtet, neue Inspektionsprogramme nur gemäß DIN EN
13508-2 durchzuführen, Inspektionsprogramme, die vor Mai 2006 begonnen wurden, können mit
den ursprünglichen Systemen zu Ende geführt werden.
Die Norm ist für jeden Inspektionszweck im Rahmen der optischen Inneninspektion, d.h. für die
• qualitative Zustandserfassung des Istzustandes im Rahmen von
Eigenkontrollverordnungen,
• Abnahme von Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen und
• Abnahme vor Ablauf der Gewährleistungsfrist
anzuwenden.
Die Einführung der DIN EN 13508-2 hat Auswirkungen auf den gesamten Prozess der
Kanalinstandhaltung… Den gesamten Fachvortrag (11. Dresdner Abwassertagung am 17./18. März 2009) finden Sie zum Download unter:
http://gutachter-kanal.de/18.html
Autor: Andreas Koch, Hannover
(nach oben)
Portables Ultraschall-Durchfluss-Messgerät für die temporäre Messung von außen
Proline Prosonic Flow 93T
Flexibel und wirtschaftlich
- Hervorragend geeignet für die bidirektionale Durchflussmessung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen
(mit/ohne Auskleidung)
- Robuste Clamp-on-Sensoren
- Einfache Montage dank funktionellem Industriedesign
- Schnelle und sichere Inbetriebnahme durch ein „Quick-Setup“
- Softwareunabhängige Datenübertragung vom integrierten Datenlogger zum PC
• Bewährtes FieldCare-Programm für die Gerätekonfiguration und das Visualisieren von Messdaten
Alles im Griff – temporär messen von außen Suchen Sie eine Möglichkeit, Prozesse effizient zu überprüfen und zu optimieren? Möchten Sie den Durchfluss in Rohrleitungen ohne Unterbrechung des Prozesses erfassen, wo und wann immer Sie wollen? Ja – dann können Sie sich voll und ganz auf Prosonic Flow 93T verlassen. Dieses mobil einsetzbare Ultraschall-Durchfluss- Messgerät besticht durch die ausgereifte „Clamp-on“-Technologie. Durchflussmengen können schnell und zuverlässig erfasst werden – direkt von außen. Prosonic Flow 93T wird netzunabhängig mit einem leistungsstarken Akku betrieben. Der integrierte Datenlogger zeichnet alle gemessenen Durchflusswerte sicher auf. Über den Stromeingang können auch Werte anderer Messgeräte eingelesen und gespeichert werden. Das sind ideale Eigenschaften, um Kontrollmessungen an bestehenden Durchfluss-Messstellen durchzuführen.
Machen Sie die Probe!
Messen und Auswerten leicht gemacht
Ultraschallsensoren aufschnallen, Messumformer anschließen
und Durchfluss erfassen. Die Übertragung der
ermittelten Messwerte ist genauso einfach:
• Datenübertragung via USB-Speicher-Stick auf den Laptop oder PC, beispielsweise für die Weiterverarbeitung mit Windows-Programmen.
• Datenübertragung via Sensorbox auf den Laptop oder PC für das Visualisieren und Auswerten von Messwerten mit dem Endress+Hauser FieldCare-Programm.
http://endress.softwerk.de/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/imgref/DED2B49ADA66C2EBC12575D70047CC19/$FILE/IN016Dde.pdf
Endress+Hauser
Messtechnik
GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
Fax 0 800 EHFAXEN
Fax 0 800 343 29 36
www.de.endress.com
(nach oben)
Für die wirtschaftliche Durchflussmessung von Wasser
Proline Promag 10D/50D
Die schlanke Lösung für kostenbewusste Anwender
- Universell einsetzbar für Trinkwasser, Brauchwasser oder Abwasser
- Kompakter, robuster Messaufnehmer für den platzsparenden Einbau
- Einfaches und passgenaues Zentrieren dank innovativer Gehäusekonstruktion
- Mit weltweit gültigen Trinkwasserzulassungen
- Standardmäßig integrierte Erdungsscheiben aus Edelstahl
• Einheitliches Bedien- und Elektronikkonzept (Proline-Gerätekonzept)
Promag D passt überall
Ob im Wasserwerk oder in der Kläranlage, ob Kühl-, Brauch- oder Trinkwasser – auf das magnetisch-induktive Durchfluss- Messgerät Promag D können Sie sich voll und ganz verlassen. Dieses kostengünstige und robuste Gerät kann für alle gängigen Messaufgaben eingesetzt werden: • Verbrauchsmessung von Wasser in Gebäuden • Kontrollieren des Zu- und Ablaufs von Trinkwasser-Speicherbecken • Regeln von Kühlwasserkreisläufen • Kontrollieren von Hilfskreisläufen • Überwachen der Wasserbilanz in Kläranlagen usw. Promag D ist mit zwei Messumformern kombinierbar: Promag 10 für Basisanwendungen und Promag 50 für Standardanwendungen mit erweiterter Funktionalität. Als kompaktes Zwischenflanschgerät mit geringem Gewicht eignet sich Promag D sowohl für die Montage auf engstem Raum als auch für den Einbau in Kunststoffleitungen. Das innovative Messaufnehmergehäuse garantiert dabei eine schnelle Montage und eine exakte Zentrierung in die Rohrleitung – ohne mechanisches Spiel! Eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit im Messbetrieb sind weitere Leistungsmerkmale, die Promag D kompromisslos erfüllt.
Machen Sie die Probe!
http://endress.softwerk.de/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/imgref/04AAA24CA8B4C632C12575D70047C618/$FILE/IN014Dde.pdf
Endress+Hauser
Messtechnik
GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
Fax 0 800 EHFAXEN
Fax 0 800 343 29 36
www.de.endress.com
(nach oben)
Digitale Sensortechnologie für die Prozessanalysentechnik (PAT)
Neue Strategien der Instandhaltung
Dr. Thomas Steckenreiter (Endress+Hauser), Dr. Armin Weinig (Lanxess)
Der Kostendruck in der Industrie nimmt weiter zu. Es sind heute nicht nur die Energie- und Rohstoffkosten, die permanent an der Produktivität in Industrieanlagen nagen, sondern vor allem die Personal- und Instandhaltungskosten, die die Wettbewerbsfähigkeit deutlich beeinflussen. Dabei gilt es im weltweiten Konkurrenzkampf mehr denn je, eine optimale Produktqualität unter maximal möglicher Produktausbeute sicherzustellen. Dabei muss auch die Sicherheit im Betrieb gewährleistet sein. Leistungsfähige Prozesse bedingen gleichermaßen einen hohen Automatisierungsgrad. Ausgeklügelte Mess-, Steuer-, und Regelsysteme in Verbindung mit automatisierten Prozessführungskonzepten unterstützen den Betreiber, diese Ziele zu erreichen. Der Einsatz von Prozessanalysenmesstechnik ist heute wichtiger Bestandteil der Mess- und Regeltechnik chemischer Anlagen, denn diese liefert auch Daten, die für Produktqualität und Produktausbeute äußerste Relevanz besitzen.
pH-Messtechnik im Betriebsalltag
Gerade die Prozessanalysenparameter – und hierzu zählen auch die pH-Messungen – sind es aber, die häufiger als andere Regelgrößen der regelmäßigen Kalibrierung bzw. Justierung und der regelmäßigen Wartung bedürfen. In den chemischen Produktionsanlagen von Lanxess sind heute im Mittel ca. 25 Prozent der eingesetzten Analysensysteme pH-Messungen. Dabei können diese in einzelnen Betrieben durchaus die Anzahl von zwanzig Systemen überschreiten. So sind zum Beispiel in der Schwefelsäureproduktion ca. 50 pH-Messungen oder in der Eisenoxidproduktion ca.100 pHMessungen installiert. Häufig muss sogar mehrmals pro Woche kalibriert/justiert werden, um im Dauerbetrieb der Anlagen einen reproduzierbaren pH-Wert zu erhalten. Die eingesetzten klassischen, analogen, hochohmigen Systeme sind dabei sehr anfällig gegen Feuchtigkeit, Salzbrücken, EMV-Störungen und Potenzialüberlagerungen. Dies führt dazu, dass Sensor, Kabel und Messumformer zusammen kalibriert werden müssen. Für den Servicetechniker bedeutet dies einen großen Aufwand vor Ort. Fehlerdiagnose ist oft erst wechselweise durch Kabel und/oder Sensortausch möglich. Zusätzlich müssen, um eine Kalibrierung oder Justierung in einer Anlage durchzuführen, Pufferlösungen, Reinigungslösungen und Wasser mitgeführt werden. Ersatzelektroden müssen für den Fall eines erforderlichen Elektrodenwechsels zur Verfügung stehen. In diesem Fall ist auch eine Erstkalibrierung vor Ort erforderlich. Dies alles bedarf der sorgfältigen Vorbereitung und die notwendige Ausrüstung muss sorgfältig verpackt mit in die Anlage genommen werden. Oft befinden sich die Messstellen an schwer zugänglichen Stellen. Dies kann bedeuten, dass der Mitarbeiter auf einer Hebebühne, Leiter oder aber auch in gebückter Haltung arbeiten muss. Zu berücksichtigen ist auch, dass der Servicetechniker sich in der Anlage anmelden muss, die erforderlichen Sicherheitsunterweisungen erhalten haben muss und entsprechende Sicherheitsausrüstungen bei sich trägt. Schwierig wird es bei notwendiger Störungsbeseitigung bei Nacht oder an Wochenenden, denn hierfür müssen die entsprechenden Kräfte eingeplant werden. In allen Fällen steht während des Instandhaltungseinsatzes der Messwert nicht zur Verfügung.
Digitale Sensortechnik – Memosens
Die Sensortechnologie Memosens von Endress+Hauser revolutioniert die Analysenmesstechnik. Heute schon stehen für die Parameter pH, gel. Sauerstoff, Leitfähigkeit und demnächst auch für die Trübungsmesstechnik Sensoren zur Verfügung. Insbesondere für die pH-Messtechnik liefert Endress+Hauser alle Sensortypen, die einen sicheren Anlagenbetrieb ermöglichen. Der Anwender kann zwischen Sensoren mit Flüssig-, Gel- oder Polymerelektrolyt und verschiedenen Diaphragmatypen wie Keramik-, Teflon- oder so genannten offenen Diaphragmen den optimalen Sensor für seinen Prozess auswählen. Inzwischen können auch Email-Sensoren der Firma Pfaudler mit Memosens Technologie angeboten werden. Die ISFET Sensoren runden das Programm ab. Damit kann für jede Applikation der ideale Sensor ausgewählt werden. Ausschlaggebend für die Memosens Technologie ist, dass die Digitalisierung des analogen Messsignals direkt im Sensor stattfindet und dass neben der Übertragung der aktuellen Messdaten alle qualitätsrelevanten Daten, wie z.B. die Temperatur, die Kalibrier-/Justier-Werte, Einsatzort, Gesamtbetriebsstunden und Betriebszeiten bei extremen Prozessbedingungen gespeichert werden. Damit wird eine optimale Messstellenbewertung unabhängig vom Standort möglich. Daneben ist die pH-Messung völlig frei von den Störungen, mit denen man mit der klassischen, analogen Technik zu kämpfen hatte. Mit der Verfügbarkeit der Sensordaten an jedem Ort ist ein Strategiewechsel in der Instandhaltung möglich, der zu einer erheblichen Kostenreduktion führt, im Vergleich zu der bisherigen Arbeitsweise.
Neue Instandhaltungsstrategie bei Lanxess
Durch die Memosens Technologie ist es möglich, alle Instandhaltungsmaßnahmen wie Reinigung, Konditionierung, Regenerierung, Kalibrierung und Justierung der pH-Sensoren an eine zentrale Stelle zu verlagern. Zu diesem Zweck wird bei Lanxess in Leverkusen ein zentraler pH-Service mit einem EDV-gestützten pH-Kalibrierstand („pH-Labor“) aufgebaut, welcher die pHSensoren für die verschiedenen Betriebe wartet und verwaltet. Reproduzierbare Laborbedingungen ermöglichen eine präzisere Kalibrierung und somit eine genauere Prozessführung. Zusätzlich verlängert die regelmäßige Regeneration und Reinigung die Lebensdauer gerade der pH Sensoren. Dieses Konzept erhöht natürlich auch die Verfügbarkeit der pH-Messstellen im Betrieb und spart zusätzliche Kosten, da der Sensoraustausch, der keine speziellen Kenntnisse der pH-Messtechnik erfordert, vom Betriebspersonal durchgeführt werden kann. Die Sensoren müssen vor Ort nur noch durch kalibrierte Sensoren ausgetauscht werden. Das verringert die Wartungszeiten in den Anlagen um mehr als die Hälfte. Ein weiterer essentieller Bestandteil dieser Instandhaltungsstrategie ist ein effektives Daten- und Sensormanagement. Mittels einer neu konzipierten Datenbank (Memobase) werden alle messstellenspezifischen Daten, die Kalibrier-/ Justierdaten sowie die Prozessdaten während der Kalibrierung der Sensoren zentral erfasst und verwaltet. Somit wird der komplette Lebenszyklus eines Sensors von der Einlagerung bis zur Verschrottung verfolgt und analysiert. Messsysteme und Wartungskonzepte können auf dieser Datenbasis analysiert und gegebenenfalls optimiert werden. So wird die vorausschauende Wartung mit verbessertem Assetmanagement zum integrierten Bestandteil der neuen Instandhaltungsstrategie. Die Datenbank Memobase verwaltet alle TAG Nummern und bucht neue Sensoren bestimmten Messstellen, Messstellenkreisen oder Anlagenteilen zu.
Damit sind in der Datenbank die TAG-Nummer, die Seriennummer des Sensors und der Sensortyp, sowie die Daten der Erstkalibrierung unveränderbar miteinander verbunden. In der Datenbank wird durch die Folgekalibrierungen die Sensorhistorie automatisch erfasst und der Applikation zugebucht. Auswertungen zu Qualitätssicherung sind damit jederzeit möglich. Diese Daten können für den Betriebsleiter oder den Qualitätsverantwortlichen aufbereitet oder in Rohfassung zur Verfügung gestellt werden. Erstmalig sind hier systematische Auswertungen über die Performance der Messstellen möglich. Das Führen eines Messstellenbuches ist nicht mehr notwendig. Durch das einfach zu handhabende Tag-Nummern-System ist eine Verwechslung der Sensoren ausgeschlossen und jeder Sensor kommt zuverlässig und unverwechselbar an den Platz, an dem er messen soll. Zur zusätzlichen Sicherheit kann bei den Messumformern der Liquiline Generation die TAG-Nr.-Prüfung und ein Kalibrierzeitalarm aktiviert werden. Damit wird verhindert, dass aus Versehen falsche oder bezogen auf das letzte Kalibrierdatum zu alte Sensoren angeschlossen werden. Das Sensormanagement stellt sicher, dass dem Betriebspersonal immer genügend Sensoren zu Verfügung stehen. Dieses ist somit in der Lage, ohne Fachkraft, Tag und Nacht sowie am Wochenende eine Störung der pH-Messung binnen Minuten zu beseitigen.
Dieses Konzept kann standortübergreifend zum Einsatz kommen. Der pH-Service bei Lanxess sieht sich heute in der Lage, auch als Dienstleister für andere Unternehmen die pH-Messstellen zu betreuen.
Wirtschaftlichkeit der digitalen Sensortechnologie
Es stellt sich die Frage der Wirtschaftlichkeit eines Strategiewechsels in der Instandhaltung von pH-Messungen durch Einsatz der digitalen Sensortechnologie. Im Folgenden werden zwei Fälle betrachtet:
• die Neuinstallation von pH-Messstellen in analoger bzw. in digitaler Technik bei gleichzeitiger Einrichtung des „pH-Labors“
• die Umrüstung von existierenden pHMessstellen auf die Sensortechnologie Memosens
Bei Einsatz der Memosens Technologie erfolgt der Elektrodenwechsel durch das Betriebspersonal ohne zusätzliche Kosten für den Betrieb. Im ersten Fall wird die Neuinstallation von 10 pH-Messstellen angenommen. Im späteren Betrieb werden eine monatliche Kalibrierung und ein 2-maliger Elektrodenwechsel jährlich je Messstelle unterstellt. Ausgehend von den bekannten Zeiten für die Instandhaltung vor Ort und im pHLabor wurden die Gesamtkosten für die Alternativen Analogtechnologie und Memosens Technologie über einen Zeitraum von 5 Jahren ermittelt. Wie die Abbildung zeigt, amortisieren sich die Mehrkosten bei der Installation von digitaler Technik – im Wesentlichen die Kosten für die Installation des „pH-Labors“ – schon nach etwas mehr als einem Jahr, bedingt durch die im Vergleich zur Analogtechnologie geringeren jährlichen Wartungskosten.
Die Wirtschaftlichkeit der Umrüstung von installierter Analogtechnik auf Digitaltechnik wird am Beispiel einer Produktionsanlage bei Lanxess untersucht. Betrachtet wird die Umrüstung von 48 pH-Messstellen in diesem Produktionsbetrieb. Bei der überwiegenden Anzahl der Messstellen wird eine wöchentliche Kalibrierung/Justierung, in Einzelfällen werden sogar drei Kalibrierungen/Justierungen pro Woche durchgeführt. Die Reinigung der Elektroden erfolgt nach messstellenspezifischen Instandhaltungsplänen. Eine vorliegende langjährige Störungsstatistik gibt Informationen über die erforderliche Anzahl von Elektrodenwechseln. Die installierte, analoge Messtechnik verursacht jährliche Instandhaltungskosten von ca. 100.000 €. Eine Umrüstung auf die Digitaltechnik reduziert die jährlichen Instandhaltungskosten auf ca. 45.000 €. Diese Umrüstung erfordert Investitionen von ca. 70.000 €, was einem Return of Investment von etwa 1,5 Jahren entspricht. Es ist klar, dass die Wirtschaftlichkeit einer Umrüstung entscheidend von den Kalibrierund Reinigungsintervallen bestimmt wird, so dass spezifische Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für einzelne Betriebe/Betriebseinheiten durchgeführt werden müssen. Die Auswertungen der bei Lanxess installierten pH-Messstellen mit der Sensortechnologie Memosens zeigen, dass sowohl die Kosten für die Instandhaltung gesenkt, die Qualität der pH-Messung gesteigert und die Lebenszeit der pH-Sensoren verlängert werden können.
http://endress.softwerk.de/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/imgref/326BA6C10900635EC12575DD0024F60B/$FILE/CS024.pdf
Endress+Hauser
Messtechnik
GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
Fax 0 800 EHFAXEN
Fax 0 800 343 29 36
www.de.endress.com
(nach oben)
Maßgeschneiderte Lösungen für die Umweltüberwachung
Immer mehr Kunden fordern schlüsselfertige Gesamtlösungen statt Einzelkomponenten: Der weltweite Trend in der Wasseranalyse geht zu maßgeschneiderten Analysensystemen für vielfältige Anforderungen in der Online-Messtechnik. Die Ansprüche steigen in der Gewässerüberwachung, in Chemieparks, in der industriellen und kommunalen Wasseraufbereitung und in der Trinkwasserversorgung hinsichtlich Verfügbarkeit der Messwerte und der zu überwachenden Parameter. Endress+Hauser und Bayer Technology Services lösen herausfordernde Kundenprojekte.
Lösungen und Konzepte
Bayer Technolgy Services (BTS) und Endress+Hauser Conducta entwickeln gemeinsam mit ihren Kunden Konzepte, die den Anforderungen rund um die Wasseranalytik gerecht werden. Dies beginnt bei der Beratung welche Grenzwerte eingehalten werden müssen bis hin zur Entwicklung von standortübergreifenden Konzepten und deren Umsetzung in passende Gesamtlösungen. Die Zusammenlegung von Industriestandorten zu Industrieparks lässt immer komplexere Organisationen entstehen, die das Reinigen von Abwässern und das Reinhalten von Gewässern verantworten.
Besondere Anforderungen an Einzel- und Gemeinschaftskläranlagen
Die stark verzweigten und kilometerlangen Abwassernetze stellen besondere Anforderungen an Einzel- und Gemeinschaftskläranlagen. Abwässer vieler verschiedener Einleiter unterschiedlicher Wassergüte werden dort gesammelt. Besonders die Abwässer aus Chemie- oder Industrieparks enthalten komplexere Verunreinigungen als das Abwasser aus einem einzelnen Betrieb. Dies erfordert eine detaillierte Analytik an den Knotenpunkten und den Kläranlageneinläufen. Folglich werden die zu überwachenden Prozess- und Stoffströme gebündelt und die Messaufgaben zentralisiert, um die erforderliche Messtechnik effizient einzusetzen und Qualität und Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Komplette Messtechnik für den sicheren Betrieb industrieller Kläranlagen
„Analysen-Container PAT“ bieten ein zukunftsweisendes Konzept für die zentralisierte Abwasseranalytik. Ob als vollklimatisierte Messstationen, Messcontainer individueller Größe oder einfacher Messschrank instrumentiert, „Analysen-Container PAT“ sind mit allen notwendigen Gerätschaften für Wasseranalyse ausgestattet.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Anwender kann unterschiedlichste Abwässer in Chemieparks zentral bewerten und so den sicheren Betrieb der Kläranlage gewährleisten. Die Anlagenbetreiber können die Kosten für die Abwasserreinigung nach dem Verursacherprinzip abrechnen, ihren Instandhaltungsaufwand straffen und optimieren.
Messstation sichert Bukarests Trinkwasser
Seit 2001 versorgt Veolia Apa Nova Bukarest mit Trinkwasser und betreibt das Trinkwassernetz ebenso wie das Abwassernetzwerk. Die drei Trinkwasseraufbereitungsanlagen Crivina, Rosu und Arcuda verarbeiten 780 000 m3 am Tag. Zwei der Anlagen gewinnen das Trinkwasser aus dem Fluss Arges. Flussaufwärts haben sich Automobil- und Petrochemie-Unternehmen angesiedelt. Frühwarnsysteme in der Trinkwassergewinnung sind hier wichtig. Neben Rückständen aus Industrieabwässern wie Kohlenwasserstoffe, Phenole oder Cyanid besteht die Gefahr der landwirtschaftlichen Verschmutzung durch Pestizide oder Stickstoff. Der installierte Analysen-Container dient als Frühwarnsystem zur Entdeckung jeglicher Art von Verschmutzung bevor das Rohwasser in den Aufbereitungsprozess gepumpt wird. So wird die Trinkwasseraufbereitungsanlage Apa Nova geschützt.
Die Kooperationspartner BTS und Endress+Hauser wickelten gemeinsam das Projekt ab. Den Zuschlag erhielten die Kooperationspartner für die umfassende Lösung von der Angebotserstellung über die Inbetriebnahme vor Ort bis hin zum Wartungsvertrag. Veolia nutzte ebenfalls das Angebot eines FAT (Factory Acceptance Test). Bei der Inbetriebnahme schulten Trainer von Endress+Hauser das Servicepersonal vor Ort.
http://www.de.endress.com/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/?Open&DirectURL=8A48A8C42B0966E5C12575CF0049E315
Endress+Hauser
Messtechnik
GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
Fax 0 800 EHFAXEN
Fax 0 800 343 29 36
www.de.endress.com
(nach oben)
Flexdip CYA112/CYH112 – Halterungen und Armaturen für Eintauchanwendungen
Flexdip bringt Sensoren modular und flexibel in den Prozess
Anwendungen
- Wasser- und Abwasseraufbereitungen
- Offene Gerinne und Becken
- Offene Tanks und Prozessbehälter
- Schwankende Pegelstände
Ihre Vorteile
- Einfaches, kostengünstiges und flexibles Baukastensystem
- Halterung weitgehend frei einstellbar in Höhe, Ausladung und Orientierung
- Installation des Halters auf dem Boden, an der Wand, auf der Mauerkrone oder am Geländer möglich
- Montage des Sensors an einem Ausleger mit Kette, fixiertem Tauchrohr oder pendelnd
- Befestigung des Sensors am Geländer
• Schwimmerausführung zum Ausgleich schwankender Pegelstände
Flexdip ist die Lösung für Eintauchanwendungen
Offene Becken, Kanäle und Tanks – wie bringt man in diesen Orten Sensoren zum Arbeiten?
Basierend auf einem modularen und flexiblen Design realisiert
Flexdip nahezu jede Messstelle. Das modulare Konzept reicht von
Armaturen, die am Geländer montiert werden bis hin zu am Geländer
montierten Pendelhaltern, die der Bewegung des Mediums in
verschiedenen Richtungen folgen.
Zusätzlich zum standardmäßigen G1-Gewinde als Sensoranschluss sind andere Anschlussgewinde und Sensorbauformen bis hin zum pH-Sensor mit Hilfe von Adaptern einsetzbar. Mit der Schnellverschraubung können Sensoren ohne Kabelverdrillen montiert werden. Sensoren mit induktivem Memosens-Steckkopf lassen sich hiermit komfortabel einbauen und wechseln.
Verfügbare Flexdip-Varianten:
• Von der vielfach genutzten Standsäule mit Querausleger über die Mauerkronenmontage bis zur Befestigung einer Armatur am Geländer
- Fester Einbau von Sensoren in einer Eintaucharmatur
- Oder: eine gütegeprüfte Kunststoffkette hält den Sensor pendelnd im Prozess, dadurch hohe Selbstreinigung
- Inklusive Schwimmer für variable Pegelstände für Regenüberlaufbecken oder SBR-Anlagen
- Ob kurz, ob lang; ob PVC oder Edelstahl
Flexdip – der modulare und flexible Weg, Sensoren in den
Prozess zubringen.
http://endress.softwerk.de/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/imgref/7D48B1933BAFF062C12575D7003528B1/$FILE/IN048_CYH112_D_71095257.pdf
Endress+Hauser
Messtechnik
GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
Fax 0 800 EHFAXEN
Fax 0 800 343 29 36
www.de.endress.com
(nach oben)
Die Wasserlinse – Leseforum für Fachleute im Abwasserbereich
Themen:
– Das Schlammvolumen verdünnt und unverdünnt. Beobachtungen auf dem Klärwerk Coburg.
– Dynamische Olfaktometrie nach DIN EN 13725:2003
– Klärwerk Waßmannsdorf: Reinigung von keramischen Belüfterkerzen
– Ammonium-Onlinemessungen im Klärwerkseinsatz
Link: http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_0909/09_Wasserlinse.pdf
(nach oben)
SIMONA®PE Platten für den Behälter- und Apparatebau
SIMONA hat jahrzehntelange Erfahrung in der Auswahl geeigneter Werkstoffe (u. a. Polyethylen), technischer Beratung und der Berechnung von Behältern. Im folgenden Beitrag werden verschiedene Klassifizierungsmaßstäbe für Polyethylen erläutert. Polyethylene werden in der Praxis hauptsächlich nach den Kriterien Dichte, Molekulargewicht und Zeitstandverhalten eingeteilt. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass sich verschiedene PE Typen in einem Kriterium unterscheiden, während sie bei den beiden anderen in die gleiche Gruppe fallen.
1. Dichte (= spezifisches Gewicht) Die Dichte steht in direktem Zusammenhang mit der Kristallinität des Materials. Je höher die Kristallinität, desto höher auch die Dichte. Die Kristallinität wiederum hängt vom Aufbau der Molekülkette (z. B. Anzahl und Länge von Verzweigungen) ab. Tabelle 1 zeigt die verschiedenen Dichte- Bereiche mit der Nomenklatur, wie sie für PE Typen verwendet werden.
2. Molekulargewicht Das Molekulargewicht enthält eine Information über die „Länge“ der Molekülketten. Da nicht alle Molekülketten
mehr unter: http://www.simona-de.com/de/service/newsletter/newsletter_pdf/2009-02-SIMONAreport.pdf
(nach oben)
Rohrvortrieb: Die grabenlose Alternative für die Kanalherstellung
Das 1923 gegründete Tiefbauunternehmen Michel Bau verfügt auf dem anspruchsvollen Gebiet der Rohrvortriebstechnik über langjährige Erfahrung. Dieses Verfahren zur Herstellung von Kanälen ent- spricht in besonderem Maß den heutigen Forde- rungen nach Baustellen mit möglichst geringen Störungen des Umfelds. Da ein Rohrvortrieb nur eine Start- und Zielbaugrube benötigt, werden die ne- gativen Faktoren eines Bauvorhabens, insbesondere Verkehrsbehinderungen, drastisch reduziert. Darüber hinaus ist dieses Verfahren oftmals wirtschaftlicher und in bestimmten Fällen (beispielsweise im Bereich von Autobahnen, Gleis- oder Hafenanlagen) sogar die einzig mögliche Technik der Kanalverlegung. Die Michel Bau beherrscht den Rohrvortrieb seit 1985 und hat seitdem zahlreiche anspruchsvolle Projekte erfolgreich durchgeführt. Dank eines umfassenden Leistungsspektrums können die Auftraggeber Kom- plettlösungen aus einer Hand nutzen. Von der Pro- jektentwicklung, der technischen Beratung und der Erarbeitung von Sondervorschlägen über die Ausfüh- rung (einschließlich Herstellung der Start- und Ziel- baugruben, Aufbau der Wasserhaltung usw.) bis zur Abnahme. Es werden alle Bereiche abgedeckt, seien es Schutzrohre für Kabel und Gas-, Wasser- und Fern- wärmeleitungen oder Produktrohre für Schmutz- und Regenwasser. Unterschiedliche Rohrmaterialien (Steinzeug, Stahl, GFK, Beton und Polymerbeton) können im Rohrvortriebsverfahren eingesetzt wer- den. Durchmesser von DN 150 bis DN 3200 in Längen von 5 m bis zu 150 m sind realisierbar. Je nach Anforderung an die Zielgenauigkeit erfolgt der Vortrieb ungesteuert oder gesteuert mittels Lasertechnik. Neben dem Rohrvortrieb beherrscht die Michel Bau weitere grabenlose Verfahren wie das Berst-Lining (eine Rohrsanierung, bei der ein neues Rohr in das alte eingezogen und dieses mittels eines Schneidkopfes zerstört wird), die hydraulische Rohr- rammung und den Stollenvortrieb (,,Kölner Verzug“)
mehr unter: http://www.michelbau.de/down/rohrvortrieb_deutsch.pdf
(nach oben)
Die erfolgreiche Kanalsanierung in Mumbai/Indien… …
war für die Michel Bau GmbH & Co. KG ein besonderes Projekt. Das mittelständische Unternehmen aus Neumünster gründete für diesen Auftrag ein Joint Venture mit einem österreichischen Bauunternehmen und trat im Prequalifizierungsprozess für das 8,6-Mio- Dollar-Projekt gegen renommierte, internationale Großkonzerne an. Michel Bau setzte sich durch und überzeugte das ausschreibende australische Ingenieur-Büro TTI, die finanzierende Weltbank und die Verwaltung Mumbais (MCBM) mit ihrem Konzept. Aufgabe Zu sanieren waren 4,3 Kilometer Schmutzwassersiel unterschiedlicher Eiprofil-Durchmesser in neun unterschiedlich langen Straßenzügen. Eine weitere Vorgabe war, den Querschnittsverlust unter vier Prozent zu halten. Die Bedingungen waren nicht einfach, in einer 19-Mio-Einwohner-Stadt, deren Versorgung weiterlaufen sollte und die denkbar engen Raum für Baustelleneinrichtungen ließ. Ausgewählt unter zwölf Bewerbern wurde die Michel Bau wegen ihres speziellen Inlinerverfahrens. Dabei wurden Rohre aus glasfaserverstärktem Kunststoff in die beschädigte Kanalisation einge- führt und wasserdicht miteinander verbunden. Ablauf Die ersten Michel Bau-Spezialisten begannen…
mehr unter: http://www.michelbau.de/down/Sanierungsprospekt_D.pdf
(nach oben)
Lötschberg Basistunnel Marti AG MoosseedorfARGE MBK Raron
Problemstellung:
Bei der Kiesaufbereitung muss der Feinanteil, der bautechnisch nur schlecht genutzt werden kann, mittels Kies- und Sandwäscher abgetrennt werden. Aus Kostengründen und behördlichen Vorschriften werden die Waschwässer gereinigt und in den Wasserkreislauf zurückgeführt. Zur Waschwasserklärung und Schlammentwässerung wird Flockungsmittel eingesetzt. Auf Grund der sich geänderter Gesteinsart blieb mit dem derzeit im Betrieb eingesetzten Flockungsmittel (Pulver) das Überwasser des Lamellenklärers milchig-trüb. Des weiteren musste die Zugabe an Flockungsmittel drastisch erhöht werden. Das trübe Überwasser sowie die Überdosierung führte zu Problemen bzgl. der Qualitätssicherung der neuen Rohstoffe.
Problemlösung:
Die REIFLOCK Abwassertechnik GmbH wurde von der Marti AG beauftragt ein optimales Flockungsmittel zu finden. Folgende Anforderungen wurden an das Flockungsmittel gestellt:
1. Breitbandige Wirkung auf Grund der sich ändernden
Gesteinszusammensetzung.
2. Überwasser muss frei von Feststoffen sein (Klarwasser)
3. Reduzierung des Flockungsmittelverbrauchs
4. Flockungsmittel soll auch zur Schlammentwässerung
eingesetzt werden können
Aus dem umfangreichen Sortiment der REIFLOCK wurden die geeigneten Flockungsmittel einem Laborversuch unterzogen. Im Laborversuch wurden unsere Flockungsmittel mit der jeweiligen Gesteinsart auf ihre Wirksamkeit geprüft. Dabei wurde Flockengröße/ -stabilität, Entwässerbarkeit und Dosierung festgehalten und bewertet. Nach Auswertung der Laborversuche wurde mit dem gefundenen Flockungsmittel ein Vorortversuch auf der Anlage durchgeführt. Schon nach der ersten Zugabe stellte sich nach kurzer Zeit wieder ein klarer feststofffreier Überlauf am Lamellenklärer ein. Durch weitere Optimierungen konnte der Versuch gegenüber dem vorigen Flockungsmittel um nahezu 30 % reduziert werden. Auch auf der Schlammentwässerung hat sich das REIFLOCK -Flockungsmittel bewährt.
http://www.reiflock.de/html/aktuell/aktuell_u.html?&home=true&artikel=25&m=2
(nach oben)
Kläranlage Mindelheim
Interview mit Herrn Betriebsleiter Lutz von der KA Mindelheim
Fragen über die Umrüstung der Kammerfilterpresse auf das ReiControl-System:
1. Wie kamen Sie bei der Entscheidungsfindung zur Umrüstung Ihrer
Kammerfilterpresse auf die Firma REIFLOCK?
Ich wurde durch diverse Empfehlungen anderer Kläranlagen auf die Firma REIFLOCK
aufmerksam. Es wurden im Vorfeld mit verschiedenen Mitbewerbern Vorversuche
durchgeführt.
Die Firma REIFLOCK hatte bei den Vorversuchen die besten Ergebnisse erzielt.
2. Was können Sie uns über das Preis-Leistungsverhältnis dieser Investition sagen?
Es werden Einsparungen bei den Entsorgungskosten erzielt. Durch die Automatisierung
mittels dem ReiControl-System ist eine hohe Betriebssicherheit gegeben. Zusätzlich hat
sich eine Reduzierung der Betriebsüberwachung eingestellt.
3. Können Sie uns Angaben bezüglich der Investitionentscheidung bzw. der für die
Kläranlagen wichtigen Kosten/Nutzenrechnung machen?
Die Investitionsentscheidung wurde durch Vorversuche geprüft. Die in den Vorversuchen
erzielten Ergebnisse haben sich bewährt.
4. Wie beurteilen Sie die Vorgehensweise der Fa.REIFLOCK bezüglich der
Entscheidungsfindung zur Umrüstung bzw. Optimierung der
Schlammentwässerung?
Die Firma REIFLOCK bietet einen schnellen und unproblematischen Service bei der
Umsetzung der Umrüstung sowie bei der Optimierung der Kammerfilterpresse. Wir können
die Firma REIFLOCK mit bestem Gewissen weiterempfehlen.
Die Firma REIFLOCK bedankt sich herzlich für das Interview bei Herrn Betriebsleiter Lutz
http://www.reiflock.de/html/aktuell/aktuell_u.html?&home=true&artikel=25&m=2
(nach oben)
Lötschberg Basistunnel
Problemstellung:
Die beim Vortrieb anfallenden Tunnelabwässer (ca. 80l/s) sollen in die Rhone eingeleitet werden. Zur Einhaltung der Wasserqualität wurde von der Behörde der Grenzwert an ungelösten Stoffen (Schwebstoffe) auf 20 mg/l festgelegt. Allein durch das dafür gebaute Absetzbecken konnte der Grenzwert nicht erreicht werden.
Problemlösung:
Die REIFLOCK Abwassertechnik GmbH wurde von der ARGE MaTrans beauftragt, das Absetzverhalten der problematischen Schlammabwässer zu optimieren um den geforderten Grenzwerten gerecht zu werden. Da aufgrund der örtlichen Verhältnisse keine baulichen Veränderungen bzw. der Bau eines weiteren Absetzbeckens nicht möglich war, sollte das Absetzverhalten mittels Zugabe von Flockungsmittel verbessert werden.
Im Laborversuch wurden die Eigenschaften bzgl. Abwasserzusammensetzung und Auswahl des geeigneten Flockungsmittel bestimmt. Die Dosiermenge und -stellen wurden bei Vorortversuchen festgelegt. Nach Abschluss der positiven Versuche entschloss man sich die entsprechende Technik direkt im Tunnel zu installieren. Aufgrund der beengten Örtlichkeiten wurde die Ansatz- und Dosierstation Reifomat 500 sowie das Flockungsmittelgebinde direkt über dem Ablaufgerinne installiert. Trotz den problematischen Umgebungsbedingungen (Staub, Feuchte, Temperatur) hat sich die Dosieranlage Reifomat 500 in der Praxis bis heute bewährt.
Seit dem Betrieb der REIFLOCK-Technik und der Dosierung von REIFLOCK Flockungsmittel werden alle geforderten Grenzwerte eingehalten. Mit der o.g. Technik wurde der Schwebstoffgehalt auf 3mg/l gesenkt. Der geforderte Schwebstoff-Gehalt von 20 mg/l wird damit deutlich unterschritten und stellt kein Problem mehr dar.
http://www.reiflock.de/html/aktuell/aktuell_u.html?&home=true&artikel=20&m=2
(nach oben)
Mit moderner Regelungstechnik auf dem Weg zur Abgabenfreiheit
PRAXISBERICHT
REGELUNGSSYSTEM SC 1000 / NITRATAX PLUS / LDO
Ladbergen (Regierungsbezirk Münster, Nordrhein-Westfalen) verfügt über
eine der leistungsfähigsten Kläranlagen der gesamten Region. Das ist umso
erstaunlicher, je mehr die äußerst schwierigen Zulaufbedingungen mit
CSB-Werten von zeitweise bis zu 3.000 mg/l berücksichtigt werden. Mit
erheblichen Umbauten auf der Anlage, einer ebenso ungewöhnlichen wie
mutigen Klärschlamm-Vererdung und dem modernen Regelungs-System
OptiNox der Fa. KLEINE sorgte das Betriebspersonal binnen weniger Jahre
für diese Spitzenstellung. Solides Fundament sämtlicher Optimierungserfolge
ist die zuverlässige Analytik der Prozess-Messtechnik.
Den ganzen Artikel lesen Sie unter:
http://www.hach-lange.de/shop/action_q/download%3Bdocument/DOK_ID/14786953/type/pdf/lkz/DE/spkz/de/TOKEN/eLZ-eMtIxO0GRF4jJx6xVj-CKdI/M/GSkhkw
(nach oben)
Robuste Klärwerks-Gleitringdichtung (GLRD) für Pumpen, Förderschnecken, Rührwerke
In Klärwerksanwendungen kommen vielfach Balg-Gleitringdichtungen, sowohl Gummibalg-,
wie auch Metallfaltenbalg-Gleitringdichtungen zum Einsatz.
Für bestimmte Einsätze sind diese Art von Gleitringdichtungen (GLRD) durchaus geeignet.
In einigen Anwendungen haben Balg-Dichtungen ihre Begrenzungen, so z. B. besteht die Gefahr des Verstopfens durch langfaserige Feststoffe und Fremdkörper, bei langsam-drehenden Wellen wird der Balg nicht „freigeschleudert“ und Ablagerungen setzen sich zwischen die Lamellen; Ermüdung des Balgmaterials kann vorzeitig eintreten, rotierende Befederung kann Schiefstellungen nicht ausgleichen etc.
Die GLRD Typ 210N (siehe Abb.) hat geschützte, gekapselte Federn, dadurch kein Verstopfen und Zusetzen; durch die stationäre Anordnung wird Schiefstellung kompensiert, der dynamische O-Ring bewegt sich immer zur sauberen Seite hin, dadurch kein Festbacken, die Flexibilität der GLRD bleibt erhalten.
Zur weiteren Feststoffbeständigkeit und Verschleißfestigkeit hat die GLRD einen massiven Wolframkarbid-Gegenring und als Gleitring einen massiven Siliziumkarbid-Ring aus dem tribologisch vorteilhaften Q2-(SiSiC-) Material.
Die Gleitringdichtung ist beständig bis
28 bar, hält jedoch z.B. bei Rückspülung – auch bei Vakuum zu. Abmessungen von
24 mm Wellendurchmesser bis 130 mm in den gängigen Abstufungen.
Die GLRD Typ 210N ist speziell auf die Anforderungen in Klärwerken ausgelegt, dabei aber universell sowohl in Pumpen, Rührwerken und Förderschnecken einsetzbar.
http://www.chetra.de/web/aktuell_robuste_klaerwerks_glrd.htm
(nach oben)
Langzeit-Gleitringdichtung für Klärwerks-Pumpen
In Klärwerken durchläuft Abwasser diverse Stadien der Reinigung und Aufbereitung. Dabei kommen sowohl bei der Vorklärung wie auch bei der Schlammumwälzung und -aufbereitung Pumpen zum Einsatz.
Zur Abdichtung werden in der Regel einfachwirkende Gleitringdichtungen (GLRD) eingesetzt.
Aufgrund der hohen Feststoffanteile im abzudichtenden Medium, abrasiver Bestandteile
(z. B. Sand) und einem pH-Bereich, der sowohl im sauren wie auch im basischen Bereich liegen kann, sind geeignete Dichtungswerkstoffe und -ausführungen erforderlich.
Die GLRD Typ 700 wird diesen Erfordernissen gerecht und bietet hohe Wirtschaftlichkeit durch Erreichen von Standzeiten im Bereich von 10 Jahren und darüber.
Diese GLRD ist eine Metallfaltenbalg-Dichtung mit „selbstreinigendem“ Lamellen-Balg aus korrosionsbeständigem Inconel (T.M. Cabot), Hartmetall-Gleitflächen und Fluor-Kautschuk (Viton® fluorelastomere*) ) als Nebendichtung. Der Wegfall einer Feder zum Schließen der Gleitflächen, ersetzt durch den Metallbalg als dynamisches Dichtelement, macht die GLRD weniger empfindlich für Ablagerungen und Verschmutzungen.
Durch geeignete Zusatzmaßnahmen wird die Wirtschaftlichkeit weiter erhöht; so ist in vielen Fällen eine dauernde Frischwasser-Spülung nicht erforderlich. Gelegentliches Spülen im Zeitraum von 2-4 Wochen für ca. 1-2 min. reicht aus.
In anderen Fällen hat sich die Anbringung einer Fettschmierung des Stopfbuchsraumes und gelegentliches Nachspeisen mittels Fettpresse bewährt.
Eine weitere Vereinfachung der Instandhaltung wird durch den Einsatz dieser Art GLRD als vormontierte einbaufertige Cartridge-Dichtung Typ 270 erzielt.
*) Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen der DuPont Performance Elastomers.
http://www.chetra.de/web/aktuell_klaerwerk.htm
(nach oben)
Erfahrungen mit der biologischen Phosphorelimination im Klärwerk Regensburg
Nach der umfangreichen Erweiterung der Kläranlage in den Jahren 1999-2002
konnte erstmals eine biologische Phosphor-Elimination durchgeführt werden. Es
traten jedoch erhebliche unerwünschte Begleiterscheinungen wie stark erhöhter
Schlammindex, Schaumbildung und Probleme beim Betrieb des Faulturms
auf, die den gesamten Anlagenbetrieb behinderten. Erst durch die Reduzierung
der biologischen P-Elimination und gezielten Fällmitteleinsatz konnten die Problemewieder beseitigt werden.
Schlussfolgerung
Am Ende bleiben jedoch die Vorteile eines stabileren Betriebes der Biologie.
Damit verbunden ist jedoch auch deutlich weniger „man power“ erforderlich, die man zur Bekämpfung der unangenehmen Begleiterscheinungen der Bio-P einbringen muss. Es stellt sich also abschließend die Frage …
Den ganzen Artikel lesen Sie unter:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_0308/wl08_praktiker.pdf
Autor:
Johann Nuber
Klärwerk Regensburg
Am Kreuzhof 2
93055 Regensburg
Tel.: +49 (0)941-5071831
Fax: +49 (0)9410941-5071849
em@il: Nuber.Johann.Amt65@regensburg.de
(nach oben)
Kreide im Einsatz auf Kläranlagen
Ein Naturprodukt als Trägermaterial für die Belebungs-Biologie
Die Mikrostruktur der Kreide zeigt heute ihre Vorteile bei dem Einsatz in Kläranlagen. Zum einen besitzen die Partikel von Natur aus eine Teilchengröße von wenigen Mikrometern, zum anderen ist damit eine für Calciumcarbonate außergewöhnlich große Oberfläche von bis zu 6 m2/g verbunden. Das natürliche Produkt Kreide hat sich als gut suspendierbarer Stoff für den Einsatz in der biologischen Abwasserbehandlung bewährt. Kreide eignet sich hervorragend zur Bildung eines Kalk-Kohlensäure- Gleichgewichtes. Es löst sich gerade soviel der Kreide, wie zur Bindung der aggressiven Kohlensäure notwendig ist. CaCO3 + CO2 = Ca(HCO3)2 Der nicht gelöste Anteil stützt die Flockenstruktur der Biologie und bietet den Bakterien eine ideales Gerüst zum Aufwachsen. Viele Betreiber von Kläranlagen kennen die Probleme, die starke Regenfälle besonders im Herbst oder Frühjahr mit sich bringen. Die erhöhten Wassermassen bringen für so manchen Kläranlagenmeister ernsthafte Probleme mit sich. Aufgrund der hydraulischen Belastung kommt es schnell zu Abtrieb von Suspensa. Handelt es sich dann noch um sehr weiches Wasser, fehlt die Säurekapazität, um eine ausreichende Nitrifikation zu erzielen. Schnell läuft man Gefahr, die Ablaufwerte nicht einhalten zu können und bis Gegenmaßnahmen
wirken, kann es manchmal schon zu spät sein. Kommt dann noch mit dem Temperaturwechsel im Frühjahr verstärktes Fadenwachstum dazu, lässt sich der ordnungsgemäße Betrieb der Kläranlage meist nur noch mit einem hohen Aufwand an Additiven und Arbeitszeit gewährleisten. Als Beispiel für den Einsatz von Kreide sollen hier zwei Kläranlagen genannt werden…
Den ganzen Artikel lesen Sie unter:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_0308/wl08_kreide.pdf
Wolfgang Kallen
Abwassertechnologie & EDV
Dirk Kosemund
Vereinigte Kreidewerke Dammann KG
Kontakt:
Vereinigte Kreidewerke Dammann KG
Hildesheimer Straße 3
31185 Söhlde
Andrea Ermer
Tel.: +49 (5129) 78204
Dirk Kosemund
Tel.: +49 (5129) 78221
(nach oben)
Höchste Messgenauigkeit in der Durchflussmesstechnik mittels Kreuzkorrelation
Durchflussmessungen in großen Rohren und offenen Gerinnen stellen auch heute
noch besondere Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik. Seit einiger
Zeit gibt es jedoch anwenderfreundliche Messgeräte auf Ultraschallbasis, die
mit Hilfe der Kreuzkorrelation vorher nicht erreichbare Genauigkeiten bieten
Ersatz einer unzulänglichen
Venturimessung im Zulauf einer
Kläranlage
Für eine rückstaubehaftete Venturimessung
musste zur Mengenbegrenzung
der Kläranlage eine Alternative
gefunden werden. Die Messung
hatte den Anforderungen der EKVOBayern
zu entsprechen. Aus Kostengründen
sollte die Lösung in den
bestehenden Baukörpern umgesetzt
werden. Der aus strömungstechnischer
Sicht einzig mögliche Messort ….
Den ganzen Artikel lesen Sie unter:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_0308/wl08_messgenauigkeit.pdf
Kontakt:
NIVUS GmbH
Im Täle 2
D-75031 Eppingen
Tel.: 07262 / 91 91-0
Fax: 07262 / 91 91-999
em@il: info@nivus.com
Internet: www.nivus.de
(nach oben)
Durchmischung, das Stiefkind der Schlammfaulung?
In Zeiten stetig steigender Strompreise wird ein Plädoyer für mehr Durchmischung
des Faulschlamms vielleicht zu einem Stirnrunzeln bei so manchem
Anlagenbetreiber führen. Aber ist es wirklich der richtige Weg, Störungen, wie
etwa ein regelmäßiges Überschäumen des Faulturmes, zu riskieren, nur um etwas
Strom zu sparen? Es ist zwar allgemein anerkannt, dass eine ausreichende
Durchmischung bei der Faulung wichtig ist, aber leider wird diese Tatsache in
der Praxis viel zu wenig beachtet., mehr unter:
http://www.die-wasserlinse.de/download/ausgabe_0308/wl08_durchmischung.pdf
Autor:
Dipl.-Ing. Bianka Muckenschnabl
UAS Messtechnik GmbH
Verfahrenstechnik, Wasser-,
Abwasserbehandlung
Prof.-Hermann-Staudinger-Str. 4
D-94227 Zwiesel
Tel.: +49 (0)9922 500943-13
Fax: +49 (0)9922 500943-10
em@il: info@uas.de
www.uas.de
(nach oben)
Neue Messtechnik und Steuerung gewährleisten zuverlässigen Betrieb des Regenbeckens
Die rund 400 Einwohner umfassende Gemeinde Bözen zählt zu den ältesten Weinanbaugebieten im Kanton Aargau (Schweiz). Gemeinsam mit 4 umliegenden Gemeinden wurde schon vor Jahren ein Abwasserverband gegründet. In dessen Einzugsgebiet liegt auch das Regenbecken der Gemeinde Bözen. Das Abwasser des Verbandes wird in einer gemeinsamen Kläranlage, welche sich am Ortsausgang der am tiefsten liegenden Gemeinde befindet, gereinigt.
Fallbeispiel als PDF herunterladen
http://endress.softwerk.de/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/imgref/56B4AE9F35649240C12575220031696F/$FILE/CS007Bde_20_Regenbecken_Boezen.pdf
(nach oben)
Audi Neckarsulm investierte in eine hochmoderne Abwasseraufbereitungsanlage.
Für optimale Werte sorgen Endress+Hauser Komponenten.
Bei Audi in Neckarsulm fallen täglich bis zu 1000 m3 Abwasser aus unterschiedlichen Produktionsbereichen, wie beispielsweise den Vorbehandlungsanlagen der Lackiererei oder auch der Aluwaschanlage an.
Für die Abwasserbehandlung hat Audi ca.1,6 Millionen Euro in eine hochmoderne Abwasseraufbereitungsanlage der Firma CHRIST GOEMA aus Vaihingen/Enz investiert. Für den sicheren Betrieb und die Einhaltung der Grenzwerte sorgen ausschließlich Endress+Hauser Messgeräte und Komponenten.
Mehr Informationen über die Abwasseraufbereitungsanlage
http://www.de.endress.com/eh/sc/europe/dach/de/home.nsf/?Open&DirectURL=E32221BCD02EBCACC12575220032EDDD
(nach oben)
Besonders stabil: mit NH4 + NO3 + O2 intermittierend regeln
EIN PRAXISBERICHT
Für ein Höchstmaß an Betriebssicherheit und Abbauleistung sorgt in Rhede
(NRW, Deutschland) die Zusammenarbeit zwischen einer Nitratsonde
und einer Ammonium-Elektrode. Sie regeln in der intermittierend
belüfteten B-Stufe einer A-B-Anlage die Stickstoff-Elimination nach beiden
Parametern. Industrielles Abwasser macht hier eine hochbelastete A-Stufe
notwendig und verlangt danach eine zuverlässige und sichere Überwachung
dieser relevanten Stickstoff-Paramter. Nur mit beiden Prozess-Messgeräten
zusammen kann die Kläranlage konstant niedrige Auslaufwerte erzielen.
Den ganzen PRAXISBERICHT lesen Sie unter:
http://www.hach-lange.de/shop/lkz/DE/spkz/de/DOK_ID/14787219/type/pdf/action_q/download%3Bdocument/TOKEN/EP3wXNxF3ezKN7rLE4bZ8bV9wgU/M/UyAxvA
(nach oben)
Optimale Nährstoffverhältnisse für die Abwasserreinigung
EIN PRAXISBERICHT
Um die gesetzlichen Anforderungen an das gereinigte Abwasser einhalten zu
können, muss der Kläranlagen-Betreiber den Reinigungsprozess sorgfältig
steuern, um möglichen Überschreitungen der Grenzwerte rechtzeitig entgegenzuwirken.
Neben den physikalischen und chemischen Verfahren beruht
die Abwasseraufbereitung im wesentlichen auf der biologischen Behandlung
durch die Mikroorganismen des Belebtschlammes. Für eine optimale Reinigungsleistung sind daher Kenntnisse über die Nährstoffbedürfnisse und die
Zusammensetzung des Belebtschlammes von großer Bedeutung. Ursachen,
Folgen und Gegenmaßnahmen für ungünstige Nährstoffverhältnisse werden
in diesem Bericht dargestellt.
Den ganzen PRAXISBERICHT lesen Sie unter:
http://www.hach-lange.de/shop/action_q/download%3Bdocument/DOK_ID/14785905/type/pdf/lkz/DE/spkz/de/TOKEN/EYfcpOkkdjG41dyTZut-2qaUbaI/M/HLPVBQ
(nach oben)
Das Frühwarnsystem in der Nachklärung
EIN PRAXISBERICHT
Keine Partikel dürfen unbemerkt die Nachklärbecken der Kläranlage in Konstanz
am Bodensee verlassen. Die Auflagen der Bodenseerichtlinie verlangen
die uneingeschränkte Aufmerksamkeit in der Auslaufüberwachung
– sowohl bei gelösten als auch bei ungelösten Substanzen. Letztere rechtzeitig
zu erkennen und einen drohenden Schlammabtrieb zu verhindern, ist die Aufgabe
der Schlammspiegel-Messgeräte vom Typ SONATAX sc. Gleich vier
dieser hochsensiblen Geräte überwachen kontinuierlich die Sedimentation
und greifen im Notfall in die Rücklaufschlamm-Regelung ein.
Den ganzen BERICHT lesen Sie unter:
http://www.hach-lange.de/shop/action_q/download%3Bdocument/DOK_ID/14786714/type/pdf/lkz/DE/spkz/de/TOKEN/HsR_qSPxX5W2e6lk0t00Ary7HrQ/M/UvdHOg
(nach oben)
Havarie-Schutz durch NH4D sc Ammonium-Elektrode
EIN PRAXISBERICHT
Waibstadt, zwischen Heidelberg und Heilbronn gelegen, betreibt eine der leistungsfähigsten Kläranlagen Deutschlands. Obwohl die auf 21.000 EW ausgelegte
Anlage mit mehr als 110 % (23.500 EW) belastet wird, bewegen sich
die Auslaufkonzentrationen mancher Stichproben in der Nähe der analytischen
Bestimmungsgrenzen. Lediglich extreme Stoßbelastungen
können die makellose Abbauleistung dieser Ausnahme-Kläranlage unterbrechen
– allerdings nur kurzfristig, denn eine NH4D sc Ammonium-Elektrode
wacht als Havarie-Sensor im Belebungsbecken kontinuierlich über alle
Einleitungen und reagiert sofort.
Den ganzen PRAXISBERICHT lesen Sie unter:
http://www.hach-lange.de/shop/action_q/download%3Bdocument/DOK_ID/14786828/type/pdf/lkz/DE/spkz/de/TOKEN/700LXeZKzurARNojmW5cms1CmXQ/M/d7gNBA
(nach oben)
Elimination und Bestimmung von Phosphat-Verbindungen
Vermehrtes Algenwachstum, das schlimmstenfalls bis zum Umkippen eines
Gewässers führen kann, ist u. a. eine Folge von erhöhten Phosphat-Konzentrationen.
Gesetzliche Grenzwerte für PO4-P bei Abwassereinleitungen
sollen Bilder wie oben verhindern. Auf Kläranlagen wird deshalb eine gezielte
P-Elimination durchgeführt: Biologisch in Verbindung mit Nitrifikation/Denitrifikation
und/oder chemisch mit entsprechenden Fällungsmitteln. Eine zuverlässige
PO4-P-Analytik ist hierbei nicht nur für die Grenzwertüberwachung
unentbehrlich sondern auch für die optimale – und somit möglichst kostengünstige
Steuerung der P-Elimination…
Den ganzen PRAXISBERICHT lesen Sie unter:
http://www.hach-lange.de/shop/action_q/download%3Bdocument/DOK_ID/14786785/type/pdf/lkz/DE/spkz/de/TOKEN/U-b_iUPWRQ8JdqPqVfj2fTIiPas/M/Z8USzg
(nach oben)
Hohe Betriebssicherheit und niedrige Betriebskosten
Eine konstante Absenkung der Investitions- und
Betriebskosten durch Einsatz neuer Techniken bei
den modernen Phosphat-Analysatoren einerseits und
gestiegene Kosten für Fällmittel, Schlammentwässerung
und -entsorgung andererseits sind die Hauptgründe,
dass die automatische Regelung auf kleinen
Kläranlagen Einzug hält.
Ablesen lässt sich die Veränderung auch aus Berichten
in der Fachpresse. Wurde die Grenze der Wirtschaftlichkeit
für eine Regelung 1997 noch bei einer
Größe von. 35.000 EW gesehen, spricht man im
Jahr 2005 schon von einem ökonomischen Limit bei20.000 EW
Den gesamten Bericht lesen Sie unter:
http://www.hach-lange.de
(nach oben)
BELÜFTUNGSREGELUNG MIT SC 1000 / AMTAX SC / LDO
PRAXISBERICHT
„Wenn wir abends nach Hause gehen, wollen wir auch das Gefühl haben,
erfolgreich für die Umwelt gearbeitet zu haben“, sagt Harald Heins,
Betriebsleiter der Kläranlage in Harsefeld (Niedersachsen, Deutschland). Bei
Nges <5 mg/l und einem CSB von 30 mg/l im Ablauf darf er auch mit einem
guten Gefühl nach Hause gehen. Seit Frühjahr 2007 reduziert seine Belüftungsregelung
auf SC 1000-Basis zudem die Betriebsstunden der
Belüftungswalzen um bis zu 20 %. „Obwohl wir in den nächsten Jahren ein
Prozess-Leitsystem installieren werden, bleibt es bei dieser kleinen, funktionierenden
Einheit. Warum sollten wir daran etwas ändern?“
Den ganzen Bericht lesen Sie unter:
http://www.hach-lange.de/shop/
(nach oben)
Betriebsoptimierung mit der NH4D sc ISE Ammonium-Sonde
Die Idylle trügt, denn der beschaulich wirkende Umlaufgraben
der Kläranlage Rommerskirchen-Villau (5.000 EGW) könnte durchaus
sparsamer mit dem Sauerstoffeintrag umgehen. Der Betreiber dieser Anlage,
der Erftverband mit Hauptsitz in Bergheim, hat sich deshalb entschieden, eine
→ Betriebsoptimierung durchzuführen.
Diese Situation findet sich auf vielen → kleineren bis mittleren Anlagen, die
ohne nennenswerte Ausstattung mit moderner Messtechnik kaum Einblick in
die Aufbereitungsprozesse haben. Mit der Entwicklung kostengünstiger und
einfacher aufgebauter → Prozess-Messgeräte, die → ohne Probenaufbereitung
arbeiten, lässt sich künftig auch hier an vielen Stellen → Energie sparen.
Lesen Sie den ganzen Bericht hier:
Fir-Lit-Pub-Lange-NH4D.pdf
(nach oben)
Telemetrie für Anlagensicherheit auf höchstem Niveau
Zuverlässigkeit ist besonders bei Regelungen ein zentrales Thema, die entweder
Betriebskosten senken oder Grenzwerte einhalten müssen.
Gleich beides wird von der externen Kohlenstoffzugabe auf der Kläranlage in
Radolfzell am Bodensee verlangt! Um dieser anspruchsvollen Doppelaufgabe
gerecht zu werden, versorgen Prozess-Messgeräte das Leitsystem ständig
mit Messdaten und signalisierungen per Telemetrie ihre Einsatzbereitschaft.
Deutlich ist seither die Anzahl der Grenzwertüberschreitungen zurückgegangen
und die Ersparnis bei der C-Dosierung beläuft sich auf bis zu 8.000 €
jährlich.
Lesen Sie den ganzen Bericht hier:
Fir-Lit-Pub-Lange-Telemetrie.pdf
(nach oben)
Die richtige Prozess-Messtechnik für den N- und P-Abbau
Im Zuge der → weitergehenden Abwasserreinigung entstanden neue Aufbereitungsverfahren
für die Parameter rarr; Stickstoff und Phosphor. Heute rücken
steigende Kosten den rarr; wirtschaftlichen Einsatz von Energie und Hilfsstoffen
immer stärker in den Mittelpunkt. Die rarr; Steuerungs- und Regelungstechnik
allein ist dieser Herausforderung nicht gewachsen. Gezielte Eingriffe in die
Aufbereitungsprozesse zur nachhaltigen Kostensenkung gelingen nur unter
Einbindung geeigneter rarr; Prozess-Messtechnik. Dieses Dokument ordnet auf
Basis der rarr; Stickstoff- und Phosphorbilanzen nach DWA die richtigen Prozess-
Messgeräte den einzelnen Aufbereitungsschritten zu.
Lesen Sie den ganzen Bericht hier:
Fir-Lit-Pub-Lange-Bilanzen.pdf
(nach oben)
Deutlich reduzierte Schlammmenge mit SOLITAX highline sc
Die landwirtschaftliche Verwertung getrockneter Schlämme rein kommunaler
Kläranlagen wird zunehmend schwieriger und damit teurer. Zusätzliche
Aufbringungsverbote verschärfen die Problematik (Klärschlammverordnung
AbfKlärV von 1992, zuletzt geändert am 20.10.2006). Die Kosten
der Klärschlamm entsorgung in Europa werden auf jährlich 2,2 Mrd. Euro
geschätzt – unter Beibehaltung des hohen Anteils an landwirtschaftlicher und
landschaftsbaulicher Verwertung (60%). Sollte die thermische Entsorgung verpflichtend
werden, stiegen die Kosten auf über 3 Mrd. Euro bzw. um 40%[1].
Die Schlammmenge lässt sich mit Hilfe der Feststoff-Sonde SOLITAX
highline sc deutlich reduzieren, z.B. auf der Kläranlage Papenburg (48.000 EW).
Lesen Sie den ganzen Bericht hier:
FW-Lit-Pub-Lange-Solitax
(nach oben)