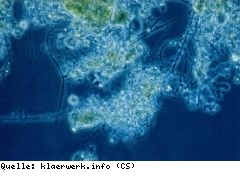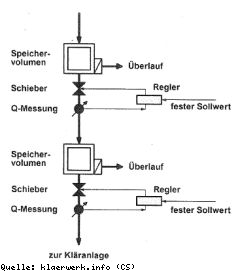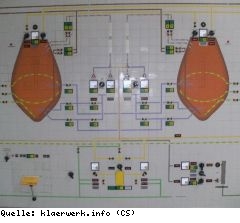Ernährungswissenschaftler der Universität Jena zeigen, dass ein Spurenelement das Leben verlängert
Die regelmäßige Aufnahme des Spurenelements Lithium kann die Lebenserwartung deutlich verlängern. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von Ernährungswissenschaftlern der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Wie das Team um Prof. Dr. Michael Ristow gemeinsam mit japanischen Kollegen in zwei unabhängigen Untersuchungen zeigen konnte, führt Lithium bereits in geringer Konzentration sowohl beim Menschen als auch bei einem Modellorganismus, dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans, zu einem längeren Leben. Seine Ergebnisse stellt das Forscherteam in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins „European Journal of Nutrition“ vor, die gerade online erschienen ist http://dx.doi.org/10.1007/s00394-011-0171-x.
Lithium ist ein lebensnotwendiger Bestandteil der Nahrung und wird vorwiegend aus pflanzlicher Nahrung und über das Trinkwasser aufgenommen. „Über die physiologische Funktion von Lithium wissen wir noch sehr wenig“, sagt Studienleiter Ristow. Wie aus einer früheren Untersuchung hervorgehe, so der Inhaber des Jenaer Lehrstuhls für Humanernährung weiter, habe sich Lithium in sehr hoher Konzentration bereits als lebensverlängernd bei C. elegans erwiesen. „Die damals untersuchte Dosierung liegt aber deutlich über dem physiologisch relevanten Bereich und ist für den Menschen giftig“, so Ristow. Um zu klären, ob Lithium auch in sehr viel geringerer Konzentration eine lebensverlängernde Wirkung aufweise, haben die Forscher nun die Wirkung von Lithium in einem Konzentrationsbereich untersucht, wie er in gewöhnlichem Leitungswasser vorkommt.
In Kooperation mit japanischen Forschern haben die Jenaer Ernährungswissenschaftler die Sterberate in 18 japanischen Gemeinden untersucht und diese in Beziehung zum jeweiligen Lithiumgehalt des Leitungswassers gesetzt. „Dabei hat sich gezeigt, dass die Sterberate in den Gemeinden deutlich geringer ausfällt, in denen mehr Lithium im Leitungswasser vorkommt“, erläutert Ristow das zentrale Ergebnis. In einem zweiten Experiment haben die Jenaer Forscher genau diesen Konzentrationsbereich am Modellorganismus C. elegans untersucht. Das Ergebnis bestätigte sich: „Auch die durchschnittliche Lebenserwartung der Würmer ist höher, wenn sie mit Lithium in dieser Dosierung behandelt werden“, so Ristow.
Auch wenn die zugrunde liegenden Mechanismen noch ungeklärt sind, so gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die beobachtete längere Lebenserwartung sowohl bei den Fadenwürmern C. elegans als auch beim Menschen durch das Spurenelement Lithium verursacht sein kann. Darüber hinaus, so spekulieren die Wissenschaftler, kann Lithium in derart niedriger Dosierung in Zukunft möglicherweise auch als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden. „Aus früheren Studien weiß man bereits, dass eine höhere Lithiumaufnahme über das Trinkwasser mit einer Verbesserung der psychischen Grundstimmung und mit einer verminderten Suizidhäufigkeit in Verbindung gebracht werden kann“, erläutert Prof. Ristow. Zusammen mit den neuen Daten würde man in mehrerlei Hinsicht von einer Steigerung der Lithiumaufnahme profitieren. Um dies sicher befürworten zu können, sind jedoch weitere Studien notwendig, so die Wissenschaftler.
Dr. Ute Schönfelder
Stabsstelle Kommunikation/Pressestelle
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Kontakt:
Prof. Dr. Michael Ristow
Institut für Ernährungswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Dornburger Straße 29, 07743 Jena
Tel.: 03641 / 949630
E-Mail: mristow@mristow.org
Weitere Informationen:
http://dx.doi.org/10.1007/s00394-011-0171-x
http://www.uni-jena.de