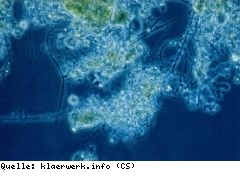Sie fährt leidenschaftlich gerne Auto, aber auch Motorrad. Studentin Maria Tönse (20) ist 1,63 m groß, wiegt 53 Kilogramm. „Ich bin aber kein PS-Junkie“, sagt die zarte Rostockerin, die für das 20-köpfige Team der Rostocker Universität beim 27. Shell-Marathon vom 26. bis 28. Mai auf dem Eurospeedway Lausitz, südlich von Berlin, an den Start gehen wird.
Beim größten Energie-Effizienzwettbewerb in Europa, fließt Benzin nur tröpfchenweise. Es geht darum, wer mit einem Liter Benzin in einem selbstkonstruierten Fahrzeug am weitesten kommt. „Ich gebe alles, damit wir gewinnen“, sagt die 20-Jährige, die bis zum Wettkampf der Studenten drei Kilo abnehmen will. Sprit sparen und dabei beim Konstruieren und Bauen des Fahrzeugs lernen, darum geht es den Studenten und Mitarbeitern der Universität Rostock um Teamleiterin Christin Freese. Sie eint das Ziel, so gut wie möglich abzuschneiden. Die Konkurrenz ist groß: Angemeldet haben sich 223 Teams, davon 25 aus Deutschland.
„Wir bauen das Fahrzeug in Leichtbaukonstruktion komplett alleine“, sagt Christin Freese. Bis zum 1. Mai soll es fertig sein. Dann geht es auf zu Probefahrten auf dem Rostocker Uni-Sportplatz am Waldessaum. Mit hohen Sicherheitsstandards. Davon überzeugen sich Experten von Shell vor dem Wettkampf. „Nicht schwerer als 50 Kilogramm soll das Auto werden“, betont die angehende Wirtschaftsingenieurin. Beim Wettkampf liegt die Fahrerin, die mit einem Fünfpunktgurt gesichert wird, in einer ultraleichten Sitzschale.
Student Peter Jennerjahn aus dem 6. Semester stellt klar: „Wir fahren nicht mit E 10. Der Brennwert von Super ist höher als der von E10″, sagt der angehende Ingenieur und fügt hinzu: „Dadurch wird eine bessere Reichweite möglich“. Alle seine anderen Mitstreiter sind Tüftlerfüchse und kommen aus der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik. Sie mussten bei der Konstruktion und dem Bau des Fahrzeuges nicht ganz bei null anfangen. Zum dritten Mal beteiligt sich die Uni Rostock an diesem Wettbewerb. Im Premierenjahr erreichte das Team von 160 Teilnehmern einen 94. Platz und kam mit einem Liter Superbenzin über 200 Kilometer weit. Letztes Jahr schieden die Rostocker wegen Maschinenprobleme aus. „Deshalb bauen wir jetzt bis auf den Antrieb ein komplett neues Fahrzeug“, sagt Student Moritz Braun. Ein U-Profil aus Aluminium bildet den Rahmen des Fahrzeuges. Die Außenhaut mit strömungstechnisch optimierter Hülle erinnert an die Silhouette eines Haifisches oder an eine Kreuzung von Moped und Fahrrad. Dass, was da in der Forschungshalle der Uni Rostock in vielen, vielen Stunden entsteht, ist am Ende Hochtechnologie vom Feinsten. „Die Automobilindustrie beäugt die Entwicklungen der Teams mit viel Interesse“, weiß Student Normann Koldrack. In Zeiten schwindender Rohstoffe bestehe die Herausforderung, Kraftstoff zu senken und Material zu sparen. „Wir sind alle um unsere Umwelt besorgt“, sagt Normann Koldrack. „Deshalb knobeln wir in Rostock an guten Lösungen für alternative Antriebssysteme“.
Das imponiert Professor Horst Harndorf, Leiter des Lehrstuhls für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren: „In der Fakultät Maschinenbau und Schiffstechnik verfolgen wir die Aktivitäten unserer Studenten mit großem Interesse und unterstützen sie nach Möglichkeit. Das gilt insbesondere für Forschungen auf dem Gebiet der effizienten Energieumwandlung, dem sich der Shell-Eco-Marathon widmet“, sagt der Professor. Er schätzt das Engagement der Studenten sehr. „Das dient dem guten Ruf der Universität Rostock gerade auch bei jungen Menschen über die Landesgrenzen hinaus“.
Prof. Harndorf sieht aber noch einen weiteren Aspekt: „Die größten Vorteile ergeben sich für die Studenten selbst. Die Erfahrungen, ein Fahrzeug mit allen Details bis zur Funktionsfähigkeit bringen zu müssen, seien von großem Wert. „Neben der Lösung technischer Fragestellungen sind Teilprojekte zu definieren und diese zeitlich und finanziell zu koordinieren. Die Studenten müssen Sponsorengelder einwerben, Netzwerke bilden und pflegen sowie ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen“. Der Professor ist überzeugt, „ dass das außerordentliche Engagement im Shell-Eco-Marathon-Team durch potenzielle Arbeitgeber sehr positiv bewertet wird.“
Auf jeden Fall gehört den Studenten um Teamleiterin Christin Freese die Sympathie der Daimler AG, Niederlassung Rostock. „Wenn es solche Pioniere des Fahrzeugbaus nicht geben würde, die an Lösungen knobeln, wie der Spritverbrauch weiter reduziert werden kann, wären wir nicht da, wo wir heute sind“, sagt Verkaufsleiter Axel Hoffmeyer. Für ihn ist das Projekt eine „interessante Sache, die Unterstützung verdient“. Axel Hoffmeyer sagt: „Wir geben 500 Euro für die Knobler.
Den Kraftstoff zu reduzieren, das ist auch unser Thema“. Teamleiterin Christine Freese freut sich über die spontane Hilfe von der Daimler AG Rostock. „Ganz ohne Sponsoren läuft das Projekt nicht“.
Zu den weiteren Unterstützern der Studenten gehören das Rostocker Fahrradfach-geschäft Little John Bikes (Josef Weißbäcker); der Verein CSER, die Hanse Yachts AG, der Verband der Ingenieure, Professoren und Mitarbeiter der Rostocker Fakultät Maschinenbau und Schiffstechnik.
Kontakt:
Christin Freese
Sprecherin des Rostocker Teams
Kontakt: Telefon: 0173 24 76 934
Mail: christin.freese@uni-rostock.de