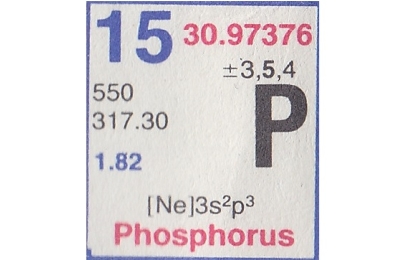Obergartzem: Molkerei bessert nach
Kläranlage auf Werksgelände in Obergartzem soll nicht mehr stinken
Nachdem sich Anwohner über Gerüche beschwert hatten, investiert die Molkerei in die Optimierung der werkseigenen Kläranlage. Mehr:
https://www.rundschau-online.de/region/euskirchen-eifel/mechernich/hochwald-molkerei-in-mechernich-will-klaeranlage-optimieren-617574
(nach oben)
Fischbach/ Luxemburg: Warum die Gemeinde zwei Kläranlagen benötigt
Die Situation mag skurril klingen. Sie erklärt sich aber durch Physik und Notfallüberlegungen. Mehr:
https://www.wort.lu/de/lokales/warum-die-gemeinde-fischbach-zwei-klaeranlagen-benoetigt-6482e111de135b9236901ca4
(nach oben)
Bad Berneck: Bauabschnitt in der Blumenau fertiggestellt
Die Hochwasserschutzmaßnahmen in der Blumenau am Weißen Main in Bad Berneck sind fertiggestellt. Bei der offiziellen Einweihung der Hochwasserschutzmaßnahmen betonte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber heute in Bad Berneck: „Hochwasserschutz ist für die Menschen vor Ort von entscheidender Bedeutung. Bei außergewöhnlichen Regenereignissen können sich Gewässer urplötzlich in reißende Fluten verwandeln. Das haben die Menschen in Bad Berneck im Jahr 2006 beim letzten großen Hochwasser hautnah erleben müssen. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahmen am Weißen Main in der Blumenau sind die Menschen dort vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt. Auch den Klimafaktor haben wir dabei berücksichtigt. Mein Dank gilt allen Beteiligten für die gute Mannschaftsleistung.“
Das Hochwasserschutzkonzept für Bad Berneck sieht Hochwasserschutzmaßnahmen an den Gewässern Weißer Main und Ölschnitz zum Weißen Main vor. Die Baumaßnahmen in der Blumenau am Weißen Main sind mit einer rund 900 Meter langen und rund 2 Meter hohen Stahlbetonmauer nun fertiggestellt. Zudem sorgt ein neues Pumpwerk mit fünf voneinander unabhängigen Pumpen und einer rund 1.500 Meter langen verlegten Rohrleitung für die Entwässerung hinter den Hochwasserschutzanlagen. Das Gesamtvolumen der Maßnahmen liegt bei rund 4,8 Millionen Euro.
Der Hochwasserschutz in Bayern soll auch in Zukunft kraftvoll ausgebaut werden: Insgesamt zwei Milliarden Euro sollen im Rahmen des laufenden Gewässer-Aktionsprogramms bis Ende 2030 investiert werden. Weitere Informationen zum Hochwasserschutz in Bayern unter www.wasser.bayern.de.
https://www.stmuv.bayern.de/aktuell/presse/pressemitteilung.htm?PMNr=151/23
(nach oben)
Berliner Regenwasseragentur: 5 Jahre Regenwasseragentur: Einmal Berlin in grün und blau, bitte!
Positive Bilanz, aber der Umbau im Bestand geht zu langsam voran
Die Berliner Regenwasseragentur feiert ihren fünften Geburtstag. 2018 gegründet als Kooperation von Berliner Wasserbetrieben und Senatsumweltverwaltung, treibt die Agentur seitdem den Umbau Berlins zur Schwammstadt voran. In ihrer Bilanz zum Jubiläum verweist die Agentur auf zahlreiche Erfolgsprojekte im Neubau, mahnt aber die schleppende Umsetzung im Bestand an.
„Wir haben in Berlin einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass Regenwasser eine wertvolle Ressource ist – das ist nicht zuletzt das Verdienst unserer Regenwasseragentur“, gratuliert Umweltsenatorin Manja Schreiner der Agentur, die 2018 als Kooperation der Senatsumweltverwaltung und den Berliner Wasserbetrieben gegründet wurde. „Ein innovatives Regenwassermanagement und die stetige Entwicklung Berlins hin zu einer wassersensiblen Stadt ist von herausragender Bedeutung. Deshalb werden wir die Regenwasseragentur weiter ausbauen und stärken.“ Neben der Gründung der Agentur hat Berlin einiges mehr getan: Seit 2018 gilt für Neubauquartiere ein Bewirtschaftungsgebot: Niederschläge müssen auf dem Grundstück versickert, verdunstet oder anderweitig genutzt werden. Die Förderbedingungen für grüne Dächer und Fassaden im Bestand wurden verbessert.
„Wir sind in Berlin schon gut vorangekommen, auch dank der Regenwasseragentur“, sagt Christoph Donner, Vorstandschef der Berliner Wasserbetriebe. „Aber das reicht nicht. Für den Umbau Berlins zur wassersensiblen Stadt brauchen wir mehr Tempo, mehr Abkopplung statt Versiegelung und einen Begrünungspflichtanteil für Neubauten in der Berliner Bauordnung. Wir müssen und wollen einen Großteil der versiegelten Flächen von der Kanalisation abkoppeln und das Regenwasser vor Ort halten. Zugleich minimiert diese dezentrale Bewirtschaftung auch Schäden an Umwelt und Eigentum bei Starkregen. Das wird Jahrzehnte und hohe Summen in Anspruch nehmen, die Aufgabe ist gewaltig.“
„Wir haben vor fünf Jahren angefangen, die Idee der Schwammstadt in die Stadt zu tragen und haben schon viel erreicht“, sagt Darla Nickel, Chefin der Regenwasseragentur. „Wir sehen eine breite Sensibilisierung und Bereitschaft in der Verwaltung, bei den Wohnungsunternehmen und in der Bevölkerung. Im Neubau geht es gut voran, unser Sorgenkind ist der Bestand und vor allem der Umbau des öffentlichen Raums, wo die Flächenkonkurrenzen am größten sind. Deswegen möchten wir Bezirke, Liegenschaftsverwalter und Gewerbe noch aktiver beim Umbau unterstützen.“
Immobilieneigentümer:innen, Wohnungsunternehmen, Planende und Umsetzende – sie alle müssen auf ihre Weise Hand anlegen, um den Umbau Berlins zur Schwammstadt Wirklichkeit werden zu lassen. Die Regenwasseragentur unterstützt sie dabei mit zahlreichen Services und Tools, z.B. Sprechstunde Regen, Maßnahmen-Handbuch, Projekt-Datenbank, Anbietersuche, Fördermittel-Übersicht oder einem Kostenrechner – alles versammelt auf www.regenwasseragentur.berlin.
Bei ihrer Gründung vor fünf Jahren war die Berliner Regenwasseragentur die erste ihrer Art in Deutschland, Vorbild war Amsterdam. Aufgabe des zunächst vierköpfigen Teams war es, die Schwammstadt Berlin voranzutreiben. Fünf Jahre später und mit vier Köpfen mehr blicken die „Regenwasseragent:innen“ zurück auf mehr als 1.000 Beratungsgespräche, über 150 Fachvorträge, viele 100 Interviews und mehrere Dutzend Schwammstadtführungen.
Zu ihrem 5. Geburtstag hat die Regenwasseragentur sich selbst beschenkt: mit einem Ideenwettbewerb für die Schwammhauptstadt. Aus 73 eingereichten Projekten wurden zehn nominiert, die heute Nachmittag (21. Juni, 14-18 Uhr) beim Forum Regenwasser in der ufa-Fabrik vorgestellt werden.
Eine Presseinformation zur jüngsten Umfrage von Regenwasseragentur und BBU zur „Schwammstadtbereitschaft“ der Wohnungswirtschaft finden Sie hier: https://www.bwb.de/de/27779_28017.php
Die Regenwasseragentur
Die Berliner Regenwasseragentur ist 2018 als gemeinsame Initiative des Landes Berlin und der Berliner Wasserbetriebe gegründet worden. Sie sensibilisiert für die Notwendigkeit der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung, informiert über und berät zu Fragen der Planung und Umsetzung, vernetzt und organisiert Weiterbildungs- und Dialogangebote. Ihre Services richten sich an Verwaltungen, Wohnungsunternehmen, Immobilieneigentümer:innen, Planer:innen und Bürger:innen in Berlin.
(nach oben)
An diesen Stränden auf Mallorca wird Abwasser ins Meer geleitet
In den vergangenen Jahren geriet Mallorca immer wieder in die Negativschlagzeilen, weil aufgrund fehlender Kapazitäten der Kläranlagen ungeklärte Abwasser und damit auch Fäkalien ins Meer gelangten. Generell gibt es diverse Strände, an denen es Einleitungsstellen gibt. Auf einer interaktiven Karte können sich Anwohner und Urlauber über die Orte informieren – und diese meiden.
Mallorca hat ein Abwasser-Problem. Erst vor wenigen Tagen mussten nach den heftigen Regenfällen am Freitag (4. August) wieder mehrere Strände gesperrt werden, weil die Kläranlagen auf der Insel überliefen und Fäkalien ins Meer gelangten. Betroffen waren unter anderem die Stadtstrände Cala Mayor, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí und Cala Estancia. Nachdem am Samstagvormittag die Ergebnisse der zuvor von den Stadtwerken entnommenen Wasserproben vorlagen, gab es mittlerweile Entwarnung. Die Strände wurden zum Baden wieder geöffnet, berichtet die „Mallorca Zeitung“. Der Strandabschnitt S’Arenal an der Playa de Palma hingegen sei erst am Dienstag (8. August) wieder freigegeben worden.
Wer auf Nummer sicher gehen will, meidet generell jene Küstenabschnitte, an denen Abflussrohre ins Meer reichen. Denn bei starkem Regen kann es dort theoretisch immer zum Eintrag von ungeklärten Abwässern gelangen. Wo sich diese Rohre befinden, zeigt eine interaktive Karte, die die balearische Statistikbehörde SITIBISA erstellt hat.
(nach oben)
München bekommt eine neue Klärschlammverbrennungsanlage
Der Stadtentwässerungsausschuss des Stadtrats hat in seiner Sitzung der Münchner Stadtentwässerung (MSE) die Projektgenehmigung für den Neubau einer Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) auf dem Klärwerk Gut Großlappen erteilt. Für das Großprojekt wurden Kosten in Höhe von 404,5 Millionen Euro brutto genehmigt. Mit dem Neubau der KVA wird für München und die Region eine wirtschaftliche, ökologische und zukunftsfeste Lösung für die kommenden Jahrzehnte umgesetzt. Die neue KVA entsteht neben der alten Anlage auf dem Areal des Klärwerks Gut Großlappen. Da dort bereits mit der bestehenden Klärschlammverbrennungsanlage ein großer Teil des Münchner Klärschlamms entwässert, getrocknet und thermisch behandelt wird, können notwendige Bestandteile der dort vorhandenen Infrastruktur weiter genutzt werden.
Besonderen Wert legt die MSE auf die Betriebs- und Entsorgungssicherheit. Die neue Anlage wird über zwei Linien verfügen – eine der beiden Linien dient als Reserve, beispielsweise im Fall von Wartungsarbeiten oder bei notwendigen Reparaturen. Zudem verfügt die geplante KVA über Möglichkeiten zur Zwischenlagerung des entwässerten Klärschlamms bei ungeplanten Betriebsunterbrechungen. So wird die Betriebs- und Entsorgungssicherheit der KVA und den Klärwerken noch einmal deutlich gesteigert.
Die Rauchgasreinigung des KVA-Ersatzneubaus wird ein hochmodernes technisches und ökologisches Niveau mit hoher Betriebssicherheit aufweisen. Die MSE rüstet die neue Anlage mit in Reihe geschalteten Wäschern und Filtern aus, was Emissionen effektiv verringert.
Ein weiterer zentraler Grund für den KVA-Neubau besteht in der Novellierung der Klärschlammverordnung auf EU-Ebene. Ab dem Jahr 2029 besteht die Pflicht, den in Klärschlammasche enthaltenen Phosphor zurückzugewinnen. Voraussetzung für die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammasche ist die Monoverbrennung, also der Verzicht auf die Beimischung anderen Materials. Eine Rückgewinnung des Phosphors aus der Asche, die bei der Mitverbrennung des Klärschlamms mit dem Müll im Heizkraftwerks Nord anfällt, ist technisch nicht möglich. Damit entfällt künftig diese Entsorgungsmöglichkeit. Mit dem Neubau einer leistungsfähigeren und modernen KVA bleibt die Entsorgungssicherheit gewährleistet.
Mit der neuen KVA werden durch eine vergrößerte Eigenstromproduktion, Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen, dem Einsparen der Pumpenleistung zum Heizkraftwerk Nord und die bessere Nutzung von Überschusswärme große energetische Verbesserungen erzielt.
Die in der neuen KVA anfallende phosphorreiche Klärschlammasche soll entsprechend den Anforderungen der Klärschlammverordnung der Phosphorrückgewinnung zugeführt werden.
Außerdem steigt bei der bestehenden KVA altersbedingt der Instandhaltungsbedarf und der Betrieb wird zunehmend unwirtschaftlich. Die MSE hat mögliche Sanierungsvarianten untersucht und Strategien für die künftige Entsorgung entwickelt. Die wirtschaftlichste und nachhaltigste Lösung – insbesondere vor dem Hintergrund der Novellierung der Klärschlammverordnung – ist der Neubau einer KVA für den gesamten Schlamm beider Münchner Klärwerke.
Der Stadtrat hat dazu 2016 einen Grundsatzbeschluss gefasst. Um die Nachhaltigkeitsziele der Klärschlammverordnung zu erreichen und die Entsorgungssicherheit für die Stadt München und die angeschlossenen Gemeinden zu gewährleisten, wurde die MSE mit der Durchführung der notwendigen Planungen für den Neubau einer KVA beauftragt.
Für das Bauvorhaben hat die MSE ein Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Für die Genehmigung musste zudem unter anderem ein Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht werden. Die festgestellten Umwelteinwirkungen liegen dabei deutlich unter den relevanten Wirkungsschwellen. Der UVP-Bericht wurde planbegleitend erstellt, um bereits in der Planungsphase auf die Minimierung der Umwelteinwirkungen zu achten. Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz für den Bau der Anlagen wurde im April 2023 von der Regierung von Oberbayern erteilt.
Parallel zum Genehmigungsverfahren hat die MSE auf Basis der Entwurfsplanung ein EU-weites Verfahren zur Gewinnung eines Generalsunternehmers für den Bau durchgeführt. Mit dem Bau der Anlage kann voraussichtlich Ende 2024 begonnen werden. Die Inbetriebnahme ist für 2027/28 – vor Inkrafttreten der Klärschlammverordnung am 1. Januar 2029 – geplant.
Zum Hintergrund:
Bei der Abwasserableitung und -reinigung fallen bei der MSE jährlich etwa 1,2 Millionen Tonnen Klärschlamm an. Dessen Entsorgung ist Teil des voll- ständigen Abwasser-Reinigungsprozesses. Auch das Verwerten und Beseitigen des anfallenden Klärschlamms ist Aufgabe der MSE. Angesichts der in der Millionenstadt München anfallenden Klärschlamm-Menge betreibt die MSE seit 1998 auf dem Klärwerk Gut Großlappen eine eigene Mono-Klärschlammverbrennungsanlage.
Im Klärwerksverbund werden dort bisher rund 70 Prozent des Schlamms, der bei der Abwasserbehandlung von München und den 22 angeschlossenen Umlandgemeinden entsteht, thermisch verwertet. Die restlichen 30 Prozent werden im Müllblock des Heizkraftwerks Nord verbrannt. Achtung Redaktionen: Mehr Informationen sind zu finden im Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses des Stadtrats vom 4. Juli 2023 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09787) sowie im Internet unter www.muenchen.de/kva.
https://ru.muenchen.de/2023/126/Muenchen-bekommt-eine-neue-Klaerschlammverbrennungsanlage-107935
(nach oben)
Landau: WL bietet Ratten und Co. Paroli
Immer mehr unerwünschte Nager im Stadtgebiet: Spezialfirma legt Köder aus
Die städtische Infrastruktur in Landau besteht unter anderem aus einem 275 Kilometer langen Kanalnetz, das auch Spielplätze und Parks durchzieht. Um dort aktiv gegen Ratten und andere Schadnager vorzugehen, startet der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) in Kürze eine neue Bekämpfungsaktion. Im Laufe des Monats Juni werden von einer Spezialfirma wieder spezielle Köder in das öffentliche Kanalsystem eingebracht. Auch Privatpersonen können sich der Aktion mit Maßnahmen auf dem eigenen Grundstück anschließen. „Die Population im Zaum zu halten ist wichtig. Ratten und Co. können Krankheiten übertragen und Infrastruktur beschädigen“, informiert Udo Adams, Mitarbeiter des EWL, der die Kampagne koordiniert.
Lebensmittelabfälle und Klimaerwärmung als Ursache
„Unser Eindruck ist, dass es insgesamt mehr Schadnager in Landau wie auch in anderen Kommunen gibt“, ordnet Udo Adams ein. Die Experten des EWL sehen dies im Klimawandel sowie im menschlichen Verhalten begründet: Milde Winter begünstigen die Zunahme der Rattenpopulation, weil echte Frostperioden ausbleiben und die Tiere besser durch den Winter kommen. Zum anderen führen unachtsam entsorgte Lebensmittel, wenn sie etwa im Haushalt über die Toilette weggespült oder in Parks oder auf Spielplätzen offen liegengelassen werden, zu vielen für Ratten leicht erreichbaren Nahrungsquellen. Dass diese unsachgemäße Entsorgung kritisch ist, darauf weist der EWL regelmäßig hin. Die Reste vom Teller, nicht aufgegessene Brote oder verdorbene Lebensmittel sind organischer Natur und gehören deshalb in die Biotonne. Das legt auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz eindeutig fest.
Wirksame Köderaktion – gemeinsam klug handeln
Mit dem Einbringen von Ködern hat der EWL eine Spezialfirma beauftragt. Diese hängt Köder in Misch- und Schmutzwasserkanäle ein, in welche sich Ratten bevorzugt zurückziehen. Nach zwei Wochen werden neue Köder nachgelegt. „Das dient auch gleichzeitig der Kontrolle, wie wirksam die erste Auslegung war. Sind die Köder weg oder angefressen, gibt es noch einige Nagetiere. Dann legen wir nach“, erklärt Udo Adams. Dieses Prozedere wird so lange wiederholt, bis es keine Spuren der Ratten im Abwassersystem mehr gibt. Die aufwendige Aktion kann durch aufmerksames Beobachten unterstützt werden: Wer den Verdacht hat, dass in seinem Umfeld Ratten unterwegs sind, kann sich an den EWL wenden. Meldungen sind möglich per Telefon unter 06341 13-8659 oder per Mail an udo.adams@landau.de.
Sind private Grundstücke von Schadnagern betroffen, sollten die Eigentümer direkt mit der beauftragten Firma Holler unter der Rufnummer 0171 4450006 Kontakt aufnehmen. Sie erhalten dort Beratung und die Möglichkeit, die öffentliche Bekämpfungsmaßnahme kostengünstig auf ihr Grundstück auszudehnen.
Vor allem Wanderratten im Fokus
Ratten fühlen sich dort wohl, wo es genug Nahrung und Nistplätze gibt. Sie gehören zur Umwelt. Doch aus Gründen der Hygiene ist es wichtig, sie in Zaum zu halten. Vor allem Wanderratten sind ernst zu nehmende Überträger von Krankheiten, etwa durch Salmonellen, Schweinetrichinen, Bandwürmer, Flöhe und Milben. Die im Kot der Tiere enthaltenen Bakterien und Viren werden vom Menschen bei Kontakt mit Haut, Schleimhäuten oder Atemwegen aufgenommen und führen so zur Erkrankung. Darüber hinaus hinterlassen sie unliebsame Schäden an Verpackungen, Lebensmitteln, elektrischen Leitungen oder an Dämmstoffen sowie an der Bausubstanz. Die Herausforderung: Ratten sind sehr anpassungsfähig und vermehren sich schnell. Ein Muttertier wirft bis zu fünfmal im Jahr sechs bis acht Junge.
Vorbeugende Maßnahmen
„Wir bekommen die Population in den Griff. Einfacher ist allerdings, dem Zuwachs mit einigen Tipps Einhalt zu gebieten“, erläutert Udo Adams. Hierfür geben die Abwasserexperten des EWL wichtige Tipps:
Keine Tauben und Enten füttern.
Speisereste nicht über den Ausguss oder die Toilette entsorgen.
Bei eigenen Komposthäufen keine Speiseabfälle, verdorbene oder gekochte Lebensmittel entsorgen.
Speiseabfälle und verdorbene Lebensmittel gehören in die Biotonne und deren Deckel geschlossen.
Gelben Sack erst am Abholtag nach draußen stellen.
Schuppen und Keller auf Nistmöglichkeiten untersuchen und gegebenenfalls Schächte und Einstiegsmöglichkeiten absichern.
https://www.ew-landau.de/%C3%96ffentliche-Informationen/Aktuelles/EWL-bietet-Ratten-und-Co-Paroli.php?object=tx,2901.5.1&ModID=7&FID=2901.8387.1&NavID=2901.11&La=1
(nach oben)
Emschergenossenschaft: Bundespräsident Steinmeier besucht renaturierte Emscher
Gemeinsamer Besuch des neuen Natur- und Wasser-Erlebnis-Parks in Castrop-Rauxel mit dem Diplomatischen Korps und NRWs stellvertretender Ministerpräsidentin Mona Neubaur
Castrop-Rauxel. Hohen Besuch empfing die Emschergenossenschaft am Dienstag im neuen Natur- und Wasser-Erlebnis-Park in Castrop-Rauxel: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte bei seiner Informations- und Begegnungsreise mit rund 150 in Deutschland tätigen ausländischen Botschafterinnen und Botschaftern sowie Vertreterinnen und Vertretern internationaler Organisationen und der stellvertretenden NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur die renaturierte Emscher und informierte sich mit seinen Gästen über die ökologische Transformation des einstigen Schmutzwasserflusses.
Castrop-Rauxel. Hohen Besuch empfing die Emschergenossenschaft am Dienstag im neuen Natur- und Wasser-Erlebnis-Park in Castrop-Rauxel: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte bei seiner Informations- und Begegnungsreise mit rund 150 in Deutschland tätigen ausländischen Botschafterinnen und Botschaftern sowie Vertreterinnen und Vertretern internationaler Organisationen und der stellvertretenden NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur die renaturierte Emscher und informierte sich mit seinen Gästen über die ökologische Transformation des einstigen Schmutzwasserflusses.
„Für uns als Emschergenossenschaft ist es heute eine große Ehre, den Bundespräsidenten gemeinsam mit zahlreichen Botschafterinnen und Botschaftern an der renaturierten Emscher empfangen zu dürfen. Das unterstreicht einmal mehr, dass der Emscher-Umbau mehr ist als ein regionales Projekt – er besitzt internationale Strahlkraft und dient als Vorbild für zahlreiche ähnliche Renaturierungsvorhaben in aller Welt“, sagte Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft, und betont die zahlreichen Mehrwerte des Emscher-Umbaus, die weit über die Wasserwirtschaft hinausragen, von Biodiversität über Stadtentwicklung, von Kunst und Bildung bis Tourismus, von Wirtschaft bis Gesundheit.
Der Emscher-Umbau
Ein blauer Fluss mit grünen Ufern ersetzt einen braunen Schmutzwasserlauf mit grauem Betonkorsett: Die seit Anfang des Jahres 2022 vollständig vom Abwasser befreite Emscher begeistert die Region und ihre Menschen. Rund 5,5 Milliarden Euro investierte die Emschergenossenschaft in das größte europäische Infrastrukturprojekt. Um die Emscher vom Abwasser zu befreien, wurden seit 1992 vier moderne Kläranlagen gebaut und mehr als 430 Kilometer an neuen unterirdischen Abwasserkanälen verlegt. 170 Kilometer an Gewässerläufen sind bereits renaturiert, die Artenvielfalt an der Emscher hat sich verdreifacht. Das neue blaugrüne Leben ist erleb- und erfahrbar: Parallel zum Flussumbau hat die Emschergenossenschaft rund 130 Kilometer an neuen Radwegen zur Verbesserung der Nahmobilität geschaffen.
Den Gästen präsentierte die Emschergenossenschaft am Dienstag den gesamten Mikrokosmos des Emscher-Umbaus mit all seinen Mehrwert-Effekten wie unter anderem dem Blauen Klassenzimmer am Suderwicher Bach, den Kunstwerken entlang der Emscher und der Beteiligungsinitiative „Mach mit am Fluss!“ – 30 Jahre des Generationenprojektes inklusive Ausblick in die Zukunft.
Die Emschergenossenschaft
Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Sie wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet und kümmert sich seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie um den Hochwasserschutz. www.eglv.de
https://www.eglv.de/medien/bundespraesident-steinmeier-besucht-renaturierte-emscher/
(nach oben)
Backnang: Aktuelles
Infoveranstaltung „Starkregenrisikomanagement in Backnang“
Starkregen führt zu erhöhten Überflutungsrisiken und stellt die Stadt Backnang vor neue Herausforderungen. Um dieses wichtige Thema zu diskutieren und konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, lädt die Stadtverwaltung Backnang zur Informationsveranstaltung „Starkregenrisikomanagement in Backnang“ am Mittwoch, 19. Juli, von 18.30 bis 21.30 Uhr, im Technikforum, Wilhelmstraße 32, ein.
Der Ablauf der Veranstaltung umfasst Impulsvorträge gefolgt von interaktiven Workshops und einem abschließenden Schlussplenum. Es besteht auch die Möglichkeit, mit Fachexperten stadtteilbezogene Aspekte zu diskutieren und konkrete Maßnahmen zur Prävention und Vorsorge zu erarbeiten. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Gewerbetreibende sowie Interessenverbände, die sich über die Auswirkungen des Starkregens informieren und konkrete Handlungsempfehlungen erhalten möchten. Anmeldungen sind per E-Mail an tiefbauamt@backnang.de und telefonisch unter 07191 894-277 möglich.
Im Rahmen der Veranstaltung wird der Unterschied zwischen Hochwasser und Starkregen erklärt. Zudem werden Erkenntnisse über die neuen Gefahren und Betroffenheiten aus dem Projekt „Starkregenrisikomanagement in Backnang“ präsentiert. Dabei werden die für Backnang erstellten Starkregengefahrenkarten, Risikosteckbriefe und ein Handlungskonzept vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf den Schutz von Gebäuden gelegt.
https://www.backnang.de/start
(nach oben)
Stuttgart: Förderwettbewerb stärkt Klimaschutz-Projekte: #jetztklimachen-Preis
Das Klima zu schützen, ist ein Wert an sich. Doch eine Finanzspritze oder eine bessere Sichtbarkeit helfen manch kreativem Projekt auf die Sprünge. Mit dem #jetztklimachen-Preis will die Stadt Stuttgart deshalb Klimaschutz-Projekte stärken und sichtbar machen.
Alle Stuttgarter*innen sind eingeladen, sich bis zum 31. Juli 2023 mit ihrem Klimaschutz-Projekt um den #jetztklimachen-Preis zu bewerben. Weitere Informationen gibt’s auf der Website https://jetztklimachen.stuttgart.de.
https://www.stuttgart-stadtentwaesserung.de/foerderwettbewerb-staerkt-klimaschutz-projekte-jetztklimachen-preis/
(nach oben)
Ruhrverband: Sorpetalsperre – Sedimente aus Vorbecken verfüllen ehemalige Klärschlammdeponie
Transport von 40.000 Kubikmetern Material führt zu erhöhtem LKW-Verkehr
Der Ruhrverband beginnt im Juli 2023 mit der angekündigten Beräumung von rund 40.000 Kubikmetern Sediment aus dem Vorbecken Amecke der Sorpetalsperre, die als Füllmaterial für die ruhrverbandseigene ehemaligen Klärschlammdeponie in Bestwig-Velmede verwendet werden. Voraussichtlich bis Oktober 2023 werden die Sedimente aus dem Talsperrenvorbecken entnommen, nach Bestwig-Velmede transportiert und im Becken 2 der dortigen Deponie eingebaut.
Anschließend wird es rund zwölf Monate dauern, bis sich das Sediment abgesetzt hat und mit einer 70 Zentimeter dicken Rekultivierungsschicht bedeckt werden kann. Mit der Maßnahme hat der Ruhrverband dasselbe Unternehmen beauftragt, das bereits im Jahr 2019 auf die gleiche Weise das Becken 1 der Deponie Bestwig-Velmede mit Sedimenten aus dem Vorbecken Mielinghausen der Hennetalsperre verfüllt hatte.
Die Zufahrt der LKW zur Deponie erfolgt über die Verbindungsstraße Bestwig-Halbeswiger Straße und einen Gemeindewirtschaftsweg. Mit der Separationsgemeinschaft Velmede wurde eine entsprechende Vereinbarung über die Nutzung der Wirtschaftswege geschlossen. Aufgrund der aktuellen Bautätigkeiten auf A46 kann es im Bereich der Stadt Meschede zwischen Juli und Oktober 2023 zu erhöhtem LKW-Verkehr kommen. Der Ruhrverband bittet um Verständnis.
https://ruhrverband.de/presse/pressemitteilungen/detailansicht/news///sorpetalsperre-sedimente-aus-vorbecken-verfuellen-ehemalige-klaerschlammdeponie/
(nach oben)
Besserer Überflutungsschutz der Barmstedter Innenstadt durch zusätzlichen Regenwasserkanal
AZV Südholstein startet Baumaßnahme am Krückauwanderweg
Zur Verbesserung der Regenwasserableitung in Barmstedt führt der Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV) ab dem 3. Juli Bauarbeiten im Bereich des Krückauwanderwegs durch. Dabei wird ein neuer Kanal zur Entflechtung des Seitengrabens von der Krückau verlegt und mehrere Schachtbauwerke gesetzt. Zeitweilig wird dafür der Wanderweg gesperrt und eine Umleitung über den Weg beim Kleingarten eingerichtet. Die Arbeiten sind bis Ende Februar 2024 geplant.
Nach der Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens am Küsterkamp und der Erneuerung des Dückers unter der Krückau beginnt der AZV Südholstein mit dem dritten und letzten Abschnitt zur Optimierung der Regenwasserableitung im Barmstedter Stadtgebiet. Dieser betrifft den Krückauseitengraben. Der Seitengraben entwässert mehr als 50 Prozent des Barmstedter Stadtgebietes, liegt aber auch innerhalb der Überflutungsfläche der Krückau. Bei einem Krückau-Hochwasser hat das zur Folge, dass Seitengraben und Fluss sich zu einem Gewässer verbinden und mit vereinter Kraft in die städtischen Kanäle stauen.
Aus diesem Grund verlegt der AZV ab dem 3. Juli ergänzende, auf der Auwiesenseite parallel zum Seitengraben verlaufende Ableitungsrohre mit einem Durchmesser von 80 cm. Diese erhöhen einerseits die generellen Kapazitäten für die Regenwasserableitung, andererseits wird auf diese Weise das Fluss/Kanal-System entflochten und so insgesamt das Überflutungsrisiko in der Stadt reduziert.
Die Arbeiten beginnen beim Krückauwanderweg auf Höhe des Freibads und erstrecken sich über 500 Meter in Richtung Regenrückhaltebecken Küsterkamp. Das Setzen von acht Schachtbauwerken ist ebenfalls Bestandteil der Maßnahme. Aufgrund der Bauarbeiten kommt es voraussichtlich für den Zeitraum Juli/August zu einer Sperrung des Wanderwegs. Für diese Zeit wird es auf der südlichen Krückau-Seite eine Umleitung über den Weg beim Kleingartenverein geben. Der Abschluss der Arbeiten ist für Ende Februar 2024 geplant.
https://www.azv.sh/aktuelles/pressebereich/besserer-ueberflutungsschutz-der-barmstedter-innenstadt-durch-zusaetzlichen-regenwasserkanal
(nach oben)
Aggerverband passt Talsperren-Betriebspläne an Klimawandel an
Gummersbach. Hitze- und Dürrephasen im Sommer, nasse Winter oder unkalkulierbare Starkregenereignisse: Der Klimawandel geht auch an den Talsperren des Aggerverbandes nicht unbemerkt vorbei. Umso wichtiger ist es, sich dem vorbeugenden Trinkwasserschutz in Zeiten sich ändernder klimatischer Bedingungen zu stellen.
Die von der Bezirksregierung genehmigten Talsperren-Betriebspläne, nach denen die Abgabe in Abhängigkeit von der Jahreszeit und des Füllstandes gesteuert wird, stammen aus dem Anfang der 2000er Jahre.
Diese Pläne schützen zuverlässig vor Hochwasser im Unterlauf, soweit die Talsperren dazu ihren Beitrag leisten können. Für die Erfüllung dieser Funktion sind auch in den Sommermonaten kontinuierliche Abgaben, die sich nach dem Füllstand richten, vorgesehen.
Der Schutz vor Hochwasser ist aber nicht die einzige Aufgabe der Talsperren. Insbesondere die Trinkwasserreservoirs der Genkel- und Wiehltalsperre dienen der permanenten Versorgung von rund 430.000 Menschen im Versorgungsgebiet des Aggerverbandes mit Trinkwasser in guter Qualität. Für diese Aufgabe ist ein möglichst dauerhaft hoher Füllstand der Trinkwassertalsperren wünschenswert. Daher sollte möglichst viel Wasser gespeichert werden.
Aus diesen gegenläufigen Aufgaben ergibt sich eine Steuerungsstrategie, die beiden Zielen gerecht werden soll.
Da die Betriebspläne der Talsperren bei hohen Füllständen auch höhere Abgaben vorsehen, wurde bisher bei den mittlerweile häufig auftretenden sommerlichen Temperaturen und langen Trockenphasen teilweise Wasser an die Gewässer abgegeben, das möglicherweise in der Zukunft zum Herbst hin für die Trinkwasserversorgung benötigt wird.
Daher hat der Aggerverband bereits Anfang Juni die Abweichung von den hohen Abgaben beantragt. Die Zustimmung von Seiten der Bezirksregierung erfolgte zeitnah. Demzufolge wird heute eine wohl dosierte Wassermenge aus den Talsperren in die Gewässerläufe abgegeben, welche zum einen die Gewässerökologie schützt und zum anderen die Wasserversorgung für das laufende Jahr gewährleistet. Mit Blick auf den Hochwasserschutz müssen Unterlieger keine Sorgen haben – Agger- und Wiehltalsperre können unvorhergesehene Unwetterereignisse schadlos zwischenspeichern.
Die Betriebspläne werden aktuell auch unter Berücksichtigung von Klimaszenarien und Vorhersagemodellen überarbeitet und angepasst.
https://www.aggerverband.de/service/presse/artikel/aggerverband-passt-talsperren-betriebsplaene-an-klimawandel-an
(nach oben)
Weltwassertag 2023: AZV Südholstein unterstützt den Wandel zu mehr Wasserschutz
Verbesserte nachhaltige Wassernutzung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Jeder kann einen Beitrag für den nachhaltigeren Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser leisten – und es muss mehr und schneller gehandelt werden. Ansonsten besteht kaum eine Chance, das Ziel der Vereinten Nationen zu erreichen, bis 2030 allen Menschen Zugang zu sauberem Wasser und einer ausreichenden Sanitärversorgung zu ermöglichen. Darauf macht der AZV Südholstein anlässlich des Weltwassertages am 22. März aufmerksam.
Wasserschutz ist eine Kernkompetenz des Abwasser-Zweckverbands Südholstein: Als Unternehmen der Daseinsvorsorge sammelt und reinigt der Verband das Abwasser aus einem Einzugsgebiet von rund 850 km2. Das sind allein für das Klärwerk Hetlingen, das größte in Schleswig-Holstein, jährlich rund 31 Millionen m3 Wasser, die mit einem Reinigungsgrad von deutlich über 90 Prozent in den Wasserkreislauf zurückgegeben werden. Weitere Klärwerkstandorte befinden sich in Glückstadt, Lentföhrden und auf Helgoland.
„Rund 260 Mitarbeitende, von der Fachkraft für Abwassertechnik bis hin zu IT-Spezialisten, Ingenieurinnen und Verwaltungsprofis, kümmern sich darum, dass wir rund um die Uhr unsere Aufgaben erfüllen“, sagt Verbandsvorsteherin Christine Mesek. „Wer eine sinnstiftende Aufgabe übernehmen möchte, findet bei uns viele attraktive Möglichkeiten.“
Auch kleinste Maßnahmen helfen dem Wasserschutz
Der AZV Südholstein versteht sich als Umweltunternehmen und hat als einer der ersten deutschen Abwasserzweckverbände eine Erklärung auf Basis des Deutschen Nachhaltigkeitskodex‘ (DNK) abgegeben. Er setzt sich zudem aktiv für die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN-Agenda 2030 ein. Ein Schwerpunkt ist Ziel Nummer 6, das im Zentrum des diesjährigen Weltwassertages am 22. März steht: Die Versorgung aller Menschen mit sauberem Wasser und ausreichenden Sanitäreinrichtungen bis 2030. Doch der dafür notwendige Wandel zum nachhaltigeren Umgang mit der lebenswichtigen Ressource Wasser muss erheblich beschleunigt werden, um dieses Ziel noch erreichen zu können. Darauf weist das Weltwassertag-Motto „accelerating change“ hin.
„Alle können dazu einen Beitrag leisten, indem sie die Art und Weise ihrer individuellen Wassernutzung überdenken“, betont Christine Mesek. „Reduzierung des Wasserverbrauchs, die Vermeidung von Wasserverschmutzung – es gibt viele Ansätze, um die Situation zu verbessern und selbst die kleinsten können helfen.“ Das vermittelt der AZV Südholstein auch mit seinen Angeboten in der Umweltbildung – der Verband ist eine zertifizierte außerschulische Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit.
Nationale Wasserstrategie mit erweiterter Herstellerverantwortung soll den Wandel voranbringen
Wirklich gelingen kann der Wandel aber nur, wenn er als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden und betrieben wird. Das unterstreicht die jüngst beschlossene „Nationale Wasserstrategie“ der Bundesregierung. Mit zehn strategischen Themen und rund 80 Maßnahmen sollen die zentralen Ziele erreicht werden. Das Spektrum reicht von der Sicherstellung von hochwertigem und bezahlbarem Trinkwasser über die Weiterentwicklung einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung bis hin zu klimaangepassten Wasserinfrastrukturen.
„Als Unternehmen mit der Kernkompetenz Wasserreinigung begrüßen wir den Beschluss sehr; insbesondere auch die damit angestrebte Einführung der erweiterten Herstellerverantwortung“, so Mesek. Das würde die Kostenverteilung für diese Aufgabe deutlich fairer gestalten. Anstatt Abwassergebühren nur den Haushalten aufzuerlegen, gelte dann der Grundsatz: Wer wasserschädliche Produkte oder Wirkstoffe herstellt oder in Verkehr bringt, muss auch verstärkt zur Beseitigung von Schäden in den Gewässern beitragen. Dies wird insbesondere bei der Finanzierung von weiteren Reinigungsstufen auf Kläranlagen eine Rolle spielen.
https://www.azv.sh/aktuelles/pressebereich/weltwassertag-2023-azv-suedholstein-unterstuetzt-den-wandel-zu-mehr-wasserschutz
(nach oben)
Stadt Balve und Ruhrverband: ziehen positive 100-Tage-Bilanz der Kanalnetzübertragung
Bürgermeister Hubertus Mühling: „Hier ist zusammengewachsen, was zusammengehört“
Die witterungsbedingt verschobene Verlegung des „goldenen“ Kanaldeckels vor dem Balver Rathaus besiegelt nun auch symbolisch die Kanalnetzübertragung von der Stadt Balve auf den Ruhrverband. Vordere Reihe kniend von links: Birgit Morgenroth (zentrale Ansprechpartnerin für das Balver Kanalnetz), Dr. Antje Mohr (Ruhrverband, Finanzvorstand), Prof. Norbert Jardin (Ruhrverband, Vorstandsvorsitzender), Hubertus Mühling (Bürgermeister von Balve). Hintere Reihe von links: Anja Schmidt, Michael Menke (beide RWG Ruhr-Wasserwirtschafts-Gesellschaft mbH), Harald Ließem, Timo Kölling, Ilka Strube (alle Ruhrverband), Hans-Jürgen Karthaus (Stadt Balve), Alexander Schulte (CDU, Balve), Lorenz Schnadt (UWG, Balve), Cay Schmidt (SPD, Balve). (Abdruck honorarfrei im Rahmen redaktioneller Berichterstattung, Quelle „Ruhrverband“)
Vor drei Monaten, zum 1. Januar 2023, hat die Stadt Balve ihre Abwasserbeseitigungspflicht gemäß Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen auf den Ruhrverband übertragen. Der sondergesetzliche Wasserwirtschaftsverband mit Sitz in Essen ist damit zusätzlich zur Abwasserreinigung auch für die ordnungsgemäße Ableitung des Abwassers innerhalb des Balver Stadtgebietes zuständig.
In einem Pressegespräch am Montag, dem 3. April, zogen die Spitzen von Stadtverwaltung und Ruhrverband gemeinsam Bilanz der ersten 100 Tage und besiegelten die neue Zusammenarbeit mit der symbolischen Verlegung eines „goldenen“ Kanaldeckels am Brunnen vor dem Balver Rathaus.
Bürgermeister Hubertus Mühling, als ehemaliger Werkleiter der Balver Stadtwerke selbst Fachmann für Abwasserfragen, sieht die an die Kanalnetzübertragung geknüpften Erwartungen für seine Kommune voll erfüllt: „Eine Zusammenführung von Kanalnetz und Kläranlage ergibt häufig Sinn, weil sie technische, personelle und wirtschaftliche Synergieeffekte mit sich bringt und parallele Strukturen überflüssig macht. Natürlich muss jede Stadt diese Entscheidung für sich unter Berücksichtigung der dortigen Rahmenbedingungen treffen, aber für Balve kann ich mit voller Überzeugung sagen: Hier ist zusammengewachsen, was zusammengehört.“
Auch Prof. Norbert Jardin, Vorstandsvorsitzender und Technikvorstand des Ruhrverbands, erkennt große Vorteile für beide Seiten: „Die Übertragung von Kanalnetzen rundet unsere wasserwirtschaftlichen Kernaufgaben sinnvoll ab. Alle Teilaufgaben der Siedlungsentwässerung aus einer Hand zu erledigen, bietet Vorteile sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht. Für die Kommune wiederum kann es eine große Entlastung bedeuten, wenn sich der Ruhrverband mit seinem umfassenden wasserwirtschaftlichen Fachwissen um die Erfüllung der immer strenger werdenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen kümmert.“
Mit der Übertragung der Aufgabe ist auch das wirtschaftliche Eigentum am Kanalnetz der Stadt Balve auf den Ruhrverband übergegangen, der dafür einen Ausgleichsbetrag von 22,8 Millionen Euro an die Stadt gezahlt hat. Für die Bürgerinnen und Bürger in Balve hat sich nicht viel geändert: Da die Gebühren- und Planungshoheit weiterhin bei der Kommune liegt, erhalten sie ihre Gebührenbescheide nach wie vor von dort. Für Fragen und Anliegen rund um das Kanalnetz oder Hausanschlüsse ist Birgit Morgenroth, die zentrale Ansprechpartnerin des Ruhrverbands, einmal pro Woche persönlich im Balver Rathaus vor Ort. Darüber hinaus ist die telefonische Erreichbarkeit in Notfällen auch nach Dienstschluss über die Rufnummer (0171/4717212) sichergestellt. Sämtliche Kontaktdaten sind auf der Internetseite der Stadt Balve zu finden.
https://ruhrverband.de/presse/pressemitteilungen/detailansicht/news///stadt-balve-und-ruhrverband-ziehen-positive-100-tage-bilanz-der-kanalnetzuebertragung/
(nach oben)
OOWV: Knappe Ressourcen clever bewirtschaften
Integriertes Wassermanagement
Oldenburg. 79 Fachleute der Wasserwirtschaft im Nordwesten vor Ort, weitere 45 online dabei – das Thema der von der Metropolregion Nordwest geförderten Veranstaltung in der Jugendherberge Oldenburg hatte am Mittwoch wohl einen Nerv getroffen: „Wasser im Nordwesten – knappe Ressourcen clever bewirtschaften!“ Mehr:
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2023/april/27/artikel/knappe-ressourcen-clever-bewirtschaften
(nach oben)
Köln: Dr.-Ing. Christian Gattke neuer Geschäftsbereichsleiter Planung und Bau
Die StEB Köln haben einen neuen Leiter des Geschäftsbereichs Planung und Bau: Dr. Christian Gattke hat zum 1. Mai die Nachfolge von Henning Werker angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist.
Der 53-jährige Diplom-Geograph kommt vom Erftverband, wo er von 2013 bis zu seinem Wechsel zu den StEB Köln die Abteilung Flussgebietsbewirtschaftung leitete. In dieser Funktion war Christian Gattke maßgeblich daran beteiligt, zahlreiche Projekte zur Gewässerrenaturierung und zum Hochwasserschutz zu planen und umzusetzen. Er initiierte und verantwortete Forschungsprojekte zur Kombination von naturnahen und technischen Verfahren bei der weitergehenden Abwasserbehandlung und der Verbreitung antibiotikaresistenter Bakterien im Abwasser.
Zuvor war Christian Gattke über fünf Jahre als Key-Account und Projektmanager bei der KISTERS AG tätig, wo er unter anderem die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes betreute. Von 2001 bis 2007 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Bauingenieurwesen der Ruhr-Universität Bochum, wo er im Bereich der Unsicherheiten hydrologischer Modelle forschte und zum Doktor-Ingenieur promovierte.
https://steb-koeln.de/Aktuelles/Erfahrener-Experte-vom-Erftverband-folgt-auf-Henning-Werker.jsp?ref=/Presse.jsp
(nach oben)
Emschergenossenschaft: Städte müssen Regenwasser wie einen Schwamm aufsaugen
Zukunftsinitiative Klima.Werk und die Westfälische Hochschule laden zu Info-Veranstaltung ein
Recklinghausen. Was hat ein Schwamm mit dem Klimawandel zu tun? Und wie betrifft das die Städte im Ruhrgebiet, wie betrifft das Recklinghausen? Antworten auf diese Fragen gibt es bei einem Info-Abend für Studierende und Bürgerschaft am Donnerstag, 11. Mai, in der Westfälischen Hochschule. Die Zukunftsinitiative Klima.Werk von Emschergenossenschaft und Kommunen ist dabei und zeigt, wie jeder einzelne etwas für Klimaresilienz tun kann.
Die Städte heizen sich auf, immer häufiger gibt es Starkregen, der Keller und Straßenkreuzungen überflutet – oder es regnet lange Zeit gar nicht. Diesen Folgen der Klimakrise sind wir aber nicht hilflos ausgeliefert: Es gibt Lösungen, zum Beispiel das städtebauliche Prinzip der Schwammstadt. Das steht im Mittelpunkt einer Info-Veranstaltung, zu der die Westfälische Hochschule in Recklinghausen zusammen mit anderen Partnern einlädt: Der BUND, die Baumschutzgruppe Recklinghausen, das Bündnis AufbruchKlimaVest, die Lokale Agenda 21 und die Emschergenossenschaft mit der Zukunftsinitiative Klima.Werk sind dabei.
Die blau-grüne Stadt der Zukunft
Unter dem Motto „Die blau-grüne Stadt der Zukunft – Das Prinzip der Schwammstadt“ werden das Problem und Lösungsstrategien vorgestellt und diskutiert. Auf dem Podium vertreten sind Dr. Marko Siekmann (Stadtentwässerung Bochum), Ulrike Raasch (Emschergenossenschaft) und Franz-Josef Knoblauch (Stadtentwässerung Recklinghausen). Prof. Dr. Katrin Grammann vom Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften moderiert die Runde. Zuschauer*innen können Fragen stellen und werden über Online-Abstimmungen interaktiv in die Veranstaltung mit eingebunden. Guido Halbig vom Deutschen Wetterdienst wird vor der Podiumsdiskussion einen Einführungsvortrag zu Klimaveränderungen halten.
Speichermöglichkeiten für Regenwasser
Versickerungs- und Speichermöglichkeiten für Regenwasser zu schaffen und die wertvolle Ressource nicht mehr in die Kanalisation abzuleiten ist die Leitlinie aller Maßnahmen der Schwammstadt. Dazu kann jeder einzelne beitragen und so das Klima in seiner Stadt positiv beeinflussen.
Die Emschergenossenschaft
Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Sie wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet und kümmert sich seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie um den Hochwasserschutz.
Die Zukunftsinitiative Klima.Werk
In der Zukunftsinitiative Klima.Werk arbeiten Emschergenossenschaft und Emscher-Kommunen zusammen an einer wasserbewussten Stadt- und Raumentwicklung, um die Folgen des Klimawandels abzumildern und die Lebensqualität in den Quartieren zu steigern. Der blau-grüne Umbau startete 2005 mit der Zukunftsvereinbarung Regenwasser (ZVR) und entwickelte sich 2014 zur Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ weiter, jetzt Zukunftsinitiative Klima.Werk. Die Serviceorganisation der Zukunftsinitiative bei der Emschergenossenschaft setzt mit den Städten die Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung um. Weitere Informationen (auch zu Förderung von Projekten) auf www.klima-werk.de
https://www.eglv.de/medien/staedte-muessen-regenwasser-wie-einen-schwamm-aufsaugen/
(nach oben)
Dresden: Unterirdischer Staudamm in der Dresdner Heide
Sven Carolus hat Spaß an großen Bauvorhaben. In Klotzsche hat der 44-jährige Bauleiter von der Coswiger Firma Heinrich Lauber derzeit eine Aufgabe zu meistern, die eine große Bedeutung für den Dresdner Stadtteil hat. Die Stadtentwässerung will dort für einen besseren Abwasser-Anschluss sorgen. Dabei hat der Bauleiter mit seinen Männern einen knapp 600 Meter langen, bogenförmigen unterirdischen Staudamm zu bauen. In dem zwei Meter hohen sogenannten Stauraumkanal direkt neben der Eisenbahnstrecke können beispielsweise bei Starkregen bis zu 1.800 Kubikmeter Abwasser zurückgehalten werden. So wird beispielsweise bei Starkregen das Kanalnetz nicht überlastet, erklärt Projektleiter Heiko Nytsch von der Stadtentwässerung. Am unteren Ende wird ein großer Absperrschieber installiert. Der kann ganz oder teilweise geschlossen werden, wird automatisch gesteuert und in der Kaditzer Leitwarte überwacht.
Das ist ein Teil eines Großprojekts, das am Abzweig zur Klotzscher Flugzeugwerft beginnt. Durch den alten Kanal unter der Grenzstraße fließt bisher das Abwasser vom Flughafen und der Flugzeugwerft zur Königsbrücker Landstraße. „Das ist nicht wenig“, sagt Investitionschef Torsten Seiler von der Stadtentwässerung. „Allein beim Enteisen der Flugzeuge im Winter fallen täglich Hunderte Kubikmeter an.“ Zusätzlich sind dort Betriebe und Einrichtungen der Mikroelektronik angeschlossen, darunter das Werk X-FAB und das Fraunhofer-Institut. „Die Kanäle müssen erneuert werden, da sie zu klein sind“, erklärt Seiler.
In der Grenzstraße haben die Arbeiten zum Jahresauftakt begonnen. Auf 400 Metern werden die alten Rohre ausgebaut und durch größere ersetzt. Im Anschluss wird ab Jahresmitte auf 200 Metern der 90 Zentimeter hohe Kanal saniert. Das geschieht, indem ein harzgetränkter Kunststoffschlauch eingerollt und die Wände somit neu abgedichtet werden. Daran schließt sich auf der anderen Seite der Königsbrücker Landstraße der unterirdische Staudamm an, der bis zur Langebrücker Straße führen soll und jetzt gebaut wird. Der untere Anschluss dieses Kanalbogens mündet wie bisher wieder in den Sammler auf der Königsbrücker Landstraße ein.
Zum Auftakt wurde neben dem alten Kanal eine 80 Zentimeter hohe Abwasser-Ersatzleitung gebaut. Sie ist seit 10. Februar in Betrieb ist. Anfang März konnte mit dem 50-Tonnen-Kettenbagger das erste Stahlbetonrohr eingehoben werden. Das drei Meter lange Rohr wiegt immerhin zehn Tonnen. Mit einem Tieflader werden jeweils zwei solcher Rohre zur Baustelle gebracht. „Bis September dieses Jahres soll der Stauraumkanal fertiggestellt werden“, erklärt Projektleiter Nytsch. Dann können die Rohre der Abwasser-Umleitung wieder abgebaut werden.
Bauleiter Carolus hat für die Stadtentwässerung schon andere Großprojekte gemeistert, so an der rechtselbischen Abwasser-Hauptschlagader, dem Altstädter Abfangkanal. Dort sanierte er auf der Tolkewitzer Bellingrathstraße einen Abschnitt, in dem das Rohr wie im Klotzscher Stauraumkanal auch zwei Meter hoch ist. Fünf Teile sind in Klotzsche schon eingebaut, die 15 Meter lang sind. 175 dieser tonnenschweren Teile werden folgen. Der Bauleiter ist zuversichtlich, mit seinem erfahrenen Team auch in Klotzsche den Bau pünktlich abschließen zu können. Dafür investiert die Stadtentwässerung rund 2,3 Millionen Euro. Für das gesamte Großprojekt bis zur Grenzstraße sind 4,6 Millionen Euro geplant.
https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/journal-1/detail/unterirdischer-staudamm-in-der-dresdner-heide/
(nach oben)
Aggerverband führt dritte große Aufforstungsaktion an der Wiehltalsperre durch
Gesamtschule Eckenhagen engagiert sich wiederholt für nachhaltige Regeneration geschädigter Waldstücke
Die Erfolge der ersten beiden Pflanzaktionen in den Jahren 2021 und 2022 sind bereits sichtbar: Mannshoch ragen heute die damals kleinen Setzlinge in den aufgeforsteten Waldstücken empor. So ist es nicht verwunderlich, dass der Aggerverband auch in diesem Jahr gerne eine Pflanzaktion mit der Gesamtschule Eckenhagen an der Wiehltalsperre durchführt.
In der Woche vom 17.-21.04.2023 engagieren sich insgesamt rund 150 Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Eckenhagen für den Erhalt der Wälder in ihrer Region. Es ist bereits die dritte große Aufforstungsaktion dieser Art an der Wiehltalsperre. Ziel ist es, die von Borkenkäfer und Dürre schwer geschädigten Waldflächen nachhaltig neu zu bepflanzen.
Mehr als 500 Pflanzen werden täglich mit Hilfe der Schülerinnen und Schüler umgesetzt. So sollen während der Aufforstungs-Woche gut zwei ha Kahlfläche neu bestückt werden. Insgesamt strebt der Verband an, durch die Pflanzaktionen in den Jahren 2021 bis 2023 rund 10.000 Bäume neu gesetzt zu haben.
Drei Forst-Mitarbeiter des Aggerverbandes leiten die nunmehr dritte Pflanz-Aktion. Heimische Baumarten wie Ahorn, Buche, Eiche und Tanne werden an den Vormittagen von den Jugendlichen geworben, um diese dann am Nachmittag auf den schwer geschädigten ehemaligen Fichten-Flächen neu zu pflanzen. Die Wasserschutz-Funktion des Waldes soll so wiederhergestellt und möglichen Erosionen vorgebeugt werden. Außerdem verspricht sich der Aggerverband durch die Auswahl verschiedener heimischer Pflanzen eine bessere Resilienz gegen Klimaveränderungen oder Kalamitäten wie z.B. den Borkenkäferbefall der vergangenen Jahre.
Unterstützt wird die Aktion wie in den Vorjahren von der Firma Jokey in Gummersbach, die für den schadlosen Transport der jungen Pflanzen Eimer aus recyceltem Plastik zur Verfügung stellt. Hauptbestandteil (ca. 75 %) dieser Eimer sind Rezyklate, die aus der haushaltsnahen Sammlung, also dem „gelben Sack“, gewonnen werden. Der Rest (ca. 25 %) sind Rezyklate aus der sogenannten postmaritimen Sammlung, bei der .B. auch alte Fischernetze Verwertung finden.
Auch der „Förderverein der Gummersbacher Rotary Clubs“ unterstützt die diesjährige Aktion wieder mit einer Spende, so dass die fleißigen Schülerinnen und Schüler mit einer kräftigen Suppe zur Mittagszeit gestärkt werden können.
https://www.aggerverband.de/service/presse/artikel/aggerverband-fuehrt-dritte-grosse-aufforstungsaktion-an-der-wiehltalsperre-durch-gesamtschule-eckenhagen-engagiert-sich-wiederholt-fuer-nachhaltige-regeneration-geschaedigter-waldstuecke
(nach oben)
Aggerverband: Anwendertreffen Membrantechnik im simas am 27.04.2023
Am 27. April fand im Schulungsinstitut für Membrantechnik in der Abwasserreinigung in Seelscheid e.V. (simas) das diesjährige Anwendertreffen für Membrananlagen in der Abwasserreinigung statt. Den fast 40 Teilnehmenden wurden interessante Vorträge zu neuen Entwicklungen und Projekten im Bereich von membrantechnischen Anlagen geboten. Im Anschluss an die einzelnen Vorträge gab es angeregte fachtechnische Diskussionen.
Membrananlagen verzeichnen aufgrund von erhöhten Reinigungsanforderungen bei der Elimination von Spurenstoffen, Mikroplastik und auch antibiotikaresistenten Keimen sowie als geeignetes Reinigungsverfahren zur Wasserwiederverwendung eine erhöhte Nachfrage. Nicht zuletzt die im Entwurf der neuen EU Kommunalabwasserrichtlinie gestellten Reinigungsanforderungen werden voraussichtlich zu einer steigenden Anzahl von installierten Membrananlagen führen.
https://www.aggerverband.de/service/presse/artikel/anwendertreffen-membrantechnik-im-simas-am-27-04-2023
(nach oben)
AZV Südholstein: Weltumwelttag: Kampf gegen die Plastikverschmutzung
AZV Südholstein – mit Resolution und Infomaterial gegen Mikroplastik-Problem
Die Plastikverschmutzung der Umwelt ist ein weltweites Problem. Ein großer Teil ist mit bloßem Auge kaum zu erkennen: winzige Mikroplastikpartikel, die u.a. das Wasser verunreinigen. Der Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV) macht anlässlich der Kampagne der Vereinten Nationen zum Weltumwelttag am 5. Juni auf das Plastikproblem aufmerksam. Mit einer Resolution, Info- und Lehrmaterial leistet der AZV selbst aktive Präventionsarbeit zum Thema.
Als Mikroplastik gelten Kunststoffpartikel mit einer Größe von ca. fünf Millimetern oder kleiner. Sie stammen beispielsweise vom Abrieb von Fahrzeugreifen oder zersetztem Plastikmüll, sind aber auch Bestandteil vieler Kosmetik- oder Reinigungsprodukte. Das Problem: Mikroplastik wird zum Gesundheitsrisiko, wenn es (insbesondere mit daran gebundenen Giftstoffen) in die Nahrungskette gelangt und es ist biologisch schwer abbaubar – das führt zum einer kontinuierlich steigenden Konzentration in der Umwelt.
Für Umweltunternehmen wie den Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV) in Hetlingen ist Mikroplastik im (Ab-)Wasser eine große Herausforderung, weil umfassendes Ausfiltern schwierig und nur mit hohem technischen Aufwand möglich ist. Nicht ohne Grund haben daher der Verband und seine Mitgliedkommunen schon vor einiger Zeit eine Resolution gegen die Wasserverschmutzung durch Mikroplastik und Medikamentenreste verabschiedet. Ihre Kernaussage: Was gar nicht erst ins Abwasser gelangt, muss auch nicht mühsam wieder herausgeholt werden.
Die Resolution fordert u.a. Aufklärung und Bewusstseinsbildung zum Themenfeld „Mikroplastik und Spurenstoffe“ sowie aktives Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft, bei der Bekämpfung der unsichtbaren Bedrohung. Für diese Ziele bietet der AZV auf seiner Website „www.azv.sh“ zahlreiche nützliche Hinweise und Materialien. Die Bandbreite reicht von Links zu Apps für Produktchecks auf Schadstoffe bis hin zu Plakaten, Infografiken, Flyern oder Videos, die kostenlos als Arbeitsmaterialien von Schulen, Bildungseinrichtungen etc. genutzt werden dürfen.
Der Verband hat die Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung in seinem Leitbild festgeschrieben und ist seit über 10 Jahren eine zertifizierte Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit. Als einer der ersten Abwasserzweckverbände in Deutschland hat er eine Erklärung auf Basis des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) erstellt.
https://www.azv.sh/aktuelles/pressebereich/weltumwelttag-kampf-gegen-die-plastikverschmutzung
(nach oben)
Käppala-Kläranlage/Schweden: Veolia Water Technologies liefert das weltweit größte MBBR-System an Käppala nach Schweden
AnoxKaldnes, eine Tochtergesellschaft von Veolia Water Technologies und der weltweit führende Anbieter von Lösungen auf der Basis von Schwebebett-Biofilmreaktoren (MBBR), unterstützt mit seiner Lösung die Modernisierung und den nachhaltigen Ausbau der Käppala-Kläranlage in Lidingö, Schweden. Die Anlage behandelt das Abwasser von mehr als einer halben Million Menschen in 11 Mitgliedsgemeinden nördlich und östlich von Stockholm und wird nach seiner Fertigstellung die größte MBBR-Lösung der Welt sein.
In Schweden entsteht ein großes Kommunalprojekt mit besonderer Weitsicht. Die Kläranlage von Käppala muss für die zukünftigen Herausforderungen nicht nur mehr leisten können, sondern auch umweltverträglicher Wasser aufbereiten. Der Kommunalverband Käppala plant daher, die Kapazität der Anlage so zu erweitern, dass im Jahr 2050 bis zu 900.000 Einwohner zuverlässig versorgt werden können und darüber hinaus die neuesten Emissionsanforderungen erfüllt werden, die erst 2026 in Kraft treten werden.
Nach ihrer Fertigstellung wird die Kläranlage Käppala das größte MBBR-Gesamtsystem der Welt sein. Jede der fünf Aufbereitungslinien der bestehenden Anlage hat ein Volumen von ca. 18.000 m3 und wird in neun Einzelzonen unterteilt, um den anspruchsvollen neuen Anforderungen gerecht zu werden. Dank der Effizienz der AnoxKaldnesTM MBBR-Systeme werden die fünf MBBR-Linien 80% der ankommenden Schadstofffracht und des Durchflusses zuverlässig behandeln können.
Der Ausbau der Kläranlage ist in vielerlei Hinsicht kein alltägliches Projekt. So ist die Kläranlage Käppala unterirdisch gebaut und die Belebungsbecken müssen aus dem Gestein gesprengt werden, so dass die Beckenwände aus Grundgestein bestehen. Mit dem patentierten AnoxK5XTM, sorgt künftig ein Trägerkörper für die sichere Abwasserbehandlung, welcher nachweislich bis zu zehn mal langlebiger als vergleichbare Trägerkörper ist. Logistik, Lebensdauer des Trägermaterials und Fachwissen waren daher drei schlagende Gründe, um Veolia Water Technologies den Zuschlag zu erteilen. Veolia kann somit in diesem Projekt seine gesamte Kompetenz nachhaltiger Wasseraufbereitung für die lokale Bevölkerung einbringen.
AnoxKaldnes hat den Vertrag mit NCC (Nordic Construction Company), einem der führenden Bauunternehmen in der nordischen Region, unterzeichnet. NCC wird seine umfangreiche Projektkompetenz für die Ausführung des Baus und die Umsetzung der neuen Aufbereitungsanlagen zur Verfügung stellen.
Mehr zum Thema: www.veoliawatertechnologies.de
(nach oben)
HAMBURG WASSER erprobt Wasserrecycling
Trotz leicht rückläufiger Wasserlieferungen blickt HAMBURG WASSER auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022. Gleichzeitig kündigt HAMBURG WASSER eine Erweiterung seiner Produktpalette um recyceltes Wasser an: In Kürze liefert der städtische Versorger im Pilotquartier Jenfelder Au Brauchwasser an einen dort ansässigen Gewerbepark, das aus aufbereitetem Abwasser und Regenwasser erzeugt wird.
Trotz leicht rückläufiger Wasserlieferungen blickt HAMBURG WASSER auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022: Mit 624,2 Millionen Euro wurde der konsolidierte Umsatz des Gesamtkonzerns leicht gesteigert. Insgesamt erzielte HAMBURG WASSER einen Überschuss von rund 97,6 Millionen Euro. Die Hamburger Wasserwerke GmbH erwirtschafteten dabei ein Ergebnis von 28,7 Millionen Euro, die Hamburger Stadtentwässerung AöR 67,6 Millionen Euro. Als herausfordernd bewertet Hamburgs städtischer Wasserversorger anhaltende Kostensteigerungen. Ohne Trendumkehr erwartet HAMBURG WASSER in den Geschäftssparten Trinkwasser und Abwasser bis 2030 Kostensteigerungen in Höhe von 45 Prozent gegenüber 2022. Das Unternehmen wird dieser Entwicklung unter anderem mit Effizienzsteigerungen und schnellerer Digitalisierung begegnen. Gleichzeitig kündigt HAMBURG WASSER eine Erweiterung seiner Produktpalette um recyceltes Wasser an: In Kürze liefert der städtische Versorger im Pilotquartier Jenfelder Au Brauchwasser an einen dort ansässigen Gewerbepark, das aus aufbereitetem Abwasser und Regenwasser erzeugt wird.
https://www.hamburgwasser.de/presse/2022/pm-hamburg-wasser-erprobt-wasserrecycling
(nach oben)
AZV Breisgauer Bucht: Wir setzen uns täglich für eine lebenswerte Umwelt ein
Sie wollen wissen, wie Ihr Abwasser gereinigt wird?
Sie haben Interesse an modernen Umweltschutztechniken?
Sie unterrichten das Thema Wasser und Abwasserreinigung an einer Schule?
Sie studieren Biologie, Umwelttechnik oder Ähnliches?
Sie planen eine Betriebsausflug?
Dann besuchen Sie unser Klärwerk
Informationen rund um die Besichtigung:
– in der Regel wochentags ab 8 Uhr
– Dauer ca. 2 Stunden (Vortrag und Rundgang)
– Gruppen von 10 bis 30 Personen
-ab 9 Jahren
– kostenfrei
Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mit uns:
Weitere Informationen zum Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht und dem Klärwerk finden Sie auf unserer
Webseite: www.azv-breisgau.de
Frau Bannwarth
Tel. 07642 6896 – 245
FAX 07642 6896 – 240
E-Mail: bannwarth.ul@azv-breisgau.de
https://azv-breisgau.de/wp-content/uploads/2023/02/Info-Blatt-Besichtigungen.pdf
(nach oben)
Erftverband informiert über Stand der Bauarbeiten
Die Kläranlage Erftstadt-Köttingen wurde in der Hochwasserkatastrophe stark beschädigt. Das Schadensbild umfasste weite Teile der maschinentechnischen Ausrüstung sowie bauliche Anlagenteile. Die Prozesse der mechanisch-biologischen Abwasserreinigung konnten mittels Leihaggregate, etlichen Provisorien und hohem Personaleinsatz bereits nach wenigen Tagen wieder in Betrieb genommen werden. Einige Hochbauten und sämtliche Anlagenteile der Schlammbehandlung wurden so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass diese neu geplant und errichtet werden müssen.
Nach einer umfangreichen Planungs-, Genehmigungs- und Ausschreibungsphase finden zurzeit die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme statt, sodass im Herbst 2023 die Faulung wieder in Betrieb genommen werden kann. Die aktuelle Marksituation war dabei die größte Herausforderung, da für einige Arbeiten kein Angebot auf die öffentliche Ausschreibung einging. Auch hier stellt die schlechte Verfügbarkeit von elektronischen Bauteilen eine weitere Herausforderung bei der Projektabwicklung dar. Die Betonsanierung des Faulbehälterinnenraums war ungewöhnlich aufwendig und ist nun nahezu abgeschlossen. Die Betonsanierung außen hat begonnen. Der Aufwand und vollständige Umfang der Sanierung wurde erst nach Außerbetriebnahme und Entleerung des Behälters deutlich, denn erst dann kann er im sonst gefüllten Innenraum mittels Gerüst eingehend auf Mängel untersucht werden.
Im Keller des Technikgebäudes werden derzeit die Montage der Faulbehälterausrüstung des Innenraums sowie der Heizungsanlage, Pumpwerke und Rohrleitungen für die Faulung durchgeführt. Im Außenbereich werden zudem neue Rohrleitungen und Kabelkanäle verlegt.
Das alte Sozialgebäude, die Wohnhäuser, der alte Gasbehälter und ein Rücklaufpumpwerk sind abgerissen. Die Leistungen zum Neubau des Betriebsgebäudes wurden schlüsselfertig vergeben. Der Baubeginn wird Mitte Juli/Anfang August sein.
Die Arbeiten zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Standort der Kläranlage Erftstadt-Köttingen werden nach derzeitigen Planungsstand bis Mitte 2025 andauern. Die Herstellungsosten belaufen sich auf insgesamt 14,8 Mio. €. Die hochwasserbedingten Kosten sind versichert. Kosten, die über die Deckungssumme der Versicherung hinausgehen, werden bei der Hochwasserhilfe des Landes geltend gemacht.
Ihre Ansprechpartnerin bei Rückfragen:
Erftverband – Pressestelle
Ronja Thiemann
Am Erftverband 6
50126 Bergheim
02271 88-2127
pressestelle@erftverband.de
https://www.erftverband.de/sanierung-der-klaeranlage-erftstadt-koettingen/
(nach oben)
Erftverband: Ausgeprägte Trockenheit im Erft-Einzugsgebiet
Die mittlere Jahrestemperatur lag im Wasserwirtschaftsjahr 2022 im Tätigkeitsbereich des Erftverbandes bei 11,8 °C und damit 0,1 °C über dem bisherigen Höchstwert von 2020. Damit war das Jahr 2,2 °C wärmer, bezogen auf den Zeitraum 1961 – 1990 und 1,1°C wärmer als im Zeitraum 1991 – 2020. Im Sommerhalbjahr waren die Temperaturabweichungen mit 2,5° C gegenüber 1961 – 1990 höher als im Winterhalbjahr (1,8 °C). Besonders warm waren die Monate Februar, August und Oktober.
Gekennzeichnet war das Wasserwirtschaftsjahr darüber hinaus von ausgeprägter Trockenheit. Insbesondere die Monate März, Juli und August wiesen ein deutliches Niederschlagsdefizit auf. Die Trockenphase in Juli und August trat in den letzten Jahren gehäuft auf. Neben 2022 waren die Jahre 2018, 2013 und 2016 unter den vier bis sechs trockensten seit Beginn der Messungen.
Insgesamt lagen die Niederschlagssummen im Sommerhalbjahr im Tätigkeitsbereich 26 Prozent unter dem Vergleichswert (1961 – 1990), im Winterhalbjahr betrug das Defizit 16 Prozent. Das gesamte Jahr war mit im Mittel 543 l/m² im Tätigkeitsbereich etwa 20 Prozent trockener als im Mittel des Vergleichszeitraums. Ein noch höheres Niederschlagsdefizit verhinderte ein regenreicher September, auf den bis zu 40 Prozent des Niederschlags im Sommerhalbjahr entfielen.
Ihre Ansprechpartnerin bei Rückfragen:
Erftverband – Pressestelle
Ronja Thiemann
Am Erftverband 6
50126 Bergheim
02271 88-2127
pressestelle@erftverband.de
https://www.erftverband.de/jahresmitteltemperatur-im-wasserwirtschaftsjahr-2022-mit-neuem-hoechstwert/
(nach oben)
Erftverband informiert über aktuellen Stand der Bauarbeiten im südlichen Verbandsgebiet
Im Jahr 1984 erbaut, dient das Hochwasserrückhaltebecken Horchheim dem Schutz der Ortschaften Weilerswist und Erftstadt vor Hochwasser. Bis zu 1.376.000 Kubikmeter Wasser kann hier gespeichert werden. Während des Hochwassers im Juli 2021 wurde der Damm in der Nacht vom 14. auf den 15. überströmt. Das Hochwasser hat das Hochwasserrückhaltebecken samt den dazugehörigen Anlagenteilen wie zum Beispiel die Pegel beschädigt. Die Steuerwarte wurde geflutet. Das Becken wurde daraufhin außer Betrieb gesetzt.
Kurz nach der Flut wurde der Damm im Bereich der offensichtlichen Erosionsschäden mit Hilfe von Wasserbausteinen provisorisch gestützt. Die anschließenden Standsicherheitsuntersuchungen zeigten, dass der restliche Teil des Dammes die Überströmung schadlos überstanden hat. Damit bei zukünftigen Extremereignissen Beschädigungen im Bereich des Durchlassbauwerks ausgeschlossen werden können, wird hinter dem Damm nun ein deutlich größeres Tosbecken errichtet.
Die dafür notwendigen Nachweise und Gutachten mussten vor Vergabe der Bauarbeiten mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt werden. Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, wurden die Arbeiten zur Instandsetzung des Dammes in zwei Bauabschnitte unterteilt: (1) Bau eines provisorischen Tosbeckens mittels Spundwänden und (2) Fertigstellung des Tosbeckens (Betonsohle) sowie Wiederherstellung des Dammes, des Pegels und der Wege.
Die Spundwandarbeiten wurden im November letzten Jahres abgeschlossen. Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts können nun zirka zwei Drittel des regulären Beckenvolumens wieder für den Hochwasserrückhalt genutzt werden. Die für die Steuerung der Dammverschlüsse notwendigen Hydraulikzylinder wurden im letzten Sommer 2022 repariert und wieder eingebaut.
Die elektronische Instandsetzung der Steuerwarte erfolgt unabhängig davon ab August dieses Jahres. Schwierigkeiten und Verzögerungen bereitet fortwährend die teilweise sehr schlechte Verfügbarkeit von elektronischen Bauteilen. Der provisorische Notbetrieb bleibt auch während der Bauarbeiten möglich. Für Samstag, den 26. August ist ein Tag der offenen Baustelle geplant. Informationen zu Ablauf und Anmeldung gibt es in den kommenden Wochen auf der Seite des Erftverbandes sowie in den sozialen Medien des Wasserverbandes.
Bauarbeiten an der Erft im Südbezirk
„Insgesamt sind wir mit der ersten Wiederherstellung durch. Die Gewässerprofile wurden optisch wieder auf den „vorherigen“ Stand gebracht. Jetzt sind wir in der Phase des Nacharbeitens.“, erklärt Erftverbandsvorstand Dr. Bucher. Es komme noch immer zu starken Sedimentum- und ablagerungen in den Gewässern. In Abstimmung mit den Planungsingenieur*innen des Verbandes wird hier entschieden, ob Strukturen, die sich eigendynamisch entwickelt haben, bleiben können oder angepackt werden müssen.
„Unsere alleinigen Baustellen sind durch. Bei einigen verbleibenden müssen noch Abstimmungen mit Dritten erfolgen“, ergänzt Bucher. „Im Moment sprechen wir zum Beispiel mit der Deutschen Bahn über die Gewässerführung im Bereich von Brücken an der Erft zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel. Diese Strecke wird durch die Bahn zurzeit komplett erneuert. Zudem ersetzt der Landesbetrieb Straßen NRW momentan die Brücke B51/Erft in Euskirchen (Oberwasser Erftpark). Die Stadt Bad Münstereifel ist mit der Erftmauersanierung in der Kernstadt durch. Hier sind wir im Austausch über Treppen- und Brückensanierungen.
Der Orbach bzw. das Orbachtal hat sich durch das Hochwasser im Juli 2021 insbesondere im Bereich zwischen der Brücke Lappermühlenallee (Euskirchener Stadtgebiet) und den Sportanlagen in Odendorf (Gemeinde Swisttal) stark verändert. Dieser Abschnitt befindet sich innerhalb des Naturschutzgebietes Orbach/Jungbach/Steinbach und Sürstbach. Dort kam es zu Uferabbrüchen, Sedimentumlagerungen, Sohlaufhöhungen und somit letztendlich zu Talverbreiterungen und Veränderungen im Gewässerverlauf. Durch die Kraft des Wassers haben sich wertvolle Gewässerstrukturen entwickelt, die wichtig für ein gesundes Gewässerökosystem im Orbach sind. Weitestgehend kann die weitere eigendynamische Gewässerentwicklung in diesem Abschnitt zugelassen werden. Auch zwischen dem Fußballplatz und den Tennisplätzen am südlichen Ortseingang von Odendorf ist der Gewässerverlauf nun breiter als vor der Flut und der Orbach hat sich in die Geländetieflage verlagert, die nordöstlich an den Fußballplatz angrenzt. Diese Tieflage (der Talweg zum Fußballplatz) wird bei Abflüssen in der Größenordnung des bisherigen HQ10 (HQhäufig)* laut der 1D-hydraulischen Nachberechnung des Verbandes überschwemmt. Etwa ab der Hälfte der Tennisplätze fließt der Orbach optisch wieder in dem gleichen Gewässerbett wie vor dem Hochwasser im Juli 2021. Die Sportanlagen werden zukünftig von der Gemeinde aus dem hochwassergefährdeten Orbachtal heraus auf höher gelegene Flächen verlegt. Zurzeit werden sie nur vorübergehend von den Sportvereinen weiter genutzt.
Innerhalb der Ortslage Odendorf müssen die Ufermauern des Orbachs aufgrund von Schäden durch die Flutkatastrophe 2021 instandgesetzt/saniert werden. Nachdem die Standsicherheit der Ufermauern im Jahr vor der Flut bereits untersucht wurde, erfolgt in den kommenden Wochen eine erneute Bestandsaufnahme der Bausubstanz, um den Sanierungsumfang im Detail festzulegen. Je nach Ergebnis ergeben sich unterschiedliche Sanierungskonzepte. Welche hydraulische Leistungsfähigkeit der Abschnitt in Odendorf dabei haben muss, bleibt derzeit noch offen, da die Rückhaltemöglichkeiten an der Steinbachtalsperre und am Sürstbach zurzeit noch Gegenstand von laufenden Planungen sind.
* HQ = H für „Hochwasser“, Q für Abfluss-Kennzahl. Die Zahl dahinter gibt an, in wie vielen Jahren das Ereignis statistisch einmal vorkommt (Jährlichkeit). Das bedeutet ein HQ10 ist statistisch einmal in 10 Jahren zu erwarten und wird auch als 10-jährliches Ereignis bezeichnet.
Ihre Ansprechpartnerin bei Rückfragen:
Erftverband – Pressestelle
Ronja Thiemann
Am Erftverband 6
50126 Bergheim
02271 88-2127
pressestelle@erftverband.de
https://www.erftverband.de/hochwasserrueckhaltebecken-horchheim-orbach-und-erft/
(nach oben)
Emschergenossenschaft: Auszeichnung für „Katernberger Bach – Mach mit!“
Emschergenossenschaft und Stadt Essen nahmen in Berlin den Preis Soziale Stadt entgegen
Berlin/Essen. Die Emschergenossenschaft und die Stadt Essen sind in Berlin für ihr gemeinsames Projekt „Katernberger Bach – Mach mit! Wasserwirtschaft, Stadtentwicklung und Menschen im Quartier Hand in Hand“ mit dem Preis Soziale Stadt ausgezeichnet worden. Insbesondere zeigte sich die Jury von der Partizipation der Bevölkerung bei der Entwicklung des Blauen Klassenzimmers am Katernberger Bach beeindruckt. Das Gewässer war über Jahrzehnte ein in Teilen verrohrter Schmutzwasserlauf und wurde im Zuge des Generationenprojektes Emscher-Umbau vom Abwasser befreit und naturnah umgestaltet.
Die Auszeichnung für das Essener Projekt begründete die Jury mit den folgenden Worten: „Das Projekt „Katernberger Bach – Mach mit!“ ist ein herausragendes Beispiel für die gemeinsame Aufwertung und Gestaltung des Lebensumfelds. Eine Vielzahl institutioneller und privater Akteure haben die Gelegenheit zum ökologischen Umbau des Bachs genutzt und eine vielfältige Blau-Grüne Infrastruktur für die Bevölkerung geschaffen. Insbesondere die Beteiligung von Jugendlichen und Kindern sowie das Konzept eines „Blauen Klassenzimmers“ hat die Jury beeindruckt. Durch die Kostenübernahme der Partner und eine starke Identifikation der Bürgerschaft ist die Verstetigung gesichert. Der Ansatz wird bereits auf andere Quartiere übertragen, sodass das gute Beispiel auch weitergetragen wird.“
Überreicht wurde die Auszeichnung unter anderem von Sören Bartol, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Für die Emschergenossenschaft nahm Bettina Gruber, als Gebietsmanagerin Mitte für den Umbau des Katernberger Bachs verantwortlich, den Preis entgegen – stellvertretend auch für die beiden nicht in Berlin anwesenden Projektleiter der Emschergenossenschaft Henning Stahlschmidt und Sebastian Ortmann. Die Stadt Essen wurde vertreten durch Margarete Meyer und Ingrid Ratay, zuständig für das Thema Stadtteilentwicklung.
„Die Auszeichnung unseres Projektes mit dem Preis Soziale Stadt ist eine wunderbare Bestätigung unserer Arbeit und unterstreicht den sozialen und nachhaltigen Charakter des Emscher-Umbaus. Uns war es besonders wichtig, die Menschen aus dem Stadtteil bei diesem Flussumbau abzuholen und mitzunehmen, denn letztlich ist es ihr unmittelbares Lebensumfeld, das wir gemeinsam mit ihnen und für sie umgestaltet haben“, sagt Bettina Gruber von der Emschergenossenschaft.
„Das besondere an dem Projekt ist die gute Zusammenarbeit der Kooperationspartner. In die Planungen waren aber eben auch maßgeblich Ideen, Wünsche und Anregungen der Katernberger Bürgerinnen und Bürger eingeflossen“, so Margarete Meyer, Leiterin der Abteilung Stadterneuerung, Städtebauförderung und Stadtteilentwicklung bei der Stadt Essen. „Gebaut wurde seit September 2019. Entstanden sind dabei unter anderem zahlreiche Bachterrassen, Entdeckerorte mit Furten, ein Jugendort, ein Spielplatz, neue Zugänge zum Gewässer und mehr. Denn das Thema Bildung spielt am Katernberger Bach unter anderem mit dem ‚Blauen Klassenzimmer‘ als Lernstandort im Freien eine wichtige Rolle, aber durch das Erleben und partizipative Gestalten des eigenen Lebensumfeldes.“
Umbau des Katernberger Bachs
Der Katernberger Bach floss seit den 1960er-Jahren größtenteils unterirdisch verrohrt durch den Essener Stadtteil Katernberg. Dadurch war er in der Wahrnehmung der Menschen kaum vorhanden. Im Rahmen des Generationenprojektes Emscher-Umbau wurde das Gewässer offengelegt. Um das Reinwasser von dem Schmutzwasser zu trennen, wird die zuvor bereits vorhandene Gewässerverrohrung nun als Abwasserkanal benutzt. Anschließend wurde der Grünzug in Katernberg neugestaltet. Dafür wurden circa 90.000 Kubikmeter Boden bewegt. Nun befinden sich an dem neu entstandenen offenen Bachlauf verschiedene Furten, ein sogenanntes „Matschufer“ und ein Blaues Klassenzimmer als Lernstandort im Freien. In den Umbau des Katernberger Bachs investierte die Emschergenossenschaft rund 29 Millionen Euro.
Für die Maßnahmen zum ökologischen Gewässerumbau erhielt die Emschergenossenschaft eine Zuwendung durch das Umweltministerium des Landes NRW in Höhe von 50 Prozent der Investitionssumme. Projekte wie das Blaue Klassenzimmer wurden vom NRW-Städtebauministerium im Rahmen der Kooperation „Gemeinsam für das Neue Emschertal“ mit knapp 350.000 Euro gefördert. Da Katernberg zum Städtebaufördergebiet „Soziale Stadt – Investitionen im Quartier, Stadtbezirk VI Zollverein, Essen“ zählt, wurden auch auf Initiative der Stadt Essen für die städtebauliche Integration und zur Stärkung der Erlebbarkeit des neuen Gewässers Fördermittel des NRW-Städtebauministeriums in Höhe von 80 Prozent der Gesamtkosten (knapp 1,3 Millionen Euro) bewilligt. Den Rest übernahm die Stadt Essen als Eigenanteil.
Gemeinsam für das neue Emschertal
Das Projekt „Katernberger Bach – Mach mit!“ ist umgesetzt worden im Rahmen der Kooperation „Gemeinsam für das neue Emschertal“ zwischen der Emschergenossenschaft und dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Ziel war es, am Katernberger Bach zusätzlich zu den Maßnahmen der ökologischen Verbesserung im Zuge des Emscher-Umbaus weitere Stationen entstehen zu lassen, die das Gewässer zugänglich machen und es so in das Stadtteilleben einbinden.
Die Auslober des Preises Soziale Stadt – gemeinsam für Quartiere sind der AWO Bundesverband e.V., der Deutscher Mieterbund, der Deutsche Städtetag, der vhw Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung sowie der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V..
Die Emschergenossenschaft
Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das effizient Aufgaben für das Gemeinwohl mit modernen Managementmethoden nachhaltig erbringt und als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Sie wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet und kümmert sich seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie um den Hochwasserschutz. www.eglv.de
https://www.eglv.de/medien/auszeichnung-fuer-katernberger-bach-mach-mit/
(nach oben)
Dresden-Kaditz: Großer Andrang beim Tag der offenen Tür im Klärwerk
Rund 6.000 Besucherinnen und Besucher nutzten am 11. Juni 2023 die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Abwasserreinigung in Dresden zu werfen. Die Stadtentwässerung Dresden lud zum Tag der offenen Tür im Klärwerk Dresden-Kaditz ein und bot ein vielfältiges Programm für Jung und Alt.
Die Gäste konnten sich auf einem Rundgang entlang der mechanischen, chemischen und biologischen Behandlungsstufen über die Abwasserreinigung informieren. Dabei mussten sie an den verschiedenen Punkten Fragen beantworten und bekamen dafür am Ende einen kleinen Preis. Außerdem konnten die beiden Faultürme bestiegen werden, in denen Klärgas gewonnen wird. Dieses Angebot war besonders beliebt, da man aus 35 Metern Höhe einen einzigartigen Ausblick auf Dresden genießt.
Das sonnige und warme Wetter spielte den Veranstaltern in die Hände. Vor allem Familien mit jüngeren Kindern nutzten das vielfältige Angebot aus Spiel, Spaß und Wissen rund ums Wasser. Das Gelände wurde zum Stadtpark. Viele Besucher verweilten vor der Bühne und genossen das Programm mit den Physikanten (einer Wissenschaftsshow), Tanzeinlagen und den Roch ´n´ Rollern von The Firebirds. Das Klärwerk – das zu den schönsten Deutschlands gehört – erinnerte an diesem Sonntag mehr an einen Stadtpark als ein Industriegelände.
„Die Dresdner lieben ihre Kläranlage und haben uns auch nach fünf Jahren pandemiebedingter Pause nicht vergessen“, meinte die Kaufmännische Geschäftsführerin Gunda Röstel. Ihr Kollege Ralf Strothteicher, Technischer Geschäftsführer, ergänzte: „Unsere Kolleginnen und Kollegen beantworteten sehr viele neugierige Fragen. Mein Eindruck war durchweg positiv: Ich traf nur auf zufriedene Gäste und motivierte Beschäftigte. Es war für uns ein rundum gelungener Tag.“
https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/journal-1/detail/grosser-andrang-beim-tag-der-offenen-tuer-im-klaerwerk-dresden-kaditz/
(nach oben)
Dresden: Unterirdischer Staudamm in der Dresdner Heide
Sven Carolus hat Spaß an großen Bauvorhaben. In Klotzsche hat der 44-jährige Bauleiter von der Coswiger Firma Heinrich Lauber derzeit eine Aufgabe zu meistern, die eine große Bedeutung für den Dresdner Stadtteil hat. Die Stadtentwässerung will dort für einen besseren Abwasser-Anschluss sorgen. Dabei hat der Bauleiter mit seinen Männern einen knapp 600 Meter langen, bogenförmigen unterirdischen Staudamm zu bauen. In dem zwei Meter hohen sogenannten Stauraumkanal direkt neben der Eisenbahnstrecke können beispielsweise bei Starkregen bis zu 1.800 Kubikmeter Abwasser zurückgehalten werden. So wird beispielsweise bei Starkregen das Kanalnetz nicht überlastet, erklärt Projektleiter Heiko Nytsch von der Stadtentwässerung. Am unteren Ende wird ein großer Absperrschieber installiert. Der kann ganz oder teilweise geschlossen werden, wird automatisch gesteuert und in der Kaditzer Leitwarte überwacht.
Das ist ein Teil eines Großprojekts, das am Abzweig zur Klotzscher Flugzeugwerft beginnt. Durch den alten Kanal unter der Grenzstraße fließt bisher das Abwasser vom Flughafen und der Flugzeugwerft zur Königsbrücker Landstraße. „Das ist nicht wenig“, sagt Investitionschef Torsten Seiler von der Stadtentwässerung. „Allein beim Enteisen der Flugzeuge im Winter fallen täglich Hunderte Kubikmeter an.“ Zusätzlich sind dort Betriebe und Einrichtungen der Mikroelektronik angeschlossen, darunter das Werk X-FAB und das Fraunhofer-Institut. „Die Kanäle müssen erneuert werden, da sie zu klein sind“, erklärt Seiler.
In der Grenzstraße haben die Arbeiten zum Jahresauftakt begonnen. Auf 400 Metern werden die alten Rohre ausgebaut und durch größere ersetzt. Im Anschluss wird ab Jahresmitte auf 200 Metern der 90 Zentimeter hohe Kanal saniert. Das geschieht, indem ein harzgetränkter Kunststoffschlauch eingerollt und die Wände somit neu abgedichtet werden. Daran schließt sich auf der anderen Seite der Königsbrücker Landstraße der unterirdische Staudamm an, der bis zur Langebrücker Straße führen soll und jetzt gebaut wird. Der untere Anschluss dieses Kanalbogens mündet wie bisher wieder in den Sammler auf der Königsbrücker Landstraße ein.
Zum Auftakt wurde neben dem alten Kanal eine 80 Zentimeter hohe Abwasser-Ersatzleitung gebaut. Sie ist seit 10. Februar in Betrieb ist. Anfang März konnte mit dem 50-Tonnen-Kettenbagger das erste Stahlbetonrohr eingehoben werden. Das drei Meter lange Rohr wiegt immerhin zehn Tonnen. Mit einem Tieflader werden jeweils zwei solcher Rohre zur Baustelle gebracht. „Bis September dieses Jahres soll der Stauraumkanal fertiggestellt werden“, erklärt Projektleiter Nytsch. Dann können die Rohre der Abwasser-Umleitung wieder abgebaut werden.
Bauleiter Carolus hat für die Stadtentwässerung schon andere Großprojekte gemeistert, so an der rechtselbischen Abwasser-Hauptschlagader, dem Altstädter Abfangkanal. Dort sanierte er auf der Tolkewitzer Bellingrathstraße einen Abschnitt, in dem das Rohr wie im Klotzscher Stauraumkanal auch zwei Meter hoch ist. Fünf Teile sind in Klotzsche schon eingebaut, die 15 Meter lang sind. 175 dieser tonnenschweren Teile werden folgen. Der Bauleiter ist zuversichtlich, mit seinem erfahrenen Team auch in Klotzsche den Bau pünktlich abschließen zu können. Dafür investiert die Stadtentwässerung rund 2,3 Millionen Euro. Für das gesamte Großprojekt bis zur Grenzstraße sind 4,6 Millionen Euro geplant.
https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/journal-1/detail/unterirdischer-staudamm-in-der-dresdner-heide/
(nach oben)
Aggerverband passt Talsperren-Betriebspläne an Klimawandel an
Gummersbach. Hitze- und Dürrephasen im Sommer, nasse Winter oder unkalkulierbare Starkregenereignisse: Der Klimawandel geht auch an den Talsperren des Aggerverbandes nicht unbemerkt vorbei. Umso wichtiger ist es, sich dem vorbeugenden Trinkwasserschutz in Zeiten sich ändernder klimatischer Bedingungen zu stellen.
Die von der Bezirksregierung genehmigten Talsperren-Betriebspläne, nach denen die Abgabe in Abhängigkeit von der Jahreszeit und des Füllstandes gesteuert wird, stammen aus dem Anfang der 2000er Jahre.
Diese Pläne schützen zuverlässig vor Hochwasser im Unterlauf, soweit die Talsperren dazu ihren Beitrag leisten können. Für die Erfüllung dieser Funktion sind auch in den Sommermonaten kontinuierliche Abgaben, die sich nach dem Füllstand richten, vorgesehen.
Der Schutz vor Hochwasser ist aber nicht die einzige Aufgabe der Talsperren. Insbesondere die Trinkwasserreservoirs der Genkel- und Wiehltalsperre dienen der permanenten Versorgung von rund 430.000 Menschen im Versorgungsgebiet des Aggerverbandes mit Trinkwasser in guter Qualität. Für diese Aufgabe ist ein möglichst dauerhaft hoher Füllstand der Trinkwassertalsperren wünschenswert. Daher sollte möglichst viel Wasser gespeichert werden.
Aus diesen gegenläufigen Aufgaben ergibt sich eine Steuerungsstrategie, die beiden Zielen gerecht werden soll.
Da die Betriebspläne der Talsperren bei hohen Füllständen auch höhere Abgaben vorsehen, wurde bisher bei den mittlerweile häufig auftretenden sommerlichen Temperaturen und langen Trockenphasen teilweise Wasser an die Gewässer abgegeben, das möglicherweise in der Zukunft zum Herbst hin für die Trinkwasserversorgung benötigt wird.
Daher hat der Aggerverband bereits Anfang Juni die Abweichung von den hohen Abgaben beantragt. Die Zustimmung von Seiten der Bezirksregierung erfolgte zeitnah. Demzufolge wird heute eine wohl dosierte Wassermenge aus den Talsperren in die Gewässerläufe abgegeben, welche zum einen die Gewässerökologie schützt und zum anderen die Wasserversorgung für das laufende Jahr gewährleistet. Mit Blick auf den Hochwasserschutz müssen Unterlieger keine Sorgen haben – Agger- und Wiehltalsperre können unvorhergesehene Unwetterereignisse schadlos zwischenspeichern.
Die Betriebspläne werden aktuell auch unter Berücksichtigung von Klimaszenarien und Vorhersagemodellen überarbeitet und angepasst. https://www.aggerverband.de/service/presse/artikel/aggerverband-passt-talsperren-betriebsplaene-an-klimawandel-an
(nach oben)
BRW Klärwerk Ohligs – Bau einer Zentratwasseranlage
Strengere gesetzliche Anforderungen erfordern auf dem Klärwerk Ohligs den Bau einer Zentratwasserbehandlungsanlage.
In der nächsten Woche beginnt der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) mit dem Bau einer Zentratwasserbehandlung auf dem Klärwerk Solingen-Ohligs. Der BRW ist wie alle Betreiber von Klärwerken in der Pflicht, die aktuellen gesetzlichen Vorgaben der Abwasserreinigung einzuhalten. Dies wird durch die Aufsichtsbehörde regelmäßig überprüft. Die strengeren gesetzlichen Anforderungen an die Reinigung des Abwassers erfordern auf dem Klärwerk Ohligs den Bau einer Zentratwasserbehandlungsanlage. Bisher wird das Zentratwasser vergleichmäßigt zur Mitbehandlung im Reinigungsprozess in den Zulauf der Anlage zurückgeführt, um eine zeitweise zu hohe Stickstoffkonzentration zu vermeiden.
Wesentliche Verringerung der internen Ammoniumrückbelastung des Klärwerkes durch das Zentratwasser aus der Faulschlammentwässerung.
Der beim Reinigungsprozess entstehende Klärschlamm wird im letzten Verfahrensschritt maschinell entwässert, bevor er in einer Monoverbrennungsanlage thermisch entsorgt wird. Das bei der Entwässerung anfallende stark stickstoffhaltige Schlammwasser (Zentratwasser) wird gesondert weiterbehandelt. Dafür baut der BRW auf dem Klärwerksgelände ein Gebäude in Stahlbeton. Das komplett abgedeckte Bauwerk wird die Abmessung von 40 x 15 Metern haben und die Geländeoberkante um ca. 5 Meter überragen. Die Anordnung des Maschinengebäudes in Massivbauweise ist so geplant, dass die Gebläse auf der dem Klärwerk zugewandten Seite angeordnet sind und dadurch Schall- und Geruchsemissionen in die Klärwerksnachbarschaft sicher vermieden werden.
Der Baubeginn ist Anfang Mai erfolgt. Die Baumaßnahme wird ca. 1 Jahr andauern.
Die Anwohner werden um Verständnis gebeten, wenn es durch die Bautätigkeit tagsüber zu unvermeidbarem erhöhten Fahraufkommen und Geräuschentwicklung durch die Bauarbeiten kommt.
http://www.brw-haan.de/aktuell/presse/klaerwerk-ohligs-bau-einer-zentratwasseranlage
(nach oben)
BRW: Ausbildungskooperation für Wasserbauer*innen geschlossen
Haan, Wesel: „Was macht eigentlich ein Wasserbauer?“, werden sich Viele fragen? Und warum Wasserbau in Heiligenhaus? Wo sind denn da Flüsse oder Seen?
Der Bergisch-Rheinische Wasserverband in Haan und die Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG in Wesel haben einen Kooperationsvertrag für die gemeinsame Ausbildung im Beruf „Wasserbauer“ geschlossen. Start der gemeinsamen Ausbildung ist bereits im Sommer 2023.
„Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren sehr gut und partnerschaftlich zusammen. Für die zukünftige Berufsausbildung der Azubis haben wir das heute auf ein noch besseres Fundament gestellt.“, erklärt Michael Wilms, Geschäftsführer der Hülskens-Wasserbau.
„Unsere Verkehrswasserbauer bekommen beim BRW den Einblick in den Wasserbau an kleinen Gewässern, hauptsächlich im Umfeld von Wohn- und Gewerbebebauung, also eher „landseitig“ im urbanen Umfeld. Wir hingegen sind mit unseren Projekten eher auf großen Gewässern, wie dem Rhein, der Elbe oder angrenzenden Zuflüssen und Kanälen inkl. Hafen- und Schleusenanlagen unterwegs. Dort lernen die Auszubildenden des BRW dann noch mal ganz andere Facetten dieses Berufes kennen. Insgesamt ist das eine Win-win-Situation für die Qualität der Berufsausbildung im Wasserbau.
BRW-Geschäftsführer Engin Alparslan: „Es freut mich, dass wir unserem Nachwuchs zum neuen Ausbildungsjahr durch die Kooperation nun noch mehr Möglichkeiten und praktisches Wissen vermitteln und auch direkt auf den Großbaustellen zeigen können. Davon profitieren in erster Linie natürlich die Azubis. Aber auch Hülskens bzw. wir werden als Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber attraktiver. Das ist in diesen Zeiten gerade für unsere Berufssparte wichtig und hilft bei der frühzeitigen Bindung, der von uns bestens qualifizierten Fachkräfte.“
Hintergrundinformation:
Die Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG geht zurück auf die ersten Projekte der industriellen Schiffbarmachung des Rheins gegen Ende des 19. Jahrhunderts und gehört damit zu den ältesten Wasserbauunternehmen Deutschlands. Mit einem Gerätepark von eigenen Binnen-Kranschiffen, Klappschuten, Pontons sowie Eimerketten-, Seil- und Auslegerbaggern bis zu 100 Tonnen ist Hülskens Wasserbau auf fast allen Binnenwasserstraßen Deutschlands unterwegs. Das Unternehmen ist Teil des Hülskens Firmenverbandes, Wesel.
Der Bergisch-Rheinische-Wasserverband ist bereits seit Anfang der 1990er Jahre als Ausbildungsbetrieb für Wasserbauer/innen aktiv, zusätzlich zur reinen Ausbildung bietet der BRW auch einen dualen Studiengang Bachelor of Ing. mit Ausbildung im Wasserbau an.
Der BRW ist ein wichtiger Akteur in der regionalen Wasserwirtschaft. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts sorgt der BRW für die Reinigung des Abwassers, die Entwicklung der Gewässer und trägt durch die Unterhaltung und die Entwicklung maßgeblich zum Erhalt der biologischen Vielfalt im komplexen Ökosystem Gewässer bei. Er ist verantwortlich für ca. 950 Kilometer Gewässerläufe in der Region und sichert damit die lebensnotwendige Ressource Wasser.
http://www.brw-haan.de/aktuell/presse/ausbildungskooperation-fuer-wasserbauer-innen-geschlossen
(nach oben)
Aggerverband: Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen besteht seit 50 Jahren
Seit 50 Jahren besteht der Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen (WKA). Am Mittwoch, dem 03.05.2023, fand eine Feierstunde in Wissen statt.
Der WKA ist der größte Trinkwasserabnehmer des Aggerverbandes. Mit dem Bau der Wiehltalsperre und der Inbetriebnahme des dortigen Wasserwerkes Auchel im Jahr 1975, beliefert der Aggerverband im Kreis Altenkirchen gut 100.000 Menschen mit jährlich bis zu 5,3 Mio. m³ Trinkwasser.
Aus heutiger Sicht haben die damals Verantwortlichen sowohl beim WKA als auch beim Aggerverband genau das Richtige getan. Der WKA suchte nach Versorgungssicherheit für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung im Kreis Altenkirchen und der Aggerverband hielt Ausschau nach zusätzlichen Absatzmärkten für sein Trinkwasser und fand diese im Raum Altenkirchen.
Das Besondere dabei ist, dass der Kreis Altenkirchen im Bundesland Rheinland-Pfalz und der Aggerverband im Bundesland Nordrhein-Westfalen liegen. So galt es nicht nur, die entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Es musste auch im Vorfeld ein Staatsvertrag zwischen den beiden Bundesländern abgeschlossen werden. Dies geschah 1972.
Übereinstimmend betonten die Festredner in ihren Beiträgen dann auch die Weitsicht der damaligen Verantwortlichen für ihre Entscheidung.
https://www.aggerverband.de/service/presse/artikel/zweckverband-wasserversorgung-kreis-altenkirchen-besteht-seit-50-jahren
(nach oben)
Neue Blockheizkraftwerk- und Verdichterstation geht in Betrieb
Sanierung und Erweiterung auf dem Gießener Klärwerk
Mit der Inbetriebnahme der hochmodernen Anlage gelingt dem Gießener Klärwerk ein großer Schritt hin zur Energie-Autarkie. Die Eigen-Energie-Erzeugung steigt von rund 70 % auf 94 %. Die aktuell vorgeschriebenen und verschärften Abgasgrenzwerte werden von den Blockheizkraftwerken (BHKW) vollumfänglich eingehalten und die anfallende Energie wird effizient genutzt, um das Abwasser zu reinigen. Bei der Feierstunde zur Inbetriebnahme der Anlage dankten die Dezernentin Gerda Weigel-Greilich und der MWB-Betriebsleiter Clemens Abel allen beteiligten Firmen, den Mitarbeitenden des MWB und der MWB-Betriebskommission, dass dieses große Projekt innerhalb der letzten sieben Jahre so reibungslos und effektiv durchgeführt wurde.
Weigel-Greilich: „Ich freue mich, dass das Klärwerk, einer der größten Energieverbraucher Gießens, mit diesem Projekt einen riesigen Schritt in Richtung Energie-Autarkie gegangen ist und damit für die Gießener Bürger*innen gleichzeitig erhebliche Kosten einspart.“
Betriebsleiter Abel betont: „Die bisherige BHKW- und Verdichterstation, die Steuertechnik sowie die Gebläse für die biologische Reinigung waren mit 24 bis 30 Jahren veraltet. Durch die Erweiterung verschiedener Klärwerk-Bereiche sowie die Umsetzung neuer Energiekonzepte wurden die neuen Anlagen für ein zukunftsweisendes Klärwerk Gießen erforderlich.“
Zahlen und Fakten
Planungs- und Umsetzungszeitraum: 2016 bis 2023
Investitionsvolumen: rund 18 Millionen Euro
Erhöhung der elektrischen Leistung BHKW: von ca. 500 kW auf 660 kW
Effizienz-Steigerung, bezogen auf Stromerzeugung alt zu neu: ca. 10%
Steigerung der erzeugten Strommenge: 1.000 MWh
Senkung des Stromverbrauchs: 885 MWh
Insgesamt werden 1.885 Megawattstunden (MWh) Strom jährlich eingespart – dies entspricht dem Stromverbrauch von rund 600 Drei-Personen-Haushalten im Jahr bzw. einer Einsparung von Stromkosten von bis zu 1 Million Euro jährlich. Diese Einsparungen helfen, die massiven Kostensteigerungen z.B. für benötigte Chemikalien aufzufangen und so die Gebühren für die Bürger*innen stabil zu halten
Senkung der erzeugten Wärmemenge: 1.000 MWh
Senkung der verbrauchten Wärmemenge: 225 MWh
Eigen-Energie-Erzeugung Klärwerk Gießen aktuell: 94% (zuvor rund 70%)
Höhere Energieeffizienz
Die Anlagen wurden auf Energieeffizienz optimiert; der elektrische Wirkungsgrad wurde verbessert
Stromerzeuger und Stromverbraucher liegen nun nur wenige Meter voneinander entfernt, so dass die Leitungsverluste auf ein Minimum reduziert wurden.
Die Schaltanlagen für die Mittelspannung (20.000 V) sowie die Niederspannungshauptverteilung (230 V/400 V) wurden erneuert
Ein neues Notstromaggregat mit einer Leistung von 1,2 MW (1.200 kW) wurde errichtet, um im Falle eines Stromausfalls die Abwasser-Reinigung aufrecht zu erhalten
Was machen Verdichter auf dem Klärwerk?
Verdichter saugen Umgebungsluft an und verdichten deren Druck um ca. 550 mbar. Dieser höhere Druck wird benötigt, um die Luft in die sechs Meter tiefen Belebungsbecken zu fördern. Die Mikroorganismen im Abwasser in den Belebungsbecken benötigen den Sauerstoff, welcher sich in der hineingepumpten Luft befindet, um damit das Abwasser zu reinigen. Die neuen Verdichter tragen zur sicheren und energieeffizienten Versorgung der biologischen Reinigungsstufe und somit zur sicheren Grenzwert-Einhaltung bei.
Zahlen und Fakten Verdichter
Vier energetisch hocheffiziente Verdichter wurden errichtet
Es handelt sich um Kompressoren, die die Luft in die acht Belebungsbecken fördern
Mit der Luft werden Schaufelräder angetrieben, die mit bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute laufen
Im Gegensatz zu den alten sogenannten Drehkolbengebläsen, sind die neuen magnetgelagert. Sie verbrauchen bis zu 15% weniger Strom als die alten Gebläse
Fakten zum Klärwerk Gießen
Ausbaugröße: 300.000 EW (Einwohnerwerte)
z. Zt. Angeschlossene: ca. 280.000 EW (hier von 187.000 angeschl. Einwohner*innen)
Abwassermenge: 23 Mio. m³ pro Jahr (Schmutzwasser + Regenwasser + Fremdwasser)
Schmutzwassermenge: 16 Mio. m³ pro Jahr (Schmutzwasser + Fremdwasser
Schmutzwasser pro Einwohner*in: ca. 120 – 150 Liter pro Tag
Klärschlammanfall: 12.000 t pro Jahr (mit 23 – 27 % Wassergehalt)
Klärschlammverwertung Thermische Verwertung in Mono- und Mitverbrennungsanlagen
Klärgaserzeugung: 2,4 Mio. Nm³ pro Jahr
Rechengut- und Sandanfall: 1.200 t pro Jahr
Betriebspersonal: ca. 30 Personen (Klärwerksbetrieb einschl. Labor, Indirekteinleiterüberwachung, Planung und Verwaltung)
Quelle: MWB – Mittelhessische Wasserbetriebe
https://www.giessen.de/Rathaus/Newsroom/Aktuelle-Meldungen/Neue-Blockheizkraftwerk-und-Verdichterstation-geht-in-Betrieb.php?object=tx,2874.5.1&ModID=7&FID=2874.59804.1&NavID=1894.87&La=1&startkat=2874.229
(nach oben)
Irschenberg: Zum Neubau unserer Kläranlage
Info-Brief der Gemeinde
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Irschenberg,
die Gemeinde Irschenberg muss die Abwasserentsorgung auf einen neuen Stand bringen und für die Zukunft ausrichten.
Rückblick – was bisher in Sachen Kläranlage gemacht wurde …
Die Kläranlage der Gemeinde in Irschenberg ist seit dem Jahr 1980, also seit über 40 Jahren ohne große Veränderungen in Betrieb. Auch das Wasserwirtschaftsamt teilte der Gemeinde mit, dass der Weiterbetrieb mit der derzeitigen Einleitgenehmigung nicht mehr möglich ist.
Aus diesem Grund wurde im Jahr 2016 eine Untersuchung zur Belastungssituation im Einzugsgebiet der Kläranlage und den Perspektiven für die Anpassung der bestehenden Abwasserbehandlung in Auftrag gegeben. In Abstimmung mit den Behörden wurde eine vorübergehende Verlängerung der Betriebserlaubnis beantragt.
Am Ende dieser Studie (2017) zeigte sich, dass die bestehende Kläranlage die inzwischen weit strengeren Auflagen an die Reinigungsleistung einer modernen Kläranlage keinesfalls mehr erfüllen können wird. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde in den Jahren 2018 und 2019 nach zukunftsfähigen Lösungen für die Abwasserentsorgung der Gemeinde Irschenberg gesucht. Im Laufe dieser Variantenuntersuchungen blieben drei denkbare Lösungen übrig, die unter technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet wurden. Die erhöhten Anforderungen wären nur mit erheblichen Eingriffen und Umbaumaßnahmen in die bestehende Anlage möglich und würden eine deutlich komplexere Verfahrenstechnik erfordern als mit dem nun vorgeschlagenen System. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die vorhandene Bausubstanz bereits 40 Jahre alt ist und die bestehende technische Ausrüstung bei weitem nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.
Folgende Varianten wurden geprüft:
Variante 1: Auflassung der gemeindeeigenen Kläranlage und Anschluss an die nächstgrößere Kläranlage in Bruckmühl
Variante 2: Beibehaltung des Standorts und Neubau der Kläranlage und eine Verlängerung des Ableitungskanals
Variante 3: Neubau der Kläranlage Irschenberg am jetzigen Standort mit moderner, innovativer, aber bewährter Technologie zur weitergehenden Abwasserreinigung
Es wurden alle drei Varianten umfassend und intensiv geprüft. Dabei zeigte sich, dass die Variante 3 den beiden Varianten 1 und 2 in jedem der o.g. Gesichtspunkte – Technik, Ökologie und Wirtschaftlichkeit – überlegen ist und daher die sinnvollste Lösung darstellen würde. Begleitend zu dieser Variantenstudie wurden bereits naturschutzfachliche Untersuchungen im und am Gewässer, dem Schwammhamer Graben durchgeführt, um die Variante 3 frühzeitig bewerten zu können.
Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden zum damaligen Zeitpunkt auch bereits mit den Genehmigungsbehörden abgestimmt, um im Rahmen des späteren Genehmigungsverfahrens auf keine unerwarteten Hürden mehr zu stoßen. Auf Basis der o.g. umfangreichen Vorarbeiten hatte sich der Gemeinderat im Frühjahr 2020 für die Weiterverfolgung der Variante 3 entschieden und konnte sich im Rahmen einer Besichtigungsfahrt im Sommer 2020 auf einer gut vergleichbaren Kläranlage in Sachen Ausgangssituation, Technik und Größe, auch mit eigenen Augen von dieser Lösung überzeugen. Daraufhin wurde eine Vorplanung beauftragt, um das Verfahrenskonzept der neuen Irschenberger Kläranlage festzulegen und den zugehörigen Kostenrahmen in einem frühen Stadium abschätzen zu lassen.
Das zukünftige Konzept sieht den Bau der neuen Anlagenkomponenten im Bereich der beiden Abwasserteiche vor, die später in keinem Fall mehr benötigt würden (auch weil diese nicht mehr den Anspruch an eine moderne Abwasseranlage erfüllen können). Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Abwasserreinigung für die Gemeinde auch während der langen Bauzeit sichergestellt ist. Vorgesehen ist hier der Bau einer neuen kompakten, mechanischen Abwasserreinigung, die in einem rein funktionell gehaltenem Technikgebäude untergebracht werden kann, welches auch die sonstigen technischen Anlagenteile aufnehmen wird.
Für die biologische Abwasserreinigung soll zukünftig die sog. SBR-Technologie genutzt werden. Ein Verfahren, das stabile und ausreichend hohe Reinigungsleistung für alle bisher geforderten Parameter (Nährstoffe) erbringt und daher auch bei sehr vielen Projekten mit großem Erfolg angewandt wird. Nachgeschaltet wird ein sog. Bodenfiltersystem, das eine Doppelfunktion aufweist. Einerseits wird dort die notwendige hydraulische Pufferwirkung für den intervallweisen Ablauf aus der SBR-Stufe erreicht und zusätzlich erfolgt eine weitestgehende Filtration des bereits gereinigten Abwassers.
Durch eine spezielle Filterschicht wird in dieser Stufe zukünftig erreicht, was normalerweise nur große Kläranlagen leisten können, nämlich die sog. 4. Reinigungsstufe. Diese bewirkt die Entnahme von Mikro-Verunreinigungen (z. B. Medikamentenrückstände) sowie den Rückhalt von Feinstpartikeln (u. a. Mikroplastik).
Die gewählten Verfahrensschritte sind grundsätzlich bekannte und bewährte Techniken, und in dieser Kombination ermöglichen sie es sogar, dass vollständig gereinigte Abwasser auch in ein kleines Gewässer abzuleiten ohne dort zu einer Verschlechterung des ökologischen Zustands zu führen. Das gewählte Anlagenkonzept wurde Ende des Jahres 2020 dann mit dem Bayerischen Abwasser- Innovationspreis des Bayerischen Umweltministeriums ausgezeichnet und mit 500.000 Euro für die Gemeinde dotiert. Für diese Förderung musste die Gemeinde auf Aufforderung des Bayerischen Umweltministeriums eine Bautafel an der Kläranlage aufstellen. Neben dem Innovationscharakter wurde dabei auch die Vorbildwirkung für viele weitere Kläranlagen im ländlichen Raum hervorgehoben. Auf weitere Fördertöpfe kann die Gemeinde Irschenberg auf Grund fehlender Programme nicht zurückgreifen. Im Laufe des Jahres 2021 wurden dann weitere vorbereitende Arbeiten durchgeführt (Vermessung, Kampfmittelprüfung, etc.), um die notwendigen Grundlagen für die weitere Planung zu schaffen. Damit konnte auch die Vorplanung fortgesetzt und im Herbst 2021 im Rahmen der Klausurtagung samt Zeitplan und Kostenschätzung vorgestellt werden.
Wie bei Projekten dieser Größenordnung üblich mussten zeitgleich die weiteren Ingenieur- und Planungsleistungen europaweit in einem aufwändigen und langwierigen Verfahren ausgeschrieben werden. So erhielt die Planungsgemeinschaft DAK Ingenieur Planungsgruppe GmbH und die enwacon engineering GmbH & Co. KG den Zuschlag erst im Juni 2022 für die weiteren Planungsphasen.
Wie ist der aktuelle Stand und wie geht’s weiter …
Das bisherige Planungskonzept, das vom Ingenieurbüro Dr.-Ing. Schreff aus Miesbach stammt, wurde zunächst von den neuen Planern umfassend geprüft und wurde inzwischen in allen wesentlichen Teilen übernommen. Die nachfolgende Darstellung zeigt das geplante Lagekonzept (Stand: Dezember 2022), das derzeit von der Planungsgemeinschaft weiter ausgearbeitet wird, und als Grundlage für eine detaillierte Kostenberechnung dienen wird. Seit dem Sommer 2022 finden regelmäßige Projektbesprechungen im kleinen und großen Kreis statt, um den Arbeitsfortschritt zu verfolgen. Inzwischen ist auch die Technische Universität München Teil des Projekts. Sie begleitet den Planungsprozess im Rahmen eines längeren Forschungsprojekts, das vom Bayerischen Umweltministerium beauftragt wurde.
Die aktuell laufende Entwurfsplanung wird bis Mai abgeschlossen sein und dann zur Genehmigung im Landratsamt eingereicht werden. Nach jetzigem Stand ist vorgesehen, die Ausschreibungen für alle Gewerke noch im Spätherbst 2023 auf den Markt zu bringen. Erfahrungsgemäß ist dies ein günstiger Zeitpunkt, um wirtschaftliche Angebote zu erhalten, so dass dann im Frühjahr 2024 mit dem Baubeginn zu rechnen wäre.
(nach oben)
Starkregen und Objektschutz – wie schütze ich mich richtig?“: Digitale Informationsveranstaltung der StEB Köln am 9. Mai 2023
Vermehrte Starkregenereignisse mit Überflutungen, Hitzeperioden mit Rekordtemperaturen sowie langanhaltende Dürren: Die Folgen des Klimawandels betreffen uns alle und fordern uns zum Handeln auf.
Am Dienstag, 9. Mai 2023, von 18 bis 19 Uhr informieren die StEB Köln daher die Kölner*innen in einer digitalen Veranstaltung, wie sie das eigene Zuhause wirksam vor Überflutungen durch Starkregen schützen können. Was ist Starkregen? Was macht Starkregen so gefährlich? Und welche Möglichkeiten der Objektschutzvorsorge gibt es?
Interessierte können sich vorab über die E-Mail-Adresse starkregen@steb-koeln.de anmelden. Der Einladungslink wird einen Tag vor der Veranstaltung versendet.
Weitere Termine finden bis einschließlich September jeden zweiten Dienstag im Monat jeweils von 18 bis 19 Uhr statt.
https://steb-koeln.de/Aktuelles/Starkregen-und-Objektschutz-%E2%80%93-wie-sch%C3%BCtze-ich-mich-richtig-Digitale-Informationsveranstaltung-der-StEB-K%C3%B6ln-am-9.-Mai-2023.jsp?ref=/Presse.jsp
(nach oben)
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband: Zukunftstag
65 Fachkräfte von morgen zu Besuch
Brake/Nethen/Im Nordwesten. Der Zukunftstag bot Fünft- bis Neuntklässlern auch beim Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) die Gelegenheit, einen Einblick in den Berufsalltag zu bekommen.
65 Schülerinnen und Schüler nutzten die Chance, in Wasserwerken, auf Kläranlagen, in Betriebsstellen und in der Hauptverwaltung Brake in den Berufsalltag hineinzuschnuppern.
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2023/april/27/artikel/zukunftstag-beim-oldenburgisch-ostfriesischen-wasserverband
(nach oben)
OOWV: Rückenwind für Konzepte der Wasserwiederverwendung
Fördermittelzusage aus Hannover für gemeinsames Projekt von PKV und OOWV in Varel
Varel. Frohe Kunde aus dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz: Zu den berücksichtigten Vorhaben im Rahmen der Förderrichtlinie „Klimafolgenanpassung Wasserwirtschaft“ zählt auch „Water ReUse“. Das Projekt, das gemeinsam von der Papier- und Kartonfabrik Varel (PKV) und dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) pilotiert und geplant wurde, erhält eine Zuwendung in Höhe von 500.000 Euro. OOWV und PKV treiben jetzt die nächsten Schritte zur Projektplanung und Genehmigung voran. Mehr:
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2023/april/17/artikel/rueckenwind-fuer-konzepte-der-wasserwiederverwendung
(nach oben)
Stuttgart: Girls’ Day 2023 – die Stadtentwässerung Stuttgart macht mit!
Ein Tag auf der Kläranlage!
Am 27. April 2023 zeigen wir Dir, wie die Abwasserreinigung in Baden-Würtembergs größtem Klärwerk funktioniert.
Erlebe den spannenden Weg von dreckigem Abwasser zu sauberen klaren Wasser
Probiere verschiedene Stationen aus
Lerne unsere Ausbildungsberufe kenn
Wann:
27.04.2023, 7.00–16.00 Uhr
Wo:
Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen
Aldinger Straße 212, 70378 Stuttgart
Anmeldung per E-Mail:
66-Ausbildung@Stuttgart.de
Weitere Informationen:
www.girls-day.de
https://www.stuttgart-stadtentwaesserung.de/girlsday-2023-wir-machen-mit/
(nach oben)
Stuttgart: Tag der offenen Tür im Hauptklärwerk S-Mühlhausen am 6. Mai 2023
Sauberes Wasser in unseren Bächen und Flüssen ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Bis heute ist ein großer technischer Aufwand notwendig um die Abwässer aus den Haushalten und der Industrie zu reinigen und die anfallenden Reststoffe umweltgerecht zu verwerten. Die zunehmende Chemikalisierung schafft dabei neue Probleme. Mit dem neuen Eingangs- und Betriebsbereich im Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen wurde ein Besucherbereich geschaffen in dem die interessante Arbeit rund um den Gewässerschutz dargestellt wird.
Die Stadtentwässerung Stuttgart (SES) lädt alle Interessierten zum Tag der offenen Tür am Samstag, 6. Mai 2023 von 11 bis 17 Uhr ins Hauptklärwerk Mühlhausen ein.
Im Zuge der Neuordnung des südlichen Bereiches im Hauptklärwerk entstand direkt am Neckar ein neues Gebäude. Von hier werden nun vom Fachbereich der mechanischen Abwasserreinigung die Reinigungsprozesse der ersten Reinigungsstufen im Klärwerk überwacht und gesteuert. Für die Besucher des Hauptklärwerks Mühlhausen besteht im neuen Gebäude die Möglichkeit sich über die Stadtentwässerung Stuttgart und speziell die Abwasserreinigung sowie zum Gewässerschutz zu informieren.
Am Tag der offenen Tür haben alle Gäste die Gelegenheit den neuen Besucherbereich kennenzulernen und hinter die Kulissen der größten Kläranlage Baden-Württembergs zu schauen. Die einzelnen Stationen der modernen Abwasserreinigung können bei einer Fahrt mit dem Bähnle über das Klärwerksgelände erkundet werden.
Wie aus Klärschlämmen der Region Energie und Rohstoffe der Zukunft entstehen, kann bei der Besichtigung der Klärschlammverbrennung erfahren werden. Speziell für Kinder werden Spiel- und Erlebnisstationen angeboten.
Im Zentrallabor der SES sind alle Besucher eingeladen sich auf Spurensuche zu begeben.
Das Hauptklärwerk Mühlhausen ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die Stadtbahn U12, Haltestelle Mühlhausen oder Hornbach gut zu erreichen. Von der Haltestelle Hornbach verkehrt ein Shuttlebus zum Hauptklärwerk.
Speziell für Fahrräder ist ein großer Parkbereich ausgewiesen
Parkmöglichkeiten für PKW sind nur begrenzt vorhanden
https://www.stuttgart-stadtentwaesserung.de/tag-der-offenen-tuer-im-hauptklaerwerk-s-muehlhausen-am-6-mai-2023/
(nach oben)
Sindelfingen: Führungen über die Kläranlage für Schulklassen und Fachbesucher
Wir zeigen Ihnen gerne bei einer Führung über die Kläranlage, wie wir Ihr Abwasser mit modernsten Reinigungsverfahren reinigen. Es wird in erster Linie die Abwasserbehandlung besichtigt. Wenn gewünscht können auch weitere Bereiche (z.B. Schlammbehandlung) der Kläranlage besichtigt werden.
Eine Führung dauert ca. 90 – 120 Minuten und wird im Zeitraum 9:00 bis 12:00 Uhr durchgeführt. Die Gruppengröße ist auf maximal 30 Personen begrenzt.
Bitte achten Sie darauf, dem Wetter entsprechend gekleidet zu sein und tragen Sie festes Schuhwerk.
https://www.zvka-bb-sifi.de/infokanal/fuehrungen
(nach oben)
Ruhrverband: Phosphor-Rückgewinnungsanlage in Bottrop darf gebaut und betrieben werden
Genehmigung der Bezirksregierung Münster ist wichtiger Meilenstein im AMPHORE-Projekt
Im Forschungsprojekt „Regionales Klärschlamm- und Aschen-Management zum Phosphorrecycling für einen Ballungsraum“ (AMPHORE) wurde ein wichtiger Projektmeilenstein erreicht: Nach umfangreichen Planungsarbeiten hat die PhosRec Phosphor-Recycling GmbH die Genehmigung zum Bau und Betrieb der Phosphor-Rückgewinnungsanlage in Bottrop erhalten. Der Genehmigungsbescheid wurde am 15. März 2023 durch die Bezirksregierung Münster übermittelt und veröffentlicht (Veröffentlichung der BR Münster).
Der Genehmigungsantrag wurde federführend von den Projektpartnern PhosRec GmbH und der Emscherwassertechnik GmbH in Zusammenarbeit mit der PARFORCE-Technology Cooperation (PTC) aus Marl erarbeitet. Wenn die Anlage fertig ist, soll dort die Rückgewinnung von Phosphor in Form von Phosphorsäure aus Klärschlammaschen erprobt und demonstriert werden. Die Klärschlammaschen fallen als Rückstände aus der Abwasserreinigung bei den am Projekt beteiligten Wasserverbänden an.
Der Bau der Multifunktionshalle in Bottrop, die die Phosphor-Rückgewinnungsanlage künftig beherbergen wird, schreitet stetig voran. Parallel kümmert sich die PTC um die Beschaffung aller notwendigen Anlagenteile, damit zeitnah nach Baufeldfreigabe die Endmontage der Anlage erfolgen kann. Die Montagearbeiten starten voraussichtlich im Mai 2023 und sollen nach aktuellem Zeitplan innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Über den Baufortschritt hält die Webseite der PhosRec GmbH auf dem Laufenden (https://phosrec.de/).
Nach der Inbetriebnahme wird in einem zweijährigen Versuchsbetrieb aus verschiedenen Klärschlammaschen Phosphorsäure als Rohstoff produziert. Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungen sind richtungsweisend für die am Projekt beteiligten Wasserverbände, denn diese sind ab 2029 gesetzlich verpflichtet, Phosphor aus ihren Klärschlämmen bzw. Klärschlammaschen zurückzugewinnen.
Das Verbundprojekt AMPHORE wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb der Fördermaßnahme „Regionales Phosphor-Recycling“ (RePhoR)“ unterstützt. RePhoR ist Teil des BMBF-Rahmenprogramms „Forschung für Nachhaltige Entwicklung“ (FONA3). AMPHORE ist über insgesamt fünf Jahre angelegt und wird vom BMBF mit insgesamt rd. 8,7 Millionen Euro gefördert.
Mehr unter: https://www.ruhrverband.de/wissen/projekt-amphore und https://www.bmbf-rephor.de/
https://ruhrverband.de/presse/pressemitteilungen/detailansicht/news///phosphor-rueckgewinnungsanlage-in-bottrop-darf-gebaut-und-betrieben-werden/
(nach oben)
OOWV: Auf der Kläranlage Lindern rollen die Bagger
Modernisierungsarbeiten haben begonnen
Lindern. Der gewaltige Presslufthammer ist am Arm des Baggers befestigt. Sein Wummern ist allgegenwärtig zu vernehmen, die Wände des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) in Lindern wackeln. Ein Stahlbetonbecken ist fast vollständig verschwunden. Schutt zeugt davon, dass hier noch vor wenigen Tagen ein Bauwerk stand. Sobald die Abrissarbeiten an dieser Stelle abgeschlossen sind, wird der riesige Presslufthammer sein Werk am benachbarten Becken tun. Die alten Nachklärbecken stehen bereits seit rund 20 Jahren leer. Nun müssen sie der Zukunft weichen.
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2023/maerz/28/artikel/auf-der-oowv-klaeranlage-lindern-rollen-die-bagger
(nach oben)
Mainz: Genehmigungsantrag für den Bau der Wasser-Elektrolyse eingereicht
4. Reinigungsstufe
Die Finanzierung ist gesichert. Machbarkeit und rechtliche Fragen sind geklärt und die Politik hat grünes Licht gegeben. Der Weg für die vierte Reinigungsstufe des Mainzer Klärwerks ist klar vorgezeichnet. 2026 soll die Anlage in Betrieb gehen. Als nächster Schritt sind jetzt die Genehmigungsunterlagen für den Bau der Wasser-Elektrolyse bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd eingereicht worden.
„Nach der erfolgreichen Umweltverträglichkeitsvorprüfung geht es also sofort weiter“, freut sich die Vorstandsvorsitzende Jeanette Wetterling. „Das zeigt: Wir sind auf Kurs.“
Der führt jetzt weiter in Richtung Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, die über den Antrag entscheiden wird.
Diesen Zeitpunkt möchte der Wirtschaftsbetrieb Mainz gerne noch einmal nutzen und den Weg der Projektumsetzung transparent begleiten. „Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger abholen, sie mitnehmen, informieren und stehen jeder Zeit für Rückfragen zur Verfügung.“
Denn die Elektrolyse ist nicht nur ein wichtiger Baustein der vierten Reinigungsstufe, „sie trägt darüber hinaus auch zur Energiewende bei“, so die Firmenchefin weiter.
Ansprechpartner: Herbert Hochgürtel
Leiter Zukunftstechnologien, Wirtschaftsbetrieb Mainz
Tel. 06131 97 15 211
Email: herbert.hochguertelstadt.mainz.de
https://www.mainz.de/microsite/wb/entwaesserung/Vierte-Reinigungsstufe-kann-kommen.php
(nach oben)
Dresden: Wie die Stadtentwässerung Stromkosten spart
Die Inflation erlebt seit dem Beginn des Ukrainekrieges Höhenflüge. Angeheizt wird sie vor allem von den Energiepreisen. Schließlich bleiben russische Öl- und Gaslieferungen aus. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Teuerungsrate im November 2022 bei zehn Prozent.
Für die Stadtentwässerung zahlt sich eine Strategie aus, die sie seit vielen Jahren verfolgt. „Schon jetzt erzeugen wir in der Kläranlage Kaditz jährlich rund 18 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom selbst“, erklärt Ralf Strothteicher, Geschäftsführer der Stadtentwässerung Dresden. Das ist so viel, wie der Verbrauch von rund 9.000 Dresdner Zwei-Personen-Haushalten, die durchschnittlich etwa 2.000 kWh jährlich benötigen.
Mit dem in Kaditz selbst erzeugtem Strom werden rund 85 Prozent des Bedarfs der Kläranlage gedeckt, auf der etwa 21 Millionen Kilowattstunden im Jahr verbraucht werden. „Unser Ziel ist es, künftig unseren gesamten Strombedarf zu decken“, sagt der Geschäftsführer. Auch für Notfälle wie einen Blackout ist die Stadtentwässerung gewappnet.
Der Blackout: Stromversorgung im Klärwerk gekappt
Regelmäßig testet die Stadtentwässerung den Ernstfall, wenn bei einem Blackout der Strom für mehrere Stunden oder gar Tage ausfällt. Erstmals wurde das im Mai 2016 geübt. Damals wurde die Stromversorgung am Zulauf gekappt, was im Klärwerk „kleine Insel“ genannt wird. Dabei handelt es sich um die Anlagen vom Zulauf über den Sandfang und den Grob- sowie den Feinrechen bis hin zum Hauptpumpwerk.
Zur Stromversorgung gibt es ein großes Notstromaggregat, was eine Leistung von 1.000 Kilowatt hat. Allerdings kann das nicht die Versorgung des gesamten Klärwerks sichern. Deshalb müssen auch die drei Blockheizkraftwerke an den Faultürmen wieder in Betrieb genommen werden, die eine Leistung von drei Megawatt haben. Da für sie beim Blackout weniger Klärgas aus den Faultürmen kommt, wurde für solche Notfälle ein Erdgasanschluss hergestellt.
Am 8. April 2017 wird erstmals die zentrale Stromzufuhr fürs Klärwerk abgeschaltet, das in solchen Fällen als große „große Insel“ bezeichnet wird. Dieser Inseltest hat gut funktioniert. Seitdem werden regelmäßig Blackout-Tests durchgeführt. Beim großen Stromausfall am 13. September vergangenen Jahres ging alles ganz schnell. Nur 20 Minuten standen die Anlagen im Klärwerk still. Noch bevor das Notstromaggregat in Betrieb genommen wurde, war der Strom wieder da.
Die Haupterzeuger: Klärgas aus Faultürmen treibt Blockheizkraftwerke an
Der Großteil des grünen Stroms wird aus dem Klärgas der beiden Faultürme erzeugt. 2021 waren es rund 17,3 Millionen Kilowattstunden. In die Faultürme kommen täglich rund 1.000 Tonnen Klärschlamm. Sie waren Ende 2011 mit zwei Blockheizkraftwerken in Betrieb genommen worden, das dritte folgt Ende 2014. So kann aus dem Klärgas der beiden Faultürme grüner Strom erzeugt werden. Das funktioniert so: Bakterien zersetzen organische Bestandteile im Klärschlamm und es steigt Faulgas empor, etwa 60 Prozent Methan, der Rest Kohlendioxid.
Ein Ei fasst rund 10.500 Kubikmeter Schlamm. Der braucht drei Wochen zum Faulen. In einem Gasometer können 5.000 Kubikmeter Gas für die drei Blockheizkraftwerke gespeichert werden. Bevor es dorthin kommt, muss es allerdings mit Aktivkohle- und Keramikfiltern gereinigt werden. In einer nächsten Stufe wird dem Gas die Feuchtigkeit entzogen. Es wird abgekühlt, sodass die Feuchtigkeit verdampft.
Kompressoren erzeugen letztlich den nötigen Gasdruck für die Motoren des jeweiligen Blockheizkraftwerks. Sie treiben Generatoren an. So kann sehr energieeffizient Wärme und Strom erzeugt werden. Mit der Wärme der Abgase werden die Faultürme und das benachbarte Betriebsgebäude beheizt. So können rund 80 Prozent der Energie des Klärgases ausgenutzt werden.
Der Plan: Neuer Speicher und mehr Klärgas
Jährlich entstehen in den Faultürmen über sieben Millionen Kubikmeter Klärgas – Tendenz steigend. 2021 waren es bereits rund 7,9 Millionen Kubikmeter. Deshalb ist der Bau eines zweiten Gasspeichers bis 2024 geplant, der ebenfalls rund 5.000 Kubikmeter fasst. Er ist einerseits nötig, damit auch in Spitzenzeiten immer genügend Gas für die Blockheizkraftwerk zur Verfügung steht.
Wird hingegen nicht viel Strom benötigt oder müssen die Kraftwerke für Wartungsarbeiten abgeschaltet werden, ist genügend Speicherkapazität da. Immerhin werden in den Faultürmen gleichmäßig rund 1.000 Kubikmeter Klärgas stündlich erzeugt, die zwischengespeichert werden müssen. „Wir wollen unbedingt verhindern, dass Klärgas abgefackelt werden muss“, erläutert Strothteicher. Denn es soll effizient zur Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt werden.
Die Investition von rund 2,4 Millionen Euro für den neuen Speicher soll sich durch die Energieerzeugung bereits nach wenigen Jahren amortisieren.
In den Faultürmen wird vor allem mehr Klärgas erzeugt, da immer mehr Bio-Abfälle zugesetzt werden, beispielsweise die Inhalte der Fettabscheider von Gaststätten und Hotels oder aus der Lebensmittelindustrie. „2023 konzentrieren wir uns darauf, weitere Bioabfallstoffe zu organisieren“, kündigt Geschäftsführer Strothteicher an. Derzeit werden rund 12.000 Tonnen jährlich in den Faultürmen zugesetzt. Da diese Stoffe viel energiehaltiger sind als Klärschlamm, sind sie so wichtig. „Deshalb versuchen wir zusätzlich Partner zu gewinnen, von denen wir solche Zusatzstoffe erhalten“, erklärt er.
Die Turbine: Stromgewinnung aus Wasserkraft
Außerdem wird im Klärwerk Kaditz Strom aus Wasserkraft gewonnen. 2021 waren es 668.386 kWh. Das funktioniert wie folgt. Durch einen 275 Meter langen Kanal fließt das gereinigte Abwasser von der Kläranlage bis zur Elbmitte. Dabei geht es bergab. Das nutzt die Stadtentwässerung im Ablaufbauwerk mit einem kleinen Kraftwerk zur Energiegewinnung. Immerhin fließen rund 55 Millionen Kubikmeter jährlich in die Elbe. Das Wasser treibt eine Turbine an. Der angeschlossene Generator erzeugt Strom fürs Klärwerk. Die sogenannte Kaplanturbine war Ende 2004 in Betrieb genommen worden. Sie hat eine Leistung von 120 Kilowatt. Die Anlage läuft Tag und Nacht. Nur bei Hochwasser, wie im Juni 2013, oder bei Störungen muss sie abgeschaltet werden.
Die Sonnenenergie: Neue Solaranlage auf Carport
Durchschnittlich rund 160.000 Kilowattstunden grünen Strom gewinnt die Stadtentwässerung jährlich aus Sonnenergie. Die größte Anlage steht auf dem Dach des Kaditzer Regenüberlaufbeckens. Dort sind 949 Solarmodule installiert, die eine Gesamtleistung von 190 Kilowatt haben. 2022 ist eine weitere Solaranlage mit 175 Modulen mit einer Leistung von 65 Kilowatt auf dem Dach eines neuen Carports hinzugekommen, erklärt der Geschäftsführer. Mit ihr können jährlich durchschnittlich 64.000 kWh Strom erzeugt und somit 21,3 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.
https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/journal-1/detail/wie-die-dresdner-stadtentwaesserung-stromkosten-spart/
(nach oben)
Dresden: 29 Millionen Euro für Gasspeicher und Industriesammler
Das Dresdner Abwassersystem ist in den vergangenen Jahren noch leistungsfähiger und auch umweltfreundlicher geworden. Dafür wurden allein in diesem Jahr 21 Millionen Euro investiert, erklärt der Technische Geschäftsführer Ralf Strothteicher. Davon flossen rund 13 Millionen Euro in die Kanalsanierung, so in Gruna und Seidnitz in das Gebiet zwischen der Winterbergstraße sowie der Bodenbacher Straße und der Gasanstaltstraße und der Winterbergstraße. Zudem konnten im Klärwerk moderne Abluftbehandlungsanlagen an der Klärschlammverladung sowie in der Schlammbehandlung in Betrieb genommen werden, verweist Strothteicher auf ein weiteres Beispiel. „Damit ist dieses Problem gelöst. Bisher gab es keine weiteren Beschwerden von Anwohnern.“
Das Großprojekt: Besserer Anschluss für Mikrochipfabriken
2023 wird die Stadtentwässerung mit rund 29 Millionen Euro deutlich mehr als in diesem Jahr investieren. Mit etwa 22 Millionen Euro fließt der größte Teil ins Kanalnetz. Das ist auch dringend nötig, wie am größten Projekt deutlich wird. Denn die Halbleiter-Industrie wächst rasant. Allein die Werke von Globalfoundries, Infineon, Bosch und X-Fab leiten schon jetzt mit ihren knapp 8,7 Millionen Kubikmetern 93 Prozent der Dresdner Industrie-Abwässer ein. Jetzt will Infineon noch seinen Dresdner Standort kräftig ausbauen. An der Südostecke des Werks an der Königsbrücker Straße ist ein Neubau für rund 1.000 zusätzliche Jobs geplant, der 2026 fertig werden soll.
Damit wäre das vorhandene Kanalnetz überlastet. „Deshalb planen wir den Industriesammler Nord“, erklärt Strothteicher. „Das Projekt hat bei uns höchste Priorität. Die Planung ist weit fortgeschritten.“ Der Hauptkanal für die Abwässer der Mikroelektronik-Betriebe soll rund zehn Kilometer lang werden. Mit dem insgesamt rund 47 Millionen Euro teuren Großprojekt sollen das rechtselbische Kanalnetz entlastet und die Möglichkeiten für die weitere industrielle Entwicklung geschaffen werden. Künftig wird das Abwasser direkt von den Gewerbegebieten zur Kläranlage geleitet.
Ab dem Frühjahr werden die Bauleistungen europaweit ausgeschrieben. Im dritten Quartal dieses Jahres soll der Bau beginnen, der spätestens 2027 abgeschlossen wird.
Die Kanalsanierung: Rund 100 Projekte 2023
Die Stadtentwässerung hat eine langfristige Strategie für die Sanierung des rund 1.800 Kilometer langen Dresdner Kanalnetzes. „in diesem Jahr haben wir rund 100 einzelne Baumaßnahmen geplant“, kündigt der Geschäftsführer an. Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Neuländer Straße in Trachau werden Kanäle für gemischtes Ab- und Regenwasser erneuert. Die bis zu 40 Zentimeter starken Rohre werden auf einer Länge von 750 Metern eingebaut.
Zudem sollen Mischwasserkanäle in Löbtau auf der Frankenbergstraße (500 Meter) sowie auf der Wernerstraße (400 Meter) saniert werden.
Die Energieerzeugung: Neuer Gasspeicher für Blockheizkraftwerke
Hoch empor ragen seit zehn Jahren die Faultürme im Kaditzer Klärwerk. Aus dem dort entstehenden Klärgas wird in den benachbarten drei Blockheizkraftwerken (BHKW) umweltfreundlich Strom und Wärme gewonnen. Jährlich entstehen in den Faultürmen über sieben Millionen Kubikmeter Klärgas. Stündlich sind es etwa 1.000 Kubikmeter, erklärt Strothteicher.
Da die Faultürme immer besser arbeiten und mehr Biogas erzeugen, soll bis 2024 ein zweiter 5.000 Kubikmeter fassender Gasspeicher errichtet werden. Das Klärgas in den Faultürmen wird gleichmäßig erzeugt. Ein weiterer Gasometer ist nötig, damit auch in Spitzenzeiten immer genügend Gas für die BHKW’s zur Verfügung steht. Wird hingegen nicht viel Strom benötigt oder müssen die Kraftwerke für Wartungsarbeiten abgeschaltet werden, ist genügend Speicherkapazität da. „Wir wollen verhindern, dass Klärgas abgefackelt werden muss“, erläutert Strothteicher. Denn es soll effizient zur Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt werden.
Die Investition von rund 2,4 Millionen Euro für den neuen Speicher soll sich durch die Energieerzeugung bereits nach wenigen Jahren amortisieren. Schon jetzt werden durch die Blockheizkraftwerke und andere Anlagen jährlich rund 18 Millionen Kilowattstunden 85 Prozent der Energie fürs Klärwerk Kaditz selbst erzeugt.
Die Optimierung: Neue Rührwerke für Belebungsbecken
Kräftig investiert die Stadtentwässerung, um die Kläranlage zu optimieren. Dafür waren zwischen 2015 und 2018 auch zwei neue Belebungsbecken der biologischen Reinigungsstufe für rund 25 Millionen Euro gebaut worden. Dort leisten Mikroorganismen die Hauptarbeit bei der Abwasserreinigung. Der Ammoniumstickstoff wird dabei in Nitrat umgewandelt.
Das geschieht auch in den sechs 18 Jahre alten Belebungsbecken, die rund 96.000 Kubikmeter fassen. Durch die Becken strömt das Abwasser 20 Stunden lang. Dafür sorgen 24 Rührwerke. Sie werden jetzt durch kleinere, energiesparende Rührwerke ersetzt, die den gleichen Effekt haben.
Die Sicherheit: Neue Entlüftung für Bauwerke am Kaditzer Zulauf
Bei den Investitionen geht es aber nicht nur darum, das Klärwerk effektiv, sondern auch sicher zu betreiben. Deshalb werden ab kommendem Jahr bis 2026 rund 3,2 Millionen für neue Lüftungsanlagen in den Gebäuden am Einlaufbereich der Kläranlage investiert. Dazu gehören die Gebäude mit den Grob- und Feinrechen, dem Sandfang und dem Hauptpumpwerk. Die rund 20 Jahre alten Anlagen werden ersetzt, um Gesundheitsgefahren für Beschäftigte sowie Explosionsgefahren durch entstehende Gase auszuschließen.
Insgesamt rund vier Millionen Euro investiert die Stadtentwässerung im kommenden Jahr im Klärwerk, weitere drei Millionen für weitere Projekte. Dazu zählt ein neues Saug- und Spülfahrzeug für die Kanalreinigung.
https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/journal-1/detail/29-millionen-euro-fuer-gasspeicher-und-industriesammler/
(nach oben)
BRW: Klärwerk Hochdahl öffnete sein Tore
Zum Tag des Wassers waren Führungen beim BRW sehr beliebt
Am 25.3.2023 hat der BRW zum Weltwassertag die Tore zum Klärwerk Hochdahl für kleine und große Besucher geöffnet. Die angebotenen Führungen waren bei den Erkrathern sehr beliebt und die maximale Teilnehmerzahl von 150 Plätzen komplett ausgebucht.
Fachleute des BRW haben Einblicke in ihre tägliche Arbeit im Prozess der Abwasserreinigung gewährt und beim anderthalbstündigen Rundgang alle Stufen im Reinigungsprozess erklärt.
Wenn das Abwasser im Klärwerk ankommt, ist es ganz offensichtlich stark verschmutzt, im besten Falle nur mit menschlichen Ausscheidungen und Toilettenpapier. Denn genau dafür sind Klärwerke gebaut. Wie die Besucher jedoch schnell bemerkten, kommen leider auch ganz andere Dinge über die Kanalisation im Klärwerk an. Wattestäbchen, Feuchttücher, Speisereste, Hygieneartikel, Zigarettenstummel und etliches mehr gibt es in der ersten Reinigungsstufe am sogenannten Rechen zu sehen. Alles Dinge, die die Abwasserreinigung unnötig erschweren und auch verteuern. Zum einen dauert die Reinigung länger und verbraucht mehr Energie. Zum anderen treten durch die missbräuchliche Benutzung der Toilette als Mülleimer immer wieder Schäden an den Maschinen am Klärwerk auf. Diese müssen dann sehr schnell behoben werden, denn das Abwasser kennt keinen Stopp und kommt Tag und Nacht in der Kläranlage an. (Ein Bereitschaftsdienst steht für alle Verbandsklärwerke von nachmittags, über die Nacht bis zum Morgen parat, um im Störfall umgehend reagieren zu können.)
Aufschlussreich war für viele Besucher, dass aus dem Abfallprodukt Klärschlamm in großem Umfang Energie gewonnen werden kann. Wenn auch noch nicht der gesamte benötigte Strom selbst erzeugt werden kann, so doch schon in beträchtlichem und steigendem Maße. Am Ende der Führung und Durchlauf aller Reinigungsstufen konnten die Besucher den Weg des jetzt gereinigten Wassers ins Gewässer verfolgen.
Der BRW wird in diesem Jahr unabhängig vom Tag des Wassers noch einige Klärwerksführungen an verschiedenen Standorten anbieten. Die Termine werden ab Mai auf der Internetseite des BRW veröffentlicht.
http://www.brw-haan.de/aktuell/presse/klaerwerk-hochdahl-oeffnete-seine-tore-fuehrungen-waren-sehr-beliebt
(nach oben)
Böblingen – Sindelfingen: Der Weg des Wassers auf der Kläranlage
Zur Reinigung der Gewässer, die in der Kläranlage ankommen werden unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Zunächst gibt es eine mechanische Reinigung, in der maschinell und durch physikalische Verfahren der Grobschmutz entfernt wird. In einem zweiten Schritt durchläuft das Wasser eine biologische Reinigung, während der das Wasser durch Bakterien und biologische Vorgänge weiter gereinigt wird. Bei der chemischen Reinigung im dritten Schritt können durch dosierte Zugabe von Eisensalz die im Wasser gelösten Phosphate ausgefiltert werden.
Die Anlage in Sindelfingen zeichnet sich durch ein vierstufiges Reinigungssystem aus: Im letzten Schritt werden durch Aktivkohlebehandlung Arzneimittelrückstände und hormonwirksame Stoffe gefiltert. Mehr:
https://www.zvka-bb-sifi.de/klaerwerke/der-weg-des-wassers-in-sindelfingen
(nach oben)
Berlin: Mehr Schutz für saubere Seen
Bis 2025 sollen rund 300.000 Kubikmeter unterirdischer Stauraum für Mischwasser in den Innenbezirken geschaffen werden. Dafür investieren das Land Berlin (60%) und wir (40%) rund 140 Millionen Euro. 253.000 Kubikmeter sind schon geschafft. Hinter den Zahlen verbergen sich über 80 spannende Bauprojekte, Anlagen und Technik, die allesamt ein Ziel haben: die Qualität unserer Gewässer, der Flüsse und Seen zu verbessern. Warum, wie und wo wir bauen, erfahren Sie hier.
https://www.bwb.de/de/gewaessergueteprogramm.php
(nach oben)
Aggerverband: Hochwasser- und Starkregenmaßnahmen an der Sülz – Arbeitskreis der Anliegerkommunen hat getagt
(Hochwasser- und Starkregenmaßnahmen an der Sülz; Quelle: Aggerverband)
Hochwasser kennt keine Kommunalgrenzen und ist nur gemeinsam zu lösen.
Auf der Grundlage dieser Erkenntnis haben sich hochrangige Vertreter der Anliegerkommunen der Sülz (Wipperfürth, Kürten, Lindlar, Overath, Rösrath), die beiden betroffenen Kreise und der Aggerverband zusammengeschlossen und in der vergangenen Woche wiederum getroffen, um die von den einzelnen Kommunen gemeldeten potentiellen Retentionsflächen entlang der Sülz zu diskutieren.
In einer Präsentation des Aggerverbandes wurde deutlich, dass eine Vielzahl von größeren und kleineren Flächen entlang der Sülz existieren, die ein zukünftiges Hochwasser zumindest abmildern können. Hier soll nun untersucht werden, ob die eigentumsmäßige Verfügbarkeit dieser Flächen gegeben ist oder eine Chance besteht, diese zu erwerben. Weiterhin sollen hydraulische und wasserbautechnische Ersteinschätzungen erfolgen, mit welchem Aufwand und welchem Effekt diese Flächen aktiviert werden könnten. Dieses soll dann in eine Prioritätenliste münden, für die der Aggerverband sich dann um Fördergelder für Planung und Realisierung einsetzen will.
Verschiedene Vertreter äußerten sich sehr positiv über die konstruktive und offene Zusammenarbeit der betroffenen Städte und Gemeinden. Es wurde aber auch betont, dass neben dem großräumigen Hochwasserschutz auch der kleinteilige, auf jede Kommune und jedes Grundstück bezogene Hochwasserschutz von Öffentlicher Hand und jedem privaten Grundstückseigentümer parallel weiterverfolgt werden muss.
https://www.aggerverband.de/service/presse/artikel/hochwasser-und-starkregenmassnahmen-an-der-suelz-arbeitskreis-der-anliegerkommunen-hat-getagt
(nach oben)
Aggerverband verleiht Förderpreis mit Hochschule im Rahmen des Weltwassertages
Gummersbach. Zum 22. Mal verleiht der Aggerverband in Zusammenarbeit mit der TH-Köln, Campus Gummersbach, seinen Förderpreis im Rahmen des Weltwassertages am 22. März.
Der diesjährige Weltwassertag steht unter dem Motto „Accelerating Change“, also den Wandel beschleunigen.
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz – BMUV, schreibt dazu: Der Weltwassertag am 22. März, zu dem die Vereinten Nationen (VN) seit 1992 aufrufen, erinnert alljährlich an die Besonderheiten von Wasser als der essenziellsten Ressource allen Lebens.
Mit dem diesjährigen Thema soll die Wichtigkeit nationaler und internationaler Zusammenarbeit in Bezug auf die Einhaltung des „Sustainable Development Goal 6“ in den Fokus gerückt werden. In diesem Ziel formulierten die Vereinten Nationen den Willen, bis 2030 sauberes Wasser und Sanitärversorgung für alle Menschen zu gewährleisten – der Zugang zu Wasser soll kein Privileg sein. Dafür bedarf es eines enormen Kraftaufwandes auf einer Vielzahl von Ebenen. Vom 22. bis zum 24. März wird es dazu eine Wasserkonferenz in New York geben.
Die Weltwassertage sollen dazu genutzt werden, insbesondere die breite Öffentlichkeit auf diese globalen Zielsetzungen und ihre lokale Bedeutung sowie auf die Herausforderungen der Umsetzung dieser Ziele aufmerksam zu machen. Menschen sollen dazu motiviert werden, sich für diese Umsetzung einzusetzen. Alle Staaten sind aufgefordert, den Weltwassertag der Umsetzung der VN-Empfehlung zu widmen und geeignete, konkrete Aktionen auf nationaler Ebene durchzuführen.
Prämiert wurde in diesem Jahr eine herausragende Abschlussarbeit mit einem wasserwirtschaftlichen Bezug.
Der Preis ist ausgelobt mit einem Preisgeld von 600 €.
Bachelor of Engineering Tobias Liese
Thema: “Techno-ökonomische Potenzialanalyse zur Aufbereitung von Deponiesickerwasser mittels Mikroalgen in Biofilmen.”
Betreuung: Prof. Dr. Miriam Sartor, Prof. Dr. Christian Wolf, beide TH Köln
Der Umgang mit Abfällen ist eine globale Herausforderung. Die weltweit gängigste Praxis zur Entsorgung von Abfällen ist die Deponierung. Durch eindringendes Niederschlagswasser und interne biochemische Prozesse entsteht an Deponiestandorten sogenanntes Deponiesickerwasser. Dieses Wasser ist durch den direkten Kontakt mit den eingelagerten Substanzen in der Regel stark verunreinigt und enthält oftmals hohe Konzentrationen abwasserrelevanter Nähr- bzw. Schadstoffe. Damit das Deponiesickerwasser risikofrei in den Wasserkreislauf rückgeführt werden kann, bedarf es einer technischen Abwasserbehandlung.
Einen vielversprechenden Ansatz zur Ergänzung und Weiterentwicklung herkömmlicher Aufbereitungsmethoden stellt die Nährstoffrückgewinnung mit Hilfe von Mikroalgen dar. Dabei werden potenzielle Schadstoffe durch die photosynthetische Stoffwechselaktivität von Mikroalgen, mit Hilfe von Lichtenergie und CO2 in zelleigene Substanzen umgewandelt. Die entstandene Biomasse kann dem Prozess im Anschluss zur Weiterverwertung entnommen werden.
Für seine Bachelorthesis hat Tobias Liese am Lehr- und Forschungszentrum :metabolon der TH Köln untersucht, wie sich die gezielte, biofilmbasierte Kultivierung von Mikrobiozönosen mit Mikroalgen im Sickerwasser der Deponie Leppe auf die Konzentrationen abwasserrelevanter Inhaltsstoffe auswirkt. Auf Basis der erhobenen Daten und bestehenden Forschungserkenntnissen wurde anschließend ermittelt, welche Ressourceneinsparungen durch die Integration einer Mikroalgen-basierten Vorbehandlungsstufe erwartet werden können. Des Weiteren wurden, für die Einschätzung des Marktpotentials, die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Verfahrens mittels Literaturrecherche erarbeitet
https://www.aggerverband.de/service/presse/artikel/aggerverband-verleiht-foerderpreis-mit-hochschule-im-rahmen-des-weltwassertages-2
(nach oben)
Wasserstrategie für mehr Klimaresilienz im Bewirtschaftungsraum des Aggerverbands
Der Temperaturanstieg sowie die in Intensität und Auftreten veränderten Niederschläge gehören zu den messbaren klimatischen Veränderungen, die Einfluss auf die Aufgaben des Aggerverbands nehmen. Eine der Ursachen ist dem voranschreitenden Klimawandel zuzuschreiben. Aus diesem Grunde hat der Aggerverband entlang von zehn Punkten eine „Wasserstrategie für mehr Klimaresilienz im Bewirtschaftungsraum des AV“ entwickelt. Darauf wird hier näher eingegangen.
1. Wiederaufbau Flutschäden
Nach der Unwetterkatastrophe vom Juli 2021 hat der Aggerverband Schäden in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro zu beheben. Dazu wird die entsprechende Wiederaufbauhilfe in Anspruch genommen. Betroffen sind sowohl Abwasseranlagen als auch die Fließgewässerinfrastruktur. Außer der Neuanschaffung geht es ebenso um eine Verbesserung der Situation bei Hochwasser und Starkregen.
2. Identifizierung von Gewässerretentionsflächen
Der Aggerverband möchte herausfinden, wo im Verbandsgebiet Flächen zur natürlichen Rückhaltung von Hochwasser aktiviert werden können. Welches Potenzial diese sogenannten Gewässerretentionsräume bieten, soll eine konzeptionelle Planung an den verbandseigenen Fließgewässern zeigen. Die technischen Stauanlagen im Verbandsgebiet sind in der Lage, Abflussspitzen aus den vorgelagerten Einzugsgebieten zu kappen und damit die Hochwasserwellen signifikant zu dämpfen. Einen ähnlichen Effekt erhofft sich der Verband durch die Aktivierung naturnaher Retentionsflächen.
3. Verdichtung Pegelmessnetz und Ausbau Wetterstationen
Datenverfügbarkeit und Datenqualität bilden die Basis zur verlässlichen Einschätzung der Gesamtsituation bei Hochwasser und Starkregen. Hier plant der Verband in naher Zukunft, sein Messstellennetz aus Pegelanlagen und Wetterstationen zu verdichten und neueste Technik einzusetzen.
4. Veröffentlichung hochwasserrelevanter Daten und Informationen
Die vorgenannten Daten sollen nicht nur den Fachleuten, sondern auch den Mitgliedskommunen sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern in verständlicher Darstellung digital zur Verfügung stehen.
5. Stärkung der hydrologischen Fachkompetenz
Die Situation vor, während und nach einem Unwetter gilt es fachkompetent zu analysieren, um Rückschlüsse sowie Empfehlungen für den technischen Betrieb und die Fachbereiche in den Häusern zu ziehen. Hierfür hat der Verband zwei Stellen in den Bereichen Hydrologie und Gewässer-Modellierung geschaffen.
6. Kooperationspartnerschaft zur Verbesserung des Hochwasser- und Starkregenschutzes in der Gebietskulisse von Agger- und Wupperverband
Vorsorgender Hochwasser- und Starkregenschutz, Bevölkerungsschutz und verbesserte Öffentlichkeitsarbeit stehen im Mittelpunkt der Kooperationspartnerschaft zur Verbesserung des Hochwasser- und Starkregenschutzes. Partner sind dabei die Kreise und kreisfreien Städte sowie der Agger- und Wupperverband.
7. Anpassung Trinkwassertalsperren-Betriebsplan
Trockenheit und Dürre, Hochwasser und Starkregen: Die Häufigkeit dieser Extreme nimmt vor dem Hintergrund des Klimawandels spürbar zu. Beide Fälle stellen den Aggerverband als Betreiber von Trinkwassertalsperren vor neue Herausforderungen. Die Anpassung der Talsperrenbetriebspläne stärkt die Wasserreservoire vor wetterbedingten Anomalien.
8. Klimawandelanpassung Fließgewässer
Nach Einschätzung des Aggerverbandes führt die Umsetzung der Gewässerentwicklungsmaßnahmen gemäß Umsetzungsfahrplan der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu doppeltem Erfolg. Zum einen bieten die naturnahen Gewässerlandschaften Rückhalteräume bei Hochwasser; zum anderen begünstigen die Schatten spendenden üppigen Grüngürtel mit ihrem Verdunstungs- und Überhitzungsschutz die Lebensräume entlang der blauen Lebensadern.
9. Umsetzung Perspektivplan Forst
Mit dem Perspektivplan Forst werden Möglichkeiten und Maßnahmen aufgezeigt, wie die Waldbewirtschaftung für den Verbandsforst des Aggerverbandes angepasst werden kann – unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen. Der Perspektivplan Forst ist heute schon ein fester Bestandteil des forstlichen Handelns im Verband.
10. Ausbau regenerativer Energien
Ziel des Aggerverbands ist es, mittelfristig eine ausgeglichene Energiebilanz vorzuweisen. Vor dem Hintergrund des energieintensiven Abwasserreinigungsprozesses sowie der Trinkwasseraufbereitung und -bereitstellung gilt dieses Ziel als ambitioniert. Dem Ausbau der regenerativen Energien, z. B. Stromerzeugung durch Wasser- und Sonnenkraft, wird hierbei eine Schlüsselposition eingeräumt.
https://www.aggerverband.de/service/presse/artikel/wasserstrategie-fuer-mehr-klimaresilienz-im-bewirtschaftungsraum-des-aggerverbands
(nach oben)
Aggerverband: Gemeinsam zum Schutz gegen Hochwasser und Starkregen
Aus der Region. „Nur wenn wir unsere Kräfte bündeln und eng zusammen arbeiten, können wir einen bestmöglichen Schutz vor Hochwasser und Starkregen erreichen“, sagt der Landrat des Oberbergischen Kreises Jochen Hagt. Er spielt damit auf die von den Kreisen Oberberg, Rhein-Berg, Rhein-Sieg, Ennepe-Ruhr, den kreisfreien Städten Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wuppertal sowie dem Agger- und Wupperverband gemeinsam unterzeichnete Vereinbarung an.
„Wir haben das Ziel, die Bevölkerung zu schützen“, ergänzt Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal die Motivation für die Kooperation und macht dabei deutlich, dass Hochwasser und Starkregen eine die Kreis- und Stadtgrenzen überschreitende Herausforderung darstellen.
Dem schließt sich auch Georg Wulf, Vorstand des Wupperverbandes, an: „Das Hochwasserereignis im Juli 2021 hat uns deutlich aufgezeigt, dass wir uns noch besser abstimmen und untereinander koordinieren müssen“. Dabei ist sich Georg Wulf sicher, dass dies nur im Zusammenspiel der kommunalen Ebene und der Wasserverbände gelingt.
Dr. Uwe Moshage, Vorstand des Aggerverbands, unterstützt dies und ergänzt: „Die Natur hat uns damals wieder einmal deutlich vor Augen geführt, dass sie keine Verwaltungsgrenzen kennt. Es bedarf also einer interkommunalen Organisation. Hier gehören die für die Flusseinzugsgebiete zuständigen Wasserverbände mit ihrem Fachwissen dazu, wenn es darum geht, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen.“
Die Mitunterzeichner der Erklärung betonen stellvertretend für alle Partner, dass neben der frühzeitigen Warnung der Bevölkerung, der Sensibilisierung und Verbesserung des Informationsflusses und dem Schutz wichtiger Infrastruktur, auch die Notwendigkeit zu mehr Eigenschutz durch die Bürgerinnen und Bürger auf der Agenda der Partner steht. Die weitere Einbindung wichtiger Akteure, wie Land- und Forstwirtschaft, steht ebenfalls im Fokus.
Darüber hinaus sind sich Jochen Hagt, Dr. Uwe Schneidewind und Georg Wulf mit den übrigen Kooperationspartnern einig, dass auch die Planungsprozesse für die Schaffung von Bauland, insbesondere im Bereich von Überschwemmungsgebieten, viel intensiver in den Fokus zu nehmen sind. „Unsere Gewässer brauchen Platz zur Entwicklung und die erforderlichen Retentionsflächen, um Starkregen und Hochwasser schadlos abführen zu können“, erklären die Partner.
https://www.aggerverband.de/service/presse/artikel/gemeinsam-zum-schutz-gegen-hochwasser-und-starkregen
Berliner Wasserbetriebe stellen ihre Bilanz 2022 vor
Berlin spart Wasser – aber spart es genug? Wie bringen wir den Umbau der Stadt zur klimaresilienten Metropole voran? Was machen wir mit dem Regenwasser? Wie sichern wir die Trinkwasserversorgung für künftige Dürrejahre? Und wie geht es eigentlich den Stadtwerken?
Antworten auf diese und andere Fragen möchten wir Ihnen gern bei unserer Jahrespressekonferenz
am Mittwoch, 12. April 2023, um 10 Uhr,
in der Unternehmenszentrale der Berliner Wasserbetriebe,
Neue Jüdenstraße 1, 10179 Berlin,
geben. Unser neuer Vorstandschef Christoph Donnerstellt gemeinsam mit Aufsichtsratschef Senator Stephan Schwarz die Bilanz 2022 vor und erklärt, wie wir die vor uns liegenden Herausforderungen bewältigen, wie wir uns gemeinsam mit Brandenburg für einen zukunftsfähigen Wasserhaushalt einsetzen und wie wir mit unserem Tochterunternehmen Berliner Stadtwerke die Energiewende weiter vorantreiben.
(nach oben)
Wasserverband Eifel-Rur (WVER): Großprojekt Umbau der Kläranlage Düren: Vorbereitende Arbeiten haben begonnen
Spaziergänger auf dem Rur-Uferradweg können zurzeit beobachten, wie der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) einen Erdwall abträgt, der sich zwischen dem Weg und der Kläranlage Düren-Merken befindet. Der Wall stammt noch aus der Zeit der Ersterrichtung der Kläranlage, als der Erdaushub beim Bau von Becken zur Abwasserreinigung in Form eines Dammes abgelagert wurde.
Nun muss der Damm weichen, denn im Rahmen eines groß angelegten Umbaus der Kläranlage Düren wird an dieser Stelle ein neues Zulaufhebewerk mit einer nachgeschalteten hochmodernen Rechenanlage und einem belüfteten Sandfang entstehen.
Der Erdwall hat eine Höhe von teilweise mehr als vier Meter, der bis auf die natürliche Geländeoberkante abgetragen wird. Dabei müssen ca. 7.000 Tonnen Erdreich aufgenommen und zur Deponie abtransportiert werden. In Kürze wird das Gelände vom Kampfmittelräumdienst untersucht, um die sich anschließenden Baumaßnahmen gesichert durchführen zu können.
Das wasserwirtschaftliche Großprojekt, welches der umfassenden Substanzsicherung und Leistungssteigerung der Kläranlage Düren dient, wird noch in diesem Jahr beginnen und sich in zwei Bauabschnitten bis Mitte 2027 hinziehen. Dabei werden neben dem erwähnten Neubau des Zulaufbereichs zwei der drei Vorklärbecken abgerissen und komplett erneuert. Auf dem Standort des dritten Beckens und der benachbarten Freifläche wird eine aus zwei Rundbecken bestehende zusätzliche biologische Reinigungsstufe errichtet. Diese ist als sog. „Hochlastbiologie“ ausgelegt und wird in der Lage sein, die in den letzten Jahren vermehrt auftretenden Lastspitzen zu beseitigen.
Dadurch wird die bestehende biologische Reinigungsstufe, in der Mikroorganismen alle relevanten Schmutzstoffe aus dem Abwasser entfernen, wirkungsvoll entlastet. Diese war zunehmend an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gekommen. Darüber hinaus wird ein sog. „Mischwasserstreckungsbecken“ errichtet, in dem bei Niederschlägen verdünntes Abwasser, das die hydraulische Aufnahmekapazität der Kläranlage überschreitet, zwischengespeichert, mechanisch behandelt und anschließend in die Kläranlage übergeleitet wird.
Nach Fertigstellung des auf ein Investitionsvolumen von ca. 85 Mio. € veranschlagten Anlagenausbaus ist die Funktionstüchtigkeit der Kläranlage Düren für die Zukunft gesichert. Die Kläranlage hat eine herausragende Bedeutung für die gesamte Region, weil sie neben den Abwässern von mehr als 100.000 Menschen große Mengen industriellen Abwassers – vor allem aus der im Dürener Raum angesiedelten Papierindustrie – aufnimmt und reinigt. Der räumliche Einzugsbereich der Kläranlage umfasst Düren, Kreuzau, Merzenich und Ortsteile von Langerwehe sowie der Eifelkommunen Nideggen und Hürtgenwald.
Der Ausbau der Kläranlage schafft somit den dringend benötigten Spielraum für die Siedlungsentwicklung der angeschlossenen Kommunen, Investitionssicherheit für die ansässige Industrie und Ansiedelungsmöglichkeiten für weitere Industrie- und Gewerbeunternehmen. Darüber hinaus wird durch die umfassende Modernisierung die Wirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebs und die Ressourceneffizienz den Anforderungen der Zukunft angepasst.
https://wver.de/grossprojekt-umbau-der-klaeranlage-dueren-vorbereitende-arbeiten-haben-begonnen/
(nach oben)
Stuttgart: Girls’ Day 2023 – die Stadtentwässerung macht mit!
Ein Tag auf der Kläranlage
Am 27. April 2023 zeigen wir Dir, wie die Abwasserreinigung in Baden-Würtembergs größtem Klärwerk funktioniert.
Erlebe den spannenden Weg von dreckigem Abwasser zu sauberen klaren Wasser
Probiere verschiedene Stationen aus
Lerne unsere Ausbildungsberufe kenn
Wann:
27.04.2023, 7.00–16.00 Uhr
Wo:
Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen
Aldinger Straße 212, 70378 Stuttgart
Anmeldung per E-Mail:
66-Ausbildung@Stuttgart.de
Weitere Informationen:
www.girls-day.de
https://www.stuttgart-stadtentwaesserung.de/girlsday-2023-wir-machen-mit/
(nach oben)
Nach Zwischenfall in Solingen Unfall in Klärwerk löst Fischsterben in der Itter aus
Hilden/Haan/Solingen · 3000 Kubikmeter Klärschlamm sind am späten Dienstagabend aus einem Klärwerk an der Grenze zwischen Hilden, Haan und Solingen ausgetreten und in die Itter gelangt. Dort sterben nun die Fische.
Rund 30 tote Fische liegen am Mittwoch hinter dem Hildener Rathaus in der Itter. Angeschwemmt nach einem Unfall in Ohligs. In Solingen waren am Dienstagabend rund 3000 Kubikmeter Klärschlamm aus einem Klärwerk ausgetreten, nachdem ein sogenannter Faulbehälter gebrochen war. „Das Material hat plötzlich…mehr:
https://rp-online.de/nrw/staedte/hilden/hilden-klaerschlamm-toetet-fische-in-itter_aid-83225201
(nach oben)
Hansestadt Hamburg: Staedtische-Unternehmen-bauen-klimafreundlichen-Gewerbehof-der-Zukunft
Wegweisendes Projekt:
CO2-arme Energieversorgung, klimaschonende Bauweise, begrünte Dächer und Fassaden dazu Ladestationen für E-Fahrzeuge und eine Wasserstofftankstelle – HAMBURG WASSER (HW), Stromnetz Hamburg (SNH) und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) planen im Auftrag des Senats einen Gewerbehof der Zukunft. Der gemeinsame Standort der städtischen Partner entsteht auf den Flächen des stillgelegten Klärwerks Stellinger Moor in Altona. Neben dem bestehenden Netzbetrieb von HW werden auf dem Gelände zukünftig zwei weitere Betriebshöfe von SNH und der VHH angesiedelt.
Mit der Fertigstellung des gemeinsamen Nutzungskonzeptes und des Architekturentwurfs wurde der erste Meilenstein des Vorhabens erreicht. Zentrales architektonisches Element ist eine trapezförmige Ringkonstruktion für 250 E-Busse der VHH. Ziel ist ein klimaneutraler Bau und Betrieb des Gewerbehofes. Die entstehenden Gebäude werden mit Photovoltaik ausgestattet. Energie liefert außerdem das nahegelegene im Bau befindliche Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) der Stadtreinigung Hamburg (SRH). Das Projekt ist bisher einmalig in Hamburg. Durch das örtliche Zusammenziehen einzelner Betriebshöfe an einen Standort wird der Raum im dichtbesiedelten Altona effizient genutzt.
Jens Kerstan, Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft: „Vor 20 Jahren wurde das Klärwerk Stellinger Moor stillgelegt, das Abwasser wird nun zentral gereinigt, um die Wasserqualität der Elbe zu verbessern. Nun entsteht auf dem 15 Hektar großen Gelände ein innovativer, zukunftsweisender Gewerbehof, der höchsten Klima-Standards gerecht wird. Photovoltaik-Anlagen, Gründächer, nachhaltige Materialien beim Bau, eine vollständige Wärmeversorgung aus Erneuerbaren Energien – all dies zeichnet diesen Betriebshof aus und lässt die Energiewende greifbar werden. Die Wiederbelebung der Flächen und die Integration in unseren Netzbetrieb in Altona ist ein ebenso bedeutender Baustein für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Wir setzen mit diesem herausragenden Projekt einen Punkt des Koalitionsvertrages um und einmal mehr zeigt sich, dass unsere öffentlichen Unternehmen Treiber der Energiewende sind.“
Andreas Dressel, Finanzsenator: „So geht gemeinsame Stadtwirtschaft! Vier städtische Unternehmen – Hamburg Wasser, Stadtreinigung Hamburg, Stromnetz Hamburg und Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein – werden dort mehr als 2.000 Arbeitsplätze bündeln. Dass wir das gemeinsam unter Moderation unseres Landesbetriebs LIG hinbekommen haben, hat Vorbildcharakter für gemeinsame Investitionen unserer öffentlichen Unternehmen auf dem Weg Richtung Klimaneutralität. In Stellingen wird exemplarisch eine optimierte, innovative und an den Entwicklungs- und Klimaschutzzielen der Stadt orientierte Flächennutzung erreicht. Danke an alle Beteiligten!“
Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „Der klimaneutrale Bau und Betrieb des Gewerbehofs von vier städtischen Unternehmen ist nicht nur ein tolles Beispiel für moderne und effiziente Flächennutzung, er ist auch eine wichtige Säule für die Antriebswende im öffentlichen Verkehr. Bis 2030 sollen alle Busse und Bahnen in Hamburg emissionslos fahren. Damit das klappt, brauchen wir die passende Lade- und Infrastruktur. 250 E-Busse der VHH können zukünftig im Gewerbehof Stellinger Moor geladen und betrieben werden – das ist hierfür ein echtes Pfund. Das Projekt zeigt auch, dass wir wichtige Infrastrukturprojekte ressourcenschonend im Herzen Hamburgs umsetzen können.“
Das maßgeblich auch vom zur Finanzbehörde gehörenden Landesbetrieb LIG koordinierte Sharing-Modell für den Betriebshof spart Ressourcen und ermöglicht technische und personelle Synergien. HW, SNH und VHH nutzen innerbetriebliche Verkehrswege, Fahrradinfrastruktur, Werkstätten, Sozialräume und Parkflächen gemeinsam. Die Wasserstofftankstelle und E-Ladestationen stehen neben den Projektpartnern auch der Fahrzeugflotte der SRH zur Verfügung. Um weitere Synergien auszuschöpfen, arbeiten die Nachbarn seit Projektbeginn eng zusammen. So erfolgt die Erschließung des Betriebshofes zukünftig von der Schnackenburgallee über das Gelände der SRH. Anfang 2022 haben HW und SNH einen Vertrag für einen gemeinsamen Betriebshof am Standort in Altona geschlossen und den Grundstein für das Projekt unter tatkräftiger Begleitung städtischer Dienststellen gelegt. Mit der VHH kommt nun der dritte städtische Partner hinzu. Das Stellinger Moor ist schon heute ein wichtiger Gewerbestandort in Hamburg. Mit den neuen Funktionen und Nutzern wird der Betriebshof in seiner Bedeutung als wichtiger Knotenpunkt für städtische Infrastruktur und Mobilität langfristig gesichert. Zudem wird er ansehnlich durch eine ambitionierte Architektur, die nachhaltig, modular und zeichenhaft ist. Die Zusammenlegung der Betriebsplätze ist in den kommenden sechs Jahren geplant, die langfristige Entwicklung ist auf 60 Jahre ausgelegt. Für die Realisierung des neuen Standortes übergibt HW die Projektleitung an die VHH.
https://www.hamburgwasser.de/presse/2022/20230208-staedtische-unternehmen-bauen-klimafreundlichen-gewerbehof-der-zukunft
(nach oben)
Flörsheim: Informationsveranstaltung zum Ausbau der Kläranlage
Am Mittwoch, 13. April, 18 Uhr, lud der Abwasserverband Flörsheim und der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main in der Begegnungsstätte Keramag/Falkenberg zu einer Informationsveranstaltung zum Ausbau der Kläranlage ein.
„Wir können damit dem berechtigten Wunsch des Ortsbeirates und der Anwohner nach Informationen nachkommen“, erklärte Bürgermeister Dr. Bernd Blisch mit Verweis darauf, dass die Pandemie trotz Beginns der Ausbaumaßnahme eine frühere Möglichkeit ausscheiden ließ.
Das Planungsbüro aquadrat Ingenieure GmbH hielt eine Präsentation und stand gemeinsam mit dem Abwasserverband für Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/2c97c81f-caee-4c1e-b2ea-7ab853688d08/220413_ErweiterungKAFloersheim_Anwohnerinformation.pdf
https://www.abwasserverband-floersheim.de/
(nach oben)
Erftverband: Girls´Day
beim Erftverband von 8 Uhr bis 14 Uhr am 27. April 2023
Jetzt anmelden: Girls´Day-Radar
https://www.erftverband.de/girlsday-2023/
(nach oben)
Erftverband: Verbandsrat wählt neuen Vorstand
In ihrer Sitzung am 28. Februar 2023 unter der Leitung des Verbandsratsvorsitzenden Dr. Hans-Peter Schick wählten die Mitglieder des Verbandsrates Herrn Professor Heinrich Schäfer zum neuen Vorstand des Erftverbandes. Der bisherige Bereichsleiter für die Abwassertechnik des Erftverbandes und ständige Vertreter des Vorstandes wechselt zum 1. Oktober 2023 auf den neuen Posten. Er folgt auf Dr. Bernd Bucher, der Ende September in den Ruhestand geht.
Herr Professor Schäfer hat an der RWTH Aachen Bauingenieurwesen studiert. Anschließend war er in Ingenieurbüros mit Projekten der Siedlungswasserwirtschaft befasst und wechselte im Jahr 2001 zum Erftverband. In dieser Zeit absolvierte er erfolgreich das berufsbegleitende Studium „Technische Betriebswirtschaft“ an der FH Bochum.
Beim Erftverband leitete er zunächst die Abteilung „Planung und Bauen“ bevor er im Jahr 2013 als Bereichsleiter die Verantwortung für die gesamte Abwassertechnik beim Erftverband übernahm. 2018 bestellte der Verbandsrat Herrn Professor Schäfer zum ständigen Vertreter des Vorstandes.
Seit dem Jahr 2008 ist Herr Professor Schäfer Lehrbeauftragter an der FH Aachen. Er wurde 2017 dort zum Honorarprofessor ernannt.
Der künftige Vorstand des Erftverbandes ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.
https://www.erftverband.de/verbandsrat-waehlt-neuen-vorstand/
(nach oben)
Emschergenossenschaft: Mit Kunst für eine versöhnte Gesellschaft
In Zusammenarbeit mit dem Künstler Jonas Hohnke realisierten Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) am Gebäude ihrer Hauptverwaltung in Essen das Kunstwerk „pond of view“, das für eine Gesellschaft des Miteinanders plädiert
Essen. „Eine emanzipierte Gesellschaft jedoch wäre die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen, ohne Angst verschieden zu sein“ – so lautet der Text, der die Metallfläche rahmt, die nun am Gebäude des Emscher-Hauses, der Hauptverwaltung von EGLV an der Kronprinzenstraße 24 in Essen, installiert wurde. Bei der 210 x 330 x 10 cm großen Edelstahl-Konstruktion, die den Titel „pond of view“ trägt, handelt es sich um ein Kunstwerk des Wuppertaler Künstlers Jonas Hohnke (*1983), das EGLV im Rahmen der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Geschichte der Verbände in Auftrag gegeben haben.
„Mit pond of view wollen wir unsere Gedenkarbeit künstlerisch reflektieren und gleichzeitig auch anderen die Möglichkeit geben, daran teilzuhaben, indem das Kunstwerk im öffentlichen Raum installiert wird. Außerdem spiegeln sich in Adornos Idee der versöhnten Gesellschaft die Werte des Haues wider und damit möchten wir auch ein Statement setzen“, sagt Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender von Emschergenossenschaft und Lippeverband.
Die Arbeit, die von Agnes Sawer (Kuratorische Leitung bei EGLV) kuratiert wurde, besteht aus zwei Teilen: einer spiegelnden Oberfläche und einem stark verkürzten Zitat aus der Schrift „Minima Moralia“ (1951) des Soziologen und Philosophen Theodor W. Adorno (1903-1969), das in Zusammenarbeit mit EGLV entwickelt und in Jonas Hohnkes Arbeit buchstäblich auf den Kopf gestellt wurde. Lesbar ist der Schriftzug, der für eine versöhnte Gesellschaft plädiert, nur, wenn man in den Spiegel schaut und sich auf diese Weise zu Adornos Gedanken und der Umgebung, die in der metallischen Oberfläche erscheint, ins Verhältnis setzt.
Der Titel der Arbeit – „pond of view“ – greift den Aspekt des Standpunkt-Beziehens auf, indem hier auf den englischen Begriff „point of view“ (Standpunkt) angespielt wird. In einem Wortspiel macht Hohnke allerdings aus dem „Punkt“ einen „Teich“ (pond) und stellt auf diese Weise einen Bezug zu der Metallplatte her, die aufgrund ihrer spiegelnden Wirkung einer Wasseroberfläche gleicht. Der Fokus wird dadurch auf den Spiegel gelenkt, der hier als Medium der Selbst- und Welterkenntnis verwendet wird.
Neben der Treppe des Haupteingangs am Emscher-Haus platziert, ist „pond of view“ im Alltäglichen verankert, wie die meisten Arbeiten des Künstlers, die gewöhnliche Situationen in den Mittelpunkt rücken. So hat Hohnke beispielsweise in seinem Werk „starting point (mur brut 13)“, Kunsthalle Düsseldorf (2019), die Geräusche einer Düsseldorfer Tiefgarage visualisiert und mit den Markierungen des Parkdecks verbunden. Hohnkes Arbeiten regen dazu an, gewöhnliche Orte ganz neu zu betrachten und die Wahrnehmung der Menschen für das Unscheinbare zu schärfen.
Jonas Hohnke hat an der Kunstakademie in Münster studiert. Stipendien führten ihn unter anderem nach Paris und Wien. Im vergangenen Jahr gewannen er und Filiz Özcelik den 76. Internationalen Bergischen Kunstpreis. Zuletzt waren Hohnkes Arbeiten im Museum Schloss Moyland, im Kunstmuseum Goch und im Kunstmuseum Bochum zu sehen und wurden unter anderem in die Sammlung des Kunsthauses NRW in Kornelimünster und in den Bestand des Kunstmuseums Solingen aufgenommen.
„pond of view“ befindet sich an der Kronprinzenstraße 24 in Essen und kann jederzeit besichtigt werden. Die Installation wird abends illuminiert. Aufgrund der aktuellen Energiesparregeln ist die Beleuchtung derzeit jedoch ausgeschaltet.
Emschergenossenschaft und Lippeverband
Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) sind öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten Emschergenossenschaft sind unter anderem die Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie der Hochwasserschutz. Der 1926 gegründete Lippeverband bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und Lippeverband rund 1.700 Beschäftigte und sind Deutschlands größter Abwasserentsorger und Betreiber von Kläranlagen (rund 782 Kilometer Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle, 546 Pumpwerke und 69 Kläranlagen). www.eglv.de
https://www.eglv.de/medien/mit-kunst-fuer-eine-versoehnte-gesellschaft/
(nach oben)
Emschergenossenschaft: Emscher-Mündung: Verfüllung des Altarmes in den Rhein macht Fortschritte
Auf dem alten Flussbett entsteht in Kürze ein Rad- und Wanderweg
Die Emschergenossenschaft schreitet mit der Verfüllung der alten Emscher-Mündungstrasse im Moment zügig voran. Das trockengelegte Flussbett soll auf einer Strecke von rund 400 Metern mit rund 80.000 Kubikmetern Erde sowie 25.000 Tonnen Wasserbausteinen aufgefüllt werden. Diese sind unter anderem beim Ausheben der rund 20 Hektar großen Auenfläche angefallen. Nach dem Abschluss der Maßnahme im Sommer 2023 erstellt die Emschergenossenschaft auf dem Altarm einen neuen Rad- und Wanderweg.
Im Jahr 2014 wurde mit dem Neubau einer naturnahen Emscher-Mündung samt Aue begonnen. Über eine Strecke von rund 500 Metern wurde der Fluss nach Norden verlegt. Seit November 2022 fließt er bereits durch diese neue Aue in den Rhein. Zunächst floss die Emscher zur Entlastung der Baustelle sowohl durch den neuen als auch durch den alten Arm. Nach dem Abklemmen des Altarmes vor wenigen Wochen ist dieser nach und nach trockengefallen und kann nun verfüllt werden.
Für lange Zeit stürzte der Fluss über ein technisches Mündungsbauwerk aus Beton sechs Meter tief in den Rhein. Seit dessen Inbetriebnahme im Jahr 1949 prägte es das Bild der Emscher am Rhein. Damit stellte das Bauwerk jedoch auch eine unüberwindbare Barriere für Fische dar, denen der Weg stromaufwärts dadurch verwehrt blieb. Die neue Mündungsaue löst dieses Problem: Der Höhenunterschied von sechs Metern zwischen den beiden Gewässern wird nun sanft ausgeglichen, unter anderem durch fischfreundliche Sohlgleiten. Fische aus dem Rhein können so auch stromaufwärts die Emscher hochschwimmen – die Mündung ist nun „barrierefrei“. Das Absturzbauwerk wird auch nach Abschluss der Verfüllung für künftige Generationen erhalten bleiben – als Zeugnis der Wasserwirtschaft im industriellen Ruhrgebiet.
Die entstandene Auenfläche im Norden soll in Zukunft als Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dienen. Zusätzlich leistet die Aue als Retentionsraum einen Beitrag zum Hochwasserschutz an Emscher und Rhein. Das Gebiet um die Mündung soll ein Ort der Naherholung werden, an dem sich Mensch und Tier an der Natur erfreuen können.
Dinslaken/Voerde. Die Emschergenossenschaft schreitet mit der Verfüllung der alten Emscher-Mündungstrasse im Moment zügig voran. Das trockengelegte Flussbett soll auf einer Strecke von rund 400 Metern mit rund 80.000 Kubikmetern Erde sowie 25.000 Tonnen Wasserbausteinen aufgefüllt werden. Diese sind unter anderem beim Ausheben der rund 20 Hektar großen Auenfläche angefallen. Nach dem Abschluss der Maßnahme im Sommer 2023 erstellt die Emschergenossenschaft auf dem Altarm einen neuen Rad- und Wanderweg.
Im Jahr 2014 wurde mit dem Neubau einer naturnahen Emscher-Mündung samt Aue begonnen. Über eine Strecke von rund 500 Metern wurde der Fluss nach Norden verlegt. Seit November 2022 fließt er bereits durch diese neue Aue in den Rhein. Zunächst floss die Emscher zur Entlastung der Baustelle sowohl durch den neuen als auch durch den alten Arm. Nach dem Abklemmen des Altarmes vor wenigen Wochen ist dieser nach und nach trockengefallen und kann nun verfüllt werden.
Für lange Zeit stürzte der Fluss über ein technisches Mündungsbauwerk aus Beton sechs Meter tief in den Rhein. Seit dessen Inbetriebnahme im Jahr 1949 prägte es das Bild der Emscher am Rhein. Damit stellte das Bauwerk jedoch auch eine unüberwindbare Barriere für Fische dar, denen der Weg stromaufwärts dadurch verwehrt blieb. Die neue Mündungsaue löst dieses Problem: Der Höhenunterschied von sechs Metern zwischen den beiden Gewässern wird nun sanft ausgeglichen, unter anderem durch fischfreundliche Sohlgleiten. Fische aus dem Rhein können so auch stromaufwärts die Emscher hochschwimmen – die Mündung ist nun „barrierefrei“. Das Absturzbauwerk wird auch nach Abschluss der Verfüllung für künftige Generationen erhalten bleiben – als Zeugnis der Wasserwirtschaft im industriellen Ruhrgebiet.
Die entstandene Auenfläche im Norden soll in Zukunft als Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dienen. Zusätzlich leistet die Aue als Retentionsraum einen Beitrag zum Hochwasserschutz an Emscher und Rhein. Das Gebiet um die Mündung soll ein Ort der Naherholung werden, an dem sich Mensch und Tier an der Natur erfreuen können.
Die Emschergenossenschaft
Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Sie wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet und kümmert sich seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie um den Hochwasserschutz.www.eglv.de
(nach oben)
Stadtentwässerung Dresden entwickelt und erprobt Konzept für Krisen
Die Stadtentwässerung Dresden hat ein Konzept für Krisen entwickelt und einen Krisenstab aufgestellt. Dabei wurde mit einem Beratungsunternehmen aus Wien kooperiert, das auf solche Fälle spezialisiert ist. „Mit dabei war ein früherer Offizier, der sehr erfahren ist”, sagt Guido Kerklies, technischer Leiter der Stadtentwässerung. Der Krisenstab besteht aus rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Er wird von der Geschäftsführung nicht nur bei Hochwasser, Sturm oder Blackout, sondern auch bei anderen Krisensituationen – wie Cyberangriffen – einberufen”, erklärt Kerklies. Die Akteure sind dann rund um die Uhr im Einsatz. Im Krisenfall soll der Stab spätestens nach zwei Stunden handlungsfähig sein, um schnell Entscheidungen zu treffen und die nötigen Schritte einzuleiten. Die Aufgaben sind klar verteilt. Insgesamt sind fünf Stabsfunktionen ausgewiesen, abgekürzt mit „S” bezeichnet (analog Stabsoffizieren bei der Bundeswehr). So beschafft der S 2 die Informationen zur Lage, sodass beispielsweise beim Sturm mit einem Blackout Gefahren oder Schäden beurteilt werden können. Jeweils ein S 3 ist für den Betrieb der Kläranlage und den Betrieb des Kanalnetzes zuständig. Sie leiten die nötigen Schritte ein. Der S 5 informiert die Presse und andere Medien, und der S 6 kümmert sich darum, dass trotz des Stromausfalls Kommunikationskanäle weiter funktionieren. Andere Fachleute halten währenddessen die Verbindung zu anderen Krisenstäben, vor allem zu dem des Brand- und Katastrophenschutzamtes, und erfüllen weitere Aufgaben. Vor Weihnachten 2022 hat der Krisenstab eine Woche lang den Ernstfall geprobt.
(nach oben)
Berlin: Mit SEMA in die Zukunft schauen
Preisgekröntes Kanalalterungsmodell wurde vervollkommnet und besteht in der Praxis
Angenommen, wir würden unseren Apparat stur darauf ausrichten, in jedem Jahr rund ein Prozent des Kanalnetzes anzufassen und dabei gut 21 Kilometer auszuwechseln, 55 Kilometer zu renovieren – was meistens linern bedeutet – und weitere 18 Kilometer zu reparieren, dann wäre das bis 2060 eine feine Sache. Der Zustand unseres Gesamtnetzes würde bis dahin immer besser, obwohl es unter diesen Annahmen stetig weiter altern würde. Aber danach würde unser rüstiger Rentner, so könnte man das Netz dann umschreiben, schnell immer klappriger.
Bis 2120, also in hundert Jahren, hätte sich die Verbesserung der ersten Jahrzehnte aber regelrecht umgekehrt und die Zahl der Kanäle, denen es richtig schlecht geht, wäre wahrscheinlich mehr als doppelt so groß wie heute. Das will natürlich niemand.
Solche Zahlen – zumeist mit so klaren wie kunterbunten Flächengrafiken eingängig visualisiert – spuckt die inzwischen gut trainierte und mit neuen Daten weiter lernende SEMA-Maschine aus, das Kanalalterungsmodell für Sanierungsstrategien, wir zusammen mit dem Kompetenzzentrum Wasser Berlin entwickelt haben.
2019 gab es für den Prototyp den Innovationspreis des VKU und branchenweit viel Aufmerksamkeit. Zwei Jahre weiter wird SEMA, das mit Nachnamen Berlin heißt, bei uns bis zur einzelnen Haltungsebene implementiert und soll damit künftig als Basis der Investitionsplanung dienen, also betrieblich genutzt werden. Und erweist sich dabei offenbar im Vergleich zwischen Simulations- und echten Inspektionsergebnissen zumindest bisher als 99-prozentig genau und übertrifft damit Wetter- und Lottoprognosen weit.
Gemauert sind Hundertjährige noch fast jugendlich
Weil SEMA inzwischen eine Menge Dinge verinnerlicht hat. Also welches Material aus welchem Jahr wo liegt und wann es wahrscheinlich altersschwach wird. SEMA prognostiziert den Netzzustand und zeigt Sanierungsschwerpunkte im Netz. „Der Netzsimulator gibt das Soll vor, über den Haltungssimulator wird das Ist verbessert. Beide Simulatoren ergänzen sich. Denn nur was man findet, kann man auch sanieren“, sagt SEMA-Mitentwickler Alexander Ringe. Wobei Alter abhängig vom Material relativ ist. Gemauert sind Hundertjährige noch fast jugendlich, während 30-jährige Plastik-Greise der Erlösung harren.
Und SEMA Berlin weiß auch, dass grabenlos im Vortrieb montierte Kanalrohre gegenüber offen im Graben verlegten Röhren zwar fast doppelt so teuer in den Boden kommen, dafür aber vermutlich auch ewig halten, weil dafür dickere Rohre verwandt werden und eben auch kein Baugraben verfüllt werden muss, was die Rohre ja auch ordentlich unter Druck setzt.
Und auch der Fakt, dass wir heute ja vorwiegend linern und weniger neu bauen, bringt Ringe auch angesichts der absehbaren Halbwertzeit der Kunststoffimplantate nicht um den Schlaf. „Wenn die Teile dann nach 50 plus x Jahren erschöpft sind, dann müssen wir sie halt rausfräsen und neu linern.“ Was die Stadt weniger stört und finanziell allemal günstiger ist.
Die Erkenntnisse aus der Anwendung des Strategie-Simulators haben uns schon klüger gemacht. So wissen wir jetzt dank SEMA, dass wir unsere heutige Sanierungsstrategie nachbessern oder weiterentwickeln müssen, um unsere Kanäle generationenübergreifend nachhaltig zu bewirtschaften. Was wir heute tun, reicht ab 2060 dafür nicht aus. Die Stellschrauben für diese Nachbesserung sind identifiziert, beispielsweise der Verbau dickerer Rohre oder die Verlängerung der Nutzungsdauer von Linern.
https://www.bwb.de/de/25726.php
(nach oben)
Berlin: Mehr Schutz für saubere Seen
Bis 2025 sollen rund 300.000 Kubikmeter unterirdischer Stauraum für Mischwasser in den Innenbezirken geschaffen werden. Dafür investieren das Land Berlin (60%) und wir (40%) rund 140 Millionen Euro. 253.000 Kubikmeter sind schon geschafft. Hinter den Zahlen verbergen sich über 80 spannende Bauprojekte, Anlagen und Technik, die allesamt ein Ziel haben: die Qualität unserer Gewässer, der Flüsse und Seen zu verbessern. Warum, wie und wo wir bauen, erfahren Sie hier.
Maßnahmen im Detail
Wo wird das Speichervolumen bis 2025 geschaffen?
Mehr unter:
https://www.bwb.de/de/gewaessergueteprogramm.php
(nach oben)
Berlin: Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick buchen Pakete
17 neue Solaranlagen für zwei Bezirke
Die Berliner Bezirke Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick haben mit den Berliner Stadtwerken weitere Solarpakete über insgesamt 17 Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 1,5 Megawatt (MW) vereinbart.
Bis auf drei werden alle 17 neuen Solaranlagen auf Schulen, deren modularen Ergänzungsbauten (MEB) oder Sporthallen errichtet. Der auf diesen Dächern erzeugte Ökostrom soll vorrangig im jeweiligen Gebäude genutzt werden, Überschüsse werden in das öffentliche Netz ausgespeist.
Die Anlagen sollen noch in diesem Jahr installiert werden und dazu beitragen, die im Berliner Energiewende- und Klimaschutzgesetz fixierten Ziele des Landes zu erreichen. Dazu gehört inzwischen auch eine möglichst vollständige Belegung mit PV-Modulen der Dächer von öffentlichen Gebäuden. Für die beiden Bezirke geht die Zusammenarbeit mit den Berliner Stadtwerken schon in die zweite Runde: sie hatten beide bereits ein Bezirkspaket unterzeichnet und legen nun nach. Mit weiteren Bezirken befinden sich die Stadtwerke derzeit in Abstimmung.
Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf entstehen insgesamt 13 Anlagen mit einer Gesamtleistung von gut 1 MW, davon 900 kW auf Schulen und dazugehörigen Gebäuden und eine Anlage mit einer Leistung von 100 kW auf dem Dach des Jugendamtes.
In Treptow-Köpenick entstehen vier Anlagen mit einer Leistung von 446 kW, davon 133 kW auf dem Archenhold-Gymnasium, der Rest auf weiteren Dachflächen des Bezirks.
Elf Bezirke haben die Berliner Stadtwerke bisher mit solchen Solarpaketen über insgesamt 181 Anlagen mit zusammen 11,6 MW Leistung beauftragt. Die Berliner Stadtwerke installieren, warten und unterhalten die Anlagen. Das jeweilige Bezirksamt verpachtet die Dächer für einen symbolischen Betrag und pachtet im Gegenzug die Solaranlage. Darüber hinaus haben acht Berliner Bezirke mit den Stadtwerken Absichtserklärungen über den Bau von mehr als 430 Solaranlagen auf bezirkseigenen Gebäuden mit einem Gesamtumfang von fast 30 MW unterzeichnet.
https://www.bwb.de/
(nach oben)
ELW/Wiesbaden: Erster E-Bagger im Rhein-Main-Gebiet bei ELW im Einsatz
Seit Dezember letzten Jahres setzen wir einen elektrisch betriebener Mobilbagger auf der Deponie im Altpapier-Umschlag ein. Angetrieben wird der E-Bagger mit Strom, den wir auf dem Deponiegelände in Blockheizkraftwerken und mit Hilfe von Photovoltaikanlagen selbst erzeugen.
Ausgestattet ist der 24-Tonner der Firma Zeppelin mit einem 90 KW Elektromotor und einem 800 l Sortiergreifer. Die Stromversorgung läuft über einen stationären Anschluss mit einem 45 m langen Schleppkabel.
Im Rhein-Main Gebiet sind die ELW der einzige Betrieb, der einen Elektrobagger betreibt. In der Umschlaghalle werden pro Woche 500 bis 700 Tonnen Altpapier auf Lastwagen verladen. „Für den Halleneinsatz ist der E-Bagger ideal, er lärmt nicht und bläst keine Abgase in die Halle, es ist ein anderes Arbeiten“, sagt Christian Orth, Sachgebietsleiter Deponiebetrieb bei den ELW.
Durch den elektrischen Antrieb senkt sich nicht nur der Wartungs-und Reparaturaufwand, auch der Verbrauch von circa 350 bis 400 Liter Dieselkraftstoff pro Monat fällt komplett weg und die CO2- und Lärmemissionen werden deutlich reduziert. Auch die Gefahr von Funkenflug ist deutlich reduziert und vereinfacht den Umgang mit Material, dass sich entzünden kann.
Darüber hinaus setzen wir seit 2019 zahlreiche weitere E-Fahrzeuge der unterschiedlichsten Ausführungen ein und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Derzeit sind bei den ELW im Bereich unter 3,5 t sieben Plug-in-Hybridmodelle und 13 rein elektrisch angetriebene Pkw und Transporter fest im Einsatz. Des Weiteren eine Kleinkehrmaschine, eine Kompaktkehrmaschine und zwei Pritschenwagen. Ein bestellter Wasserstoffmüllwagen wird demnächst geliefert.
https://www.elw.de/aktuelle-meldungen/erster-e-bagger-im-rhein-main-gebiet-bei-elw-im-einsatz
(nach oben)
Ruhrverband: beseitigt Abwasser in Balve
Zusätzlich zur Behandlung des Abwassers ist der Verband nun auch für die Ableitung in der NRW-Kleinstadt zuständig
Die Stadt Balve hat ihre Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband übertragen. Die Neuregelung ist zum 1. Januar in Kraft getreten. Der Ruhrverband ist damit seit Jahresbeginn zusätzlich zur Behandlung des Abwassers auch für die ordnungsgemäße Ableitung des Abwassers zuständig….mehr:
https://www.zfk.de/wasser-abwasser/abwasser/ruhrverband-beseitigt-abwasser-in-balve
(nach oben)
OOWV: Nachts hören sie die Pumpen pfeifen
Einfallsreich gegen den Verschleiß
Großheide. Bis zur Brust steht Keno Schmidt im Schacht. In der Hand hält der Anlagenkoordinator der Kläranlage des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) in Großheide eine defekte Kompaktsteuerung für das Unterdruck-Abwassersystem. Dass er knietief im Schmutzwasser steht und das Bauteil auswechseln muss, ist kein Einzelfall. Immer wieder verstopfen die Leitungen, da Dinge in der Toilette landen, die nicht hineingehören. Von Knochen über Hygieneartikel bis hin zu Kinderspielzeug war bereits alles Mögliche der Grund für eine Verstopfung der Unterdruck-Anlage.
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2023/februar/23/artikel/nachts-hoeren-sie-die-pumpen-pfeifen
(nach oben)
Hamburg /Abwasser: Wichtige Ressource und Informationsquelle für Pandemiebekämpfung
Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat heute zusammen mit der Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Dr. Antje Draheim, die Hamburger Kläranlage besucht. Sie informierten sich dabei über das hier durchgeführte SARS-CoV-2 Abwassermonitoring und den Pandemieradar sowie über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Abwasserwirtschaft.
https://www.hamburgwasser.de/presse
(nach oben)
Erftverband und Kooperationspartner informieren rund ums Thema Wasser
Seit 1992 rufen die Vereinten Nationen in jedem Jahr zum Weltwassertag auf. Ziel ist es, auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für die Menschheit aufmerksam zu machen. Dies nimmt der Erftverband als Anlass interessierte Bürger*innen am 22. März, dem internationalen Tag des Wassers, mit einem Wasserdorf in der Bergheimer Innenstadt rund ums Thema Wasser zu informieren. Der Weltwassertag am 22. März 2023 steht unter dem Motto „Accelerating Change“ („Gemeinsam schneller zum Ziel“).
„Zwischen MEDIO.RHEIN.ERFT und Extrablatt wird ein kleines Wasserdorf entstehen“, kündigt Ronja Thiemann, Pressereferentin des Erftverbandes, an. „Mit einem großen Erftverbands-Team und tollen Kooperationspartnern möchten wir passend zum diesjährigen Motto gemeinsam für das Thema Wasser begeistern und zugleich sensibilisieren. Viele Menschen wissen gar nicht, wo das Wasser herkommt, wenn sie den Hahn aufdrehen; wo das Wasser hinfließt, wenn sie die Toilettenspülung betätigen oder sich die Hände waschen. Geschweige denn, wie Wasser wieder sauber wird. Das möchten wir ändern und gleichzeitig zeigen, wie wertvoll die Ressource Wasser und wie vielfältig und spannend Wasserwissen ist!“, ergänzt sie. „Wir freuen uns viele kleine und große Besucher*innen zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Hubert-Rheinfeld-Platz zu begrüßen. Für die Kleinen und alle Junggebliebenen haben wir uns auch ein schönes Rätsel und tolle Gewinne ausgedacht.“
Die zahlreichen Teams des Erftverbandes stehen für Fragen und Antworten zu den Themen Grundwasser, Kanalbetrieb, Abwasserreinigung, Renaturierung, Hochwasserschutzkooperation und Gewässerunterhaltung parat. In einer Mini-Kläranlage kann beispielsweise unter einem Mikroskop beobachtet werden, wie Wasser wieder sauber wird. Beim Team Kanalbetrieb können mit Schachtkamera und Nebelmaschine Rohre inspiziert werden. Am Traktor gibt es alles Wissenswertes rund um die Gewässerunterhaltung und am Stand des Verbandes gibt es Informationen zu Renaturierungen, Ausbildungsberufen, Hochwasserschutzkooperation und vielem mehr.
Frei nach dem Motto des diesjährigen Weltwassertages „Gemeinsam schneller zum Ziel“, wird der Erftverband den Tag zusammen mit weiteren Ausstellenden gestalten. Dabei sind: Das Naturparkzentrum Gymnicher Mühle mit Erftmuseum und Wassererlebnispark, der örtliche Trinkwasserversorger Westnetz/Westenergie/E.ON, die Stadtwerke Bergheim als Betreiber des Bergheimer Kanalnetzes, das Infomobil des HochwasserKompetenzCentrum (HKC) mit Infos über Hochwasserschutz am eigenen Objekt und die Stadtbibliothek Bergheim, die Bücher rund ums Thema Wasser ausstellt.
Kurzinfos zu den Ausstellenden
Erftverband
Als öffentlich-rechtlicher Wasserverband im Rheinischen Revier setzt der Erftverband sich für den Lebensraum Erft und für eine ganzheitliche Wasserwirtschaft ein. Mit mehr als 150 Jahren Erfahrung schafft er die Basis für artenreiche Flusslandschaften und reinigt das Abwasser für 1,2 Millionen Menschen. Mit rund 600 Wasserbegeisterten plant, baut und betreibt der Erftverband Grundwassermessstellen, Kläranlagen, Regenüberlauf- und Hochwasserrückhaltebecken. Darüber hinaus unterhält und renaturiert er die Fließgewässer im Einzugsgebiet der Erft.
https://www.erftverband.de/
Westnetz GmbH/Westenergie AG/E.ON Energie Deutschland GmbH
Westnetz ist der Strom- und Gasverteilnetzbetreiber im Westen Deutschlands und ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Energieunternehmens Westenergie AG. Sie betreiben Netze unterschiedlicher Besitzer. Das Netz erstreckt sich vom Emsland bis in den Hunsrück, von der niederländischen Grenze bis ins Weserbergland. Der Einkauf der Westnetz ist Teil des konzernweiten E.ON-Beschaffungsnetzwerkes. Als E.ON sind sie außerdem für Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Kerpen, Rheurdt und Wettringen der Wasserlieferant!
https://www.westnetz.de/
https://www.eon.de/de/pk/trinkwasser.html
HochwasserschutzKompetenzCentrum e. V. (HKC)
Das HochwasserKompetenzCentrum (HKC) ist ein eingetragener Verein, der Starkregen- und Hochwasserbetroffene, Politik, Wissenschaft und die unter-schiedlichsten Hochwasserschutzakteure zu einem einzigartigen Netzwerk zusammenführt. Am Infomobil können sich alle Bürger*innen nicht nur Expertentipps zum Umgang mit Hochwasser einholen, sondern auch informieren, was präventiv getan werden kann, um sein Grundstück zu schützen. Das Infomobil hält Anschauungsmaterial zum allgemeinen Hochwasserschutz und weitere Informationen bereit. Die Beratung durch ausgewiesene Expert*innen umfasst auch Tipps für den hochwassersicheren Objektschutz von Wohn- und Geschäftshäusern. Neben Empfehlungen für bauliche Maßnahmen an Gebäuden werden auch Hinweise für die Verhaltensvorsorge ausgesprochen.
https://hkc-online.de/
Stadtwerke Bergheim
Die Stadtwerke Bergheim sind unter anderem Betreiber des 330 km langen Bergheimer Kanalnetzes. Dazu gehören z. B. die Reinigung, Inspektion und Wartung der Kanäle. Zum Serviceangebot gehören auch die Reinigung und Überprüfung privater Hausanschlüsse. Außerdem kümmern sie sich um die Abfallentsorgung und auf über 250 Kilometern Gemeindestraßen um den Tiefbau und die Straßenbeleuchtung.
https://swbm.de/
(nach oben)
Emschergenossenschaft: Begrünte Fassade an der Schalker Meile verbessert das Stadtklima
Bepflanzung ist ein Baustein der Klimaanpassungsstrategie. NRW-Umweltministerium und Emschergenossenschaft fördern die Maßnahme
Gelsenkirchen. Sie sieht schön aus und wirkt außerdem wie eine natürliche Klimaanlage: Die neue Fassadenbegrünung am Haus Kurt-Schumacher-Straße 111. Als Teil der Zukunftsinitiative Klima.Werk begrüßt die Stadt Gelsenkirchen die vertikale Bepflanzung. Viele solcher Maßnahmen helfen dabei, die Quartiere gegen die Folgen des Klimawandels wie Hitzebelastung oder Starkregen zu wappnen. Land und Emschergenossenschaft haben das Projekt mit rund 116.000 Euro gefördert, die Stiftung Schalker Markt hat es angestoßen.
Wo vorher eine kahle Hauswand war, schmückt seit Kurzem ein grüner Teppich mit 2377 einzelnen Pflanzen die Fassade des Wohnhauses an der Kurt-Schumacher-Straße. Das Grün ist aber nicht nur ein ästhetischer Blickfang, es hat auch einen ganz konkreten Nutzen für das Mikroklima vor Ort: Die rund 90 Quadratmeter große vertikale Vegetation sorgt über die Verdunstung ihrer Blätter für eine Kühlung der Umgebung und bindet Feinstaub. An einer der am stärksten befahrenen Straßen in Gelsenkirchen ist das ein positiver Effekt mit Vorbildcharakter.
Versiegelte Flächen speichern Hitze
Städte brauchen mehr Grün, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Denn Wetterextreme mit Starkregen-Ereignissen, Dürrephasen und Hitzesommern nehmen auch in unseren Breitengraden zu. Schon heute sind die Jahresdurchschnittstemperaturen in Nordrhein-Westfalen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen um 1,6 Grad gestiegen. Wo viel Asphalt und Beton ist, wird es richtig heiß, weil die versiegelten Flächen die Hitze des Tages speichern. Im Hochsommer heizen sich Innenstädte schon jetzt um bis zu zehn Grad mehr auf als weniger dicht bebaute Quartiere.
Nachhaltige Entwicklung des Stadtteils
Die Schalker Meile als eine der Hauptverkehrsadern in der Stadt Gelsenkirchen gehört zu einem solcherart belasteten Raum mit ungünstigen bioklimatischen Verhältnissen (hoher Versiegelungsgrad, geringer Grünflächenanteil, Lärm- und Staub). Eine Fassadenbegrünung wie die an der Immobilie mildert diese Belastungen und zeigt an prominenter Stelle, wie es gehen kann. Die Stiftung Schalker Markt, die sich eine nachhaltige, städtebauliche Entwicklung des Stadtteils Schalke zum Ziel gesetzt hat, hat das Projekt „Fassadenbegrünung“ initiiert, vorangetrieben und die Eigentümergemeinschaft des Hauses unterstützt, ebenso wie die Stadt Gelsenkirchen. Der direkt benachbarte Quartiersgarten der Stiftung und anderer Partner wie den Gelsenkirchener Werkstätten zahlt ebenso wie die Fassadenbegrünung auf die Verbesserung des Klimas vor Ort ein.
Wichtiger Baustein für Lebensqualität
„Zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit gehört die Entwicklung städtischer Quartiere mit Blick auf die Anforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung“, sagte der Gelsenkirchener Stadtbaurat Christoph Heidenreich bei der Vorstellung der Fassadenbegrünung. „Maßnahmen wie diese sind ein kleiner, aber wichtiger Baustein, um die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt zu sichern.“ Auch deshalb engagiert sich die Stadt Gelsenkirchen in der Zukunftsinitiative Klima.Werk.
Klimarobuster Umbau zur Schwammstadt
Diese hat sich zum Ziel gesetzt, die Städte im Ruhrgebiet klimarobust umzubauen – nach dem städtebaulichen Konzept der Schwammstadt. „Mit Dach- und Fassadenbegrünungen, Abkopplung von der Kanalisation oder Flächenentsiegelung müssen wir dafür sorgen, dass Regenwasser lokal aufgenommen und gespeichert wird, um vor Ort positiv fürs Mikroklima zu wirken“, erläuterte Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender von Emschergenossenschaft und Lippeverband, beim Pressetermin. „Je mehr Speicherkapazitäten und Ablaufflächen es für Niederschlag gibt, desto geringer ist auch das Gefährdungspotenzial von Starkregen. Je mehr Grün und damit Verdunstungsflächen es gibt, desto besser funktionieren Kühlung und Frischluftzufuhr“, so Uli Paetzel weiter.
Finanziert wurde die Fassadenbegrünung an der Kurt-Schumacher-Straße aus dem Fördertopf des Ruhrkonferenz-Projektes „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ des Landes Nordrhein-Westfalen und von der Emschergenossenschaft (rund 116.000 Euro Gesamtkosten, rund 80 Prozent hat das Land übernommen).
Stauden, Gräser und Kräuter
Die Fassade der Immobilie ist nun auf einer Fläche von rund 90 Quadratmetern begrünt. Dabei handelt es sich um eine wandgebundene Fassadenbegrünung, die in diesem Fall folgendermaßen konstruiert ist: Die Kopfseite des Gebäudes ist in zwei Streifen vom Boden bis zum Dach mit gabionenartigen Elementen begrünt. Zwischen diesen Streifen wurden Verbindungen aus Rankgittern gelegt, so können Kletterpflanzen aus der Begrünung in die Rankgitter hineinwachsen. Gepflanzt wurden Stauden, Kleingehölze, Gräser, Kräuter oder Kletterpflanzen. Zur Bewässerung der Pflanzen wird aufgefangenes Regenwasser genutzt, so dass der Abfluss in die Kanalisation verringert wird. Nun kann die Begrünung ihre positive Wirkung entfalten – auch für die Biodiversität an dieser Stelle. Denn Insekten finden hier ebenfalls Nahrung.
Die Emschergenossenschaft
Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Sie wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet und kümmert sich seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie um den Hochwasserschutz.
Die Zukunftsinitiative Klima.Werk
In der Zukunftsinitiative Klima.Werk arbeiten Emschergenossenschaft und Emscher-Kommunen zusammen an einer wasserbewussten Stadt- und Raumentwicklung, um die Folgen des Klimawandels abzumildern und die Lebensqualität in den Quartieren zu steigern. Der blau-grüne Umbau startete 2005 mit der Zukunftsvereinbarung Regenwasser (ZVR) und entwickelte sich 2014 zur Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ weiter, jetzt Zukunftsinitiative Klima.Werk. Unter dem Dach des Klima.Werks wird das Ruhrkonferenz-Projekt „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ des Landes Nordrhein-Westfalen umgesetzt, an dem sich seit 2020 alle Wasserverbände der Region beteiligen. Die Förderkulisse des Projekts umfasst das Gebiet des Regionalverbandes Ruhr (53 Städte und Gemeinden). In den klimafesten Wandel sollen bis 2030 rund 250 Millionen Euro investiert und in ausgewiesenen Gebieten 25 Prozent der befestigten Flächen abgekoppelt und die Verdunstungsrate um 10 Prozentpunkte gesteigert werden. Die Serviceorganisation der Zukunftsinitiative bei der Emschergenossenschaft setzt mit den Städten die Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung um. Weitere Informationen (auch zu Förderung von Projekten) auf www.klima-werk.de
https://www.eglv.de/medien/begruente-fassade-an-der-schalker-meile-verbessert-das-stadtklima-2/
(nach oben)
29 Millionen Euro für Gasspeicher und Industriesammler
Das Dresdner Abwassersystem ist in den vergangenen Jahren noch leistungsfähiger und auch umweltfreundlicher geworden. Dafür wurden allein in diesem Jahr 21 Millionen Euro investiert, erklärt der Technische Geschäftsführer Ralf Strothteicher. Davon flossen rund 13 Millionen Euro in die Kanalsanierung, so in Gruna und Seidnitz in das Gebiet zwischen der Winterbergstraße sowie der Bodenbacher Straße und der Gasanstaltstraße und der Winterbergstraße. Zudem konnten im Klärwerk moderne Abluftbehandlungsanlagen an der Klärschlammverladung sowie in der Schlammbehandlung in Betrieb genommen werden, verweist Strothteicher auf ein weiteres Beispiel. „Damit ist dieses Problem gelöst. Bisher gab es keine weiteren Beschwerden von Anwohnern.“
Das Großprojekt: Besserer Anschluss für Mikrochipfabriken
2023 wird die Stadtentwässerung mit rund 29 Millionen Euro deutlich mehr als in diesem Jahr investieren. Mit etwa 22 Millionen Euro fließt der größte Teil ins Kanalnetz. Das ist auch dringend nötig, wie am größten Projekt deutlich wird. Denn die Halbleiter-Industrie wächst rasant. Allein die Werke von Globalfoundries, Infineon, Bosch und X-Fab leiten schon jetzt mit ihren knapp 8,7 Millionen Kubikmetern 93 Prozent der Dresdner Industrie-Abwässer ein. Jetzt will Infineon noch seinen Dresdner Standort kräftig ausbauen. An der Südostecke des Werks an der Königsbrücker Straße ist ein Neubau für rund 1.000 zusätzliche Jobs geplant, der 2026 fertig werden soll.
Damit wäre das vorhandene Kanalnetz überlastet. „Deshalb planen wir den Industriesammler Nord“, erklärt Strothteicher. „Das Projekt hat bei uns höchste Priorität. Die Planung ist weit fortgeschritten.“ Der Hauptkanal für die Abwässer der Mikroelektronik-Betriebe soll rund zehn Kilometer lang werden. Mit dem insgesamt rund 47 Millionen Euro teuren Großprojekt sollen das rechtselbische Kanalnetz entlastet und die Möglichkeiten für die weitere industrielle Entwicklung geschaffen werden. Künftig wird das Abwasser direkt von den Gewerbegebieten zur Kläranlage geleitet.
Ab dem Frühjahr werden die Bauleistungen europaweit ausgeschrieben. Im dritten Quartal dieses Jahres soll der Bau beginnen, der spätestens 2027 abgeschlossen wird.
Die Kanalsanierung: Rund 100 Projekte 2023
Die Stadtentwässerung hat eine langfristige Strategie für die Sanierung des rund 1.800 Kilometer langen Dresdner Kanalnetzes. „in diesem Jahr haben wir rund 100 einzelne Baumaßnahmen geplant“, kündigt der Geschäftsführer an. Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Neuländer Straße in Trachau werden Kanäle für gemischtes Ab- und Regenwasser erneuert. Die bis zu 40 Zentimeter starken Rohre werden auf einer Länge von 750 Metern eingebaut.
Zudem sollen Mischwasserkanäle in Löbtau auf der Frankenbergstraße (500 Meter) sowie auf der Wernerstraße (400 Meter) saniert werden.
Die Energieerzeugung: Neuer Gasspeicher für Blockheizkraftwerke
Hoch empor ragen seit zehn Jahren die Faultürme im Kaditzer Klärwerk. Aus dem dort entstehenden Klärgas wird in den benachbarten drei Blockheizkraftwerken (BHKW) umweltfreundlich Strom und Wärme gewonnen. Jährlich entstehen in den Faultürmen über sieben Millionen Kubikmeter Klärgas. Stündlich sind es etwa 1.000 Kubikmeter, erklärt Strothteicher.
Da die Faultürme immer besser arbeiten und mehr Biogas erzeugen, soll bis 2024 ein zweiter 5.000 Kubikmeter fassender Gasspeicher errichtet werden. Das Klärgas in den Faultürmen wird gleichmäßig erzeugt. Ein weiterer Gasometer ist nötig, damit auch in Spitzenzeiten immer genügend Gas für die BHKW’s zur Verfügung steht. Wird hingegen nicht viel Strom benötigt oder müssen die Kraftwerke für Wartungsarbeiten abgeschaltet werden, ist genügend Speicherkapazität da. „Wir wollen verhindern, dass Klärgas abgefackelt werden muss“, erläutert Strothteicher. Denn es soll effizient zur Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt werden.
Die Investition von rund 2,4 Millionen Euro für den neuen Speicher soll sich durch die Energieerzeugung bereits nach wenigen Jahren amortisieren. Schon jetzt werden durch die Blockheizkraftwerke und andere Anlagen jährlich rund 18 Millionen Kilowattstunden 85 Prozent der Energie fürs Klärwerk Kaditz selbst erzeugt.
Die Optimierung: Neue Rührwerke für Belebungsbecken
Kräftig investiert die Stadtentwässerung, um die Kläranlage zu optimieren. Dafür waren zwischen 2015 und 2018 auch zwei neue Belebungsbecken der biologischen Reinigungsstufe für rund 25 Millionen Euro gebaut worden. Dort leisten Mikroorganismen die Hauptarbeit bei der Abwasserreinigung. Der Ammoniumstickstoff wird dabei in Nitrat umgewandelt.
Das geschieht auch in den sechs 18 Jahre alten Belebungsbecken, die rund 96.000 Kubikmeter fassen. Durch die Becken strömt das Abwasser 20 Stunden lang. Dafür sorgen 24 Rührwerke. Sie werden jetzt durch kleinere, energiesparende Rührwerke ersetzt, die den gleichen Effekt haben.
Die Sicherheit: Neue Entlüftung für Bauwerke am Kaditzer Zulauf
Bei den Investitionen geht es aber nicht nur darum, das Klärwerk effektiv, sondern auch sicher zu betreiben. Deshalb werden ab kommendem Jahr bis 2026 rund 3,2 Millionen für neue Lüftungsanlagen in den Gebäuden am Einlaufbereich der Kläranlage investiert. Dazu gehören die Gebäude mit den Grob- und Feinrechen, dem Sandfang und dem Hauptpumpwerk. Die rund 20 Jahre alten Anlagen werden ersetzt, um Gesundheitsgefahren für Beschäftigte sowie Explosionsgefahren durch entstehende Gase auszuschließen.
Insgesamt rund vier Millionen Euro investiert die Stadtentwässerung im kommenden Jahr im Klärwerk, weitere drei Millionen für weitere Projekte. Dazu zählt ein neues Saug- und Spülfahrzeug für die Kanalreinigung.
https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/journal-1/detail/29-millionen-euro-fuer-gasspeicher-und-industriesammler/
(nach oben)
Dresden: Ruhe an der Semperoper
Straff gespannt sind die Stahlketten, an denen die riesige Stahlbetonkonstruktion am Kranarm hängt. Eine Viertelstunde zuvor ist Brummifahrer Jörg Oswald mit seinem Schwertransport aus dem Betonwerk Bautzen angerollt. Jetzt senkt er den neun Tonnen schweren Koloss mit seinem mobilen Steuerteil Zentimeter für Zentimeter ab. Währenddessen dirigiert Polier Roman Roitsch von der Coswiger Baufirma Lauber seine Männer, die mit Fingerspitzengefühl die l-förmige Konstruktion hinabbugsieren. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Flächen-Abdeckung über einem unterirdischen Abwasserbauwerk, erklärt Bauleiter Daniel Kalweit von der Stadtentwässerung.
Mit solchen Abdeckungen hat das Unternehmen ein Problem. Sie sind in die Jahre gekommen und klappern, wenn Autos darüber fahren. Genauso war es bisher auch an der Straße „Am Zwingerteich“, die genau in der großen Kurve zwischen Landtag und Semperoper abzweigt.
Deshalb hat das Unternehmen ein Programm gestartet, um solche Abdeckungen zu erneuern oder instand zu setzen. Gehandelt wurde bereits auf der Altstädter Zufahrt der Augustusbrücke. Dort wurde im Zuge der Brückensanierung per Schwerlastkran eine tonnenschwere neue Abdeckplatte eingehoben. Neue Flächen-Abdeckungen über Abwasserbauwerken gibt es jetzt auch am Altstädter Anschluss der Carolabrücke sowie an der Micktener Böcklinstraße am Beginn der Flutrinne, wo die Arbeiten im November abgeschlossen werden konnten.
Da beim jetzigen Bauprojekt eine Vollsperrung nötig ist, musste erst das Ende des Striezelmarktes abgewartet werden. Denn bis Weihnachten parkten viele Busse mit Besuchern am Zwingerteich. Unter der Straße verläuft ein 1867 fertiggestellter bis zu zwei Meter hoher Sandsteinkanal, durch den früher das Abwasser in die Elbe floss. Um die Jahrhundertwende wurde davor der Altstädter Abfangkanal gebaut, der in Richtung des 1910 übergebenen Klärwerks Kaditz verläuft.
2004 hatte die Stadtentwässerung hinter dem Anschluss an den Altstädter Abfangkanal ein unterirdisches Bauwerk mit einem großen Absperrschieber errichtet, das bei Starkregen Abwasser eine zeitlang zurückhalten kann, damit der anschließende Hauptkanal nicht überlastet wird, erklärt Bauleiter Kalweit. „Durch die 19 Jahre alten Abdeckungen gab es aber Unfallgefahr.“ Denn die einzelnen Gussplatten klapperten, wenn Fahrzeuge darüber rollten, und hoben sich um mehrere Zentimeter. Mit der massiven, über fünf Meter langen Stahlbetonkonstruktion mit Edelstahl-Beton-Abdeckungen kann das jetzt nicht mehr passieren. „Das ist eine Konstruktion für die Ewigkeit, bei der es nie wieder solche Probleme geben wird“, ist Bauleiter Kalweit sicher.
Für diese neue Lösung investiert die Stadtentwässerung rund 70.000 Euro. Geht alles nach Plan, kann die Sperrung der Straße am 8. Februar aufgehoben werden. Für dieses Jahr sind weitere Einbauten neuer Flächen-Abdeckungen geplant, so an der Ecke Salzburger/Troppauer Straße, am Käthe-Kollwitz-Ufer neben dem Hochwasser-Pumpwerk an der Waldschlößchenbrücke und auf der Kreuzung Pirnaer Landstraße/Leubener Straße.
https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/journal-1/detail/ruhe-an-der-semperoper/
(nach oben)
Berlin: Wasserkreislauf
Das Berliner Trinkwasser wird aus den Grundwasserreserven Berlins gewonnen. Was passiert auf dem Weg vom Grundwasser bis in den Haushalt und von dort bis ins Klärwerk?
Der Weg des Wassers führt von der Trinkwassergewinnung bis zur Abwasserbehandlung. In Berlin wird das Trinkwasser aus dem Grundwasser gewonnen, in Wasserwerken aufbereitet und über das Rohrnetz an Industrie und Haushalte verteilt. Nach Gebrauch wird es als Abwasser über die Kanalisation zu Pumpwerken und weiter in die Klärwerke geleitet, in denen es verschiedene Reinigungsstufen durchläuft, um schließlich in Flüsse geleitet zu werden. Ein Teil dieses Wassers versickert, durchläuft den natürlichen Reinigungsprozess und gelangt zusammen mit dem Niederschlagswasser in das Grundwasser.
https://www.bwb.de/de/wasserkreislauf.php
(nach oben)
Berlin: Unsere Zukunftsstrategie 2030
Starkregen sowie Trockenheit als akute Ausprägungen des Klimawandels, die wachsende Stadt, Digitalisierung in nahezu allen Bereichen des Lebens und wachsende gesellschaftliche Anforderungen an uns – die vergangenen Jahre und insbesondere auch das Jahr 2020 haben uns deutlich vor Augen geführt, dass die Welt von rasanten Veränderungen geprägt ist. Dass diese Entwicklungen auch eine Vielzahl von Herausforderungen für die Wasser- und Energiewirtschaft und damit auch für unsere Zukunft mit sich bringen, ist für jeden spürbar geworden.
Unsere Antwort ist die Zukunftsstrategie 2030 – Ressourcen fürs Leben
Wasser, Abwasser und Energie für Berlin – das ist unser Auftrag. Diesen heute und in Zukunft, unter sich verändernden Bedingungen und mit Blick auf künftige Generationen erfolgreich erfüllen zu können, ist unser erklärtes Ziel. Unserer Vision eines nachhaltigen und klimaresilienten Berlins folgend, ist die Zukunftsstrategie Quelle für Inspiration und Motivation.
Unsere Werte
Die Strategie fußt auf den Werten, die von Beschäftigten und Führungskräften als Fundament unseres Handelns und gleichsam als Kompass auf unserem Weg in die Zukunft formuliert worden sind….
https://www.bwb.de/de/zukunftsstrategie-2030.php
(nach oben)
AZV Südholstein: Regenrückhaltebecken Küsterkamp: Bauarbeiten zur Ertüchtigung gehen in die nächste Phase
Fällarbeiten schaffen Platz für Beckenerweiterung
Am 28. Januar beginnen am Regenrückhaltebecken Küsterkamp in Barmstedt größere Rodungsarbeiten im östlichen Bereich. Sie erfolgen im Rahmen der Arbeiten des AZV Südholstein, die das ursprüngliche Speichervolumen des Beckens wiederherstellen.
Wie berichtet haben über die Jahre Ablagerungen und Verlandungsprozesse zu einer erheblichen Verkleinerung des Regenrückhaltebeckens geführt. Die wichtige Funktion, Regenwasser von rund zwei Dritteln der versiegelten Flächen in Barmstedt aufzunehmen, konnte dadurch nicht mehr erfüllt werden. Der Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV), der für die abwassertechnische Anlage zuständig ist, arbeitet daher in enger Zusammenarbeit mit den Wasser- und Naturschutzbehörden und der Stadt Barmstedt an der Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit.
Aktuell beginnt am 28. Januar die nächste Phase der Ertüchtigungsarbeiten im östlichen Bereich. Dabei werden auf einer Fläche von rund 3.880 m² Rodungsarbeiten durchgeführt. Das ist notwendig, um Platz für die nächsten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen zu schaffen. Beispielsweise folgen Instandsetzungsarbeiten und die Profilierung weiterer Polderflächen: Polder rings um das Becken geben zusätzlichen Schutz als „Pufferzone“. Wenn dem Becken bei einem Starkregen-Ereignis Überlastung droht, kann ein Teil des Wassers vorübergehend von den Poldern aufgenommen werden.
Um das ursprüngliche Speichervolumen des Regenrückhaltebeckens wiederherzustellen, wurde das Becken bereits in südliche Richtung erweitert. Der nördliche Bereich ist aus der abwassertechnischen Funktion herausgenommen und wird der Natur überlassen. Als Ersatz für alle notwendigen Rodungen hat der AZV Südholstein an anderer Stelle eine doppelt so große Ausgleichsaufforstung durchgeführt.
https://www.azv.sh/aktuelles/pressebereich/regenrueckhaltebecken-kuesterkamp-bauarbeiten-zur-ertuechtigung-gehen-in-die-naechste-phase
(nach oben)
Lippeverband renaturiert den Dattelner Mühlenbach und stärkt den Hochwasserschutz
Vorbereitende Maßnahmen starten im Februar
Datteln. Im Februar finden Rodungsarbeiten entlang des Dattelner Mühlenbaches zwischen Wiesenstraße und Castroper Straße statt. Die Rodungsarbeiten dienen als Vorbereitung für die anstehende Renaturierung des Dattelner Mühlenbaches durch den Lippeverband in diesem Bereich. Im Anschluss an die Rodungsarbeiten müssen eine Kampfmittelsondierung und weitere Bodenuntersuchungen durchgeführt werden, bevor im Sommer die Arbeiten zur Renaturierung beginnen können. Vorher wird der Lippeverband interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung einladen und dort die geplante Maßnahme vorstellen.
Im November wurde bereits zwischen Castroper Straße und Gertrudenstraße Rodungen durchgeführt. In diesem Bereich konnte der Lippeverband im Januar mit der ökologischen Verbesserung des Baches beginnen.
Fast 100 Jahre lang floss Abwasser durch den Dattelner Mühlenbach und Teile seiner Nebenläufe – bergbaubedingt. Damit ist seit September 2020 Schluss. Die Abwasserfreiheit war eine wichtige Voraussetzung, um jetzt den Bach wieder naturnah zu gestalten und der Natur am Bach wieder Raum zu geben. Gleichzeitig stärkt die ökologische Verbesserung den Hochwasserschutz am Dattelner Mühlenbach.
Der Lippeverband
Der Lippeverband ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Seine Aufgaben sind in erster Linie die Abwasserentsorgung und -reinigung, Hochwasserschutz durch Deiche und Pumpwerke und die Gewässerunterhaltung und -entwicklung. Dazu gehört auch die ökologische Verbesserung technisch ausgebauter Nebenläufe. Darüber hinaus kümmert sich der Lippeverband in enger Abstimmung mit dem Land NRW um die Renaturierung der Lippe. Dem Lippeverband gehören zurzeit 155 Kommunen und Unternehmen als Mitglieder an, die mit ihren Beiträgen die Verbandsaufgaben finanzieren. www.eglv.de
https://www.eglv.de/medien/lippeverband-renaturiert-den-dattelner-muehlenbach-und-staerkt-den-hochwasserschutz/
(nach oben)
OOWV: Kommunen können sich ab jetzt für den OOWV-Ferienpass bewerben
Ferienspaß mit Wasser
Nordwesten. Die #MissionWasser startet in eine neue Runde. Wieder beteiligt sich der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) an den Ferienpass-Aktionen während der Sommerferien. In der Zeit vom 11. bis 20. Juli 2023 bietet die OOWV-Abteilung Umweltbildung zwischen 10:00 bis 13:30 Uhr ein spannendes Ferienprogramm an jeweils einem Standort im Norden und Süden des Verbandsgebiets an. Städte und Gemeinden können jetzt ihr Interesse bekunden und an der Verlosung der freien Termine teilnehmen. Jeweils drei Kommunen haben pro Standort Chance darauf, dabei zu sein. Die Bewerbungsfrist endet am 10. März 2023.
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2023/februar/9/artikel/kommunen-koennen-sich-ab-jetzt-fuer-den-oowv-ferienpass-bewerben
(nach oben)
Dippoldiswalde: Abwasserleitung geplatzt – Dippoldiswalde kämpft mit dreckigem Wasser aus Kläranlage
Dippoldiswalde – Im Abwasserbetrieb der Stadt Dippoldiswalde hat es eine Havarie gegeben. Aus Zuläufen zur Kläranlage Seifersdorf trete Abwasser aus, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag mit.
Es komme zu Geruchsbelästigungen. In der Nähe befindet sich die Talsperre…mehr:
https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/abwasserleitung-geplatzt-dippoldiswalde-kaempft-mit-dreckigem-wasser-aus-einer-klaeranlage-2739906
(nach oben)
Mörfelden-Walldorf: Bald reineres Wasser im Hessischen Ried
Die Tuchfilteranlage, die jetzt in der Kläranlage von Mörfelden-Walldorf aufgestellt wurde, filtriert Spurenstoffe und sorgt für unbelastetes Wasser im Hessischen Ried.
Am Donnerstag hat die Kläranlage von Mörfelden-Walldorf eine Tuchfilter-Anlage erhalten. Die Tuchfiltration ist ein Kernelement…mehr:
https://www.fr.de/rhein-main/kreis-gross-gerau/moerfelden-walldorf-ort799239/bald-reineres-wasser-im-hessischen-ried-92072133.html?cmp=defrss
(nach oben)
Abwasserverband Bergstraße: Landesregierung fördert vierte Reinigungsstufe in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit rund 3,7 Millionen Euro
Der Abwasserverband Bergstraße (AVB) darf sich für die Erweiterung der Kläranlage in Weinheim über einen Landeszuschuss in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro freuen. Die Gesamtkosten für die sogenannte vierte Reinigungsstufe mit Pulveraktivkohle belaufen sich auf fast 31 Millionen Euro.
An der Kläranlage waren weiterführende Maßnahmen zur Phosphorelimination erforderlich. Eine Machbarkeitsstudie hatte ergeben, dass es sinnvoll ist, mit dem Bau der Pulveraktivkohlestufe Synergieeffekte zu gewinnen und zusätzlich auch Spurenstoffe zu entfernen, wodurch die Gewässer noch besser vor stofflichen Einträgen geschützt werden.
„Durch die Erweiterung mit der vierten Reinigungsstufe wird die Kläranlage in Weinheim auf den neuesten Stand der Technik gebracht“, sagte Umweltministerin Thekla Walker heute (07.12.) in Stuttgart. Das ist eine gute Nachricht für die Menschen dort, fügte Walker hinzu, „weil das Geld gut investiert ist, um aktiv die Gewässer zu schützen.“ Mit der hochmodernen Reinigungsstufe lassen sich Spurenstoffe wie Arzneimittel-, Röntgenkontrastmittel, Wasch- und Reinigungsrückstände sowie Hormone aus dem Abwasser weitgehend entfernen.
25 Kläranlagen sind bisher mit der vierten Reinigungsstufe ausgerüstet
Unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge, erläuterte Ministerin Walker, habe das Umweltministerium daher bereits vor einigen Jahren damit begonnen, den Ausbau von Kläranlagen mit innovativen Verfahren der sogenannten vierten Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination zu unterstützen.
Dabei konzentriere sich das Land auf die besonders empfindlichen Gewässer sowie die großen Kläranlagen und Belastungsschwerpunkte. „Auf dieser Grundlage sind in Baden-Württemberg inzwischen 25 Kläranlagen mit einer gezielten Reinigungsstufe zur Spurenstoffentfernung ausgestattet, weitere 27 mit dieser speziellen Technik befinden sich in Bau oder Planung.“ Mit dieser Vorgehensweise gehört Baden-Württemberg bundes- und europaweit zur Spitze.
Die Kläranlage in Weinheim
Der AVB betreibt in Weinheim eine Kläranlage mit einer Ausbaugröße von 200.000 Einwohnerwerte. Die Anlage verarbeitet das Abwasser der Verbandsmitglieder, also der großen Kreisstadt Weinheim und der Gemeinden Hemsbach, Hirschberg und Laudenbach sowie der in Hessen liegenden Gemeinden Viernheim, Birkenau und Gorxheimertal. Das gereinigte Abwasser wird über eine etwa 1,7 Kilometer lange Druckleitung in die Weschnitz eingeleitet.
In Weinheim kommt nach der Erweiterung das Ulmer Verfahren zur Anwendung. Dabei wird Pulveraktivkohle (PAK) zur gezielten Spurenstoffelimination nach der biologischen Reinigung dosiert. Dem Abwasser werden dazu im Kontaktbecken neben der PAK zusätzlich Fällmittel und Flockungsmittel zugesetzt, um eine Sedimentation der PAK zu ermöglichen.
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/presse-service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-foerdert-vierte-reinigungsstufe-in-weinheim-rhein-neckar-kreis-mit-rund-37-millionen-euro
(nach oben)
Waldshut-Tiengen: 6 Millionen Euro für erneuerte Kläranlage
Die Kläranlage in Waldshut ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Nach abgeschlossenen Prüfungen ist eine Sanierung nun günstiger als eine Abwasserüberleitung nach Albbruck.
Für sauberes Wasser sorgt die Kläranlage am Auweg in der Waldshuter Bleiche. Damit sie das auch weiterhin…mehr:
https://www.badische-zeitung.de/16-millionen-euro-fuer-erneuerte-klaeranlage–239220738.html
(nach oben)
Wurmsham: Rund 3000 Liter Öl in Auffangbecken von Kläranlage gefunden
In einem Becken einer Kläranlage im niederbayerischen Landkreis Landshut ist eine große Menge Öl festgestellt worden.
„Es handelte sich um rund 3000 Liter, die sich in einem Auffangbecken befanden“, teilte die Polizei …mehr:
https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/3000-liter-oel-auffangbecken-klaeranlage-gefunden-37789272
(nach oben)
Stadtentwässerung Dresden entwickelt und erprobt
Konzept für Krisen
Die Stadtentwässerung Dresden hat ein Konzept für Krisen entwickelt und einen Krisenstab aufgestellt. Dabei wurde mit einem Beratungsunternehmen aus Wien kooperiert, das auf solche Fälle spezialisiert ist. „Mit dabei war ein früherer Offizier, der sehr erfahren ist“, sagt Guido Kerklies, technischer Leiter der Stadtentwässerung. Der Krisenstab besteht aus rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Er wird von der Geschäftsführung nicht nur bei Hochwasser, Sturm oder Blackout, sondern auch bei anderen Krisensituationen – wie Cyberangriffen – einberufen“, erklärt Kerklies. Die Akteure sind dann rund um die Uhr im Einsatz. Im Krisenfall soll der Stab spätestens nach zwei Stunden handlungsfähig sein, um schnell Entscheidungen zu treffen und die nötigen Schritte einzuleiten. Die Aufgaben sind klar verteilt. Insgesamt sind fünf Stabsfunktionen ausgewiesen, abgekürzt mit „S“ bezeichnet (analog Stabsoffizieren bei der Bundeswehr). So beschafft der S 2 die Informationen zur Lage, sodass beispielsweise beim Sturm mit einem Blackout Gefahren oder Schäden beurteilt werden können. Jeweils ein S 3 ist für den Betrieb der Kläranlage und den Betrieb des Kanalnetzes zuständig. Sie leiten die nötigen Schritte ein. Der S 5 informiert die Presse und andere Medien, und der S 6 kümmert sich darum, dass trotz des Stromausfalls Kommunikationskanäle weiter funktionieren. Andere Fachleute halten währenddessen die Verbindung zu anderen Krisenstäben, vor allem zu dem des Brand- und Katastrophenschutzamtes, und erfüllen weitere Aufgaben. Vor Weihnachten 2022 hat der Krisenstab eine Woche lang den Ernstfall geprobt.
(nach oben)
OOWV-Kläranlage Twistringen: Ersatzpflanzungen wegen Kanalbau
Twistringen. Auf dem Gelände der Kläranlage des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) in Twistringen wird ein Teil des Abwasserkanals neu gebaut. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen am Montag, dem 9. Januar 2023.
„Durch die baulichen Veränderungen an der Kläranlage liegt der alte Kanal nicht mehr sinnvoll“, erläutert OOWV-Anlagenleiter Gerd Lehmkuhl. „Da er zudem mehrere Jahrzehnte alt ist und wir ihn partiell sowieso erneuern müssen, legen wir ihn bei der Gelegenheit ganz neu.“ Um die Arbeiten ausführen zu können, müssen einige Bäume auf der der Straße zugewandten Seite der Kläranlage weichen. Das wurde im Vorfeld mit der Stadt Twistringen abgestimmt. Begleitet wird die Maßnahme zudem von einem unabhängigen Baumsachverständigen. Ersatzpflanzungen sind nicht vorgeschrieben, ausgeführt werden sie trotzdem. „Wir haben uns früh dafür entschieden, die entnommenen acht Bäume durch 18 Neupflanzungen im vom Regenrückhaltebecken einsehbaren Teil der Kläranlage zu kompensieren“, sagt Gerd Lehmkuhl. Der Kanalbau ist ein Teil eines Maßnahmenbündels, das die Funktionsfähigkeit der OOWV-Kläranlage in Twistringen auch in den kommenden Jahren erhalten soll.
https://www.oowv.de/fileadmin/user_upload/oowv/content_pdf/presse/Pressemitteilungen/PM_2023/1-2023_PM_Ersatzpflanzungen_wegen_Kanalbau.pdf
(nach oben)
AZV Südholstein: Verbandsversammlung im Zeichen schwieriger Zeiten
Gestern fand im Klärwerk Hetlingen die Verbandsversammlung des Abwasser-Zweckverbands (AZV) Südholstein statt. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Beschluss des Wirtschaftsplans 2023 und die Entwicklung der Abwassergebühren. Die Zentrale Abwassergebühr wird ab dem kommenden Jahr auf 1,36 €/m³ steigen – Auswirkungen der Corona-Pandemie, Inflation und der russische Angriff auf die Ukraine machen die Anpassung notwendig.
Auch wenn die Pandemie langsam an Bedeutung zu verlieren scheint, sind ihre Folgeerscheinungen an vielen Stellen unverändert sichtbar. Das wurde auch bei den Ausführungen der Verbandsvorsteherin, Christine Mesek, anlässlich der Verbandsversammlung des Abwasser-Zweckverbands (AZV) Südholstein im Hetlinger Klärwerk deutlich. Der Verband ist – wie viele andere Unternehmen – weiterhin mit gestörten Lieferketten und einer eingeschränkten Verfügbarkeit von bestimmten Rohstoffen und Produkten konfrontiert. Das hat zu deutlichen Preissteigerungen bei diversen technischen Betriebsmitteln und Dienstleistungen geführt (z.B. Produkte zur Ausfällung von Phosphor aus dem Abwasser oder Transportleistungen).
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen erfordern Gebührenanpassung
„In den letzten zwölf Jahren konnten die Kosten für die Ableitung und die Reinigung von Abwasser relativ stabil gehalten oder sogar gesenkt werden, obwohl sich die Lebenshaltungskosten und andere Bereiche deutlich verteuerten“, bestätigt Christine Mesek, die auf der Verbandsversammlung einstimmig für eine weitere Amtszeit bis Ende 2029 wiedergewählt wurde. „Doch mit der Pandemie und aktuell auch aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine sind bekanntermaßen viele Kosten, insbesondere für Energie, massiv gestiegen. Um weiterhin unsere Aufgaben zuverlässig und in der vorgeschriebenen Qualität erfüllen zu können, ist leider eine Anpassung der Zentralen Abwassergebühr notwendig.“
Die Verbandsversammlung beschloss daher, die Gebühr von 1,15 €/m³ auf 1,36 €/m³ für das Jahr 2023 anzuheben. Dies gilt voraussichtlich auch für das Folgejahr 2024. Mit diesen Einnahmen kann der AZV seine zahlreichen Maßnahmen zur Bestandserhaltung und Sanierung der Abwasserinfrastruktur fortführen und notwendige Investitionen tätigen. Hier stehen beispielsweise die weitere Erhöhung der Energieeffizienz und der Eigenenergieproduktion im Fokus. Der Hetlinger Standort wird dank selbst produziertem Klärgas und Fotovoltaik bereits zu rund 90 Prozent mit regenerativer Energie versorgt, das soll noch weiter gesteigert werden.
Über 43 Millionen Euro Investitionen in Klärwerke und Kanalnetze
Die für 2023 geplanten Investitionen belaufen sich auf rund 43 Millionen Euro. 27, 7 Millionen sind für die Kanalnetze in der Aufgabenverantwortung des AZV eingeplant, 15,5 Millionen für die Klärwerke. Erstmalig umfasst der Wirtschaftsplan auch die Aufgaben des ehemaligen Glückstädter Zweckverbands SEG, der am 1.1.2022 in den AZV Südholstein integriert wurde. Die überwiegenden Investitionen bei den Klärwerken werden am Standort Hetlingen getätigt: Hier werden wichtige Projekte wie die Optimierung der mechanischen Abwasserreinigung, der Umbau und die Erneuerung der Klärschlammbehandlung und die Erneuerung des Prozessleitsystems fortgeführt.
Im Sammlernetz wird ein großes, bereits in der Umsetzung befindliches Projekt, die Rehabilitation des Pumpwerks II in Elmshorn, fortgesetzt sowie weitere Verbesserungen angestoßen; beispielsweise in Moorrege am Pumpwerk die Erneuerung der Druckrohrleitungsführung und in Horst die Erneuerung der Druckrohrleitung. Weiter gehören zu den erwähnenswerten Vorhaben in Glückstadt die Erneuerung von Schmutz- und Niederschlagswasserkanälen (Holländer Gang, Grüner Weg) sowie der Vollausbau der Stolpmünder Straße und auf Helgoland die Umlegung des Regenwasserkanals am Schwimmbad.
Neben diesen technischen Aufgaben kümmert sich der Verband intensiv um die kontinuierliche Optimierung und Weiterentwicklung seiner Prozesse und die Effizienz seiner Tätigkeiten und Dienstleistungen. Jüngst wurden die ersten Überprüfungsaudits für die ISO 9001:2015 (Qualität) und die ISO 14001:2015 (Umwelt) sowie die Erst-Zertifizierung nach ISO 45001:2018 Arbeitsschutz) bestanden. „Große Aufmerksamkeit genießen zudem der Ausbau unserer Digitalisierung und die Stärkung unserer Attraktivität als Arbeitgeber“, sagt Christine Mesek. „Unsere Aufgaben wachsen und wir agieren in einem herausfordernden Umfeld – dafür sind engagierte Auszubildende und qualifizierte Fachkräfte nötig, denen wir als Umweltunternehmen sichere, sinnstiftende und attraktive Arbeitsplätze bieten können.
https://www.azv.sh/aktuelles/pressebereich/azv-suedholstein-verbandsversammlung-im-zeichen-schwieriger-zeiten
(nach oben)
EnBW: Zum Jahreswechsel – neuer Abrechnungsmodus für Frisch- und Schmutzwasser
Die getrennte Abwicklung bringt finanzielle Vorteile – Zwischenabrechnung zum Jahresende.
Zum Jahreswechsel gibt es in der Landeshauptstadt Änderungen bei der Frisch- und Schmutzwasserabrechnung. Für die rund 100.000 betroffenen Kundinnen und Kunden mit eigenen Zählern heißt das, sie erhalten in Zukunft zwei getrennte Abrechnungen. Hintergrund ist eine Änderung des Bundes im Umsatzsteuergesetz, die Privatkunden mit zusätzlich 19 Prozent Umsatzsteuer auf die Schmutzwasserentgelte belasten würde. Aus diesem Grund wird in Zukunft die Abrechnung des Frischwasserverbrauchs von der Berechnung des anfallenden Schmutzwassers getrennt. Ab dem 1. Januar 2023 ersetzt eine öffentlich-rechtliche, umsatzsteuerfreie Schmutzwassergebühr das frühere Entgelt für Abwasser.
Die Umstellung führt allerdings zu einer Reihe von Veränderungen bei der Abrechnung. Bisher wurden in einer gemeinsamen Rechnung der EnBW neben dem Frischwasserentgelt der EnBW auch das Schmutzwasserentgelt der Landeshauptstadt erhoben. Durch die Umwandlung in eine Schmutzwassergebühr ist eine Trennung der Abrechnung in eine Rechnung für Frischwasserentgelt und in einen Gebührenbescheid für Schmutzwasser entsprechend der gesetzlichen Vorgaben erforderlich. Die Abrechnung übernimmt weiterhin die EnBW.
Konkret bedeutet das für die betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher:
Zum 31.12.2022 erfolgt für alle Verträge eine Zwischenabrechnung.
Ab Januar 2023 erhalten alle Kunden je eine Rechnung für das Frischwasser und einen Gebührenbescheid für das Schmutzwasser.
Kundinnen und Kunden mit Einzug per SEPA-Lastschrift müssen nur dann aktiv werden, wenn sie verschiedene Konten für die beiden Zahlungen nutzen möchten.
Kunden, die selbst überweisen, müssen die neuen Bankverbindungen und die unterschiedlichen Buchungszeichen beachten.
Der gewohnte Turnusabrechnungstermin ändert sich nicht.
Die Verbraucher erhalten im Januar ein Schreiben, in dem die Änderungen nochmals ausführlich erklärt werden.
Alle Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten im Januar ein Schreiben von der EnBW mit einer ausführlichen Erklärung der Änderungen.
EnBW und Stadt arbeiten derzeit intensiv an einer möglichst reibungslosen Umstellung. Die Mitarbeitenden der Stadtentwässerung Stuttgart sorgen 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr für die sichere Ableitung und umweltgerechte Reinigung des Abwassers der Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger. Als gemeinwohlorientierter Betrieb haben bezahlbare Gebühren, nachhaltige Sicherung der Infrastruktur und die Gewährleistung einer sauberen Umwelt Priorität.
(nach oben)
Staufener Bucht: Freiburger Behörde verlangt 46.500 Euro für eine wasserrechtliche Genehmigung
Das geklärte Abwasser von rund 130.000 Menschen wird in Breisach in den Rhein geleitet. Der Abwasserzweckverband Staufener Bucht hat dafür nun eine saftige Rechnung erhalten.
Niemand mag gerne Rechnungen. Was für Bürgerinnen und Bürger gilt, trifft auch auf den Abwasserzweckverband Staufener Bucht zu, vor…mehr:
https://www.badische-zeitung.de/freiburger-behoerde-verlangt-46-500-euro-fuer-eine-wasserrechtliche-genehmigung–235915005.html
(nach oben)
Ruhrverband: ist ab dem 1.1.2023 in Balve abwasserbeseitigungspflichtig
Für die Bürgerinnen und Bürger ergeben sich kaum Änderungen
Am 14. Dezember 2022 wurde die Vereinbarung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband im Balver Rathaus unterschrieben.
Die Stadt Balve hat ihre Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 52, Abs. 2 Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen auf den Ruhrverband übertragen. Nachdem auch die wasserwirtschaftliche Prüfung durch die Bezirksregierung vollzogen ist und die verbandsrechtliche Genehmigung durch das NRW-Umweltministerium vorliegt, tritt die Übertragung zum 1. Januar 2023 in Kraft. Die Ratsmitglieder des Stadtrates in Balve hatten in ihrer Sitzung am 2. November 2022 bereits einstimmig bei zwei Enthaltungen für die Übertragung auf den Ruhrverband votiert. Der Ruhrverband ist damit ab dem 1.Januar 2023 zusätzlich zur Behandlung des Abwassers auch für die ordnungsgemäße Ableitung des Abwassers zuständig. Mit der Übertragung der Aufgabe geht auch das wirtschaftliche Eigentum am Kanalnetz der Stadt Balve auf den Ruhrverband über. Dafür zahlt der Verband der Stadt einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 22,8 Millionen Euro.
Für die Bürgerinnen und Bürger in Balve wird sich nicht viel ändern. Frau Birgit Morgenroth, vom Regionalbereich Nord, ist die zentrale Ansprechpartnerin des Ruhrverbands für alle Belange rund um das Kanalnetz. Einmal pro Woche wird sie persönlich für Fragen und sonstige Anliegen, die das Kanalnetz oder Hausanschlüsse betreffen, vor Ort im Rathaus sein. Darüber hinaus ist die telefonische Erreichbarkeit in Notfällen auch nach Dienstschluss über die Rufnummer (0171/4717212) sichergestellt. Sämtliche Kontaktdaten werden auf der Internetseite der Stadt Balve veröffentlicht.
Die Gebührenhoheit und die Ausstellung der Gebührenbescheide verbleiben nach wie vor bei der Stadt. Fragen zum Gebührenbescheid werden daher weiterhin von der Stadt Balve beantwortet. Darüber hinaus verbleibt auch die Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzepts und damit die Planungshoheit bei der Stadt.
Dem Ruhrverband bietet sich durch die Kanalnetzoption die Chance, seine wasserwirtschaftlichen Kernaufgaben sinnvoll abzurunden. Er verfügt mit seiner mehr als 100-jährigen Unternehmensgeschichte über umfassende Erfahrungen in der Abwasserbeseitigung sowie über spezialisiertes Fachwissen in der gesamten Siedlungsentwässerung. Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb der Kanalisation und der damit eng verknüpften Niederschlagswasserbehandlungsanlagen und Kläranlagen aus einer Hand zu erledigen, bietet große Vorteile sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht. Vor diesem Hintergrund wird der Betrieb des rund 107 Kilometer langen Kanalnetzes und der sechs Pumpwerke im etwa 75 Quadratkilometer großen Stadtgebiet in die vorhandenen Betriebsabläufe beim Ruhrverband integriert und vom Regionalbereich Nord in Arnsberg operativ gesteuert. In Arnsberg steht ein schlagkräftiges Team zur Unterstützung bei Betriebsproblemen und zur Organisation und Abwicklung von Instandsetzungs- und Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Das Betriebspersonal ist auf der Kläranlage Balve stationiert.
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts darf der Ruhrverband keine Gewinne erzielen und unterliegt den gleichen steuerlichen Rahmenbedingungen wie die Kommunen. Der Ruhrverband steht für Gebühren-stabilität und nachhaltigen Substanzerhalt ebenso wie für eine hohe Qualität und Effizienz in der Aufgabenerledigung. Dies ist gerade in einer Zeit, in der auf die Betreiber von Abwasseranlagen durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen neue Anforderungen im Hinblick auf die Überwachung, Zustands-erfassung und bauliche Sanierung von Kanalisationen zukommen, von besonderer Bedeutung.
https://ruhrverband.de/presse/pressemitteilungen/detailansicht/news///ruhrverband-ist-ab-dem-112023-in-balve-abwasserbeseitigungspflichtig/
(nach oben)
Münchner Klärwerke: Neubau der Klärschlammverbrennungsanlage
Die beiden Münchner Klärwerke Gut Großlappen und Gut Marienhof reinigen das Abwasser aus den Haushalten von insgesamt 1,5 Millionen Einwohnern der Stadt, der 22 angeschlossenen Umlandgemeinden sowie den Gewerbe- und Industriebetrieben. Neben der Ableitung und Behandlung des Abwassers ist eine zentrale Aufgabe der Münchner Stadtentwässerung (MSE) auch die Verwertung und Beseitigung des anfallenden Klärschlamms – jährlich etwa 33.000 Tonnen Trockenrückstand (TR, bedeutet Anteil der Trockenmasse an der gesamten Schlammmasse nach Verdampfung des Wasseranteils). Angesichts dieser Größenordnung ist es sinnvoll, in München eine eigene Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) zu betreiben.
Die MSE betreibt seit 1998 eine eigene KVA am Klärwerk Gut Großlappen. In der Anlage werden jährlich rund 22.000 Tonnen TR Klärschlamm aus den beiden Klärwerken thermisch verwertet. Das entspricht rund zwei Drittel des Münchner Klärschlamms. Der Rest wird aufgrund fehlender Verbrennungskapazitäten zusammen mit Müll im Heizkraftwerk Nord (HKWN) verbrannt….mehr:
https://stadt.muenchen.de/infos/neubau-klaerschlammverbrennungsanlage.html
(nach oben)
Lippeverband erneuert Kanäle
Arbeiten am ersten Bauabschnitt beginnen im Januar
Hamm. Der Lippeverband wird ab Januar 2023 mit dem Neubau der 90 Jahre alten Kanäle in der Bahnhofstraße und der Heinrich-Reinköster-Straße beginnen. Geplant ist eine Bauzeit von rund sechs Monaten. Der Lippeverband bittet für etwaige Beeinträchtigungen um Verständnis.
Die Maßnahme in der Bahnhofstraße hat eine Länge von circa 150 Metern, startet auf Höhe der Bahnhofstraße 16a und endet am Willy-Brandt-Platz. Die Stolpersteine vor dem Café Heinrich wurden bereits vorab durch die Stadt Hamm ausgebaut und eingelagert. Nach Bauende werden sie an alter Stelle wiedereingesetzt.
Die Oberflächen einschließlich der Baumbeete werden nach Abschluss der Arbeiten wiederhergestellt, vier zusätzliche Bäume werden gepflanzt sowie eine neue Weihnachtsbaumhülse eingesetzt.Die Straßenbeleuchtung muss während der Bauarbeiten zum Teil abgebaut werden. Mit den Stadtwerken Hamm ist bereits eine temporäre Zwischenlösung geplant, sodass die Beleuchtung in allen Bauphasen sichergestellt ist.
Die Verkehrsführung für Rettungsfahrzeuge und Anlieferungsverkehr wird je nach Bauabschnitt über die Straße „Am Stadtbad/ Luisenstraße“ oder den „Willy-Brandt-Platz“ erfolgen. Hierfür werden die Absperrungen Willy-Brandt-Platz/ Bahnhofstraße zeitlich begrenzt entfernt.
Der Lippeverband
Der Lippeverband ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Seine Aufgaben sind in erster Linie die Abwasserentsorgung und -reinigung, Hochwasserschutz durch Deiche und Pumpwerke und die Gewässerunterhaltung und -entwicklung. Dazu gehört auch die ökologische Verbesserung technisch ausgebauter Nebenläufe. Darüber hinaus kümmert sich der Lippeverband in enger Abstimmung mit dem Land NRW um die Renaturierung der Lippe. Dem Lippeverband gehören zurzeit 155 Kommunen und Unternehmen als Mitglieder an, die mit ihren Beiträgen die Verbandsaufgaben finanzieren.
https://www.eglv.de/medien/lippeverband-erneuert-kanaele/
(nach oben)
StEB Köln: Vertreter aus Dnipro zu Gast
In der vergangenen Woche war erstmals eine Delegation aus dem ukrainischen Dnipro zu Gast in Köln – seit Ende Oktober besteht zwischen den beiden Städten eine Projektpartnerschaft.
Auch die StEB Köln empfingen Vertreter der Delegation zum Fachaustausch.
Dabei standen neben der Vorstellung der StEB Köln als Unternehmen der Hochwasserschutz in Theorie und Praxis sowie eine Führung über das Großklärwerk Köln-Stammheim auf dem Programm. Beim Aufbau der mobilen Hochwasserwände durch Mitarbeitende der StEB Köln packten Yurii Reskalenko (Chefingenieur “Dniprovodokanal”, links auf dem Aufbau-Foto), und Dmytro Volik, (Leiter der Hauptabteilung Architektur und Planung von Dnipro, rechts auf dem Aufbau-Foto), kurzerhand auch selbst mit an.
Während ihres Aufenthaltes in Köln besuchte die Delegation auch weitere Kölner Unternehmen, beispielsweise die RheinEnergie und die IHK.
https://www.steb-koeln.de/Aktuelles/Vetreter-aus-Dnipro-zu-Gast-bei-den-StEB-K%C3%B6ln.jsp?ref=/Aktuelles/Aktuelles.jsp
(nach oben)
Köln: Internationaler Austausch bei den StEB Köln
“The Role of Rain and Storm Water Management in Water Sensitive Urban Planning” – „Die Rolle von Regenwasser- und Starkregenmanagement in der wassersensiblen Stadtplanung“: Das war das Thema der internationalen Dialogveranstaltung, die vom 6. bis 8. Dezember bei den StEB Köln stattfand. Zusammen mit dem Projekt „Connective Cities“ hatten die StEB Köln kommunale Fachleute aus der ganzen Welt eingeladen, um insbesondere über innerstädtische Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel zu diskutieren.
Die rund 30 kommunalen Fachleute kamen aus Tansania, Kamerun, Gambia, Ruanda, Bangladesch, Jordanien, Brasilien, der Ukraine sowie aus Deutschland. Schwerpunkt der Agenda waren die Präsentation eigener Best-Practice-Beispiele sowie darauf aufbauende Diskussionsrunden. Die Dialogveranstaltung schaffte damit eine interkontinentale Plattform für gemeinsames Lernen zwischen kommunalen Praktiker*innen.
Konkrete Diskussionsthemen bzw. mögliche Ansatzpunkte in den Kommunen der Teilnehmer*innen waren beispielsweise der (vermehrte) Einsatz von Baumrigolen, Versickerungsmaßnahmen in finanzschwächeren Städten oder Stadtteilen und die Partizipation der Bevölkerung bei der Hochwasserprävention am Beispiels des Ahrtals.
Inwiefern die zahlreichen Ideen weiterverfolgt bzw. welche Ansatzpunkte aufgegriffen wurden, das wird in rund einem Jahr in einem digitalen Folgetermin eruiert.
„Connective Cities“ ist ein Kooperationsprojekt der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), des Deutschen Städtetags und von Engagement Global mit ihrer „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“.
https://www.steb-koeln.de/Aktuelles/Internationaler-Austausch-bei-den-StEB-K%C3%B6ln.jsp?ref=/Aktuelles/Aktuelles.jsp
(nach oben)
FULDA: Konsequenter Ausbau der erneuerbaren Energien, bei leicht verringertem Investitionsvolumen
(jo). Nach 21 Einsatzjahren wird beim Abwasserverband Fulda (AVF) ein altgedientes Spülfahrzeug ersetzt: Das rund 26 Tonnen schwere neue Spezialfahrzeug wird für die Reinigung von Kanälen benötigt. Mit einer Schlauchlänge von 250 m und einem Wasserdruck von bis zu 200 bar kann es Kanäle bis 300 cm Durchmesser reinigen. Der dabei anfallende Schlamm wird vom Fahrzeug aufgesaugt und durch eine spezielle Aufbereitungstechnik im Fahrzeug entwässert. Das Fahrzeug wird vom AVF, der für die Stadt Fulda sowie für die Gemeinden Künzell und Petersberg zuständig ist, täglich genutzt. Für das Bedienen des Fahrzeuges werden 2 Personen mit entsprechender Schulung benötigt. Insbesondere die digitale Steuerung sämtlicher Prozesse unterscheidet es von seinem Vorgänger.
Das Spezialfahrzeug der neuesten Generation kostet den AVF die stolze Summe von 670.000 Euro. Aber was genau ist so teuer daran? Es sind vor allem die technischen Aufbauten, die auf die speziellen Anforderungen des Kanalbetriebes mit vielen Schmutzstoffen und hohen Reinigungsdrücken ausgerichtet sind. Am Anfang des Beschaffungsprozesses hatte eine europaweite Ausschreibung gestanden, am Ende entschied sich der Verband für das wirtschaftlichste Angebot.
Spülfahrzeuge kommen nach etwa 15-20 Jahren an das Ende ihrer „Lebenserwartung“. Das Vorgängerfahrzeug des AVF, ein reiner „Combi“, der ausschließlich mit Frischwasser für die Erledigung seiner Aufgaben befüllt werden musste, war viele 1.000 Betriebsstunden im Einsatz und wird nunmehr außer Dienst gestellt.
Der Nachfolger verfügt über eine durchgehende Luftfederung, wodurch das Gewicht des Fahrzeugs auf den Achsen individuell bestimmt und somit Gewichtsüberschreitungen vermieden werden können.
Da Kanalreinigungsarbeiten regelmäßig im öffentlichen Straßenraum stattfinden und dem AVF die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Passanten sowie der anderen Verkehrsteilnehmer wichtig ist, befindet sich am kompletten Fahrzeug eine Rundumbeleuchtung. Zudem zeigt ein großer, grell leuchtender Pfeil auf der Rückseite des Fahrzeugs die Richtung an, in die die Passanten und Autofahrer am Fahrzeug vorbeilaufen bzw. -fahren sollen. Mit diversen Spiegeln am Führerhaus und Kameras am ganzen Fahrzeug kann der Fahrer alles, was um das Fahrzeug geschieht, jederzeit im Blick behalten. Das Fahrzeug verfügt zudem über einen sechs Meter langen hydraulisch dreh- und schwenkbaren Auslegearm, der zentral auf dem Fahrzeug angebracht ist. An diesem Arm sind alle wichtigen Komponenten für die Kanalreinigung angebracht (Saugschlauch, Hochdruckschläuche, Seilwinde, Höhensicherungsgerät, Arbeitsscheinwerfer usw.). Dieser Hydraulikarm kann um das ganze Fahrzeug herumgefahren werden, was insbesondere bei beengten Platzverhältnissen von Vorteil ist. Weiterhin kann erstmals mit einem Saug- und Spülfahrzeug des Abwasserverband Fulda auch vor dem Fahrzeug gesaugt und gespült werden, um die Fahrzeugbediener auf stark befahrenen Straßen vor dem fließenden Verkehr zu schützen. Der Lkw dient hier als Auffahrschutz.
Hat man die Möglichkeit genutzt, beim Abwasserverband Fulda eine spannende 3-jährige Ausbildung zur „Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice“ zu absolvieren, kann der Einsatzbereich durchaus im Führen und Bedienen eines solchen Spezialfahrzeuges sein.
Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt das neue Spülfahrzeug Maßstäbe: Im Gegensatz zu seinem Vorgänger verwendet es ausschließlich aufbereitetes Wasser und kein Frischwasser mehr, um anstehende Arbeiten zu erledigen.
https://www.abwasserverband-fulda.de/newsreader-v2/konsequenter-ausbau-der-erneuerbaren-energien-bei-leicht-verringertem-investitionsvolumen.html
(nach oben)
Emscher: Platz für den Inhalt von sieben Millionen Badewannen
Die Emscher-Auen in Castrop-Rauxel und Dortmund sorgen für Hochwassersicherheit, nun wird das Rückhaltebecken sogar noch weiter ausgebaut – NRW-Umweltminister Oliver Krischer setzte dafür am Montag (19.12.) den ersten Spatenstich
Castrop-Rauxel/Dortmund. 900.000 Kubikmeter Fassungsvolumen besitzen die Emscher-Auen, das größte Hochwasserrückhaltebecken der Emschergenossenschaft an der Stadtgrenze Castrop-Rauxel/Dortmund, aktuell – das sind 50 Prozent mehr als der Phoenix See in Dortmund-Hörde. Nun werden die Emscher-Auen weiter ausgebaut, denn noch bestehen sie aus vier Einzelbecken. Nach der Beseitigung der Trenndämme, die seit der Befreiung der Emscher vom Abwasser nicht mehr benötigt werden, bestehen die Emscher-Auen ab spätestens Mitte 2025 aus einem einzigen Becken. Den ersten Spatenstich setzte die Emschergenossenschaft am Montag gemeinsam mit NRW-Umweltminister Oliver Krischer sowie den Städten Dortmund und Castrop-Rauxel.
Das Fassungsvolumen wird im Endausbauzustand ganze 1,1 Millionen Kubikmeter betragen. Konkret entspricht das dem Inhalt von sieben Millionen Badewannen, die im Extremwetterfall in den Emscher-Auen zurückgehalten werden können. „Das ist ein sehr wichtiger Baustein für die Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Emscher, der sich von Castrop-Rauxel bis Dinslaken positiv auswirken wird. In Zeiten des fortschreitenden Klimawandels und zunehmender Extremwetterereignisse liefert diese Maßnahme einen wesentlichen Beitrag zur Klima-Resilienz der Region. Das Land unterstützt diese eindrucksvolle Kombination von Hochwasserschutz und naturnaher Gewässerentwicklung“, sagt Oliver Krischer, Umweltminister des Landes Nordrhein-Westfalen.
Den Ausbau des Beckens möglich macht die Abwasserfreiheit in der Emscher. Die Befreiung des Flusses von ihrer Schmutzwasserfracht war ein Generationenprojekt, das erheblich zur Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im zentralen Ruhrgebiet beigetragen hat. Die einstige Köttelbecke ist heute Vergangenheit, die neue abwasserfreie Emscher die Voraussetzung für blaugrünes Leben in und am Fluss. „Das Revier hat nun infolge der Emscher-Renaturierung als symbolträchtigstem Projekt im Rahmen des hiesigen Strukturwandels die Chance, zur grünsten Industrieregion Europas zu werden. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels muss dabei im Vordergrund stehen“, sagt Dr. Frank Dudda, Vorsitzender des Rates der Emschergenossenschaft und Oberbürgermeister der Stadt Herne.
„Mit dem im vergangenen Jahr abgeschlossenen Emscher-Umbau haben wir bereits Vorarbeit geleistet, denn neben der Abwasserfreiheit der Gewässer und ihrer ökologischen Umgestaltung stand bei dem wohl größten Infrastrukturprojekt des Landes insbesondere auch die Verbesserung des Hochwasserschutzes immer im Vordergrund“, sagt Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft.
Der Hochwasserschutz ist seit Gründung der Emschergenossenschaft im Jahr 1899 eine ihrer wesentlichen Kernaufgaben. Bei der Umgestaltung der Emscher spielte das Thema eine gewichtige Rolle, da die Emschergenossenschaft als regionaler Wasserwirtschaftsverband bereits früh die Auswirkungen des prognostizierten Klimawandels erkannt hat und den Emscher-Umbau entsprechend an die neuen Herausforderungen anpasste. „Anders als noch 1991 geplant, entstanden im Zuge des Emscher-Umbaus anstatt nur 4,6 Millionen mehr als 5 Millionen Kubikmeter an zusätzlichem Retentionsraum zur Optimierung des Hochwasserschutzes im Emscher-Gebiet“, sagt Paetzel.
So groß wie 46 Fußballfelder
Die Emscher-Auen umfassen eine Fläche von 33 Hektar. Das entspricht der Größe von 46 Fußballfeldern. „Wieso muss es denn bloß so groß sein?“, lautete die meistgestellte Frage der Nachbarschaft im Vorfeld der Baumaßnahme. „Gut, dass die Emschergenossenschaft dieses große Becken hier gebaut hat“, hörte man dagegen in den Tagen nach dem 14. Juli 2021. „Im Laufe des Unwetters im vergangenen Jahr, das in anderen Regionen Nordrhein-Westfalens und Deutschlands zu massiven Sachschäden und tragischerweise auch zu Todesfällen geführt hat, wurden die Emscher-Auen erstmals komplett eingestaut – im Starkregen überstand das Hochwasserrückhaltebecken Emscher-Auen nicht nur seine Feuertaufe, sondern schützte wie vorgesehen die unterhalb liegenden Kommunen an der Emscher vor den Wassermassen“, sagt Dr. Frank Obenaus, Technischer Vorstand der Emschergenossenschaft.
„In Dortmund, im Osten der Emscher-Region gelegen, erzielt das Becken auch im Westen einen erheblichen Effekt. Denn das Prinzip dabei ist: Was in Quellnähe an Wasser zurückgehalten werden kann, kommt erst gar nicht an der Mündung an, kann also dort nicht für Überflutung sorgen. Das zeigt einmal mehr, wie sehr doch alle Anrainerkommunen miteinander verbunden sind und wie sich Zusammenarbeit auszahlt“, sagt Dortmunds Bürgermeisterin Barbara Brunsing.
Zur Entlastung des Hochwasserrückhaltebeckens Emscher-Auen baut die Emschergenossenschaft darüber hinaus aktuell nur wenige Kilometer östlich das Hochwasserrückhaltebecken Dortmund-Ellinghausen: Es besteht aus mehreren Beckenteilen, die auf beiden Seiten der Ellinghauser Straße gelegen knapp 530.000 Kubikmeter Fassungsvolumen bieten. Die Fertigstellung ist für Mitte 2023 vorgesehen.
Abseits der Funktion als technische Hochwasserschutzeinrichtung sind die Emscher-Auen für die Menschen ein idyllisches Naherholungsbiet. Teil des Bauprojekts sind daher auch neue Radwege im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens. Für die Natur bedeuten die Emscher-Auen einen einzigartigen Lebensraum. Eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen haben rund um das Becken ein neues Zuhause gefunden und sogar Zugvögel lassen sich dort nieder, wenn sie aus ihren Winterquartieren zurück in die Brutgebiete ziehen. Rajko Kravanja, Bürgermeister von Castrop-Rauxel, sagt: „Für unsere Stadt sind die Emscher-Auen ein einzigartiges Juwel – ein Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür, das von den Bürgerinnen und Bürgern bereits weit vor der Fertiggestellung angenommen und erobert wurde.“
Nicht nur die Menschen und die Tiere erobern den neuen Naturraum zurück, sondern künftig auch die Emscher – denn innerhalb des Beckens wird sie künftig einen neuen kurvenreicheren Verlauf erhalten. Die neue Emscher – sie kommt!
Infobox:
900.000 Kubikmeter fassen die Emscher-Auen heute.
1,1 Millionen Kubikmeter Fassungsvolumen sind es nach dem Ausbau.
7 Millionen Badewannen – so viel Wasser kann das Becken später aufnehmen.
33 Hektar groß ist die Fläche des Beckens.
46 Fußballfelder passen dort drauf.
Die Emschergenossenschaft
Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Sie wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet und kümmert sich seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie um den Hochwasserschutz. www.eglv.de
https://www.eglv.de/medien/platz-fuer-den-inhalt-von-sieben-millionen-badewannen/
(nach oben)
Dresden: Wie die Stadtentwässerung Stromkosten spart
Die Inflation erlebt seit dem Beginn des Ukrainekrieges Höhenflüge. Angeheizt wird sie vor allem von den Energiepreisen. Schließlich bleiben russische Öl- und Gaslieferungen aus. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Teuerungsrate im November 2022 bei zehn Prozent.
Für die Stadtentwässerung zahlt sich eine Strategie aus, die sie seit vielen Jahren verfolgt. „Schon jetzt erzeugen wir in der Kläranlage Kaditz jährlich rund 18 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom selbst“, erklärt Ralf Strothteicher, Geschäftsführer der Stadtentwässerung Dresden. Das ist so viel, wie der Verbrauch von rund 9.000 Dresdner Zwei-Personen-Haushalten, die durchschnittlich etwa 2.000 kWh jährlich benötigen.
Mit dem in Kaditz selbst erzeugtem Strom werden rund 85 Prozent des Bedarfs der Kläranlage gedeckt, auf der etwa 21 Millionen Kilowattstunden im Jahr verbraucht werden. „Unser Ziel ist es, künftig unseren gesamten Strombedarf zu decken“, sagt der Geschäftsführer. Auch für Notfälle wie einen Blackout ist die Stadtentwässerung gewappnet.
Der Blackout: Stromversorgung im Klärwerk gekappt
Regelmäßig testet die Stadtentwässerung den Ernstfall, wenn bei einem Blackout der Strom für mehrere Stunden oder gar Tage ausfällt. Erstmals wurde das im Mai 2016 geübt. Damals wurde die Stromversorgung am Zulauf gekappt, was im Klärwerk „kleine Insel“ genannt wird. Dabei handelt es sich um die Anlagen vom Zulauf über den Sandfang und den Grob- sowie den Feinrechen bis hin zum Hauptpumpwerk.
Zur Stromversorgung gibt es ein großes Notstromaggregat, was eine Leistung von 1.000 Kilowatt hat. Allerdings kann das nicht die Versorgung des gesamten Klärwerks sichern. Deshalb müssen auch die drei Blockheizkraftwerke an den Faultürmen wieder in Betrieb genommen werden, die eine Leistung von drei Megawatt haben. Da für sie beim Blackout weniger Klärgas aus den Faultürmen kommt, wurde für solche Notfälle ein Erdgasanschluss hergestellt.
Am 8. April 2017 wird erstmals die zentrale Stromzufuhr fürs Klärwerk abgeschaltet, das in solchen Fällen als große „große Insel“ bezeichnet wird. Dieser Inseltest hat gut funktioniert. Seitdem werden regelmäßig Blackout-Tests durchgeführt. Beim großen Stromausfall am 13. September vergangenen Jahres ging alles ganz schnell. Nur 20 Minuten standen die Anlagen im Klärwerk still. Noch bevor das Notstromaggregat in Betrieb genommen wurde, war der Strom wieder da.
Die Haupterzeuger: Klärgas aus Faultürmen treibt Blockheizkraftwerke an
Der Großteil des grünen Stroms wird aus dem Klärgas der beiden Faultürme erzeugt. 2021 waren es rund 17,3 Millionen Kilowattstunden. In die Faultürme kommen täglich rund 1.000 Tonnen Klärschlamm. Sie waren Ende 2011 mit zwei Blockheizkraftwerken in Betrieb genommen worden, das dritte folgt Ende 2014. So kann aus dem Klärgas der beiden Faultürme grüner Strom erzeugt werden. Das funktioniert so: Bakterien zersetzen organische Bestandteile im Klärschlamm und es steigt Faulgas empor, etwa 60 Prozent Methan, der Rest Kohlendioxid.
Ein Ei fasst rund 10.500 Kubikmeter Schlamm. Der braucht drei Wochen zum Faulen. In einem Gasometer können 5.000 Kubikmeter Gas für die drei Blockheizkraftwerke gespeichert werden. Bevor es dorthin kommt, muss es allerdings mit Aktivkohle- und Keramikfiltern gereinigt werden. In einer nächsten Stufe wird dem Gas die Feuchtigkeit entzogen. Es wird abgekühlt, sodass die Feuchtigkeit verdampft.
Kompressoren erzeugen letztlich den nötigen Gasdruck für die Motoren des jeweiligen Blockheizkraftwerks. Sie treiben Generatoren an. So kann sehr energieeffizient Wärme und Strom erzeugt werden. Mit der Wärme der Abgase werden die Faultürme und das benachbarte Betriebsgebäude beheizt. So können rund 80 Prozent der Energie des Klärgases ausgenutzt werden.
Der Plan: Neuer Speicher und mehr Klärgas
Jährlich entstehen in den Faultürmen über sieben Millionen Kubikmeter Klärgas – Tendenz steigend. 2021 waren es bereits rund 7,9 Millionen Kubikmeter. Deshalb ist der Bau eines zweiten Gasspeichers bis 2024 geplant, der ebenfalls rund 5.000 Kubikmeter fasst. Er ist einerseits nötig, damit auch in Spitzenzeiten immer genügend Gas für die Blockheizkraftwerk zur Verfügung steht.
Wird hingegen nicht viel Strom benötigt oder müssen die Kraftwerke für Wartungsarbeiten abgeschaltet werden, ist genügend Speicherkapazität da. Immerhin werden in den Faultürmen gleichmäßig rund 1.000 Kubikmeter Klärgas stündlich erzeugt, die zwischengespeichert werden müssen. „Wir wollen unbedingt verhindern, dass Klärgas abgefackelt werden muss“, erläutert Strothteicher. Denn es soll effizient zur Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt werden.
Die Investition von rund 2,4 Millionen Euro für den neuen Speicher soll sich durch die Energieerzeugung bereits nach wenigen Jahren amortisieren.
In den Faultürmen wird vor allem mehr Klärgas erzeugt, da immer mehr Bio-Abfälle zugesetzt werden, beispielsweise die Inhalte der Fettabscheider von Gaststätten und Hotels oder aus der Lebensmittelindustrie. „2023 konzentrieren wir uns darauf, weitere Bioabfallstoffe zu organisieren“, kündigt Geschäftsführer Strothteicher an. Derzeit werden rund 12.000 Tonnen jährlich in den Faultürmen zugesetzt. Da diese Stoffe viel energiehaltiger sind als Klärschlamm, sind sie so wichtig. „Deshalb versuchen wir zusätzlich Partner zu gewinnen, von denen wir solche Zusatzstoffe erhalten“, erklärt er.
Die Turbine: Stromgewinnung aus Wasserkraft
Außerdem wird im Klärwerk Kaditz Strom aus Wasserkraft gewonnen. 2021 waren es 668.386 kWh. Das funktioniert wie folgt. Durch einen 275 Meter langen Kanal fließt das gereinigte Abwasser von der Kläranlage bis zur Elbmitte. Dabei geht es bergab. Das nutzt die Stadtentwässerung im Ablaufbauwerk mit einem kleinen Kraftwerk zur Energiegewinnung. Immerhin fließen rund 55 Millionen Kubikmeter jährlich in die Elbe. Das Wasser treibt eine Turbine an. Der angeschlossene Generator erzeugt Strom fürs Klärwerk. Die sogenannte Kaplanturbine war Ende 2004 in Betrieb genommen worden. Sie hat eine Leistung von 120 Kilowatt. Die Anlage läuft Tag und Nacht. Nur bei Hochwasser, wie im Juni 2013, oder bei Störungen muss sie abgeschaltet werden.
Die Sonnenenergie: Neue Solaranlage auf Carport
Durchschnittlich rund 160.000 Kilowattstunden grünen Strom gewinnt die Stadtentwässerung jährlich aus Sonnenergie. Die größte Anlage steht auf dem Dach des Kaditzer Regenüberlaufbeckens. Dort sind 949 Solarmodule installiert, die eine Gesamtleistung von 190 Kilowatt haben. 2022 ist eine weitere Solaranlage mit 175 Modulen mit einer Leistung von 65 Kilowatt auf dem Dach eines neuen Carports hinzugekommen, erklärt der Geschäftsführer. Mit ihr können jährlich durchschnittlich 64.000 kWh Strom erzeugt und somit 21,3 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.
https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/journal-1/detail/wie-die-dresdner-stadtentwaesserung-stromkosten-spart/
(nach oben)
Berlin: Gänsefett lässt nicht nur Bäuche wachsen
Wasserbetriebe bitten um Fütterung von Abfalltonnen statt Bakterien
Gänsebraten macht glücklich, zu Weihnachten besonders. Das liegt auch am Fett. Was sich bei Menschen auf die Hüften setzt und sie träge und faul macht, setzt sich im Abwasser an Kanalwände und wird dort faulig. Das stinkt uns im Kanalbetrieb und stört auch im Klärwerk. Das liegt an der Fettliebe von Microthrix parvicella, einem Fadenbakterium im Abwasser. Bei weihnachtlicher Nahrungsschwemme schalten die kleinen Gesellen von Mikro auf Makro, vermehren sich ungebremst und lassen so Klärwerke überschäumen, wenn ihnen nicht mit zusätzlichem Aufwand an Chemie und/oder physikalischen Tricks Einhalt geboten wird.
Wenn Klärwerker:innen weihnachtlich ums Herz wird, dann kam dazu über viele Jahre auch ein tiefer Seufzer. Denn obwohl zum Fest fast das gesamte öffentliche Leben pausiert, ergo auch weniger Abwasser in die Kläranlagen fließt, schäumten dort immer wieder die Becken über. Massen an Schwimmschlamm – eine auf der (Ab-)Wasseroberfläche schwimmende Melange aus organischen Rückständen und Mikrorganismen – trat auf und gelegentlich auch über die Beckenränder.
In den letzten Jahren haben wir das Problem zwar mit Umbauten, Flockungshilfs- und Antischaummitteln entschärft.
Deshalb appellieren die Berliner Wasserbetriebe an alle Bratenden, das in Töpfen und Tiegeln zurückbleibende Fett nicht durch den Ausguss wegzuspülen. In der Kanalisation backt es an den Rohren fest, verstopft sie, fault und stinkt und im Klärwerk lässt es den Klärschlamm wahrhaft überschäumen, weil eben jene Microthrix beim Fett keine Grenzen kennt.
Tricks gegen Thrix: Zeitung bildet und bindet
Dabei lässt sich das Gänsefett gleich in der Küche nutzen, etwa zum Abschmecken von Grün- oder Rotkohl oder als Schmalz. Im Kühl- oder Gefrierschrank kann man es portionsweise aufheben und es sich später schmecken lassen – das Internet ist voller Rezepte und selbst gegen Husten, Sodbrennen und wunde Haut soll es helfen.
Wenn´s aber entsorgt werden soll, dann richtig: Eine Schüssel mit alter Zeitung auslegen, dann das – nicht zu heiße – Fett hineingießen und nach dem Erhärten in die Biotonne. Töpfe und Pfannen ebenfalls mit Zeitung oder Küchenpapier auswischen und diese dann in den Hausmüll geben. Der wird später verbrannt und dabei ist jede Kalorie willkommen, zumal die Abwärme des BSR-Müllheizwerks in Ruhleben letztlich Fernwärme wird.
https://www.bwb.de/de/pressemitteilungen27771.php
(nach oben)
OOWV: Kläranlage Oldenburg wird zum Vorbild beim Wiederaufbau
OOWV startet Solidarpartnerschaft mit ukrainischen Wasserver- und Abwasserentsorgern
Im Nordwesten. Hier steht der Wiederaufbau von Teilen der kritischen Infrastruktur in der Ukraine im Mittelpunkt: Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) und kommunale Wasserver- und Abwasserentsorger aus den Städten Tschernihiw und Sumy im Nordosten des Landes kooperieren im Rahmen einer Solidarpartnerschaft
Vier Gäste aus der Krisenregion an der Grenze zu Russland und Weißrussland waren im November einige Tage zu Besuch beim OOWV. Bei diesem ersten persönlichen Kennenlernen in größerer Runde besichtigten sie unter anderem Wasserwerke, Kläranlagen sowie das Museum Kaskade. Vor Ort fand jeweils ein reger fachlicher Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des OOWV statt.
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2022/dezember/1/artikel/klaeranlage-oldenburg-wird-zum-vorbild-beim-wiederaufbau