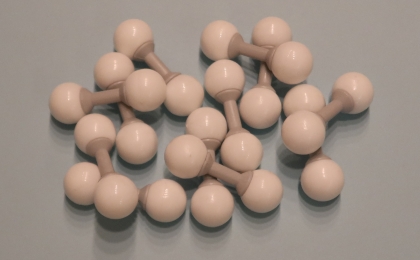Die Nutzungspotenziale von Abwasserkanälen für die Wärmeversorgung von Gebäuden oder als Wärmequelle für die leitungsgebundene Wärmeversorgung sind gerade in urbanen Räumen groß. In der Analyse werden Möglichkeiten aufgezeigt, den Informationszugang insbesondere für Dritte zu verbessern. Das umfasst Anspruchsregelungen in den Informationsfreiheitsgesetzen der Länder. Duldungsansprüche bzw. Gestattungen für die Abwasserwärmenutzung können die Abwasserwärmenutzung erleichtern. Das Papier schließt mit Handlungsempfehlungen für Bund, Länder und Kommunen.
1 Einführung
Es gibt erst wenige Projekte, bei denen Abwasserkanäle als Wärmequelle für die Wärmeversorgung von Gebäuden oder Quartieren genutzt werden. Beispiele findet man z. B. in Stuttgart1, Winnenden2, Bamberg3 oder Rheine4 (eine Liste weiterer Projekte findet sich in Fritz & Pehnt (2018)5). Dabei ist Abwasserwärme des Kanalsystems oder am Auslauf von Kläranlagen ein gutes Wärmereservoir für den Betrieb von Wärmepumpen. Dies liegt vor allem an dem über das Jahr hinweg relativ konstantem Temperaturniveau, das insbesondere in den Wintermonaten höher ist als die Temperatur der Umgebungsluft und des Grundwassers. Nach Fritz & Pehnt (2018) beträgt das deutschlandweite Nutzwärmepotenzial der Wärmeentnahme aus Abwasserkanälen bis zu 33 TWh/a.
Für die flächendeckende Nutzung der Wärme aus Abwasserkanälen gibt es nach wie vor einige Barrieren. Neben Informationsdefiziten ist der mangelnde Informationszugang ein zentrales Hemmnis. Es fehlt dabei an leicht zugänglichen Informationen zu Lage (digitale Karten/ GIS) und relevanten weiteren Parametern wie Kanaldurchmesser, Durchflussmengen und Temperatur des Abwassers. Fokus der vorliegenden Analyse ist daher die Frage, wie Informationen leichter und besser zugänglich gemacht werden können. Durch die Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung ist zu erwarten, dass Informationen zukünftig leichter zugänglich sind, da der Entwurf des Wärmeplanungsgesetzes eine Berechtigung vorsieht, relevante Informationen zu Abwasserkanälen zu erfassen. Hierzu zählen nach dem Gesetzesentwurf vom 21.07.2023 für Kanäle mit einer Mindestnennweite von DN 800 (80 cm Innendurchmesser) die Lage, die Nennweite in Metern, das Jahr der Inbetriebnahme und der Trockenwetterabfluss (jeweils straßenbezogen). Allerdings adressiert der Entwurf des Wärmplanungsgesetztes in erster Linie die Länder und die für die Wärmeplanung verantwortlichen Stellen. Dritte wie Hauseigentümer oder Wohnungsunternehmen, die die Abwasserwärme nutzen möchten, dürften auch in Zukunft nicht immer einfach an die relevanten Informationen kommen. Wie insbesondere der Zugang zu Informationen von Dritten verbessert werden kann, ist die zentrale Frage dieser Analyse und wird in Kapitel 3 detailliert betrachtet. Dabei werden auch weitere rechtliche Fragen beleuchtet, die sich mit der Nutzung der Wärme aus Abwasserkanälen verbinden wie die Duldung der Nutzung des Abwasserkanals für die Wärmeentnahme und die Erhebung von Gebühren.
Neben dem schwierigen Informationszugang gibt es weitere Barrieren für die Nutzung von Abwasserwärme. Dazu gehören z. B. Wissenslücken bei vielen kommunalen Akteuren und Projektentwicklern, welche sich auch in Bedenken der Betreibenden von Kanalnetzen und Kläranlagen zeigen. Beispielsweise bestehen Vorbehalte im Hinblick auf die sichere Funktionsfähigkeit von Kläranlagen, sollte Wärme aus dem Kanalnetz entzogen werden.
Entsprechende Temperaturanforderungen in den Kläranlagen müssen in der Planung von Abwasserwärme-Projekten berücksichtigt werden (s. auch unten). Bei umgesetzten Projekten sind keine Probleme hinsichtlich der Funktionsfähigkeit von Kläranlagen bekannt Projektentwickler berichten darüber hinaus von der Herausforderung, dass Genehmigungsprozesse bislang nicht standardisiert sind. Diese Standardisierung kann auf Erfahrungen aus erfolgreichen Projekten aufbauen. Erste Ansätze hierzu gibt es von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) mit dem
1 https://www.stadtwerke-stuttgart.de/partner-der-energiewende/neckarpark/
2 https://www.zvw.de/lokales/winnenden/das-gerberviertel-plus-entsteht-in-winnenden-derabwasserkanal-hats-in-sich_arid-409670
3 https://www.stadtwerke-bamberg.de/zukunftba/lagarde
4 https://www.mv-online.de/sonderthemen/stadtwerke/heizt-rheine-bald-teils-mit-abwasser-384719.html
5 Fritz, S.; Pehnt, M. (2018): Kommunale Abwässer als Potenzial für die Wärmewende? Kurzstudie im Auftrag des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Abgerufen am 30.07.2023 unter https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/ifeu-bmu_Abwaermepotenzial_Abwasser_final_update.pdf
Merkblatt M-114, das eine Grundlage für entsprechende Standardisierungsprozesse (z. B. hinsichtlich Genehmigungsabläufen, Gebührenordnung) sein könnte. Einen Schritt in diese Richtung ist man in Baden-Württemberg gegangen. Um Genehmigungsprozesse zu vereinheitlichen und damit zu beschleunigen, hat die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg einen Mustervertrag für die Abwärme-Nutzung in Abwasserkanälen und Kläranlagen erstellt, der auf Anfrage verfügbar ist.
Für die Abwasserwärmenutzung gibt es im Kern drei Optionen:
► die Nutzung nicht gereinigter Abwässer vor der Kläranlage im Abwasserkanal,
► die direkte Nutzung in der Kläranlage,
► die Nutzung des gereinigten Abwassers im Auslauf der Kläranlage.
Die vorliegende Analyse fokussiert auf die Nutzung der Abwasserkanäle, also die Nutzung des nicht gereinigten Abwassers vor der Kläranlage. Der Vorteil ist, dass Abwasserkanäle überall in Kommunen zu finden sind und damit nah an potenziellen Wärmeabnehmern liegen. Allerdings ist nicht jeder Kanal für die Abwasserwärmenutzung geeignet. Eine Grundvoraussetzung ist ein ausreichender Innendurchmesser der Abwasserkanäle, um einen Wärmeübertrager im Kanal installieren zu können. Nach Fritz & Pehnt (2018) können Wärmeübertrager ab einem Durchmesser von DN 400 installiert werden, wobei ein Durchmesser von mindestens DN 800 empfohlen wird7. Der Trockenwetterabfluss in dem Kanalabschnitt, in dem ein Wärmetauscher eingebaut wird, sollte bei mindestens 15 l/s liegen. Entsprechende Abwassermengen sind in Gemeinden ab ca. 3.000 bis 5.000 Einwohnern*Einwohnerinnen zu erwarten. Kanal-Wärmetauscher können Längen von mehreren hundert Metern erreichen, um die benötigte Leistung bereitzustellen. Eine Alternative sind Bypass-Wärmetauscher, bei denen ein Teilstrom des Abwassers aus dem Kanal entnommen und über einen Platten- oder Doppelrohrwärmeübertrager geleitet wird. Die Anforderungen an den Kanal(durchmesser) sind für diese Variante geringer, allerdings sind auch die Investitionskosten höher.
Im Zuge des Wärmeentzugs ist eine Verringerung der Temperatur des Abwassers um drei bis vier Kelvin praktikabel, womit eine Wärmeentzugsleistung von zwei bis vier kW/m² Wärmeübertrager-Oberfläche erreicht werden kann. Bei der Nutzung ist stets sicherzustellen, dass die Temperatur im Zulauf einer Kläranlage nicht zu weit sinkt, da sonst der Betrieb der Kläranlage nicht gewährleistet ist. Die Temperatur im Zulauf der Kläranlage sollte nicht unter 10 °C fallen.
https://www.kea-bw.de/waermewende/wissensportal?no_cache=1#c6594%20_top
Energie in Infrastrukturanlagen (2004): Wärmenutzung aus Abwasser. Verfügbar unter https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Energieeffizienz/Abwasserwaermenutzung/Leitfaden_RatgeberLeitfaden_Waerme_aus_Abwasser.pdf
2 Existierende Informationsinstrumente und Informationsbedarfe
Für die Planung und Durchführung von Projekten zur Abwasserwärmenutzung aus Abwasserkanälen benötigen Planende Informationen über das existierende Kanalnetz. Insbesondere Informationen zu Dimensionen, Abflussdaten und Temperatur sind wichtig, um die (Nutzungs-)Potenziale abschätzen und Projekte entwickeln zu können. Die entsprechenden Informationen sind aktuell nicht flächendeckend zugänglich. Zwar haben einige Kommunen damit begonnen, diese Daten zu digitalisieren und frei zugänglich zu machen, oftmals stehen Interessierte aber vor dem Problem, dass Zuständigkeiten unklar sind und die Informationsbereitstellung keine Priorität hat. Im aktuellen Entwurf des Wärmeplanungsgesetztes (s. oben) ist verankert, dass für die Wärmeplanung verantwortliche Stellen diese Daten erheben können. Es ist also davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren deutlich mehr abwassernutzungsrelevante Informationen digital verfügbar sein werden.
Fraglich bleibt, ob die damit verbundene Detailtiefe z. B. für Projektentwickler ausreicht. Hierfür wäre eine flächendeckende Darstellung der Potenziale z. B. in Wärmekatastern oder Potenzialkarten hilfreich. In einigen Gebieten gibt es bereits entsprechende Potenzialkartierungen, u. a. in Hamburg-Bergedorf, Hamburg-Wilhelmsburg, Stuttgart, Oldenburg, Berlin (im Aufbau) und entlang des Emscher-Kanals (Nordrhein-Westfalen). Eine Ausweitung dieserart Aktivitäten könnte der Nutzung von Wärme aus Abwasserkanälen einen Schub geben. Alternativ könnte eine Verpflichtung der Kanalnetzbetreiber zur Informationsbereitstellung die Informationslage verbessern (s. Kapitel 3).
Für zentrale Abwasserwärmequellen ist die Informationslage deutlich besser. So stellt die Bayerische Staatsregierung in einem Potenzialkataster Informationen zu allen Kläranlagen in Bayern zur Verfügung und hat einen Leitfaden zur Abwasserwärmenutzung im Kanal und im Auslauf von Kläranlagen veröffentlicht. Auch in Baden-Württemberg wurden die Standorte für die Abwasserwärmenutzung aus dem Auslauf von Kläranlagen identifiziert und analysiert und ein Informationsportal etabliert (s. unten).
Darüber hinaus gibt es auf Länderebene einzelne Anlaufstellen für Interessierte (die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):
► Bayern: Trägerverein Umwelttechnologie-Cluster Bayern e.V. – Cluster-Arbeitskreis Abwasserwärmenutzung
► Baden-Württemberg: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Landesverband Baden-Württemberg (DWA); Klimaschutz- und Energieagentur (KEA) – Initialberatung
► Rheinland-Pfalz: Energieagentur Rheinland-Pfalz – Initialberatung
https://www.karten.energieatlas.bayern.de/
Bayerisches Landesamt für Umwelt (2013). Energie aus Abwasser – Ein Leitfaden für Kommunen. Verfügbar unter
https://www.dwa-bw.de/files/_media/content/PDFs/LV_Baden-Wuerttemberg/Homepage/BW-Dokumente/Homepage%202013/Service/Fachdatenbank/Leitfaden%20Energie%20aus%20Abwasser.pdf
https://www.abwasserwaerme-bw.de/cms/content/media/Abschlussbericht_Abwasserwaermenutzung-BW_komprimiert.pdf
3 Ansätze zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Informationen / Rechtliche Fragen
Für potenzielle Investoren, die eine Nutzung der Abwasserwärme für den Betrieb von Wärmepumpen erwägen, aber auch für Betreiber von Abwasseranlagen und für Kommunen, die sich dem Thema in der Wärmeplanung widmen wollen, stellen sich rechtliche Fragen in Bezug auf die Zugangsmöglichkeiten zu den Kanälen, auf die Verfügbarkeit von für die Planung nötigen Informationen und (für den Fall der Nutzung) um die jeweiligen Nutzungsentgelte. Nachfolgend sollen die betreffenden rechtlichen Fragestellungen einer Klärung zugeführt werden. Dabei ergeben sich drei Fragenkomplexe mit verschiedenen Unterfragen:
- Komplex 1: Zu den Verfügungsmöglichkeiten über die Abwasserwärme: Wer hat welche Rechtsstellung im Hinblick auf die Abwasserwärme bzw. deren Nutzung? Wie kann eine Nutzungsmöglichkeit rechtlich bewirkt/sichergestellt werden?
- Komplex 2: Zur Entgeltlichkeit der Nutzung von Abwasserwärme: Wie kann die Nutzung entgolten werden? Wie ist die Nutzung derzeit gebühren-/entgeltrechtlich einzuordnen?
- Komplex 3: Zu den Gesetzgebungskompetenzen für spezielle rechtliche Bestimmungen:
Durch wen (Bund, Länder, Gemeinden?) können Regelungen geschaffen werden über
a) Informationsansprüche Dritter,
b) Duldungsansprüche bzw. Gestattungen für die Nutzung der Abwasserwärme,
c) Gebühren/Entgelte für die Gestattung der Nutzung?
3.1 Verfügungsmöglichkeiten über die Abwasserwärme
Nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)11 sind nur „Sachen“ eigentumsfähig (siehe § 903 BGB). Die Abwasserwärme ist als solche keine „Sache“ im Sinne des BGB (siehe dort § 90 zum Sachbegriff), da es sich bei der Wärme nicht um einen körperlichen bzw. körperlich begrenzten Gegenstand handelt.
Die Nutzung der Abwasserwärme erfordert jedoch einen Zugriff auf den jeweiligen Kanal und auf das darin befindliche Abwasser. Beides (Kanal und Abwasser) sind „Sachen“. Außerdem muss für den Anschluss an den Kanal der Boden bewegt, also das Grundstück in Anspruch genommen werden.
Verfügungsberechtigt über eine Sache ist grundsätzlich der jeweilige Eigentümer (§ 903 BGB), sofern dieser das Verfügungsrecht nicht an Dritte weitergegeben hat (durch Vertrag) oder sich aus sonstigen gesetzlichen Regelungen etwas anderes ergibt. Für den Zugriff auf die Abwasserwärme durch Dritte bedarf es folglich mehrerer Gestattungen. Das ist unproblematisch, wenn die Verfügungsberechtigten über das Abwasser, den Kanal und den Boden an der Zugriffsstelle identisch sind. Dann bedarf es nur eines Gestattungsvertrages. Anders liegt es, wenn diese jeweils unterschiedlichen Rechtspersonen verfügungsberechtigt sind. In diesem Fall besteht das Risiko, dass es insgesamt zu einer Ablehnung der Abwasserwärmenutzung kommt, sobald eine verfügungsberechtigte Person einen Vertragsschluss ablehnt.
Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 72) geändert worden ist.
Hinsichtlich des Abwassers bestimmt § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)12: „Abwasser ist von den juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu beseitigen, die nach Landesrecht hierzu verpflichtet sind (Abwasserbeseitigungspflichtige). Die Länder können bestimmen, unter welchen Voraussetzungen die Abwasserbeseitigung anderen als den in Satz 1 genannten Abwasserbeseitigungspflichtigen obliegt. Die zur Abwasserbeseitigung Verpflichteten können sich zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter bedienen.“
Die nach Landesrecht zur Abwasserbeseitigung verpflichteten juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind in der Regel die Gemeinden, denn die Abwasserbeseitigung gilt als Teil der den Gemeinden nach Art. 28 Abs. 2 GG obliegenden örtlichen Daseinsvorsorge. Hiervon ausgehend kann es sich aber auch um den jeweiligen Landkreis, um einen Verbund von
Gemeinden (Zweckverband) oder einen Verbund von Gemeinden und Dritten (Abwasserverband) handeln (siehe beispielhaft § 37 des Hessischen Wassergesetzes13). Außerdem kann es unter Anwendung des jeweiligen Landesrechts in Einzelfällen vorkommen, dass die Aufgabe einem Privatunternehmen übertragen worden ist (was aber selten ist). Wenn die Abwasserbeseitigung praktisch in der Hand eines gemeindlichen Stadtwerks (bzw. eines kommunalen Abwasserbeseitigungsunternehmens) liegt, kann es entweder sein, dass diesem die Aufgabe als solche übertragen worden ist (was nur möglich ist, wenn es selbst rechtsfähig ist, z. B. als AöR oder GmbH) oder dass diesem lediglich die Durchführung der Aufgabe überlassen wurde.
Hinsichtlich des Zugriffs auf das Kanalnetz und den Boden kommt es darauf an, an welcher Stelle des Kanalnetzes der Zugriff erfolgt und wer an der Zugriffsstelle jeweils Eigentümer des Grundstücks und Eigentümer des Kanals ist. Zu beachten ist dabei, dass fest mit dem jeweiligen Boden verbundene Sachen (wie Abwasserkanäle) nach § 94 BGB eigentumsrechtlich grundsätzlich als Bestandteile der Grundstücke gelten, auf denen (bzw. in oder unter denen) sie sich befinden. Daraus können sich unter Umständen Zuordnungsprobleme ergeben.
Der typische Fall dürfte der Zugriff auf einen Abwassersammelkanal sein. Hier ergibt sich folgende Ausgangssituation: - Die Sammelkanäle befinden sich üblicherweise unter öffentlichem (gemeindlichem) Boden (Straßenland). Wenn es um den Zugriff auf einen Sammelkanal geht und die Gemeinde zugleich – so der Regelfall – Betreiberin des Kanalnetzes ist, wirft die Zuordnung nach § 94 BGB keine Probleme auf, denn dann handelt es sich bei den Verfügungsberechtigten über den Kanal, über den Boden und über das Abwasser um dieselbe Rechtsperson: die Gemeinde. Es ist folglich nur ein Vertrag mit der Gemeinde erforderlich.
- Wenn die Gemeinde die Aufgabe der Abwasserbeseitigung oder deren Durchführung jedoch einer anderen Rechtsperson übertragen hat (z. B. einem Zweckverband, einem Abwasserverband, einem eigenen Stadtwerk als AöR bzw. als GmbH oder auch einem privaten Drittunternehmen), dann muss aus dem zur Übertragung oder zur Durchführung der Aufgabe geschlossenen Vertrag abgeleitet werden, ob die Gemeinde damit auch das Eigentum am Kanalnetz übertragen hat – was im Einzelfall unterschiedlich sein kann. Im Regelfall dürfte davon auszugehen sein, dass das Eigentum am Kanalnetz mit übertragen werden sollte, so dass die Kanäle dann anders als von § 94 BGB angenommen nur „Scheinbestandteile“ der Grundstücke sind. Dann gehören die Kanäle dem Netzbetreiber,
der Grund und Boden jedoch der Gemeinde. Ob das Eigentum am Kanalnetz übertragen wurde, muss im Einzelfall geprüft werden - Für die unter (2) beschriebene spezielle Situation ist zu ergründen, ob für den Zugang zum Kanal nicht zwei Verträge geschlossen werden müssten, zum einen mit dem Netzbetreiber und zum anderen mit der Gemeinde – da für den Anschluss der Wärmepumpe in den Boden eingegriffen werden muss. Auch insoweit kommt es auf die Vertragslage an. Zwar dürfte im Regelfall davon auszugehen sein, dass nach der Vertragslage der Kanalnetzbetreiber selbst für den Zugang zu den Kanalanlagen in den Grund und Boden eingreifen darf. Aber für die Inanspruchnahme des Bodens durch Dritte kann das nicht als selbstverständlich angenommen werden. Deshalb spricht viel dafür, dass in Fällen, in denen die Gemeinde die Aufgabe oder die Durchführung der Abwasserbeseitigung einer anderen Rechtsperson übertragen hat, jedenfalls für die nötigen Arbeiten im Boden zusätzlich eine Gestattung durch die Gemeinde als Grundstückseigentümerin eingeholt werden muss.
Sofern auf den Auslauf des Klärwerks zugegriffen werden soll (bzw. der Zugriff auf dem Klärwerksgrundstück erfolgen soll), gelten die vorstehenden Erwägungen entsprechend: Es kommt darauf an, wem die Verfügungsberechtigung über die jeweilige Zugriffsstelle am Auslauf zusteht. Gehört das betreffende Grundstück an dieser Stelle dem Klärwerksbetreiber, dann muss nur mit diesem ein Vertrag geschlossen werden. Ist das nicht der Fall, so kommt es darauf an, ob auf Grundlage des jeweiligen Vertrages zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Klärwerksbetreiber davon ausgegangen werden kann, dass der Klärwerksbetreiber über seine technische Infrastruktur sowie über den Boden im Bereich der Zugriffsstelle verfügen können soll oder nicht.
3.2 Entgeltlichkeit der Nutzung von Abwasserwärme
Die Beseitigung der (privaten) Abwässer ist eine entgeltfähige Leistung des Betreibers der Kanalisation gegenüber den angeschlossenen Grundstückseigentümern. Letztere sind üblicherweise nach kommunalrechtlichen Satzungen (die auf Grund Landesrechts erlassen wurden) anschluss- und benutzungspflichtig. Das ändert aber nichts daran, dass sie mit der Abwasserbeseitigung eine entgeltfähige Leistung in Anspruch nehmen. Im Regelfall ist davon auszugehen, dass eine öffentlich rechtliche Nutzungsbeziehung besteht (siehe § 56 WHG), denn die Abwasserentsorgung ist eine hoheitliche Aufgabe öffentlich- rechtlicher Aufgabenträger, soweit nicht (nach Landesrecht) im Einzelfall eine Aufgabenprivatisierung erfolgt ist oder die Gemeinde ein eigenes Unternehmen in Privatrechtsform (z. B. ein als GmbH konstruiertes Stadtwerk) mit der Durchführung der Leistung (dritt-)beauftragt hat.
Handelt es ich bei dem Betreiber des Kanalnetzes um eine öffentlich-rechtliche Körperschaft/ Rechtsperson (Gemeinde – ggf. einschl. Eigenbetrieb -, Anstalt öffentlichen Rechts, Zweckverband, Abwasserverband), so werden für die Entsorgungsleistung Gebühren erhoben. Geregelt ist dies in der von dem jeweiligen Träger aufgestellten Abwassersatzung bzw. der betreffenden Gebührensatzung. Handelt es sich ausnahmsweise um ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen (GmbH der Gemeinde, Privatunternehmen), so kann dieses auf Grund allgemeiner Geschäftsbedingungen privatrechtliche Entgelte erheben. Soll Abwasser durch einen Dritten zum Zwecke der Wärmegewinnung genutzt werden, so erbringt der Betreiber des Kanalnetzes dem Dritten gegenüber ebenfalls eine Leistung: Er gestattet ihm die Nutzung des Abwassers für die Wärmepumpe. Auch diese Art der Leistung ist grundsätzlich gebühren- bzw. entgeltfähig. Allerdings ist diese Leistung bisher üblicherweise nicht Gegenstand der jeweiligen Abwasser-/ Abwassergebührensatzungen (bei öffentlich- rechtlichen Nutzungsbeziehungen) bzw. der allgemeinen Geschäftsbedingungen (bei
privatrechtlichen Nutzungsbeziehungen), da diese Leistung bisher noch nicht verbreitet ist.
Fraglich ist, ob die Benutzung des Abwassers für Zwecke der Wärmeentnahme bzw. deren Gestattung gegenüber Dritten im Falle einer hoheitlichen Abwasserbeseitigung an dessen hoheitlichem Charakter teilhat, so dass es möglich ist, Satzungsbestimmungen zu erlassen, nach denen dafür Gebühren erhoben werden. Gegen diese Annahme lässt sich anführen, dass die Nutzung zum Zwecke der Wärmeentnahme nicht zu dem historisch gewachsenen Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge zählt. Dafür spricht jedoch, dass ein enger sachlicher Zusammenhang mit der hoheitlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung besteht. Über diese Frage könnten Streitigkeiten entstehen, sofern keine übergeordneten gesetzlichen Bestimmungen darüber geschaffen werden sollten.
Sofern nicht von einer hoheitlichen Leistung auszugehen sein sollte oder sich der Betreiber des Kanalnetzes trotz eines angenommenen hoheitlichen Charakters dazu entschließt, keine Gebührenregelungen in einer Satzung zu treffen, bleibt in jedem Falle die Möglichkeit der vertraglichen Vereinbarung eines Entgelts für die Abwassernutzung im Einzelfall. Sofern ein (seltener) Einzelfall vorliegen sollte, in dem zusätzlich auch eine Gestattung des Grundstückseigentümers erforderlich ist (siehe oben unter 3.1), erbringt auch der Grundstückseigentümer eine Leistung, für die in dem jeweiligen Fall ein vertragliches Entgelt auszuhandeln wäre.
Im Falle einer Zuordnung der Leistung zum hoheitlichen Aufgabenbereich (zum Beispiel für Informationsbereitstellung, Reinigungsarbeiten und Inspektionen der Wärmeübertrager), wenn also Gebühren erhoben werden, gelten hinsichtlich der Höhe der ggf. erhobenen Gebühren die allgemeinen Grundsätze des Gebührenrechts. Das bedeutet, dass hier das Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip zum Tragen kommen. Die Gebühren können daher in jedem Falle kostendeckend ausgestaltet werden. Sie können diese Größenordnung jedoch überschreiten, soweit sie zum Wert der erbrachten Leistung (des zugewandten Vorteils) in einem äquivalenten Verhältnis stehen. Bei allgemein vorgegebenen Entgelten privatrechtlicher Unternehmen sowie im Falle einzelvertraglicher Vereinbarungen gibt es keine vergleichbaren Bindungen bzw. Grundsätze.
3.3 Gesetzgebungskompetenzen für spezielle rechtliche Bestimmungen
Die Frage, wem (Bund, Länder, Kommunen) für spezielle Regelungen über die Nutzung von Abwasserwärme die Rechtsetzungskompetenz zusteht, interessiert im vorliegenden Kontext für drei Regelungsrichtungen:
a) die Informationsansprüche Dritter (am Anschluss einer Wärmepumpe Interessierter),
b) die Regelungen über Duldungsansprüche bzw. Gestattungen für die Nutzung der Abwasserwärme durch Dritte,
c) die Erhebung von Gebühren bzw. Entgelten für die Gestattung der Anschlüsse und Nutzungen.
3.3.1 Grundlagen
Nach Art. 70 Abs. 1 GG haben die Länder das Recht der Gesetzgebung, soweit das Grundgesetz nicht dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Soweit dem Bund für ein Rechtsgebiet eine „konkurrierende“ Gesetzgebungsbefugnis für eine der im Katalog des Art. 74 Abs. 1 GG bezeichneten Materien zukommt, steht den Ländern die Gesetzgebung zu, solange und soweider Bund von ihr nicht Gebrauch gemacht hat (Art. 72 Abs. 1 GG).
Für die hier betrachteten Regelungen können aus den Titeln des Artikels 74 Absatz 1 GG folgende in Betracht kommen:
► Nr. 11: „Recht der Wirtschaft“ (insbesondere „Energiewirtschaft“),
► Nr. 24: „Luftreinhaltung“ (hier zugeordnet: Klimaschutz),
Nicht einschlägig dürfte demgegenüber eindeutig Art. 74 Abs. 1 Nr. 32 GG (Wasserhaushalt) sein, denn es geht zwar um einen Anspruch gegenüber den zur Abwasserbeseitigung verpflichteten Körperschaften bzw. Einrichtungen/Unternehmen, aber die Wärmenutzung selbst dient nicht dem Wasserhaushalt.
Zu beachten ist, dass in diesem Katalog das Kommunalrecht nicht aufgeführt ist und zu den Rechtsmaterien zählt, für die von einer (originären) Gesetzgebungskompetenz der Länder auszugehen ist.
Sofern Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG einschlägig sein sollte, ist zu ergänzen, dass der Bund das Gesetzgebungsrecht nur hat, „wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht“ (Art. 72 Abs. 2 GG). Für Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG gilt das nicht.
Zu beachten ist außerdem, dass das Grundgesetz zwischen den Gesetzgebungskompetenzen für das materielle Recht (vereinfachend: „über die Sache“) und für das behördliche Verfahrensrecht (Recht des Verwaltungsvollzugs) unterscheidet. Für Letztere sind die Gesetzgebungskompetenzen in Art. 84 GG gesondert geregelt. Dort ist grundsätzlich von der Länderzuständigkeit auszugehen.
3.3.2 Informationsansprüche Dritter
Um die Möglichkeiten der Nutzung von Abwasser für Wärmezwecke konkret einschätzen zu können, benötigen die jeweils Interessierten bestimmte Informationen über die Lage der jeweiligen Kanäle, ihre Größenmerkmale, die Abwasserfrachten und Temperaturverhältnisse etc. Diese Informationen können sie nur über die jeweiligen Betreiber der Abwasserkanäle (Netze) erhalten. Dabei handelt es sich – wie bereits erwähnt – fast immer um öffentlich- rechtliche Körperschaften oder Einrichtungen und auch in den Fällen, in denen die betreffenden Einrichtungen privatrechtlich organisiert werden, um solche, denen die Aufgabe der Abwasserbeseitigung als Hoheitsaufgabe übertragen wurde.
Je nach Rechtslage kann unter Umständen in dem jeweiligen Bundesland bzw. in der jeweiligen Kommune bereits heute ein Rechtsanspruch auf Erhalt der betreffenden Informationen bestehen. Denn in der Mehrzahl der Bundesländer existieren für die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Land geltende Informationsfreiheitsgesetze, die einen Anspruch von Privatpersonen auf amtliche Informationen vermitteln, ohne dass ein berechtigtes Interesse geltend gemacht werden muss. Lediglich in Niedersachsen und Sachsen gibt es derzeit noch überhaupt keine Bestimmungen zur Informationsfreiheit. In Bayern ist der betreffende Auskunftsanspruch allerdings an das Vorliegen eines berechtigten Interesses gebunden (siehe § 39 Abs. 1 des insoweit einschlägigen BayDSG).17 Aber auch ansonsten ist die Rechtslage in den Einzelheiten und hierbei insbesondere hinsichtlich des Anwendungsbereichs uneinheitlich. In Vgl. Kment, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 70 Rn. 17 ff. m.w.N. Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) vom 15. Mai 2018 (GVBl. S. 230, BayRS 204-1-I), das durch § 6 des Gesetzes vom 18. Mai 2018 (GVBl. S. 301) geändert worden ist.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/uba_ad_hoc_papier_abwasserwaerme.pdf