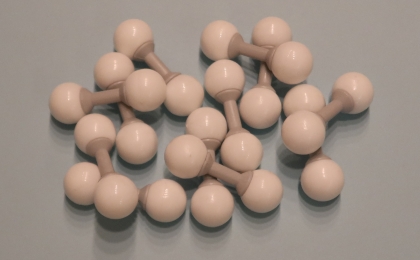ÖWAV-Seminarteaser „1. Österreichischer Wasserstofftag“
ÖWAV-Vizepräsident DI Mag. Gerhard Gamperl und Hon. Prof. Dr. Christian Schmelz stellen den 1. Österreichischen Wasserstofftag vor, der am 20. Oktober 2021 in Wien stattfinden wird…mehr:
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=427727
(nach oben)
Kommunale Abfallwirtschaft in Graz
Am 6. Oktober 2021 veranstaltete der ÖWAV, in Kooperation mit dem Land Steiermark, das Seminar „Kommunale Abfallwirtschaft“ unter dem Thema „Herausforderungen, Strategien und Praxis“ in Graz.
Nach Begrüßung und Eröffnung durch Mag. Evelyn Wolfslehner (BMK) und HR DI Johann Wiedner (Amt d. Stmk. LR) startete die Veranstaltung mit Block 1 unter dem Titel „Herausforderungen und Strategien“, moderiert durch Mag. Dr. Ingrid Winter. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Notfallplanungen auch in der kommunalen Abfallwirtschaft fest verankert sein sollten. Eine Branche, welche eine umfassende Erfahrung auf diesem Gebiet hat, ist die Stromversorgung; der heurige Plenarvortrag betrachtete dieses Thema aus dem Blickwinkel der österreichischen Übertragungsnetzbetreiberin APG. Neben wesentlichen Schritten zur Umsetzung des Kreislaufwirtschaftspaketes auf Bundes- und Landesebene wurde der Frage nachgegangen, wie die Weiterentwicklung der kommunalen Abfallwirtschaft hin zu einem ganzheitlichen Abfall- und Ressourcenmanagement gelingen kann.
DI Elisabeth Punesch (Amt d. NÖ LR) führte nachfolgend durch den zweiten Veranstaltungsteil „Biogene Abfälle – Praxisberichte“. Der 2. Themenblock spannte den Bogen von der Relevanz der biogenen Abfälle für die Erreichung der Recyclingquoten bis hin zu Praxisbeispielen, wie deren getrennte Sammlung besser gelingen kann.
Der letzte Teil des Seminars, moderiert durch GF DI Georg Pfeifer, widmete sich „Zukunftsthemen für die kommunale Abfallwirtschaft“, so diskutierten u.a. im Round Table hochkarätige VertreterInnen der Branche zur Problematik Alttextilien.
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=430735
(nach oben)
Coronavirus: Basisinformationen für die Betreiber von Abwasseranlagen
Basisinformationen für Betreiber von Abwasseranlagen zum SARS-CoV-2 Virus (COVID-19 Pandemie)
Informationen: ÖWAV-Kernteam COVID-19 und Abwasser (Stand: Juli 2021)
Sehr geehrte Anlagenbetreiber und ÖWAV-Mitglieder!
Aufgrund der laufenden Entwicklungen rund um die COVID-19 Pandemie ist der Österreichische Wassser-und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) in bundesweite ExpertInnengruppen eingebunden. Der ÖWAV hat für die Betreiber von Abwasseranlagen die folgenden Informationen zusammengestellt. Es wird ersucht, die angeführten Empfehlungen jedenfalls kritisch zu prüfen und – soweit zutreffend – im eigenen Bereich anzuwenden.
Gegebenenfalls sollten zusätzliche Schritte im Sinne dieser Empfehlungen gesetzt werden, angepasst an die konkreten Bedingungen für den Betrieb der eigenen Anlage.
Die folgenden Informationen und Empfehlungen basieren auf regelmäßig durchgeführten Recherchen sowie ExpertInnengesprächen seitens des ÖWAV (siehe auch die unten angeführten Links) und werden durch den ÖWAV-Ausschuss Team COVID-19 & Abwasser getragen, welcher eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe bestehend aus der Interaktion FG Qualität und Hygiene sowie FG Abwassertechnik und Gewässerschutz darstellt. Die laufenden Recherchen zum Stand des Wissens zu COVID-19 und Abwasser basieren auf der Recherche und Analyse der international verfügbaren qualitätsgesicherten aktuellen Literatur in akkreditierten Datenbanken. Bis Dato konnten über 300 spezifische Arbeiten zum Thema gefunden werden.
Eine zentrale Frage: Kommen infektiöse SARS-CoV-2-Viren im Abwasser vor?
Laut derzeitigem Stand der international anerkannten wissenschaftlichen Literatur werden infektiöse Partikel über den Stuhl infizierter Personen nicht oder nur in sehr geringen Konzentrationen in das Abwasser ausgeschieden. Der Hauptübertragungsweg ist die aerogene Übertragung von Mensch zu Mensch (Aerosole, Tröpfchen). Auf Basis von Informationen über verwandte Corona-Viren ist anzunehmen, dass selbst wenn infektiöse SARS-CoV-2-Viren ins Wasser gelangen, diese deutlich kürzer infektiös bleiben als andere bekannte fäkalbürtige virale Krankheitserreger (z.B. Rotaviren, Adenoviren, Noroviren, Hepatitis A Viren). Aktuelle Laborstudien mit Abwasser und experimentell hinzugefügten infektiösen SARS-CoV-2-Viren deuten jedoch darauf hin, dass diese Virenpartikel durchaus für einige Zeit im Rohabwasser infektiös bleiben können.
Das Risiko einer Übertragung durch Fäkalien wird von der WHO aufgrund des derzeitigen Informationsstandes als gering bewertet (WHO Website 01.04.2021: Interime Guidance Document 29.7.2020). Das Auftreten infektiöser SARS-CoV-2-Partikel kann in kommunalem Abwasser jedoch nicht ausgeschlossen werden. Ungeachtet dessen sind die einschlägigen arbeitshygienischen und arbeitsmedizinischen Richtlinien für Abwasseranlagen so ausgelegt, dass sie alle mikrobiologischen Gefährdungen, einschließlich solcher durch Viren, umfassen und dass die vorzusehenden Maßnahmen zur Reduktion der Infektionsrisiken effektiv und optimal ausgelegt sind. Das konsequente Einhalten der allgemeinen Arbeitsschutzregeln und betrieblichen Hygienemaßnahmen reicht auch für den Schutz gegen SARS-CoV-2 völlig aus. Das gilt ebenso für unterschiedliche Varianten dieses Virus (Mutationen).
Nach wie vor ist gemäß der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung der Corona-Krankheit über Fäkalien als vernachlässigbar einzuschätzen. Die prinzipielle Übertragbarkeit über Fäkalien konnte jedoch anhand einer Tierstudie mit Frettchen experimentell gezeigt werden. Seitens der WHO wird das Betriebspersonal von Wasser- oder Abwasseranlagen nicht als eine besonders gefährdete Berufsgruppe eingeschätzt, und es wurde bis Dato keine gehäufte Anzahl an Erkrankungen unter dieser Personengruppe nachgewiesen.
Mit Hilfe der PCR-Nachweismethode (molekularbiologische Nachweismethoden für DNA- oder RNA-Moleküle) können Teile der SARS-CoV-2-RNA (RNA, Ribonukleinsäure) in kommunalem Abwasser nachgewiesen und Varianten (Mutationen) von SARS-CoV-2 im Abwasser durch Sequenzierung unterschieden werden. Bei der im Abwasser nachweisbaren RNA handelt es sich um genetisches Material des Virus im Zufluss von Kläranlagen, von welchem keine Ansteckungsgefahr ausgeht. Diese Nachweismethode („abwasserbasierte Epidemiologie“) wird mittlerweile in vielen Ländern und Regionen der Welt zur Bereitstellung ergänzender Informationen zum COVID-19-Infektionsgeschehen in der Bevölkerung für Gesundheitsbehörden herangezogen. Als Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung eines solchen Abwasser-Monitorings in Österreich kann die Vorgangsweise der Länder Tirol (www.tirol.gv.at/covid-abwasser) und Vorarlberg (vorarlberg.at/-/covid-19-covid-19-abwasserüberwachung-in-vorarlberg) genannt werden.
Der ÖWAV ist bestrebt, zum Thema „Corona im Abwasser“ aktuelle Informationen zu sammeln und seinen Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Seit Anfang Juni 2020 existiert eine hierfür eingerichtete ÖWAV Arbeitsgruppe zum Thema COVID Pandemie und Abwasser, die in alle diesbezüglichen Fragestellungen eingebunden ist und auch eine laufende Evaluierung zum Stand des Wissens und der Pandemiesituation vornimmt (> Team COVID-19 und Abwasser).
Empfehlungen – folgende Punkte sind möglichst zu beachten:
• Strikte Einhaltung der allgemeinen Arbeitsschutzregeln und betrieblichen Hygienemaßnahmen (Maßnahmenplanung und Evaluierung gemäß ÖWAV Regelblatt 405)
• Ressourcenplanung in Bezug auf Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Desinfektionsmittel beachten (Lieferengpässe!)
• Nicht unbedingt notwendige Tätigkeiten auf einen späteren Zeitpunkt verschieben
• Vorausplanung Notbetrieb: Es kann zu personellen Engpässen (und damit zu Einschränkungen des Normalbetriebs) kommen:
– Welche Aufgaben sind auch im Notbetrieb zu leisten?
– Wer steht zur Verfügung?
– Welche Funktionen können über die Fernwartung gesichert werden?
– Welche Kommunikationswege stehen bei eingeschränkter Mobilität (verordnete Ausgangssperren u.Ä.) zur Verfügung?
• Entsprechende Planung von Schicht- bzw. Bereitschaftsdiensten (z.B. wechselweiser Dienst zur Kontaktvermeidung, fernmündliche Dienstübergaben bzw. unter möglichst einfacher Nutzung schriftlicher digitaler Kommunikation, Reinigung bzw. Desinfektion von Arbeitsplätzen, keine gemeinsamen Pausen)
• Unterstützung zwischen benachbarten Anlagen (Nützen der Kontakte in den ÖWAV-Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften)
• Kontakte im Betrieb (und auch im Privaten) auf ein notwendiges Maß reduzieren und die allgemeinen Verhaltensregeln einhalten (siehe Links unten)
• Ausstellen einer Bestätigung durch den Betreiber (Gemeinde, Abwasserverband etc.) für jene Mitarbeiter, die für Betrieb und Aufrechterhalten der Funktionsfähigkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie insbesondere der Abwasserentsorgung im Einsatz sind (zum Mitführen mit dem Ausweis im Falle von Ausgangsbeschränkungen)
Hinweis: Die Umsetzung bzw. Prüfung der angeführten Maßnahmen muss kritisch und in Bezug auf den eigenen Betrieb erfolgen. Dies sollte in Eigenverantwortung auch dann geschehen, wenn keine ausdrücklichen individuell oder generell anzuwendenden rechtlichen Vorgaben definiert sind.
Die ExpertInnen beim ÖWAV sind bemüht, die Entwicklungen laufend zu beobachten und aktuelle Informationen an die Anlagenbetreiber weiterzugeben.
Hier erhalten Sie weiterführende Informationen:
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=391804
(nach oben)
Österreichische Wasserwirtschaftstagung 2021
Die alle vier Jahre stattfindende Österreichische Wasserwirtschaftstagung mit dem Schwerpunkt Abwasser stand in diesem Jahr unter dem Leitthema „Die Abwasserwirtschaft in Österreich – Im Spannungsfeld von Krisen und neuen Herausforderungen“. Die in Kooperation mit dem Land Steiermark, dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und der Graz Holding am 23. und 24. Juni 2021 als Webinar veranstaltete Tagung bot VertreterInnen von Kommunen, Verbänden und Behörden, aber auch PlanerInnen, und VertreterInnen der Wirtschaft und Wissenschaft die Möglichkeit, aktuelle Fragestellungen der Abwasserwirtschaft zu diskutieren.
Eröffnet wurde die Veranstaltung mit über 140 TeilnehmerInnen von ÖWAV-Präsident BR h.c. DI Roland Hohenauer. Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl, Stadt Graz und Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus per Video-Grußbotschaften sowie LR Ök.-Rat Johann Seitinger, Land Steiermark, lobten die Krisenfestigkeit der österreichischen Wasserver- und Abwasserentsorgung und leiteten mit ihren Begrüßungsworten in die Vorträge ein.
Im anschließenden Festvortrag erläuterte Vorstandsvorsitzende DI Dr. Sabine Herlitschka, MBA, von der Infineon Technologies Austria AG, ihre Ansätze zu neuen Chancen im Hinblick auf die Corona-Pandemie unter dem einst von Winston Churchill verkündeten: „Never waste a good crisis“. In den fachlichen Vorträgen wurden einerseits technische Innovationen und Anlagen, andererseits aber auch organisatorische und wirtschaftliche Herausforderungen insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie präsentiert. Im Programm enthalten waren sowohl Vorträge zum Themenbereich Kläranlagen, als auch zum Themenbereich Kanalanlagen. Zudem wurde erstmals ein Block von der Jungen Wasserwirtschaft im ÖWAV unter dem Motto „Die Umsetzung einer nachhaltigen Wasserwirtschaft aus Sicht der Jungen im ÖWAV“ gestaltet. Gastvorträge aus Europa rundeten das Programm ab. Nele Rosenstock, MSc, Europäische Kommission, DG Environment, gab dazu einen Einblick über die aktuelle Folgenabschätzung für die Revision der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser (UWWTD) während Oliver Loebel, Generalsekretär der EurEau, über die Ziele der europäischen Abwasserwirtschaft für die Neufassung des gesetzlichen Rahmens in der EU referierte.
Den Abschluss der Veranstaltung bildeten die Schlussworte von Univ.-Prof. DI Dr. Thomas Ertl, ÖWAV-Vorstand und Vorsitzender der ÖWAV-Fachgruppe „Abwassertechnik und Gewässerschutz“.
Der ÖWAV bedankt sich bei allen Mitwirkenden und Vortragenden sowie bei allen Teilnehmer und Sponsoren für die Durchführung dieser erfolgreichen Tagung.
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=424395
(nach oben)
Webinar „Fischschutz & Fischabstieg“
Am 16. Juni 2021 veranstaltete der ÖWAV im Rahmen des Schwerpunktjahres Hochwasserschutz das Webinar „Fischschutz und Fischabstieg – Erfordernisse, Sichtweisen, Maßnahmen“. Wasserkraftanlagen verändern Fließgewässer. Die flussabwärts gerichtete Wanderung von Fischen wird oft erheblich eingeschränkt. Der Fischschutz und der Fischabstieg stellen die Fachleute vor große Herausforderungen. Im Rahmen des Seminars wurden Antworten auf wichtige Fragen gesucht und diskutiert: Wie hoch müssen die Anforderungen an Fischschutzeinrichtungen sein? Wie ist die gesetzliche Situation? Wie ist der Stand der Forschung Welche Möglichkeiten des Fischschutzes gibt es schon heute?
Univ.Prof.Dr.-Ing. Markus Aufleger (Universität Innsbruck), DI Peter Matt (FG-Leiter „Wasserbau, IB und Ökologie“ / ÖWAV-Vorstand) und DI Markus Federspiel (FG-Leiter „Wasserbau, IB und Ökologie“ / ÖWAV-Vorstand) eröffneten die Veranstaltung und begrüßten die rund 80 Teilnehmer:innen zum Webinar.
Univ. Prof. DI Dr. Stefan Schmutz (Boku Wien) führte durch den ersten Block, in dem die ExpertInnen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zum Thema „Erfordernisse und Möglichkeiten zum Schutz von Fischen an Wasserkraftanlagen“ referierten.
Im Laufe der Veranstaltung konnten die TeilnehmerInnen ihre Fragen und Anmerkungen nicht nur über die Chat-Funktion sondern auch direkt über ihr Mikrofon einbringen, was trotz der virtuellen Durchführung doch einen guten Dialog und Erfahrungsaustausch ermöglichte.
Der zweite und zugleich letzte Teil der Veranstaltung, moderiert von DI Dr. Robert Fenz (BMLRT), widmete sich den „Fischschutzmaßnahmen an Wasserkraftwerken“. Im Anschluss an die Diskussion übergab Robert Fenz das abschließende Wort an Univ.Prof.Dr.-Ing. Markus Aufleger, der die ZuschauerInnen nach einem kurzen Resümee verabschiedete.
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=423787
(nach oben)
Erste ÖWAV-Kurse „Fettabscheider-Schulungsnachweis“ abgehalten
Nach einer coronabedingten Verschiebung konnten unter Einhaltung der aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen und mit strengem COVID-19 Sicherheitskonzept am 8. Juni in Salzburg sowie am 10. Juni 2021 in Wien die ersten beiden Kurse des neuen ÖWAV-Ausbildungskurses „Fettabscheider-Schulungsnachweis“ abgehalten werden.
Unter der Leitung von Ing. Gerhard Gross, welcher auch als Leiter des ÖWAV-Unterausschusses „Fettbelastete Abwässer“ intensiv in die Überarbeitung des ÖWAV-Regelblattes 39 „Einleitung von fetthaltigen Betriebsabwässern“ eingebunden war, wurden den jeweils ca. 20 Teilnehmer:innen (die Kurse waren somit ausgebucht) die notwendigen Kenntnisse, um den ordnungsgemäßen Betrieb, die Wartung und die jährliche Überprüfung einer Fettabscheideranlage durchführen zu können, vermittelt. Der Abschluss dieses Kurses dient als Schulungsnachweis für das Ansuchen um erleichterte Überwachung (gem. IEV § 4 Abs. 5a) als Alternative zum Abschluss eines Wartungsvertrages und die Teilnehmer:innen können somit beim zuständigen Kanalisationsunternehmen als eingeschulte Person namhaft gemacht werden.
Für Herbst 2021 sind zwei weitere Kurse geplant. Eine Anmeldung ist bereits möglich!
• 14. Oktober 2021, Graz
• 23. November 2021, Innsbruck
Information und Anmeldung: ÖWAV, Isabella Seebacher, Tel.: +43-1-535 57 20-82, seebacher@oewav.at,
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=423774
(nach oben)
Online-Kamingespräch der „Jungen Abfallwirtschaft“
Bei ihrem ersten Kamingespräch am 1. Dezember 2020 beleuchtete die „Jungen Abfallwirtschaft im ÖWAV“ das Thema „Der Austrian Green Deal“. Bei dieser Online-Veranstaltung, die überaus gut besucht war, konnten mit Mag. Sarah Warscher (BMK) und Prof. DI Dr. Vasiliki-Maria Archodulaki (TU Wien) zwei kompetente Interviewpartnerinnen aus Politik und Forschung interviewt werden. Dabei wurde unter anderem über zielführende Ansätze zur Umsetzung des „Green Deals“ diskutiert. Auch die knapp 50 TeilnehmerInnen nutzten die Chance, Fragen an die Expertinnen zu richten.
https://www.oewav.at/Page.aspx?taret=406113
(nach oben)
Coronavirus-Update: Informationen für die Betreiber von Abwasseranlagen
Informationen für Betreiber von Abwasseranlagen zum COVID-19 Virus (SARS-CoV-2)
Informationen: ÖWAV-Kernteam COVID-19 und Abwasser
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sehr geehrte Anlagenbetreiber und ÖWAV-Mitglieder!
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das COVID-19 Virus ist der ÖWAV auch in bundesweite ExpertInnengruppen eingebunden. Der ÖWAV hat für alle Betreiber von Abwasseranlagen die folgenden Informationen zusammengestellt. Es wird ersucht, die angeführten Empfehlungen jedenfalls kritisch zu prüfen und – soweit zutreffend – im eigenen Bereich anzuwenden.
Gegebenenfalls sollten zusätzliche Schritte im Sinne dieser Empfehlungen gesetzt werden, angepasst an die konkreten Randbedingungen für den Betrieb der eigenen Anlage.
Die folgenden Informationen und Empfehlungen basieren auf Recherchen sowie ExpertInnengesprächen seitens des ÖWAV (siehe auch die unten angeführten Links und die neu etablierte ÖWAV-Arbeitsgruppe zum Thema COVID19 und Abwasser).
Kommen infektiöse SARS-CoV-2 Viren im Abwasser vor? Laut derzeitigem Stand des Wissens werden infektiöse Partikel über den Stuhl infizierter Personen nicht oder nur in sehr geringen Konzentrationen in das Abwasser ausgeschieden. Der Hauptübertragungsweg ist die aerogene Übertragung von Mensch zu Mensch (Aerosole, Tröpfchen, Spritzer). Auf Basis von Informationen zu verwandten Corona-Viren ist anzunehmen, dass selbst wenn infektiöse SARS-CoV-2 Viren ins Wasser gelangen, diese im Wasser oder im Abwasser deutlich kürzer infektiös bleiben als andere bekannte abwasserbürtige virale Krankheitserreger (z.B. Rotaviren, Adenoviren, Noroviren, Hepatitis-A-Viren).
Das Risiko einer Übertragung durch Fäkalien wird von der WHO aufgrund derzeitiger Information daher als gering bewertet (Stand 23.4.2020). Ungeachtet dessen, sind die einschlägigen arbeitshygienischen und arbeitsmedizinischen Richtlinien für Abwasseranlagen so ausgelegt, dass sie alle mikrobiologischen Gefährdungen, einschließlich solcher durch Viren, beinhalten und dass deren Maßnahmen zur Reduktion der Infektionsrisiken effektiv und optimal ausgelegt sind. Das Einhalten der allgemeinen Arbeitsschutzregeln und betrieblichen Hygienemaßnahmen sind daher auch gegen SARS-CoV-2 als ausreichend anzusehen.
Nach den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung der Krankheit über Fäkalien nach wie vor gering, bis heute ist kein einziger Fall bekannt. Nach einer Information der WHO ist auch nicht bekannt, dass das Betriebspersonal von Wasser- oder Abwasseranlagen eine besonders gefährdete Berufsgruppe ist, oder dass sich eine gehäufte Anzahl an Erkrankungen unter dieser Personengruppe befindet.
Mittlerweile wurden von verschiedenen Forschungsgruppen Teile des SARS-CoV-2 Virus (RNA, Ribonukleinsäure) im Abwasserstrom nachgewiesen (mittels molekularbiologischer Testungen). Dabei handelt es sich um genetisches Material im Zufluss von Kläranlagen, von welchem keine Ansteckungsgefahr ausgeht.
Der ÖWAV ist bestrebt, zum Thema „Corona im Abwasser“ aktuelle Informationen zu sammeln und seinen Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Seit Anfang Juni existiert eine hierfür eingerichtete ÖWAV-Arbeitsgruppe zum Thema COVID Pandemie und Abwasser, die in alle diesbezüglichen Fragestellungen eingebunden ist und auch eine laufende Evaluierung zum Stand des Wissens und der Pandemiesituation vornimmt (> ÖWAV-Arbeitsgruppe).
Empfehlungen – folgende Punkte sind möglichst zu beachten:
• Strikte Einhaltung der allgemeinen Arbeitsschutzregeln und betrieblichen Hygienemaßnahmen (gemäß Evaluierung, Maßnahmenplanung und ÖWAV-Regelblatt 405)
• Ressourcenplanung in Bezug auf PSA und Desinfektionsmittel beachten (Lieferengpässe!)
• Nicht unbedingt notwendige Tätigkeiten auf einen späteren Zeitpunkt verschieben
• Vorausplanung Notbetrieb: Es kann zu personellen Engpässen (und damit zu Einschränkungen des Normalbetriebs) kommen:
> Welche Aufgaben sind auch im Notbetrieb zu leisten?
> Wer steht zur Verfügung?
> Welche Funktionen können über die Fernwartung gesichert werden?
> Welche Kommunikationswege stehen bei eingeschränkter Mobilität zur Verfügung?
• Entsprechende Planung von Schicht- bzw. Bereitschaftsdiensten (z.B. wechselweiser Dienst zur Kontaktvermeidung, fernmündliche Dienstübergaben, Reinigung bzw. Desinfektion von Arbeitsplätzen, keine gemeinsamen Pausen)
• Abstimmung in der Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaft bzgl. Vertreterregelungen
• Kontakte im Betrieb (und auch im Privaten) auf ein notwendiges Maß reduzieren und die allgemeinen Verhaltensregeln einhalten (siehe Links unten)
• Ausstellen einer Bestätigung mit Firmenstempel, die die Mitarbeiter als Arbeitskraft in der Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge ausweist (zum Mitführen mit dem Ausweis im Falle von Ausgangsbeschränkungen)
Hinweis: Aktuell gibt es zu den oben angeführten Punkten keine gesetzlichen Vorgaben. Die Umsetzung bzw. Prüfung der angeführten Maßnahmen muss kritisch und in Bezug auf den eigenen Betrieb erfolgen.
Der ÖWAV ist bemüht die aktuelle Situation ständig zu beobachten und aktuelle Informationen an die Anlagenbetreiber weiterzugeben.
Hier erhalten Sie weiterführende Informationen:
NEU (Nov. 2020): > COVID-19: Regelungen zum Aufrechterhalten des Anlagenbetriebs für kommunale Trinkwasserversorgungsanlagen und für kommunale Abwasserentsorgungsanlagen (Land Tirol, Stand: 10.11.2020)
Information zum Thema Abwasser
DWA: Gefährdung durch Coronavirus
DWA: Pandemiemaßnahmen in Abwasserbetrieben
WHO
SVGW: Pandemiehandbuch
Informationen der Länder bzgl. Corona in der Wasserwirtschaft
Niederösterreich
Oberösterreich
Steiermark
Tirol
Vorarlberg (allgemeine Information, die Anlagenbetreiber werden vom Amt der Vorarlberger Landesregierung direkt kontaktiert)
ÖWAV-Regelwerk in Bezug auf Hygiene
ÖWAV-Regelblatt 405 „Arbeitshygienische und arbeitsmedizinische Richtlinien für Abwasseranlagen“ (aus dem Jahr 2016, welches im Rahmen der Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften an alle teilnehmenden Anlagen verteilt wurde)
ÖWAV-Hygiene-Merkblatt für das Betriebspersonal von Abwasseranlagen
Allgemeiner Umgang
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES)
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin – Infektionsprävention
Robert-Koch-Institut
WHO
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=391804
(nach oben)
Aktuelle Information zu SARS-CoV-2-Viren und Betrieb von Abwasseranlagen
Aktuelle Information der ÖWAV-Arbeitsausschüsse „Kläranlagenbetrieb“ und „Team COVID-19 und Abwasser“ zu SARS-CoV-2-Viren und Betrieb von Abwasseranlagen (Stand: 4.12.2020)
www.oewav.at/sars_abwasser
(nach oben)