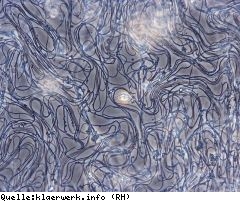Emschergenossenschaft gewinnt internationalen Preis für Wasserstoff-Projekt
Die EMSCHERGENOSSENSCHAFT wurde von der International Water Association (IWA) mit dem Project Innovation Award für ihr Wasserstoff-Projekt ausgezeichnet. Auf der Kläranlage in Bottrop stellt das Wasserwirtschaftsunternehmen in einem Forschungsprojekt aus Faulgas Wasserstoff her.
Die IWA mit Hauptsitz in London zeichnet jährlich weltweit herausragende Projekte im Bereich des Wasseringenieurswesen aus. In diesem Jahr ging der erste Preis im Bereich „Regionale Gewinner Europa“ an die EMSCHERGENOSSENSCHAFT für ihr Projekt „EuWaK – Erdgas und Wasserstoff aus Kläranlagen“. Der Preis in der Kategorie „Angewandte Forschung“ wurde am 10. September 2008 anlässlich des IWA World Water Congress in Wien verliehen. Aufgabenstellung in der genannten Kategorie ist es, neue oder verbesserte Prozesse, Instrumentarien oder Kontrollmöglichkeiten innerhalb des Wasseringenieurswesens zu entwickeln.
Wasserstoff aus Faulgas
Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft, insbesondere im Verkehrssektor. Kläranlagen können erste wichtige Bausteine der künftigen Wasserstoff-Infrastruktur sein und damit einen bedeutenden Beitrag für die Etablierung der Wasserstofftechnologie leisten.
Das Besondere am Pilotvorhaben EuWaK: Erstmals wurde die komplette, dezentrale Wasserstoff-Infrastruktur vom nachhaltigen Primärenergieträger Klärschlamm bis zum Wasserstoff-Endverbraucher errichtet. Projektziel ist die Herstellung von hochreinem Wasserstoff aus Klärschlamm und anderer Biomasse, der in Brennstoffzellen-Fahrzeugen als Kraftstoff genutzt werden kann. Aus einem Teilstrom des Faulgases der Kläranlage Bottrop wird im ersten Aufbereitungsschritt ein Produktgas mit Erdgasqualität erzeugt, das auch als Bioerdgas bezeichnet werden kann. Ein Teilstrom des Bioerdgases wird ausgeschleust und an einer Gastankstelle an betriebseigene Gasfahrzeuge abgegeben.
Im zweiten Schritt wird das übrige Bioerdgas durch Dampfreformierung zu Wasserstoff umgewandelt. Als Verbraucher für den Wasserstoff wurde keine Brennstoffzelle, sondern ein Verbrennungsmotor gewählt. Der Wasserstoffmotor reagiert bei Wasserstoff-Qualitätsschwankungen im Gegensatz zu Brennstoffzellen unsensibel, ist weitaus kostengünstiger und verfügt bei heutiger Technik über eine erheblich längere Nutzungsdauer.
Der Wasserstoffmotor steht in einer ca. 1 km von der Kläranlage entfernten Bottroper Schule mit angeschlossenem Schwimmbad und dient dort zur Strom- und Wärmeversorgung. Die Anbindung der Wasserstofferzeugung an die Schule erfolgt über eine Rohrleitung.
Die Bautätigkeiten für die Anlage wurden im Mai 2007 begonnen und innerhalb von sieben Monaten abgeschlossen. Ende 2007 begann die Inbetriebnahme, die im 4. Quartal 2008 endet. Es folgt ein zweijähriger Forschungsbetrieb, der vor allem der Optimierung der Gesamtanlage und der wissenschaftlichen Auswertung dient. Damit wird eine fundierte Datenbasis geschaffen, um Entscheidungsgrundlagen über den weiteren Betrieb der EuWaK-Anlage und die Abschätzung der Übertragbarkeit auf weitere Kläranlagenstandorte zu gewinnen.
Hintergrundinformation:
EMSCHERGENOSSENSCHAFT und LIPPEVERBAND sind als regionaler Träger der Wasserwirtschaft im Einzugsgebiet von Emscher und Lippe u. a. für die Reinigung des Abwassers von ca. 4 Mio. Einwohnern und fast 3 Mio. Einwohnergleichwerten aus Industrie und Gewerbe zuständig. Hierfür werden 58 Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von 500-2,4 Mio. Einwohnerwerten betrieben. Als einer der größten Kläranlagenbetreiber Deutschlands hat die EMSCHERGENOSSENSCHAFT frühzeitig entschieden, die Erzeugung von Bioerdgas und Wasserstoff im Demonstrationsvorhaben EuWaK (Erdgas und Wasserstoff aus Kläranlagen) auf der Kläranlage Bottrop zu testen und weiterzuentwickeln. Das Projekt wird mit Förderung des Landes NRW und der Europäischen Union realisiert. Projektpartner der EMSCHERGENOSSENSCHAFT sind das Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW), das Ingenieurbüro Redlich und Partner GmbH (IBR), die Tuttahs & Meyer Ingenieurgesellschaft für Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft mbH (T&M) und die Stadt Bottrop.
Weitere Information unter www.iwahg.org bzw. www.eglv.de