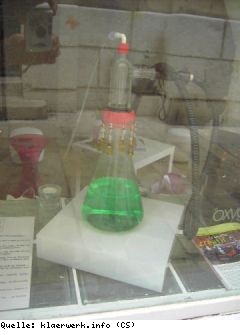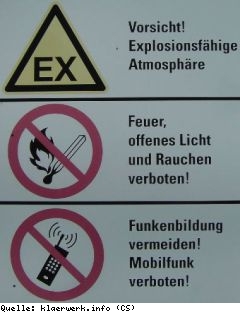OLG Karlsruhe 1.2.2010, 1 U 137/09
Wird ein Gullydeckel unterspült, angehoben, von einem darüber fahrenden Fahrzeug beschädigt, hoch geschleudert und verletzt den Fahrer eines nachfolgenden Kraftfahrzeugs, so können diesem Ansprüche gegen die Gemeinde als Inhaberin einer Rohrleitungsanlage aus § 2 Abs. 2 i.V.m. § 6 HPflG zustehen. In solchen Fällen steht das Unfallgeschehen in engem räumlichen und zeitlichen Ursachenzusammenhang mit den Wirkungen des Wassers.
Sachverhalt:
Der Kläger ist ein heute 29-jähriger Lkw-Fahrer. Er war im Sommer 2005 mit einem Sattellastzug bei Dämmerung und starkem Regen eine Tour gefahren. Er bewegte sich schließlich zwischen zwei Feuerwehrautos, die sich im Einsatz unter Sondersignal befanden. Das vor ihm fahrende Fahrzeug, ein Lkw Unimog, überfuhr einen Kanaldeckel, der vom starken Regen unterspült und aus seiner Fassung gehoben worden war. Der Kanaldeckel zerbrach und ein Teil des gusseisernen Kranzes mit einem Gewicht von etwa vier Kilogramm schleuderte gegen die Windschutzscheibe des 30 Meter dahinter fahrenden Klägerfahrzeugs.
Der Kläger konnte den Sattelzug von 52 km/h auf 48 km/h abbremsen. Das Kanaldeckelstück zerschlug die Windschutzscheibe und traf auf sein Gesicht. Der Kläger wurde daraufhin zwei Wochen stationär behandelt und musste sich mehreren gesichtschirurgischen und zahntechnischen Eingriffen unterziehen. Die Haftpflichtversicherung der beklagten Gemeinde hatte außergerichtlich ein Schmerzensgeld von 9.000 € an den Kläger gezahlt. Der Kläger verlangte allerdings weitere 56.000 €.
Die Beklagte verweigerte die Zahlung. Sie war der Ansicht, den Kläger träfe ein hälftiges Mitverschulden. Der Unfall sei so nur geschehen, weil der Kläger zum einen seiner Pflicht nicht nachgekommen sei, das hinter ihm fahrende Tanklöschfahrzeug vorbeifahren zu lassen. Zum anderen sei er mit einer Geschwindigkeit von 17 bis 23 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit deutlich zu schnell gewesen.
Das LG gab der Klage i.H.v. weiteren 31.000 € statt. Die hiergegen gerichteten Berufungen blieben vor dem OLG erfolglos. Die Revision vor dem BGH wurde nicht zugelassen.
Gründe:
Die beklagte Stadt ist dem Kläger gem. § 2 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 6 HaftPflG zum Ersatz des entstandenen materiellen und immateriellen Schadens verpflichtet.
Ein Kanalisationsnetz zählt zu den unter § 2 HaftpflG fallenden Rohrleitungsanlagen. Die Haftung hängt nicht davon ab, ob die Anlage unter Druck steht. Der Gesetzgeber hat im Interesse eines umfassenden Schutzes der Betroffenen auch die Fälle in die Haftung einbezogen, in denen – wie bei einem Kanalisationssystem – Flüssigkeiten lediglich unter Ausnutzung des Gefälles in Rohrleitungsanlagen transportiert werden.
Die mit der Ableitung des Wassers grundsätzlich verbundene Betriebsgefahr hatte sich dadurch verwirklicht, dass die Anlage der Belastung nicht standhielt und nicht mehr in der Lage war, das Wasser zu „leiten“. Nichts anderes gilt, wenn ein Kanaldeckel durch Oberflächenwasser unterspült und angehoben wird. Dass der Schaden mechanisch weiter dadurch mit verursacht wurde, dass der Kanaldeckel zerbrach, ein Stück durch das vorausfahrende Feuerwehrauto aufgewirbelt und durch die Windschutzscheibe geschleudert wurde, änderte nichts an der Erfüllung des Haftungstatbestandes. Denn das Unfallgeschehen stand in engem räumlichen und zeitlichen Ursachenzusammenhang mit den Wirkungen des Wassers.
Der Kläger musste sich weder ein Mitverschulden nach § 4 HaftPflG i.V.m. § 254 BGB noch die Betriebsgefahr des von ihm geführten Sattelschleppers nach § 254 BGB i.V.m. § 17 Abs. 4 StVG anrechnen lassen. Laut Sachverständigem wären die Verletzungen des Klägers auch entstanden, wenn dieser eine Geschwindigkeit von 30 km/h eingehalten hätte. Auch ein etwaiger Verstoß des Klägers gegen das Gebot, Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz überholen zu lassen, war nicht als Mitverschulden zu werten. Diese Sorgfaltspflicht bezweckt nur, dass die Feuerwehrfahrzeuge möglichst schnell an den Einsatzort kommen. Sie soll aber nicht verhindern, dass ein Fahrzeug weiter hinter einem anderen herfahren kann und dort den Gefahren, die von einem vorausfahrenden Fahrzeug ausgehen, ausgesetzt ist.
Linkhinweis:
Den Volltext der Entscheidung finden Sie auf den Webseiten der Landesrechtsprechungsdatenbank Baden-Württemberg.
Quelle: http://www.otto-schmidt.de/zivilrecht_zivilverfahrensrecht/news_16282.html