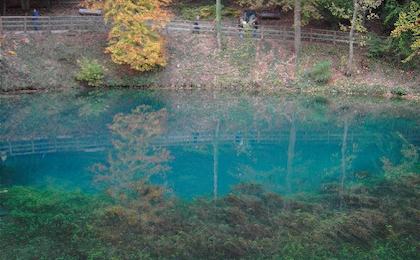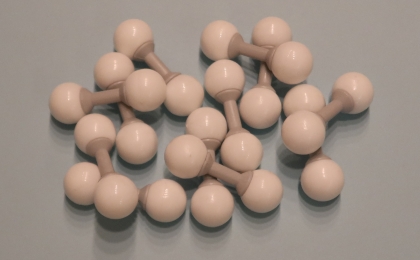Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft der Männer 2024 (EURO 2024) in Deutschland führt der Verein „a tip: tap“ im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMUV) eine „Trinkbrunnen-Kampagne“ durch. Der VKU unterstützt die Kampagne gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund sowie anderen Partnern. Kommunale Wasserversorger können sich ab Januar 2024 um einen von 51 öffentlichen Trinkbrunnen bewerben. Die ausgewählten Bewerber erhalten 15.000 Euro für Kauf, Bau, Wartung und mindestens fünfjährigem Betrieb eines Trinkbrunnens an einem öffentlich zugänglich viel frequentierten Ort.
Sofern Sie Interesse an der Kampagne haben, können Sie bereits jetzt unverbindlich Ihr Interesse bekunden und werden zum Start der Trinkbrunnen-Kampagne informiert. Dafür senden Sie eine E-Mail an euro-trinkbrunnen@atiptap.org. Weitere Informationen, auch zu den Bewerbungsmodalitäten, entnehmen Sie dem hier hinterlegten Ankündigungstext oder der Website des Vereins a tip: tap unter www.euro-trinkbrunnen.de.
Das Projekt „EURO 2024 NACHHALTIG: EIN SPIEL – EIN TRINKBRUNNEN“ wird vom BMUV aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
https://www.vku.de/themen/umwelt/artikel/trinkbrunnen-kampagne-zur-euro-2024-bewerbungsphase-fuer-kommunale-wasserversorger-startet-im-januar-2024/
Trinkbrunnen-Kampagne zur EURO 2024: Bewerbungsphase für kommunale Wasserversorger startet im Januar 2024
Neue Kläranlage für Universität der Bundeswehr München
Das Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik der Universität der Bundeswehr München hat eine neue Versuchskläranlage in Betrieb genommen. Die Anlage ermöglicht Untersuchungen im Technikumsmaßstab. Dies ermöglicht es, Grenzen im Betrieb bis hin zum Betriebsversagen zu untersuchen, was im großtechnischen Maßstab nicht möglich ist, da dies mit direkten Auswirkungen auf den Gesundheits-, Gewässer- und Ressourcenschutz verbunden wäre. Die Versuchsanlage arbeitet nach dem Belebungsverfahren. Durch den modularen Aufbau der Anlage ist zudem eine maßgeschneiderte Anpassung an individuelle Betriebsanforderungen möglich. Ein zentraler Aspekt der Anlage ist die kontinuierliche Datenerfassung durch Online-Sensoren. Mittels Filtration wird eine zuverlässige Partikelentfernung sichergestellt. Sand und Aktivkohle werden hier als effektive Filtermedien eingesetzt, Druck und Wasserqualität werden in Echtzeit überwacht. Die Einrichtung einer zweistraßigen Versuchsanlage ermöglicht präzise Vergleiche und Bewertungen der Ergebnisse. Daten aus diesen Versuchen bilden die Grundlage für die Simulation zukünftiger Störfallszenarien in digitalen Modellen.
https://www.gfa-news.de/webcode.html?wc=20231010_001
Wasseraufbereitung in Zeiten des Klimawandels – mehr Physik beim Umweltschutz
Frischwasser gehört zu den wertvollsten Ressourcen auf unserer Erde. Nur etwa drei Prozent des weltweit verfügbaren Wassers ist Süßwasser. Immer extremer werdende Wetterverhältnisse wie Hitze und Dürren zeigen, dass es ein kostbares Gut ist. Gleichzeitig steigt der Bedarf für Frischwasser seitens der Wirtschaft und der Industrie. Denn für die Herstellung von Lebensmitteln wird enorm viel Wasser benötigt, das dann als Ab- bzw. Prozesswasser aufwändig – meist chemisch und kostspielig – gereinigt werden muss.
Forscherinnen und Forscher im Projekt PHYSICS & ECOLOGY unter der Leitung von Dr. Marcel Schneider vom Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP) in Greifswald haben nun sehr gute Ergebnisse erzielt: Physikalische Methoden wie Plasma sind in Bezug auf die Dekontamination von Ab- bzw. Prozesswasser konkurrenzfähig zu etablierten Methoden wie Ozonung, UV-Behandlung oder Aktivkohle. Die Konkurrenzfähigkeit bezieht sich sowohl auf ihre Behandlungseffektivität gegenüber Keimen und Pestiziden, als auch auf ihre Kosteneffizienz. Dr. Marcel Schneider erklärt hierzu: „Die Ergebnisse bestärken uns in unserer Annahme, dass innovative physikalische Verfahren wie zum Beispiel Plasma zur Dekontamination von Wasser eine Alternative zu herkömmlichen Methoden sein können. Wir sind damit dem Ziel, Wasser von Agrarchemikalien zu reinigen, aufzubereiten und wieder zurückzuführen, einen großen Schritt nähergekommen.“
Im Rahmen des durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Bündnisses PHYSICS FOR FOOD, das die Hochschule Neubrandenburg mit dem INP und Wirtschaftspartnern in insgesamt sieben Leitprojekten auf den Weg gebracht hat, wird an physikalischen Alternativen in der Land- und Ernährungswirtschaft geforscht. Das Ziel: In der Landwirtschaft und bei agrartechnischen Produktionsprozessen soll weniger Chemie gebraucht bzw. die Umwelt dadurch weniger belastet werden. Es geht um mehr Physik beim Klima- und Umweltschutz.
Seit Dezember 2021 ist das Projekt aus dem Labor in die Quasi-Wirklichkeit verlegt worden. Der Projektpartner Harbauer GmbH aus Berlin hat einen Demonstrator konstruiert, in dem sich 1:1 die Prozesse nachbilden lassen, die nötig sind, um durch verschiedene physikalische Verfahren aus Abwasser wieder Frischwasser zu machen.
Im Demonstrator wird mit acht Technologien gearbeitet. Dabei sind Spaltrohr, Kiesfilter, Ultrafiltration, UV-Behandlung, Ozon und Aktivkohlefilter die bereits für eine Wasseraufbereitung etablierten Technologien, während es den Einsatz von Plasma und zusätzlich Ultraschall – als insgesamt zwei vielversprechende Verfahren – noch weiter zu optimieren gilt. Mit diesen Methoden sollen neue Wege beschritten werden. Es gibt aktuell im Übrigen kaum Anlagen in der Größenordnung des Demonstrators, bei denen diese innovativen Technologien mit den etablierten Verfahren verglichen aber auch kombiniert werden können, und die bei einem hohen Durchsatz die Behandlung unter realistischen Bedingungen ermöglichen.
Seit kurzem steht dieser Demonstrator in Stralsund. Die Braumanufaktur Störtebeker GmbH hat hierfür einen Teil ihres Brauereigeländes und ihr Prozesswasser zur Verfügung gestellt. Dort sollen insgesamt ein Kubikmeter Wasser pro Stunde – also so viel wie fünf gefüllte Badewannen – durch den Demonstrator laufen, der in einem 20 Fuß-Schiffscontainer untergebracht ist. Thomas Ott, Betriebsleiter der Störtebeker Braumanufaktur, erklärt hierzu: „Unsere Brauerei zeichnet sich durch innovative Brauspezialitäten mit den besten Rohstoffen aus. Wasser spielt im gesamten Produktionsprozess eine herausragende Rolle. Wir sind sehr daran interessiert, unseren Beitrag für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu leisten und Frischwasser einzusparen, indem es insbesondere durch eine physikalische Aufbereitung wiederverwendet werden kann.“
Die Braumanufaktur in Stralsund ist dabei der zweite Standort des Demonstrators. Die ersten vielversprechenden Ergebnisse konnten auf dem Gelände der rübenverarbeitenden Fabrik in Anklam, der Cosun Beet Company GmbH & Co. KG (CBC Anklam), erzielt werden. Im Demonstrator ist das Prozesswasser behandelt worden, das nach dem Waschen der Zuckerrüben angefallen war. Miriam Woller-Pfeifer, Betriebsingenieurin bei der CBC Anklam, resümiert nach dem Einsatz des Demonstrators: „Unser Ziel ist eine komplette Kreislaufwirtschaft bei der Verarbeitung von Zuckerrüben. Wir wollen sämtliche Bestandteile optimal und nachhaltig nutzen. Die Wasseraufbereitung ist dabei ein zentraler Punkt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Die erzielten Ergebnisse stimmen uns dahingehend sehr optimistisch.“
Über PHYSICS FOR FOOD
Die Hochschule Neubrandenburg, das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP) und Wirtschaftsunternehmen starteten im Jahr 2018 das Projekt ‚PHYSICS FOR FOOD – EINE REGION DENKT UM!‘. Das Bündnis entwickelt seitdem gemeinsam mit zahlreichen weiteren Partnern neue physikalische Technologien für die Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung. Dabei kommen Atmosphärendruck-Plasma, gepulste elektrische Felder und UV-Licht zum Einsatz.
Ziel ist es, Agrarrohstoffe zu optimieren und Schadstoffe in der Lebensmittelproduktion zu verringern, chemische Mittel im Saatgut-Schutz zu reduzieren und die Pflanzen gegenüber den Folgen des Klimawandels zu stärken. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Initiative ‚WIR! – Wandel durch Innovation in der Region‘ gefördert (Förderkennzeichen 03WIR2810).
WHy: Wasserstoff aus methanolhaltigem Abwasser produzieren
Dipl.-Chem. Iris Kumpmann Abteilung Kommunikation
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Ob zur Stabilisierung der Stromnetze, als Energieträger, Rohstoff für die Industrie oder Kraftstoff für den Transportsektor – Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie der Energiewende. Doch wo kommen die großen Wassermengen her, die für die Produktion regional benötigt werden? Durch die kritische Wassersituation in vielen Regionen birgt das Thema jetzt und in Zukunft großes Konfliktpotenzial. Eine alternative Wasserquelle könnte die Methanolproduktion bieten – mit gleich mehreren Vorteilen.
Die grüne Wasserstoffwirtschaft, also Herstellung, Transport und Nutzung von nachhaltig erzeugtem Wasserstoff, ist ein Element der Energiewende – eine entsprechende Infrastruktur vorausgesetzt. Die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie sieht bis 2030 den Aufbau von 10 GW Elektrolysekapazität vor. Die Fernnetzbetreiber planen die Fertigstellung eines über 11 000 km umfassenden Wasserstoff-Kernnetzes bis 2032, das die großen Wasserstoff-Einspeiser mit allen großen Verbrauchern verbindet[1]. Vielen Regionen bereiten die Pläne jedoch Ungewissheit und Sorge: Für die Herstellung von Wasserstoff werden erhebliche Mengen an Wasser benötigt. In Zeiten des Klimawandels, mit immer längeren Trockenphasen, wird die Wasserversorgung so zum Konfliktthema. Genau da setzen Forschende des Fraunhofer UMSICHT mit dem Projekt »WHy« (Wastewater to Hydrogen – Methanol) an. Sie untersuchen die nachhaltige Bereitstellung von Wasser für die Wasserstoffherstellung.
Keine Konkurrenz zur Trinkwassergewinnung und Bewässerung
Im Verbundprojekt Carbon2Chem® entwickelt das Fraunhofer UMSICHT gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Wirtschaft ein Verfahren zur Umsetzung von Hüttengasen aus der Stahlproduktion zu Basischemikalien. Eine dieser Chemikalien ist Methanol, das unter Verwendung von CO2 aus Hüttengas und Wasserstoff synthetisiert wird. Dessen weltweit produzierte Menge lag 2018 bei 10 Mio. Tonnen[2]. Bei der Aufbereitung des durch die Synthese gewonnenen Methanols zu einem hochwertigen Produkt bleibt Abwasser mit Methanolresten im Sumpf der Destillation zurück. Dieses Abwasser steht im Fokus der Fraunhofer-Forschenden. Es eignet sich für die Elektrolyse zur Wasserstoffgewinnung und steht dabei nicht in Konkurrenz mit Trinkwassergewinnung und Bewässerung. »Zudem kann der gewonnene Wasserstoff für die Methanolproduktion wiederverwendet werden. Wir schließen auf diese Weise den Kreis«, erklärt Dr.-Ing. Ilka Gehrke, Leiterin der Abteilung Umwelt und Ressourcennutzung am Fraunhofer UMSICHT.
Laborversuche erfolgreich
Anders als bei der klassischen Wasserelektrolyse wird Wasser bei der sogenannten Methanol-assistierten-Wasserelektrolyse (MAWE) nicht allein zu H2 und O2 gespalten, sondern Wasser und Methanol reagieren zu CO2 und H2. Die theoretische Gesamtzellspannung ist dabei deutlich geringer. Ilka Gehrke: »Das heißt, die MAWE verbraucht potenziell weniger Energie als eine klassische Wasserelektrolyse. Sie ist damit wirtschaftlicher.« Die ersten Versuchsreihen im Labormaßstab sind bereits erfolgreich verlaufen. Als nächstes steht die weitere Optimierung der Methanol-assistierten-Wasserelektrolyse und die praktische Umsetzung an.
[1] https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/energiewende-und-nachhaltiges-wirtschaften…
[2] Araya, S. S., Liso, V., Cui, X., Li, N., Zhu, J., & Lennart, S. (2020). A Review of The Methanol Economy: The Fuel Cell Route. Energies, 13(3), 596.
Originalpublikation:
https://www.umsicht.fraunhofer.de/de/presse-medien/pressemitteilungen/2023/why.h…
Weitere Informationen:
https://www.umsicht.fraunhofer.de/de/projekte/why.html
WHy: Wasser für die grüne Wasserstoffwirtschaft
Schwerin: Vier große MV-Städte testen ihr Abwasser auf Keime
Schwerin ist dem bundesweiten Projekt „Abwasser-Monitoring für die epidemiologische Lageüberwachung“ beigetreten und damit testen nun vier große Städte in Mecklenburg-Vorpommern ihr Abwasser auf Krankheitskeime. Das teilte die Schweriner Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Im Zulauf der Kläranlage Schwerin-Süd würden regelmäßig Proben genommen und gut gekühlt binnen weniger Stunden ins Labor des Umweltbundesamtes nach Berlin geliefert.
Schwerin ist dem bundesweiten Projekt „Abwasser-Monitoring für die epidemiologische Lageüberwachung“ beigetreten…mehr:
https://www.stern.de/gesellschaft/regional/mecklenburg-vorpommern/kommunen–vier-grosse-mv-staedte-testen-ihr-abwasser-auf-keime-34183188.html?utm_campaign=alle-nachrichten&utm_medium=rss-feed&utm_source=standard
Meldungen zu Energie- und E-Technik
| Meldungen 2012 | Meldungen 2013 | Meldungen 2014 | Meldungen 2015 |
| Meldungen 2016 | Meldungen 2017 | Meldungen 2018 | Meldungen 2019 |
| Meldungen 2020 | Meldungen 2021 | Meldungen 2022 | Meldungen 2023 |
Bringt das die Energiewende voran? Kläranlage soll grünes Methanol produzieren
Kläranlagen dienen traditionell der Abwasserreinigung. Dass sich dort auch grünes Methanol produzieren lässt, soll eine Demonstrationsanlage in Bottrop beweisen. Mehr:
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/energie/synergien-nutzen-klaeranlage-soll-gruenes-methanol-produzieren/
Meldungen zu Hochwasser 2022
KS-Bluebox® sorgt für Sicherheit bei Starkregen
Regenwasserbewirtschaftung made bei Funke
Das Abwasserwerk Frankenberg, Eigenbetrieb der Stadt Frankenberg (Eder), vertraut bei Starkregen auf Regenwasserbewirtschaftung made by Funke. Für das neue Baugebiet „An der Marburger Straße“, auf dem in den nächsten Jahren rund 160 Wohneinheiten sowie ein Familienzentrum entstehen sollen, stellen KS-Bluebox®-Elemente der Funke Kunststoffe GmbH wichtige Bausteine des Entwässerungskonzeptes dar. Damit das Regenwasser aus dem neuen Ortsteil nicht ungedrosselt in die vorhandenen Gewässer oder in die Kanalisation gelangt, wird es kontrolliert dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt. Dabei durchläuft das Niederschlagswasser ein Schachtbauwerk, wo Schmutzstoffe zurückgehalten werden, um dann – gepuffert durch die KS-Bluebox®-Elemente – gedrosselt abgegeben zu werden. Darüber hinaus werden auf der Großbaustelle HS®-Kanalrohre in verschiedenen Nennweiten und den Farben blau und braun verlegt. Außerdem sorgen Produkte wie der CONNEX-Anschluss oder das FABEKUN®-Sattelstück für die einwandfreie Einbindung der Hausanschlussleitungen in die Sammler.
Noch ist von dem künftigen Wohngebiet „An der Marburger Straße“ im hessischen Frankenberg nicht viel zu sehen. Bagger, Lkw und umfangreiche Tiefbauarbeiten zeugen jedoch davon, dass in dem Bereich am südlichen Stadtrand oberhalb von Bockental einiges bewegt wird. Es handelt sich um ein Großprojekt, das die Stadt Frankenberg angeschoben hat. Insgesamt sollen hier rund 160 Bauplätze für Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser sowie ein Familienzentrum mit Kita- und Krippenplätzen entstehen. Derzeit läuft die Erschließung des ersten Bauabschnitts für rund 35 Wohneinheiten und das Zentrum. Im Auftrag des Abwasserwerks Frankenberg stellt die Heinrich Rohde Tief- und Straßenbau GmbH, Korbach, die komplette unterirdische Infrastruktur über Telefon, Gas, Wasser, Strom, Glasfaser bis hin zu einer Entwässerung im Trennsystem sowie eine Regenrückhaltung her. „Zur Anbindung des neuen Wohngebietes werden die frühere Kreisstraße 117 zu einer Stadtstraße umgebaut sowie zwei Kreisverkehre neu errichtet, darunter auch der erste fünfarmige Kreisverkehr Frankenbergs“, beschreibt Dipl.-Ing. Michael Schulze, Bauleiter, Heinrich Rohde Tief- und Straßenbau GmbH die umfangreichen Baumaßnahmen. „Um auch Fußgängern und Radfahrern genügend Raum zu geben, beträgt die geplante Straßenbreite sechs Meter plus beidseitiger, kombinierter Geh- und Radwege. Insgesamt summiert sich die zu schaffende Straßenfläche somit auf rund 18.500 m2.“ Mehr:
https://tmkom.de/ks-bluebox-sorgt-fuer-sicherheit-bei-starkregen/
Besser vorbereitet sein auf Starkregen und Sturzfluten
Die Universität Trier ist an einem Verbundprojekt beteiligt, das den Einsatz von Notabflusswegen während Wasser-Extremereignissen erforscht.
Starkregen und daraus entstehende Sturzfluten gab es in den letzten Jahren immer häufiger. Sie haben zu großen Schäden an der Infrastruktur und vereinzelt sogar zu Verletzten und Todesopfern geführt. Sogenannte Notabflusswege stellen eine Möglichkeit dar, Wassermengen möglichst schadlos durch Wohngebiete abzuleiten. Mit ihnen befasst sich das Verbundforschungsprojekt „Urban Flood Resilience – Smart Tools“ (FloReST), das nun unter der Förderinitiative „Wasser-Extremereignisse“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gestartet ist.
Neben der Universität Trier sind die Hochschule Trier mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld, die Hochschule Koblenz, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der Softwareentwickler Disy Informationssysteme GmbH sowie die Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann & Partner beteiligt. Gemeinsam bündeln sie die nötigen Fachkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis.
„Unsere Kanalisation ist auf eine gewisse Wassermenge beschränkt, die sie abtransportieren kann“, erklärt Juniorprofessor Dr. Tobias Schütz von der Universität Trier. Bei Wasser-Extremereignissen wie Starkregen und dadurch entstehenden Sturzfluten würden allerdings so große Wassermengen frei, dass die Kanalisation regelrecht überflutet werde. „Es entstehen Oberflächenabflüsse, die möglichst kontrolliert und ohne große Schäden zu verursachen durch Siedlungen gesteuert werden müssen. Hierfür werden Notabflusswege in die Bebauung hinein geplant“, so Schütz.
In enger Abstimmung mit Pilotkommunen, Fachverbänden und betroffenen Bürgerinnen und Bürgern sollen nachhaltige und lokal angepasste Maßnahmen zur Hochwasser- und Sturzflutvorsorge entwickelt werden. Dabei stellt die kontinuierliche Einbindung einiger bereits von Sturzfluten betroffener Kommunen sicher, dass sich die entwickelten Maßnahmen auch in die Praxis übertragen lassen. Schütz betont allerdings, dass alle beteiligten Gemeinden das Thema Notabflusswege bereits vor der Flutkatastrophe des vergangenen Jahres im Blick hatten: „Aus fachlicher Sicht war das Thema schon lange relevant, es mangelte an einer Umsetzung in der Praxis. Mit allen beteiligten Akteuren hatten wir schon vor mehr als anderthalb Jahren erstmals Kontakt.“
Während der dreijährigen Projektlaufzeit verfolgen die sechs Verbundpartner eine Reihe von Schwerpunktthemen. Dazu zählt die Neuentwicklung eines robotergestützten Systems, das eine hochaufgelöste 3D-Datenerfassung der innerörtlichen Infrastruktur ermöglicht. Damit wird eine bisher schwer erreichbare Erfassung kleinster Fließhindernisse und Bruchkanten ermöglicht. Technologien mit künstlicher Intelligenz sollen zukünftig Notabflusswege durch Machine-Learning-Verfahren auch ohne die ressourcen-intensive detaillierte Anpassung hydraulischer Modelle für große Einzugsgebiete nachweisbar machen. Zudem soll der Einsatz von Drohnentechnik dazu genutzt werden, belastungsabhängige Notabflusswege experimentell auszuweisen, um die Maßnahmen zur Hochwasser- und Sturzflutvorsorge zielgenau planen und umsetzen zu können.
Des Weiteren ist geplant, eine App zu entwickeln, die die Erfahrungen und Ortskenntnisse der Bürgerinnen und Bürger zu vergangenen Starkregenereignissen erfasst. So soll die Bürgerbeteiligung gefördert und die Betroffenenperspektive mit einbezogen werden. Hinzu kommen Workshops, um Forschungsinteressen und die benötigten Lösungen in den einzelnen Kommunen zu ermitteln. „Was wir im Projekt erforschen, wollen wir möglichst zielgenau an die Bedürfnisse der Kommunen und der darin lebenden Bürgerinnen und Bürger anpassen“, betont Schütz.
Neben der Zusammenarbeit mit fünf Pilot-Kommunen wird das Projekt FloReST durch Mitglieder eines Projektbeirats aus der Praxis (Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz), aus der Landesverwaltung (Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement, Landesamt für Umwelt) sowie dem Gemeinde- und Städtebund (Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz) unterstützt.
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Kontakt
JProf. Dr. Tobias Schütz
Hydrologie
Tel. +49 651 201-3071
Mail: tobias.schuetz@uni-trier.de
https://idw-online.de/de/news795526
Hochwasserschutz mit Sensoren und künstlicher Intelligenz
Bei Hochwassergefahr fehlen oft entscheidende Informationen zur Gebietsreaktion: Wieviel Wasser kann der Boden aufnehmen? Wie verhalten sich Flusszuläufe? Ein Frühwarnsystem soll dabei helfen, diese Fragen zu beantworten.
weiterlesen: https://www.process.vogel.de/hochwasserschutz-mit-sensoren-und-kuenstlicher-intelligenz-w-628b44dab8a89/?cmp=nl-254&uuid=3b9cdc634579b4ebff976fbd61412261
Neues Forschungsprojekt: Warnsystem für gefährliche Starkregen und Sturzfluten
Bastian Strauch Hochschul- und Wissenschaftskommunikation
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
• AVOSS verknüpft Wetterdaten mit hydrologisch relevanten Informationen wie aktuelle Bodenfeuchte, Landbedeckung und Geländeneigung
• Bisher sind Vorhersagen von lokalen Sturzfluten oft kaum möglich, weil ihre Entstehung kompliziert ist und die aktuellen hydrologischen Bedingungen nicht berücksichtigt werden
• Prototypische Anwendungen in Pilotregionen sollen Qualität und Belastbarkeit der Vorhersagen zeigen
In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland immer wieder Sturzfluten mit zum Teil verheerenden Auswirkungen. Ausgelöst wurden sie durch lokalen Starkregen. Eine Warnung vor solchen Ereignissen ist bisher oft nicht möglich, weil ihre Entstehung kompliziert ist und sie meist schnell und räumlich stark begrenzt auftreten. Ein neues Forschungsprojekt soll diese Lücke im Warnsystem schließen. Es wird koordiniert von Prof. Dr. Markus Weiler, Hydrologe an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Universität Freiburg. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert das Vorhaben, das über drei Jahre läuft.
Skalen von ganz Deutschland bis Gemeindeebene
Das neue Forschungsprojekt heißt AVOSS (Auswirkungsbasierte Vorhersage von Starkregen und Sturzfluten auf verschiedenen Skalen: Potentiale, Unsicherheiten und Grenzen). Es soll prototypisch Warnungen auf unterschiedlichen räumlichen Skalen von ganz Deutschland über einzelnen Bundesländern bis auf Gemeindeebene ermöglichen.
„Bestehende Warnwerkzeuge für Starkregen und deren Folgen beziehen sich nur auf die Vorhersage von Niederschlag und lassen die aktuellen hydrologischen Verhältnisse unbeachtet“, erklärt Weiler. Dabei seien gerade hydrologische Eigenschaften wie etwa die aktuelle Bodenfeuchte und Landbedeckung sowie das Gefälle oder die Bodenbeschaffenheit letztlich dafür entscheidend, ob ein Starkregenereignis auch eine Sturzflut auslöst: „Eine belastbare Sturzflutwarnung muss daher neben den meteorologischen Faktoren auch die hydrologischen berücksichtigen“, sagt der Freiburger Forscher.
Gefährdung quasi in Echtzeit abbilden
Meteorologische, hydrologische und hydraulische Informationen sollen in dem Projekt verknüpft und zu einem Warnsystem zusammengeführt werden, das quasi in Echtzeit die aktuelle Sturzflutgefährdung abbilden kann. Dazu arbeiten im interdisziplinären AVOSS-Projekt mehrere Universitäten und Forschungseinrichtungen aus ganz Deutschland mit Meteorolog*innen und Ingenieurbüros zusammen. Zusätzlich sind Akteur*innen aus der Praxis wie Landesbehörden und Gemeinden eingebunden.
So soll die Praxistauglichkeit der zu entwickelnden Warnwerkzeuge gewährleistet werden. Außerdem sind prototypische Anwendungen für Pilotregionen geplant, um die Qualität und Belastbarkeit der Sturzflutwarnungen zu bewerten.
Weitere Informationen zu AVOSS auf der Projekthomepage: www.avoss.uni-freiburg.de
Faktenübersicht:
• Das Forschungsprojekt AVOSS wird an der Universität Freiburg koordiniert. Außerdem beteiligt sind die Leibniz Universität Hannover, das GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam, die Forschungszentrum Jülich GmbH, die AtmoScience GmbH aus Gießen (Tochtergesellschaft der Kachelmann AG), die BIT Ingenieure AG aus Freiburg und die HYDRON GmbH aus Karlsruhe.
• Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt im Rahmen der Fördermaßnahme „WaX – Wasser-Extremereignisse“ mit rund 2,6 Millionen Euro für den Zeitraum von drei Jahren.
• Projektkoordinator Prof. Dr. Markus Weiler ist Professor für Hydrologie an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Universität Freiburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Identifikation und Modellierung der dominanten Abflussbildungsprozesse unter verschiedenen meteorologischen und hydrologischen Gegebenheiten, speziell auch hinsichtlich des Auftretens von Starkregenereignissen und der daraus resultierenden Überflutungsgefahren.
Bastian Strauch Hochschul- und Wissenschaftskommunikation
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof. Dr. Markus Weiler
Professur für Hydrologie
Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Tel.: 0761/203-3530 oder 3535
E-Mail: markus.weiler@hydrology.uni-freiburg.de
avoss@hydrology.uni-freiburg.de
Überflutungsvorsorge klimafest machen – DWA legt Positionspapier „Hochwasser und Starkregen“ vor
Starkregenvorsorge verbindlich in Bauleitplanung integrieren, Zonung nach Gefährdung in Überschwemmungsgebieten, Starkregenvorsorge und Hochwasservorsorge gesamtheitlich denken, diese Forderungen stellt die DWA in ihrem aktuellen Positionspapier „Hochwasser und Starkregen“. „Politik und Wasserwirtschaft müssen die notwendigen Maßnahmen schnell und umfassend umsetzen. Ein vollständiger Schutz vor Überflutungen kann nie, insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels, gewährleistet werden. Weitreichende Vorsorgemaßnahmen sind aber möglich und notwendig, um die Risiken niedrig zu halten.
Zudem muss das Katastrophenmanagement so verbessert werden, dass der Verlust von Menschenleben sicher verhindert werden kann,“ betonte DWA-Präsident Uli Paetzel anlässlich des Jahrestages der Hochwasserkatastrophe am 14. und 15. Juli. „Eine solche Katastrophe darf sich nicht wiederholen.“
Download des DWA-Positionspapiers: http://dwa.de/positionen
Themenseite Hochwasser der Helmholtz-Klima-Initiative
Die Helmholtz-Klima-Initiative hat anlässlich des bevorstehenden Jahrestagescder Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Themenseite mit wissenschaftlichencHintergründen und Einordnungen auscWissenschaft und Praxis veröffentlicht.
Auf der Helmholtz-Sonderseite „Ein Jahr nach der Flut“ beantworten führende Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen die wichtigsten Fragen zu den Lehren aus der Hochwasserkatastrophe in zitierfähigen Statements. Außerdem gibt es einen Überblick über aktuelle Forschungen zu dem Thema sowie Bildmaterial.
https://www.helmholtz-klima.de/aktuelles/ein-jahr-nach-der-flut
Nach der Flut ist vor der Flut – Universität Potsdam am BMBF-Projekt zu Wasser-Extremereignissen beteiligt
Extremereignisse wie Dürre, Starkregen und Sturzfluten haben in Deutschland in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Um das Risikomanagement bei extremen Niederschlägen, großflächigen Überschwemmungen oder langanhaltenden Dürreperioden zu verbessern, fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit der Maßnahme „WaX – Wasser-Extremereignisse“ zwölf neue Forschungsverbünde. Das Institut für Umweltwissenschaften und Geographie der Universität Potsdam ist mit dem Verbundvorhaben „Inno_MAUS“ sowie mit dem Vernetzungsvorhaben „Aqua-X-Net“ dabei. Die WaX-Auftaktveranstaltung findet heute und morgen in Bonn statt.
Ziel der neuen Fördermaßnahme ist es, die gravierenden Folgen von Dürreperioden, Starkregen- und Hochwasserereignissen durch verbesserte Managementstrategien und Anpassungsmaßnahmen abzuwenden. Insgesamt zwölf Forschungsvorhaben mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis sowie ein Vernetzungs- und Transfervorhaben werden praxisnahe und fachübergreifende Ansätze erarbeiten, die die Auswirkungen von Wasserextremen auf die Gesellschaft und den natürlichen Lebensraum begrenzen und gleichzeitig neue Perspektiven für die Wasserwirtschaft eröffnen. Die Forschungsschwerpunkte liegen dabei auf digitalen Instrumenten für Monitoring, Analyse, Vorhersage und Kommunikation, dem Risikomanagement hydrologischer Extreme und auf urbanen extremen Wasserereignissen.
Im Forschungsverbund „Innovative Instrumente zum MAnagement des Urbanen Starkregenrisikos (Inno_MAUS)“, das in der Arbeitsgruppe Hydrologie und Klimatologie an der Uni Potsdam angesiedelt ist, sollen digitale Instrumente zum Umgang mit Starkregenrisiken in Städten weiterentwickelt und den Kommunen bereitgestellt werden. Um Starkregenereignisse mit geringer Ausdehnung besser vorhersagen zu können, wird dabei das Potenzial von tiefen neuronalen Netzen und hochauflösenden Radarbildern erforscht.
„Die Menge des Oberflächenabflusses ist davon abhängig, wie schnell wie viel Regenwasser versickern kann. Deshalb spielt die Möglichkeit, Wasser in der Stadt auf entsiegelten Flächen zurückzuhalten, eine wichtige Rolle“, sagt der Projektleiter Prof. Dr. Axel Bronstert. Das bei Starkregenereignissen oberflächlich abfließende Wasser wird zum einen mit hydrologischen Modellen simuliert. Zum anderen kommt innovatives Machine Learning zum Einsatz, um die Simulationen um ein Vielfaches zu beschleunigen und damit Gefährdungssituationen schneller einschätzen zu können. „Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Abschätzung der Schäden an Gebäuden und Infrastruktur durch urbane Flutereignisse“, erläutert Axel Bronstert. „Um solche Schäden zu vermeiden, ist eine enge Zusammenarbeit vieler Akteure wichtig, wie beispielsweise der Wasserwirtschaft, der Rettungsdienste und der Stadt- und Raumplaner.“
Die aus hydrologischer Sicht sehr verschiedenen Städte Berlin und Würzburg sind die Forschungspartner des Projekts, in dem die Universität Potsdam mit der Technischen Universität München und den Geoingenieurfirmen Orbica UG (Berlin) und KISTERS-AG (Aachen) zusammenarbeitet.
Begleitet werden die Verbundprojekte vom Vernetzungs- und Transfervorhaben „Aqua-X-Net“, das vom Deutschen Komitee Katastrophenvorsorge e. V. (DKKV) in Bonn zusammen mit der Arbeitsgruppe Geographie und Naturrisikenforschung von Prof. Dr. Annegret Thieken an der Universität Potsdam durchgeführt wird. Das Vorhaben ermöglicht durch Veranstaltungs- und Kommunikationsformate eine intensive Vernetzung und den Austausch der zwölf Forschungsvorhaben, stellt Synergien her und übernimmt eine öffentlichkeitswirksame Kommunikation der Ergebnisse. „Damit die Forschungsergebnisse in Wirtschaft, Fachverwaltung und Politik, aber auch in der breiten Öffentlichkeit ankommen, werden im Vernetzungs- und Transferprojekt Handlungsempfehlungen für Anwenderinnen, Anwender und kommunale Verbände sowie leicht verständliche Informationsmaterialien entwickelt“, betont Annegret Thieken. „Damit soll ein nachhaltiger und zielgruppengerechter Praxistransfer erreicht werden.“
Am 2. und 3. Mai 2022 kommen die Verbundvorhaben der Fördermaßnahme WaX zur Auftaktveranstaltung in Bonn erstmals zusammen. Während dieses zweitägigen Kick-Offs werden sich die Akteure der zwölf Vorhaben und ihre beteiligten Partner vorstellen, kennenlernen und austauschen.
Das BMBF fördert die Maßnahme „Wasser-Extremereignisse (WaX)“ im Rahmen des Bundesprogramms „Wasser: N – Forschung und Innovation für Nachhaltigkeit“. Wasser: N ist Teil der BMBF-Strategie „Forschung für Nachhaltigkeit (FONA)“. Die Forschungsvorhaben laufen bis Anfang 2025.
Link zur Fördermaßnahme: https://www.bmbf-wax.de/
https://idw-online.de/de/news792847
UBA: Fragen und Antworten zum Thema Hochwasser
In vielen Regionen Deutschlands haben starke Regenfälle zu Hochwasser und großen Zerstörungen geführt. Was ist nach dem Rückgang des Wassers zu beachten? Wer hilft bei Problemen nach dem Hochwasser? Was ist beim Trinkwasser zu beachten? Und was tun gegen Schimmel? Antworten auf diese und weitere Fragen in unseren FAQ.
Warum kommt es zu Hochwasser?
Hochwasser haben natürliche Ursachen, wie langanhaltende Niederschläge, Starkregenereignisse oder die Schneeschmelze. Dennoch nehmen wir Menschen mit der Gestaltung unserer Umgebung Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf von Hochwasserereignissen. Der Mensch hat auf vielfältige Weise in das Abflussgeschehen eingegriffen und das heutige Erscheinungsbild von Flüssen und Bächen sowie der gesamten Landschaft massiv geprägt. Diese Maßnahmen hatten das Ziel, nah am Fluss Standorte für Wirtschaftsansiedlungen und Wohnorte zu schaffen, die Schifffahrt zu erleichtern oder Siedlungen vor Hochwasser zu schützen. Häufig konnten so auch höhere Erträge in der Landwirtschaft durch Entwässerung, Dränagen und Intensivierung erreicht werden. Dies führte über langjährige Prozesse zum Verlust der natürlichen Überschwemmungsgebiete und des Wasserrückhaltes in der Landschaft. Der jahreszeitliche Rhythmus des Abflussverhaltens der Gewässer wurde gestört. Hochwasser fließen heute schneller und mit erheblich steilerer Welle ab, da die Flüsse nur wenig verzweigt und stark begradigt sind. Hochwasser transportieren heute ein größeres Wasservolumen pro Zeiteinheit.
Parallel zu diesen Entwicklungen steigen die Werte, z.B. die Anzahl von Wohngebäuden, Industrie und Kulturstätten, in ehemaligen Auen und auf Überschwemmungsflächen an. Trifft ein Hochwasser auf eine Siedlung oder ein Industriegebiet, können sehr hohe Schäden entstehen.
Die Erfahrung des Jahrhunderthochwassers im Einzugsgebiet der Elbe und Donau im Sommer 2002 führten zur stärkeren Verankerung des Hochwasserschutzes im Wasserhaushaltsgesetz (2005), zur Entwicklung einer europäischen Richtlinie zum besseren Umgang mit den Hochwasserrisiken (2007) sowie zur erneuten Anpassung des Wasserhaushaltsgesetzes (2010), um die europäischen Vorgaben zum Hochwasserrisikomanagement umzusetzen.
Was tun im Ernstfall?
Aktuelle Informationen zu Niederschlägen, Starkregenereignissen und Warnungen erhalten Sie beim Deutschen Wetterdienst (DWD) und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Informationen über aktuelle Hochwasserereignisse erhalten Sie beim länderübergreifenden Hochwasserportal.
Bitte beachten Sie unsere 10 Tipps für das richtige Verhalten bei Hochwassergefahr.
Übergreifende Informationen zum Thema Hochwasser und zur internationalen Abstimmung an den großen Flüssen finden sich bei den Internationalen Kommissionen:
IKSR – Internationale Kommission zum Schutz des Rheins
IKSE – Internationale Kommission zum Schutz der Elbe
IKSD – Internationale Kommission zum Schutz der Donau
IKSO – Internationale Kommission zum Schutz der Oder
IKSMS – Internationale Kommission zum Schutz der Mosel
Was sollte nach Rückgang des Hochwassers beachtet werden?
Nach Ablauf des Wassers sollte die Versicherung informiert und der Schaden fotografisch dokumentiert werden.
Zur Sicherheit ist zu prüfen, ob die Gefahr eines Stromschlages besteht und möglicherweise Chemikalien oder Heizöl ausgelaufen sind. Lebensmittel, die Kontakt mit dem Hochwasser hatten, sollten entsorgt werden.
Nach Entfernung des Schlamms aus den betroffenen Gebäuden sollte so schnell wie möglich mit der Trocknung des Gebäudes begonnen werden.
Das Umweltbundesamt empfiehlt, wenn möglich eine technische Trocknung durchzuführen. Nicht betroffene Räume oder Wohngeschosse müssen während der Trocknung abgeschottet werden (zum Beispiel Keller gegen Obergeschosse abdichten) um eine Verwirbelung von Stäuben, Fasern, chemischen oder mikrobiologischen Stoffen zu vermeiden.
Wird der Boden durch das Hochwasser verunreinigt?
Die Sedimente vieler Flüsse sind immer noch mit Schadstoffen zum Teil hoch belastet. Sie werden bei Überschwemmungen mit dem Flusswasser teilweise wieder freigesetzt und lagern sich in den Überschwemmungsgebieten bevorzugt in strömungsberuhigten Bereichen ab. Der Oberboden von überspülten und mit Schadstoffen kontaminierten Gartenflächen sollte nach Ablauf des Wassers auf jeden Fall untersucht werden, wenn zukünftig darauf Gemüse angebaut werden soll. Das örtlich zuständige Umweltamt kann Auskunft darüber geben, ob es sinnvoll ist, eine Bodenschicht abzutragen – und wenn ja, bis zu welcher Tiefe – und zu entsorgen.
Das Land Thüringen hat 2013 ein Merkblatt mit Hinweisen zum sachgerechten Umgang mit den von Hochwasser betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen herausgegeben.
Auch von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft gibt es „Hinweise zu Hochwasserschäden auf landwirtschaftlich genutzten Flächen“.
Was muss ich beim Trinkwasser nach einem Hochwasser beachten?
Wenn über das örtliche Gesundheitsamt keine Abkochempfehlung oder eine Verwendungseinschränkung angeordnet wird (bei Beeinträchtigung der Wassergewinnungs- bzw. Aufbereitungsanlagen durch das Hochwasser möglich), kann das Trinkwasser bedenkenlos weiter verwendet werden.
Bei Einstellung der Trinkwasserversorgung (zum Beispiel in Passau) erfolgt die Versorgung der Bevölkerung über Wasserwagen oder Mineralwassergebinde.
Im Falle des „Überlaufens“ von Einzelwasser-Versorgungen (sog. Hausbrunnen) sollte das Wasser abgekocht werden, bis der Betrieb des Brunnens wieder bestimmungsgemäß verläuft und die Wasserproben nach Trinkwasserverordnung in Ordnung sind.
Alle wichtigen Informationen zur Qualität von Brunnenwasser
Hinweis: Oft wird beobachtet, dass in Hochwasserzeiten das Trinkwasser verstärkt nach Chlor riecht. Dies ist eine Folge des vorsorglichen Handelns der Wasserversorger, die Chlor zur Desinfektion des Trinkwassers einsetzen, um Verkeimungen des Trinkwassers vorzubeugen. Die zugesetzte Menge an Chlor ist nicht gesundheitsschädlich.
Können Colibakterien und Düngemittel aus Feldern bei Hochwasser ins Trinkwasser gelangen?
Wenn die Trinkwassergewinnung und -aufbereitung regelgerecht erfolgen bzw. der möglicherweise schlechteren Rohwasserqualität durch die Wasserversorger angepasst werden, ist es nicht möglich, dass Colibakterien und Düngemittel ins Trinkwasser gelangen.
Das Trinkwasser wird zudem über die Anforderungen der Trinkwasserverordnung ständig mikrobiologisch und chemisch überwacht. Werden Verunreinigungen nachgewiesen, unternimmt das örtliche Wasserwerk Maßnahmen, um die Bevölkerung zu schützen, zum Beispiel eine Allgemeine Warnung verbunden mit Verhaltenstipps zum Umgang mit dem Trinkwasser.
Weitere Hinweise finden Sie in dieser Broschüre.
Darf ich Obst und Gemüse essen, welches mit dem Hochwasser in Kontakt gekommen ist?
Da im Hochwasser mit Keimbelastungen zu rechnen ist (eventuell durch Überlaufen von Kläranlagen), sollten Obst und Gemüse zumindest gründlich mit Trinkwasser gewaschen werden. Sicherer ist es, wenn Obst und Gemüse vor dem Verzehr gekocht werden.
Was sollte ich beim Reinigen nach einem Hochwasser beachten?
Beim Säubern der Gegenstände sind Maßnahmen zum Schutz der eigenen Gesundheit zu beachten:
Schutzhandschuhe aus Kunststoff tragen (in Baumärkten erhältlich).
Arbeitskleidung nach Benutzung gründlich waschen oder Einwegschutzanzug verwenden und entsorgen.
Sind Gegenstände bereits von Schimmel befallen sind zusätzliche Maßnahmen zu beachten:
Schimmelpilzsporen nicht in andere Räume verbreiten, Vorsicht beim Transport verschimmelter Materialien, angrenzende Räume geschlossen halten.
Schimmelpilzsporen nicht einatmen
Atemschutz tragen (in Baumärkten erhältlich) und nach Gebrauch entsorgen. Schimmelpilzsporen nicht in die Augen gelangen lassen – spezielle Staub-Schutzbrille tragen (in Baumärkten erhältlich).
Grundsätzlich sollten mit Schimmelpilzen befallene Materialien vor der Trocknung ausgebaut werden. Damit eine zügige Entfeuchtung erfolgen kann sollten Oberbeläge, Vorbaukonstruktionen oder Verkleidungen zuvor entfernt werden, da die Nässe durch die Überflutung tief in die massive Bausubstanz eindringen konnte (Mauerwerk, Böden, Decken).
Sollte nach einem Hochwasser desinfiziert werden?
Das Umweltbundesamt rät von einer Behandlung durchnässter Räume mit Desinfektionsmitteln ab, da das Hochwasser nicht nur Fäkalien, sondern eine Vielzahl chemischer Stoffe enthalten kann, die gegebenenfalls mit Desinfektionsmitteln reagieren. Wichtiger ist jedoch, dass bei durchnässten Materialien die Desinfektion nicht wirksam ist, da nicht alle Mikroorganismen erreicht werden. Zudem gehen auch von toten Schimmelpilzsporen gesundheitliche Gefahren aus. Deshalb sollten alle mit Schimmel befallenen Materialien (zum Beispiel Holz, Tapeten, Putz) aus den durchfeuchteten Gebäudeteilen entfernt werden.
Kann ich vom Hochwasser durchnässte Materialien retten?
Bei Hochwasser sollten die betroffenen Räume möglichst vollständig ausgeräumt werden.
Noch nicht von Schimmelpilzen befallene Gegenstände können gesäubert und getrocknet werden, um einer Schimmelbildung vorzubeugen. Allerdings kann Hochwasser Fäkalien und auch andere Schadstoffe (zum Beispiel Heizöl) enthalten. Als Grundregel kann gelten, dass Gegenstände, die sich nicht innerhalb von 24-48 Stunden trocknen lassen, entsorgt werden sollten, um Keim- und Schimmelbildung vorzubeugen.
Befallene poröse Materialien – etwa Tapeten, Gipskartonplatten, poröses Mauerwerk, poröse Deckenverschalungen – können nicht gereinigt werden. Leicht ausbaubare Baustoffe wie Gipskartonplatten oder leichte Trennwände sind auszubauen und zu entfernen. Starker Schimmelpilzbefall auf nicht ausbaubaren Baustoffen sollte vollständig – dass heißt auch in tiefer liegenden Schichten – durch Abtragen der Baustoffe entfernt werden.
Feuchtes Holz mit aktivem Schimmelpilzwachstum ist sehr schwierig zu sanieren. Es muss zumeist entsorgt werden. Bei schwierig zu entfernenden, tragenden Teilen kann ein oberflächlicher Befall durch Abschleifen entfernt werden. Befallene Möbelstücke mit geschlossener Oberfläche – also Stühle und Schränke – sollten oberflächlich feucht gereinigt, getrocknet und gegebenenfalls mit 70 %-igem Ethylalkohol desinfiziert werden.
Stark befallene Einrichtungsgegenstände mit Polsterung, wie etwa Sessel oder Sofas, sind nur selten mit vertretbarem Aufwand sinnvoll zu sanieren. Im Normalfall sollten sie entsorgt werden. Befallene Haushaltstextilien – wie Teppiche oder Vorhänge – sind zumeist ebenfalls nur mit großem Aufwand zu reinigen. Bei starkem Befall sollten auch diese besser entsorgt werden.
Kann sich durch das Hochwasser in den Häusern mittelfristig Schimmel bilden?
Ja. Durch Hochwasser betroffene Gebäude können massiv durchfeuchtet werden. Auch nach Abfluss des Wassers verbleibt die Feuchtigkeit noch längere Zeit in den durchnässten Wänden, Decken und Böden. Infolge der Feuchtigkeit können sich auf den meisten Materialien Schimmelpilzen und Bakterien bilden.
Je nach Temperatur kann es bereits innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen zu einem Schimmelpilzbefall, insbesondere an feuchteempfindlichen Bausubstanzen kommen, wie zum Beispiel an Gipsputzschichten, Holzverkleidungen, Leichtbauwänden und Tapeten.
Wie erkenne ich Schimmelpilzbefall?
Schimmelpilze bilden weiße oder farbige – etwa grüne, braune oder schwarze – Überzüge auf feuchten Wänden oder Gegenständen. Diese Überzüge sehen aus wie Watte oder wie ein Rasen. Manchmal können andere – chemische – Ablagerungen ähnlich aussehen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um Schimmelpilze handelt, hilft das örtliche Gesundheitsamt.
Wie schädlich ist Schimmel?
Die hohe Feuchtigkeit in gefluteten Räumen bietet ideale Bedingungen für das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien. Materialien im Haus wie Holz oder das Mauerwerk können durch die Mikroorganismen angegriffen und zerstört werden. Außerdem geben sie Sporen und flüchtige organische Stoffe ab. Das kann zu Reizungen der Atemwege und allergischen Reaktionen führen.
Weiterführende Informationen zur gesundheitlichen Relevanz von Schimmel.
Wie kann ich dem Schimmelpilzbefall vorbeugen?
Jeder Tag mit feuchten Wänden und Gegenständen erhöht das Risiko eines Schimmelpilzwachstums. Trocknen Sie deshalb die feuchten Gegenstände und Wohnungen möglichst rasch durch gezieltes Heizen und Lüften. Am besten sorgen Sie über mehrere Tage für Durchzugslüftung. Trockene Wände sind die beste Vorsorge gegen Schimmelpilzbefall und die Basis für eine dauerhafte Sanierung.
Umweltmedizinische Beratungsstellen in Deutschland
Wer hilft mir bei Problemen nach dem Hochwasser weiter?
Für Fragen zum Trinkwasser oder Problemen mit dem Trinkwasser ist das regionale Wasserversorgungsunternehmen zuständig.
Sollten Schadstoffe austreten, wird das lokale Umweltamt oder die untere Wasserbehörde oder Bodenschutzbehörde (beide in der Regel beim Landratsamt angesiedelt) weiterhelfen.
Fragen zu Badegewässern beantworten die Landesumweltämter.
Mehr Informationen zum Thema Schimmel finden Sie auf den Seiten des Umweltbundesamts im UBA-Schimmelleitfaden und im Ratgeber Schimmel im Haus.
Wie finde ich eine fachkundige Firma zur Sanierung eines Hochwasserschadens?
Die Durchführung der Trocknungs- und Sanierungsmaßnahmen erfordert eine besondere Sachkunde. Sofern bereits muffiger Geruch oder ein Schimmelpilzbefall vorliegt sind besondere Schritte erforderlich um die eigene Gesundheit nicht zu gefährden und eine Belastung nicht betroffener Räume zu vermeiden.
Empfehlungen zur Suche nach entsprechend spezialisierten Firmen finden Sie hier
Netzwerk Schimmelpilzberatung
Bundesverband Schimmelpilzsanierung e.V.
Berufsverband Deutscher Baubiologen VDB e.V.
Wo finde ich Beratung zum Thema Schimmel in Innenräumen?
Einige Gesundheitsämter bieten Beratung bei Schimmelpilzproblemen an. Für die Anzeige von Schimmelproblemen in öffentlichen Gebäuden (zum Beispiel Kindergärten, Schulen) sind die örtlichen Gesundheitsämter zuständig.
Mietervereine geben Tipps zum Umgang mit Vermietern, wenn ein Schimmelpilzproblem auftritt.
In Bundesländern, in denen Wohnungsaufsichtsgesetze bestehen (Hamburg, NRW, Berlin, Hessen), können auch die Städte im Rahmen der Wohnungsaufsicht beraten und konkret beim Vermieter eine Mängelbeseitigung anordnen und hoheitlich durchsetzen.
Umweltmedizinische Beratungsstellen in Deutschland
Beratungsstandorte des Netzwerkes Schimmelpilzberatung in Deutschland
Mehr Fragen und Antworten zum Thema finden Sie auch hier: https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen
https://www.umweltbundesamt.de/themen/fragen-antworten-thema-hochwasser
DWA: Hochwasservorsorge und Katastrophenschutz besser abstimmen
Wasserwirtschaftliche, stadtplanerische und raumordnerische Maßnahmen müssen nach Auffassung der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) deutlich enger verzahnt werden. Hochwasserschutz und Katastrophenschutz müssten zudem besser aufeinander abgestimmt werden, um Menschenleben auch im Katastrophenfall zu schützen, sagte Prof. Uli Paetzel, Präsident der DWA.
Die Wasserwirtschaft halte alle gesetzlichen Vorgaben zur Hochwasservorsorge ein und gehe mit dem angestrebten Schutzniveau zum Teil
Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.
Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.
Nach der Unwetterkatastrophe: Die meisten der 37 Abwasserreinigungsanlagen im Vulkaneifelkreis des Kreises laufen normal
Lediglich zwei sind außer Betrieb und werden zurzeit instandgesetzt.
Zwei Kläranlagen in der Verbandsgemeinde Gerolstein sind derzeit nicht im Einsatz. Woran es liegt, sagt Werkleiter Harald Brück: „Sie können davon ausgehen, dass dies eine Folge des Hochwassers ist.“ Sechzehn Anlagen zur Reinigung der Abwässer betreibt die VG Gerolstein, zwei davon seien zurzeit komplett ausgefallen, berichtet Brück. „Es sind an allen Kläranlagen vereinzelt Schäden aufgetreten, die aber keine negativen Auswirkungen auf deren Reinigungsleistung haben.“
Auch Kläranlagen des WVER vom Hochwasser betroffen
20. Juli 2021 Redaktion epa Schreiben Sie einen Kommentar
Unter anderem wurden Anlagen in Schleiden, Gemünd, Kall, Marmagen sowie die Kläranlage Urft-Nettersheim überflutet
Die Käranlage Urft-Nettersheim wurde von der Urft unter Wasser gesetzt. Bild: Alexander Esch/WVER
Nordeifel – Das gewaltige Hochwasser, das in der Nordeifel massive Schäden verursacht hat, ist auch an vielen Kläranlagen des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER) nicht spurlos vorübergegangen. Besonders betroffen waren die Kläranlagen in der Eifel. So wurden die Anlagen in Schleiden, Gemünd, Urft-Nettersheim, Kall, Marmagen, Mulartshütte und Roetgen überflutet. In Eschweiler überschwemmte die benachbarte Inde die dortige Kläranlage vollständig. Das an der westlichen Landesgrenze verlaufende Gewässer, die Wurm, uferte auf die Kläranlage Frelenberg aus. Auch eine Vielzahl von Regenüberlaufbecken und Pumpwerken wurde unter Wasser gesetzt. Die Reinigung des Abwassers ist auf den vorgenannten Anlagen weitgehend zum Erliegen gekommen.
https://eifeler-presse-agentur.de/2021/07/auch-klaeranlagen-des-wver-vom-hochwasser-betroffen/
Extremereignis traf das gesamte Wuppergebiet
Hohe Pegelstände an Wupper und Nebengewässern. Talsperren stiegen an und leisteten Rückhalt.
Pressemitteilung vom 15.07.2021
Einen Tag nach den extremen Regenmengen: In weiten Teilen NRWs und insbesondere im Wuppergebiet sind nicht nur extrem hohe Regenmengen gefallen, sondern das Einzugsgebiet der Wupper war flächendeckend betroffen. Vom 14. Juli bis heute Morgen fielen zum Beispiel im Bereich der Bever-Talsperre in Hückeswagen rund 140 Liter pro Quadratmeter. Das ist rund ein Zehntel der Regenmenge, die im Durchschnitt an dieser Messstelle in einem Jahr fällt. Auch an anderen Messstellen im Wuppergebiet wurden Regenmengen im Bereich von 130 bis 160 Litern pro Quadratmetern gemessen.
Ein solches Extremereignis liegt deutlich über einem üblichen Hochwasser. Diese Mengen sind statistisch noch seltener als einmal in 1.000 Jahren und ein solches Extremereignis erzeugt Hochwasser, welches deutlich über den bekannten Ereignissen liegt. Vergleichbare Regenmengen flächendeckend im Gebiet hat es im Wupperverband seit Beginn der Aufzeichnungen nicht gegeben.
Amtliche Hochwasser-App für Deutschland von Bund und Ländern
Mit der App „Meine Pegel“ hat die Bund/ Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) am 6. Juni 2016 eine neue Anwendung für Smartphones und Tablets vorgestellt, die Nutzern und Nutzerinnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Wasserstände an Flüssen und Seen in Deutschland ermöglicht. Zur aktuellen Information über steigende Wasserstände können automatische Benachrichtigen aktiviert werden. Die kostenfreie App bietet für mehr als 1600 Wasserstandspegel in Deutschland aktuelle Informationen und für rund 300 davon zusätzlich auch Vorhersagen zum Wasserstand. Wie der aktuelle Vorsitzende der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, Peter Fuhrmann vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, anlässlich der Vorstellung mitteilte, wird die App von den Hochwasserdiensten der Bundesländer in Zusammenarbeit mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. Sie soll sowohl den individuellen Informationsbedürfnissen der Bevölkerung entsprechen, als auch die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes mit mobil zugänglichen Informationen unterstützen. Aber auch für die Schifffahrt und andere Gewässernutzer wie Angler oder Freizeitpaddler sind solche Informationen von Interesse. Ergänzend zu den Wasserständen biete die App einen schnellen Überblick zur Hochwasserlage in ganz Deutschland und einen direkten Zugang auf die amtlichen Hochwasserinformationen der Bundesländer.
www.hochwasserzentralen.info/meinepegel
Nach dem Hochwasser ist vor dem Hochwasser …
Folgt man dieser oft gehörten Redewendung, befinden wir uns direkt vor einem Hochwasser. Die Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden auf unserer Kläranlage Zittau (Sachsen) wurden erst kürzlich abgeschlossen und der Schutz gegen Hochwasser deutlich verbessert. Doch wie wir erlebt haben, reicht allein der technische Schutz in einem konkreten Hochwasserfall nicht aus. Unsere Mitarbeiter müssen auch vor, während und nach dem Hochwasser die richtigen Handlungen vornehmen.
Den ganzen Artikel lesen Sie in: Betriebsinfo Informationen für das Betriebspersonal von Abwasseranlagen Heft 4-2015 unter https://klaerwerk.info/DWA-Informationen
Autor
Felix Heumer, Abwassermeister
Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft
mbH
Äußere Weberstraße 43, 02763 Zittau, Deutschland
Tel. +49 (0)35 83/57 15 14
E-Mail: Felix.Heumer@sowag.de
Liechtenstein: Hochwasser-Vorhersagemodell für den Alpenrhein geht in Betrieb
Wichtige Grundlage für rechtzeitige Schutzmaßnahmen und Warnung der Bevölkerung
Eschen/FL (VLK) – In den letzten beiden Jahren hat das Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU) zusammen mit Vertretern der Internationalen Regierungskommission Alpenrhein (IRKA) ein neues Abflussprognosemodell für den Alpenrhein erstellt, das genauere Hochwasservorhersagen möglich macht. Im Juli wird dieses Modell in den operativen Betrieb gehen. „Das ist ein wichtiger Baustein für den integralen Hochwasserschutz“, sagte Landesrat Erich Schwärzler bei der jüngsten IRKA-Sitzung in Eschen (Fürstentum Liechtenstein).
Quelle: http://presse.cnv.at/land/dist/vlk-47031.html
Nach dem Hochwasser
Sanierungsarbeiten auf der Kläranlage Saalfelden
Im Bundesland Salzburg in Österreich befindet sich der Reinhalteverband Pinzgauer Saalachtal, der zwei Kläranlagen betreibt. Die Verbandskläranlage ist eine zweistufige Belebungsanlage mit Hybridverfahren, die für 80 000 EW ausgebaut ist. Das Junihochwasser 2013 hat den Pinzgau und speziell unsere Kläranlage in Saalfelden voll erwischt. Aber der Reihe nach. Unser Hochwassereinsatz begann am Samstag, dem 1. Juni. Am Abend gegen 22 Uhr informierte ich mich telefonisch beim diensthabenden Klärfacharbeiter über die aktuellen Pegelstände und fuhr dann sicherheitshalber zur Kläranlage. Etwa um 24 Uhr sah die Lage noch gut aus. Der erhöhte Pegel im Bereich der Einleitungsstelle… den ganzen Artikel lesen Sie unter:
https://klaerwerk.info/DWA-Informationen/KA-Betriebs-Infos#2014-1
Autor
Michael Geisler,
Betriebsleiter Kläranlagen Reinhalteverband Pinzgauer Saalachtal
Marzon 1,
5760 Saalfelden,
Österreich
Tel. +43 (0)65 82/7 35 42
E-Mail: geisler@rhv-saalfelden.org
Am Tag als das Hochwasser kam
Kläranlage Hartkirchen/Inzing
Es regnete schon einige Tage im Landkreis Passau mit sehr hohen Niederschlägen. Doch was dann auf die Kläranlage zukam, konnten wir zu diesem Zeitpunkt nicht absehen. Sonntag, 2. Juni: Auch an diesem Tag hörte es nicht auf zu regnen. In immer kürzer werdenden Abständen kontrollierte ich telefonisch die Pegelstände von Inn und Rott. Gegen 17 Uhr machte ich eine Kontrollfahrt zur Kläranlage Hartkirchen/Inzing, einer Stabilisierungsanlage für 2500 EW. Ein Bach, der unmittelbar an der Kläranlage vorbeifließt, begann über die Ufer zu treten. Doch die Gefahr einer Überflutung der Anlage war nicht zu erkennen. Aber ich war so beunruhigt, dass ich zwei Stunden später mit meinen Mitarbeitern eine weitere Kontrollfahrt durchführte. Inzwischen hatte das Hochwasser die Zufahrtsstraße zur Kläranlage erreicht und begann, sie zu überfluten. Durch eine Absperrblase, die wir im Notüberlauf angebracht haben, konnten wir verhindern, dass … den ganzen Artikel lesen Sie unter:
https://klaerwerk.info/DWA-Informationen/KA-Betriebs-Infos#2014-1
Autor
Josef Gründl,
Abwassermeister Kläranlage Pocking
Stadt Pocking
Simbacher Straße 16
94060 Pocking,
Deutschland
E-Mail: josef.gruendl@ka-pocking.de
Das Jahrhunderthochwasser und die Auswirkungen auf Abwasseranlagen
Nicht in allen Landesteilen Mitteleuropas wütete das Hochwasser im Mai/Juni 2013. So kamen aus Westdeutschland und auch aus der Schweiz keine Rückmeldungen, dass Abwasseranlagen überschwemmt wurden und ihren Betrieb einstellen mussten. DWA-Landesverband Nord Vom Elbehochwasser waren die Kläranlagen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg und Bremen in der Regel nur durch erhöhte Zuflüsse im Kanal betroffen. Direkte Überflutungen sind nicht bekannt. Allerdings führten örtliche Starkregen, verbunden mit über Wochen hinweg anhaltenden Niederschlägen, zu heftigen Hochwasserereignissen in der Region um Hildesheim, Braunschweig und dem Harz. Insbesondere die Harzgewässer führten extrem viel Wasser, da auch die Talsperren gefüllt waren und kaum noch Rückhalt möglich war. Südlich von Hannover liegt die Kläranlage Soßmar, eine Stabilisierungsanlage für 12 000 EW. Das Hochwasser hatte die Belebungsbecken fest im Griff, sie waren bis zum Rand gefüllt . Der Bruchgaben, ein kaum …mehr:
Den ganzen Artikel lesen Sie in: Betriebsinfo Informationen für das Betriebspersonal von Abwasseranlagen Heft 4-2013
Autor:
Manfred Fischer (Gauting, Deutschland)
Pecher: Neue Homepage: Starkregen, Stadtentwässerung und Stadtentwicklung
Extreme Regenfälle in Städten können Gefahren für Anwohnende und für materielle Güter bedeuten. Das LANUV NRW hat im Rahmen des Klima-Innovationsfonds das Projekt „Klimawandel in Stadtentwässerung und Stadtentwicklung“ (KISS) initiiert, mit dem Handlungsgrundlagen für die siedlungswasserwirtschaftliche Planung bereit gestellt werden sollen, um Schäden durch extreme Niederschläge in Städten mindern zu können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Gefährdungsanalysen, der dafür erforderlichen Datenbasis, den hierfür einsetzbaren Modellen und dem Regelwerk, das in diesem Zusammenhang gilt. Ein wichtiges Ergebnis ist auch der Maßnahmenkatalog zur Schadensvermeidung bzw. -minimierung.
Nach Abschluss des Forschungsprojektes KISS „Klimawandel in Stadtentwässerung und Stadtentwicklung“, das von der Dr. Pecher AG, der TU Kaiserslautern und hydro und meteo bearbeitet wurde, haben das LANUV NRW und das MKULNV NRW den Abschlussbericht auf einer neuen Homepage veröffentlicht.
Am 11.09.2013 ist eine Abschlussveranstaltung zum Projekt beim BEW in Essen geplant.
Link zum Bericht:
http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/KISS_Bericht.pdf
Homepage des LANUV:
http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/klimawandel.htm
Die Projektergebnisse werden in diesem Jahr zudem
u. a. auf den folgenden Veranstaltungen präsentiert:
NOVATECH, Lyon,
14. Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium
aqua urbanica, Zürich
Rückfragen an: Dr. Holger Hoppe (holger.hoppe@pecher.de)
www.pecher.de/aktuelles2.php?id=214
Nach dem Elbe-Hochwasser: Neue Nutzungswege für belastetes Gras aus den Elbauen
Leuphana entwickelt Konzept für die Überschwemmungsgebiete – Belasteter Grünschnitt eignet sich als Bodenverbesserer
Lüneburg. Das Elbe-Hochwasser hat Schlamm auf die landwirtschaftlich genutzten Wiesen und Weiden zwischen den Deichen getragen. Der ist allerdings vielfach mit Schwermetallen und Dioxinen belastet. Eine Arbeitsgruppe um die Geobiowissenschaftlerin Prof. Dr. Brigitte Urban von der Leuphana Universität Lüneburg ermittelt gerade die genaue Höhe der Schadstoffbelastung in den Ablagerungen der Auenböden. Zusammen mit Partnern arbeiten die Wissenschaftler an der Entwicklung eines Verfahrens, mit dem der belastete Grünschnitt zu Pflanzenkohle verarbeitet werden kann.
Die Schadstoffe würden dabei zerstört. Das Material könnte anschließend – mit Nährstoffen angereichert – als Bodenverbesserer in der Landwirtschaft eingesetzt werden. „Wir gehen davon aus, dass es durch die Flut zu vergleichsweise starken Schlammablagerungen auf den flussbegleitenden Wiesen gekommen ist“, sagt Diplom-Biologe Frank Krüger, der zur Arbeitsgruppe um Professor Urban gehört. Schon vor der Flut Ende Mai und Anfang Juni 2013 waren die Böden stark belastet: 2012 wurden Dioxinwerte gemessen, die in der Spitze beim 35-fachen des allgemein anerkannten Richtwerts von 40 Nanogramm pro Kilogramm Boden für die Bewirtschaftung der Auen lagen. Zur Verminderung des Schadstofftransfers in die menschliche Nahrungskette haben die Behörden deshalb unter anderem empfohlen, die Auen nur wenige Wochen am Stück zu beweiden.
Immerhin rund 4.500 der etwa 6.000 Hektar Überschwemmungsgebiet der Mittelelbe in Niedersachsen werden grünlandwirtschaftlich genutzt. Für die Landwirte sei die Dioxin-Belastung dieser Flächen seit Jahrzehnten ein Problem, so Krüger. Sie bräuchten Gras und Heu als Futtermittel. Doch der Umweltschadstoff Dioxin könne praktisch nicht abgebaut werden, lagere sich vielmehr an Pflanzen und in fettreichen, alltäglichen Lebensmitteln wie Eiern, Milch und Fleisch ab.
Mit ihrem neuen Forschungsprojekt „Aktivierte Pflanzenkohle“ innerhalb des EU-Regionalentwicklungsprojekts Innovations-Inkubator der Leuphana wollen die Wissenschaftler jetzt gemeinsam mit Praxispartnern eine Methode entwickeln, um die Wiesen dennoch nutzen zu können. Aus dem belasteten Grünschnitt soll zunächst Pflanzenkohle hergestellt werden. Dabei werde, so sind sich die Wissenschaftler sicher, das Dioxin vollständig zerstört. Anschließend soll die Pflanzenkohle mit Nährstoffen aus Biokompost, Gülle oder Mist fruchtbar gemacht werden. So entsteht ein neuer Bodenverbesserer, der künstlich hergestellten Mineraldünger ersetzen kann.
Für ihr Projekt arbeiten die Leuphana-Wissenschaftler zusammen mit der Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue, den wendländischen Unternehmen ERDE Innovation, ERDE Institut und Gräflich von Bernstorff‘sche Betriebe sowie dem rheinland-pfälzischen Biokohle-Hersteller Pyreg. Voruntersuchungen bescheinigen dem neuen Verfahren gute Erfolgsaussichten. Obendrein ist der neue Dünger auch klimafreundlich: Bei der Herstellung von Pflanzenkohle wird das CO2 aus den Pflanzen gebunden und gelangt nicht mehr in die Atmosphäre.
Das neue Verfahren könnte für alle Überflutungsgebiete der Elbe von Dessau bis Hamburg neue Nutzungswege eröffnen, davon sind die Lüneburger Forscher und ihre Mitstreiter überzeugt.
Freising: Aktuelle Informationen für Hochwasser-Geschädigte
Einige der wichtigsten Informationen der letzten Tage für Hochwassergeschädigte im Überblick:
Weitere Soforthilfen für Hochwassergeschädigte möglich
http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.freising.de/big/service/archiv/specialdetail/article/Weitere-Soforthilfen-fuer-Hochwassergeschaedigte-moeglich.html&juHash=0ed1987691fd5ce937566d23419ff28c23b4ec0d
• Antrag auf Gewährung einer staatlichen Soforthilfe „Haushalt/Hausrat“
http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=fileadmin/user_upload/06_IR_Presseamt/0610_pdf-Files/Antrag_Soforthilfe_Haushalt_Hausrat.pdf&juHash=c2af000fa6c415fd6aa973f0d213c35eaa7df3ac
• Antrag auf Gewährung einer staatlichen Soforthilfe „Ölschäden an Gebäuden“
http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=fileadmin/user_upload/06_IR_Presseamt/0610_pdf-Files/Antrag_Soforthilfe_OelschaedenGebaeude.pdf&juHash=9b0e007c95b3385e568f67738c23fcaffec324dd
• Antrag auf Gewährung von Notstandsbeihilfen und/oder Staatsbürgerschaften aus dem „Härtefonds Finanzhilfen“
http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=fileadmin/user_upload/06_IR_Presseamt/0610_pdf-Files/Antrag_Notstandbeihilfen_Staatsbuergschaften.pdf&juHash=41eced548e2463028aa11788743246ee8c1a07e7
Staatliches Sofortgeld kann ab sofort bei der Stadtverwaltung beantragt werden
http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.freising.de/service/archiv/specialdetail/article/Unbuerokratisch-Staatliche-Soforthilfe-kann-ab-sofort-bei-der-Stadtverwaltung-Freising-beantragt-we.html&juHash=24d9b89f7ad92ff8c1af1c1fdfa6aeb46569f981
• Antrag auf Gewährung des Sofortgeldes für Privathaushalte
http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.kreis-freising.de/fileadmin/docs/Aktuelles/Sofortgeld_Information_Antrag_Privathaushalte__2_.pdf&juHash=aa645aea8ef90c1efd50bfdcf2fa15367ea5bf94
• Antrag auf Gewährung des Sofortgeldes für Unternehmen und land-/forstwirtschaftliche Betriebe
Hilfe in finanziellen und seelischen Notlagen der KASA der Diakonie in Freising
http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.kreis-freising.de/fileadmin/docs/Aktuelles/Sofortgeld_Information_Antrag_Unternehmen.pdf&juHash=17a1e533e86befd9bd88ce03433f8573491719e8
Kostenlose Sperrmüllannahme bei den Wertstoffhöfen noch bis 22. Juni
http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.freising.de/big/service/archiv/specialdetail/article/Hochwasser-Schaeden-Kostenlose-Sperrmuellannahme-noch-bis-22-Juni.html&juHash=bf32c659d0576b78fabff78ca061e4b22b9d2734
Das Hochwasser und seine Folgen – Statikbüro gibt Tipps zum Umgang mit angegriffener Bausubstanz
http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.freising.de/service/archiv/specialdetail/article/Das-Hochwasser-und-seine-Folgen.html&juHash=57e10a6d0cc5bd2cf039bdd1ac865179165b8dde
Fuerstenfeldbruck: Hochwasser – Bilanz und Hilfe für die Opfer
Die Niederschläge Ende Mai haben in vielen Gemeinden des Landkreiseszu Überschwemmungen geführt. In der Brucker Innenstadt wurde lange Zeit um die Entwicklung der Amper gebangt. Zwar erreichte der Pegel die Meldestufe 1, doch blieb die Stadt vor größeren Überschwemmungen verschont. Der Fluss trat nur teilweise über die Ufer und es kam vereinzelt zu Grundwassereinbrüchen. Dennoch waren die Feuerwehren Fürstenfeldbruck, Aich und Puch unermüdlich im Einsatz. Gemeinsam mit Grafrath, Nassenhausen und Adelshofen sowie den städtischen Bauhofmitarbeitern befüllten sie unter anderem 13.000 Sandsäcke und transportierten sie in die überfluteten Gebiete des Landkreises.
Intensive bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen der Stadt sowie ein neu ausgearbeiteter „Katastrophenschutz-Sonderalarmplan Hochwasser“ boten der Feuerwehr in Fürstenfeldbruck eine solide Arbeitsgrundlage, um die Situation entspannt und sicher meistern zu können, berichtet Andreas Lohde, Referent für Hochwasserschutz: „Das Hochwasserschutzkonzept der Stadt mit den dazugehörigen Beschaffungen für den abwehrenden Hochwasserschutz hat sich augenscheinlich bewährt. Die Rückhaltebecken von Pfaffing hatten sich beträchtlich gefüllt und das Wasser verzögert weitergegeben. Zusammen mit den Retintionsbecken am Oberlauf des Krebsenbaches haben die Regenauffangbecken am Tulpenfeld verhindert, dass dieses Quartier, so wie 2002, flächendeckend überflutet wurde. Die neue Starkregenentwässerung von Puch hat auch den Ortsteil Lindach vor größerem Schaden geschützt.“
Hilfe für die Betroffenen
Im Zuge der Hilfe für hochwassergeschädigte Bürger teilte das Landratsamt mit, dass alle Betroffenen des Landkreises wasserschadenbedingte, brennbaren Abfälle bei der Müllverbrennungsanlage Geiselbullach (Josef-Kistler-Weg 22, 82140 Olching) kostenlos entsorgen dürfen. Die Annahme erfolgt unter der Angabe, dass der Abfall aus einem hochwassergeschädigten Gebiet stammt. Die Aktion ist zeitlich begrenzt vom 04.06. bis 14.06.2013. Weiterhin stehen den Bürgern auch die großen Wertstoffhöfe zur kostenfreien Entsorgung von Sperrmüll bis max. 2 m³ zur Verfügung. Bei eventuellen Rückfragen können Sie sich auch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck wenden.
Selbstverständlich möchte auch die Stadt Fürstenfeldbruck ihren Beitrag zur Unterstützung der vom Hochwasser geschädigten Fürstenfeldbrucker Bürgerinnen und Bürger leisten. Die Feuerwehreinsätze, die im Rahmen des Hochwasserereignisses angefallen sind, bleiben für die Betroffenen kostenfrei und werden von der Stadt getragen.
Finanzielle Hilfen beim Landkreis beantragen
Für entstandene Hochwasserschäden können Betroffene verschiedene finanzielle Hilfen beim Landratsamt beantragen. Diese Anträge sind am Ende dieser Seite als Download, beim Bürgerservicezentrum des Landratsamtes in der Münchner Straße sowie in der Stadtverwaltung, Hauptstraße 31, bei Herrn Robert Wickenrieder, Zimmer 008, Telefon 08141 281-3250 und Herrn Thomas Brodschelm, Zimmer 112, Telefon 08141-281-3221 erhältlich. Die ausgefüllten Anträge können bei den genannten Sachbearbeitern zur Weiterleitung an das Landratsamt oder direkt beim Landratsamt abgegeben werden. Auch die Übersendung per Fax ist möglich: 08141/519-450
• Sofortgeld für Hochwassergeschädigte
Das von der Staatsregierung bereitgestellte Sofortgeld für Hochwassergeschädigte beträgt 1.500 EUR für Privathaushalte. Bei Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern und land- und forstwirtschaftlichen Betrieben werden bis zu 5.000 EUR gewährt.
Das Sofortgeld wird gezahlt, wenn der Schaden durch das Hochwasser Ende Mai/Anfang Juni 2013 entstanden ist und die Mittel zur Ersatzbeschaffung von durch das Hochwasser zerstörten Hausrat oder Betriebsvermögen verwendet werden. Das Sofortgeld ist zurückzuzahlen, wenn und soweit der Geschädigte Versicherungsleistungen erhalten hat.
• „Soforthilfe Haushalt/Hausrat“ aus dem Härtefonds:
Private Haushalte, die durch das Hochwasser oder Starkregenereignis einen Schaden erlitten haben, können eine Soforthilfe von bis zu 5.000 EUR je Haushalt beantragen. Voraussetzung ist, dass es sich um einen nicht versicherbaren Schaden handelt. Falls der Schaden versicherbar war, aber keine Versicherung abgeschlossen wurde, kann eine Soforthilfe von bis zu 2.500 EUR beantragt werden.
Ein eventuell bereits erhaltenes Sofortgeld schließt die Soforthilfe „Haushalt/Hausrat“ nicht aus. Die Soforthilfe kann dann aber nur für den Schaden beantragt werden, der durch das Sofortgeld noch nicht abgedeckt wurde.
Dem Antrag ist eine Bestätigung der Gebäude- und/oder Hausratversicherung beizufügen, aus der hervorgeht, ob der Schaden versicherbar war. Andere Nachweise sind bei Antragstellung nicht erforderlich. Das Landratsamt empfiehlt allerdings, die Rechnungen, die im Zusammenhang mit dem Schaden angefallen sind, aufzubewahren und sofern möglich den Schaden mit Fotos zu dokumentieren.
• „Soforthilfe Ölschaden an Gebäuden“ aus dem Härtefonds:
Für durch das Schadensereignis bedingte Ölschäden an privat genutzten oder nicht gewerblich vermieteten Wohnräumen kann eine Soforthilfe von bis zu 10.000 EUR je Wohngebäude beantragt werden, falls der Schaden nicht versicherbar war. Sofern der Schaden versicherbar war, aber keine Versicherung abgeschlossen wurde, kann eine Soforthilfe von bis zu 5.000 EUR beantragt werden. Neben der Bestätigung der Gebäude- und/oder Hausratversicherung ist dem Antrag auch ein Nachweis des Ölschadens (z.B. Kostenvoranschlag / Rechnung für Schadensbeseitigung) beizufügen.
Ein eventuell bereits erhaltenes Sofortgeld schließt die Soforthilfe „Ölschaden an Gebäuden“ nicht aus. Die Soforthilfe kann dann aber nur für den Schaden beantragt werden, der durch das Sofortgeld noch nicht abgedeckt wurde.
• Notstandsbeihilfen aus dem Härtefonds:
Privathaushalte, Gewerbebetriebe und selbständig Tätige sowie Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft können außerdem Zuschüsse als Notstandsbeihilfen erhalten. Voraussetzung ist, dass Wohngebäude und Hausrat bzw. unternehmerisches Vermögen der Betroffenen in so großem Ausmaß geschädigt wurden, dass die Geschädigten ohne staatliche Hilfe in eine existentielle Notlage zu geraten drohen.
Für die Notstandsbeihilfen sind keine festen Beträge festgelegt. Über Art und Höhe der Hilfen wird nach Prüfung der finanziellen Verhältnisse der Geschädigten und des Schadensausmaßes im Einzelfall entschieden.
Downloadbereich:
Sofortgeldantrag für Privathaushalte
http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/gfx/1263EC15FAB6167EC1257B8D001670E7/$file/Sofortgeld2013_Antrag_Privathaushalte.pdf
Sofortgeldantrag für Unternehmen
http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/gfx/0EE208E204D18525C1257B8D0017192C/$file/Sofortgeld2013_Antrag_Unternehmen.pdf
Antrag auf Soforthilfe für Haushalt/Hausrat
http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/gfx/49B02684FE49ED9AC1257B8D00176AF5/$file/Antrag_Soforthilfe_Haushalt_Hausrat.pdf
Antrag auf Soforthilfe bei Ölschäden
http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/gfx/469AE37533825A15C1257B8D0017997B/$file/Antrag_Soforthilfe_Oelschaden.pdf
Antrag auf Notstandsbeihilfen
http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/gfx/89459798A84A5DAEC1257B8D0017BFAC/$file/Antrag_Notstandbeihilfen.pdf
http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/id/pa_hochwasser_juni2013.html
Fuerstenfeldbruck: Firma aus Moorenweis sammelt für Hochwassergeschädigte in Deggendorf und Passau
Die Firma Elektrotechnik Themel aus Moorenweis organisiert einen Hilfstransport mit Gütern des täglichen Bedarfes (auch Möbel, Elektrogeräte, Geschirr, Kleidung, Baumaterialien ect.) in die Hochwassergebiete nach Deggendorf und Passau. Sammelstelle ist das Lager der Firma ( ca. 2000 m² Fläche ) Albertshofen 7 in 82272 Moorenweis (ehemaliges Sägewerk in Moorenweis).
Selbstverständlich sollen die Sachspenden voll funktionstüchtig und nicht defekt sein. Wer die Hilfsaktion unterstützen möchte, kann die Sachspenden am Freitag 14.06.2013 von 12.00 – 18.00 Uhr und Samstag 15.06.2013 von 09.00 – 12.00 Uhr dort abgeben. Für den Transport konnte die Firma Vilgertshofer gewonnen werden.
Quelle: http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/id/li_sachspenden_hochwasser.html
Exepd: Beständiger Korrosionsschutz in Verteilerkästen auch bei Überflutung
Besonders in Überflutbecken und Kanalschächten wird ein hoher Anspruch an die IP-Schutzgrad von elektrischen Komponenten gestellt. Sind Pumpen oder Schieber meist so konstruiert, dass diese auch unter Wasser funktionieren, erweist sich die Anforderung an Zwischenklemmkästen dauerhaft IP68 zu garantieren, meist als zu hoch. Durch den Einsatz des Gießharzes IPEX 68 kann dauerhaft das Eindringen von Wasser und der damit verbundene direkte oder indirekte Ausfall der nachgeschalteten elektrischen Geräte verhindert werden. Der Anschlussraum des Klemmenkastens wird nach Anschluss der Leiter an die Klemmstelle mit einem elektrisch isolierenden, Zweikomponenten Harz befüllt. Nach der Topfzeit von ca. 25 Minuten entsteht ein wiederentfernbares, isolierendes Gel, welches einen dauerhaften Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit garantiert. Im Wartungs- oder Störungsfall kann mit Messspitzen direkt durch das Gel geprüft werden, der Stechkanal verschließt sich wieder. Muss man an der Verdrahtung etwas ändern, dann kann man das Gel einfach entfernen, neu verdrahten und den Kasten erneut vergießen. IPEx 68 ist auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Verbindung mit Klemmenkästen der Firma Exepd geeignet.
Hochwasser – Die AöW-Geschäftsführerin Christa Hecht erklärt:
„Alle Menschen in den Hochwassergebieten haben unser Mitgefühl und Anerkennung für ihre Leistungen im Kampf mit den Fluten. Ebenso sprechen wir besondere Anerkennung allen Helfern und Helferinnen aus, sowohl im freiwilligen als im dienstlichen Einsatz.“
Und auch auf Informationen der Fachverbände möchten wir verweisen:
Presseinformation der DWA
http://de.dwa.de/presseinformationen-volltext/items/mehr-hochwasservorsorge-noetig.html
Dokumentation und Handlungsempfehlungen des DVGW
http://www.dvgw.de/wasser/organisation-management/krisenmanagement/hochwasser/
Hier finden Sie aktuelle Informationen.
http://www.aoew.de/
HACH LANGE: Schutz-Chlorung
Hochwasserbedingte mikrobiologische Verunreinigungen erfordern schnelles Handeln
Aufgrund der Hochwassersituation bzw. der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen sind viele Flüsse in Deutschland über die Ufer getreten.
Sind davon Trinkwassergebiete betroffen, kann eine mikrobiologische Verunreinigung im Grundwasser die Folge sein. In einem solchen Fall wird meist sehr schnell eine Chlorung der betroffenen Wassernetze angeordnet. Am Wasserhahn des Endverbrauchers soll dann die Konzentration von z.B. 0,2 mg Chlor pro Liter nicht unterschritten werden. Dies setzt die genaue Dosierung und eine ebenso exakte Überwachung der Chlor-Messwerte im Wasserwerk voraus.
HACH LANGE bietet schon seit vielen Jahren weltweit bewährte Messtechnik für diesen Einsatzbereich an.
Hier finden Sie alle Produkte, die bei der Chlor-Überwachung im Trinkwasser zum Einsatz kommen.
http://www.hach-lange.de/view/content/newsdetails?newsid=8798157595504
Spenden für Zeitz
Der durch das Hochwasser entstandene Schaden in der Detmolder Partnerstadt Zeitz kann noch nicht beziffert werden, er geht jedoch in die Millionen. Daher ist die Stadt Zeitz auf Spenden angewiesen: Spendenkonto
Spendenkonto:
Stadt Zeitz
Sparkasse Burgenlandkreis
Kontonummer: 3 200 000 030
Bankleitzahl: 800 530 00
Verwendungszweck: Hochwasser Zeitz
Wenn Spenden für konkrete Einrichtungen bestimmt sind, kann der Name der Einrichtung zusätzlich im Verwendungszweck mit angegeben werden.
Ansprechpartnerin in Detmold für Spenden und Hilfsangebote ist Martina Gurcke, vom Team Städtepartnerschaften der Stadt Detmold unter 05231/977- 655.
Informationen zur aktuellen Lage in Zeitz finden Sie unter www.zeitz.de.
Weitere Informationen zu Hilfsmaßnahmen der Stadt Detmold finden Sie außerdem hier!
Sammlung für hochwassergeschädigte Kitas in Zeitz
Durch das Hochwasser in Zeitz wurden viele Einrichtungsgegenstände unbrauchbar
Sachspenden werden ab Montag am Detmolder Bauhof entgegengenommen
Detmold. Das Hochwasser hat die Detmolder Partnerstadt Zeitz schwer getroffen, in der kommenden Woche werden daher Sachspenden am Detmolder Bauhof gesammelt. „Es geht uns darum, möglichst zielgerichtet Sachspenden nach Zeitz zu bringen. Also wirklich Dinge, die dort konkret benötigt werden und die sich in einem guten Zustand befinden“, erklärt Martina Gurcke vom Team Städtepartnerschaft der Stadt Detmold, die die Hilfsangebote koordiniert.
In der kommenden Woche werden deshalb Sachspenden für die städtische integrative Kindertageseinrichtung Musikus und für die Kita Kleine Strolche auf dem Gelände des Detmolder Bauhofs zusammengestellt. Durch das Hochwasser sind beide Einrichtungen, in denen derzeit 262 Kinder betreut wurden, außer Betrieb. Die Betreuung wird derzeit teilweise in anderen Kitas der Stadt Zeitz abgesichert. Ein großer Teil der Kinder, deren Eltern nicht berufstätig sind, kann jedoch momentan keine Einrichtung besuchen.
Auf einer Liste haben die Zeitzer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebietes Kita, die Dinge aufgeführt, die dort dringend benötigt werden: nicht nur Kinderspielzeug, Handtücher, Büroartikel und Küchenutensilien fehlen, sondern auch Schlafkörbchen für Babys, Musikinstrumente und Computer.
Ab Montag, 17. Juni, steht ein Container am Detmolder Bauhof, Georgstr. 10, bereit, in den die Sachspenden verladen werden. Dort können die Sachspenden bis Freitag, 21. Juni, abgegeben werden, montags bis donnerstags in der Zeit von 7 bis 16 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr. Der Transport soll dann am Samstag, 22. Juni, Richtung Zeitz aufbrechen. Vor Ort sollen die Spenden direkt zu den Betroffenen gebracht werden. Ermöglicht wird die Aktion durch das Engagement eines gebürtigen Zeitzers, der sich an die Stadt Detmold gewandt hat und den Transport nach Zeitz organisiert und durchführt.
Weiterhin ist die Stadt Zeitz auf finanzielle Spenden angewiesen: Spendenkonto: Stadt Zeitz, Sparkasse Burgenlandkreis, Kontonummer: 3 200 000 030, Bankleitzahl: 800 530 00, Verwendungszweck: Hochwasser Zeitz. Wenn Spenden für konkrete Einrichtungen bestimmt sind, kann der Name der Einrichtung zusätzlich im Verwendungszweck mit angegeben werden.
Ansprechpartnerin ist Martina Gurcke unter 05231 977-655.
Weitere Informationen finden Sie hier!
http://www.stadtdetmold.de/2587.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4228&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2586&cHash=46b19fe5894b24e7fdb4791c6a8fc3de
UNITECHNICS: Starkregenereignisse führen zu hohem Oberflächenwassereintritt
Wenn es wie in den letzten Tagen stark und langanhaltend regnet, dringen enorme Mengen an Oberflächenwasser dürch die Fugen oder Lüftungsöffnungen von Schachtdeckeln in Schmutzwasserkanäle. Durch diesen Fremdwassereintrag entstehen meist höhere Energiekosten durch die erhöhten Pumpenlaufzeiten, höhere Überleitungskosten an externe Kläranlagen oder auch erhöhte Personalkosten durch Havarieeinsätze.
Mit dem Fremdwasserverschluss-System von UNITECHNICS können Sie diesen Erscheinungen wirkungsvoll entgegentreten!
Hier können Sie sich näher über unser Systeme gegen Fremdwasser informieren.
http://www.unitechnics.de/aktuelles/
UNITECHNICS beteiligt sich an Spendenaktion
Aufgrund der anhaltenden Hochwasserlage in Teilen Süd- und Ostdeutschlands unterstützen wir den DLRG-Hochwassereinsatz.
http://www.unitechnics.de/aktuelles/unitechnics-beteiligt-sich-an-spendenaktion/
Elbehochwasser: Auslegungsfrist für Biosphärenreservatsgesetz Flusslandschaft Elbe M-V verlängert
Nr. 191/2013 – 14.06.2013 – LU – Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Der Gesetzentwurf zum Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern“ liegt derzeit in den betroffenen Amts- und Stadtverwaltungen, im Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee sowie beim Landkreis Ludwigslust-Parchim aus. Im Rahmen einer freiwilligen Öffentlichkeitsbeteiligung haben alle Betroffenen die Gelegenheit, Anregungen und Bedenken zum Entwurf vorzubringen.
Auf Grund des Elbehochwassers haben sich zeitliche Einschränkungen ergeben, die sowohl die Verwaltungen als auch Beteiligungsrechte der Bürger, Gemeinden und Betriebe der Region betreffen. Aus diesem Grund hat Umweltminister Dr. Till Backhaus entschieden, die Auslegungsfrist bis zum 21.06.2013 zu verlängern. Damit können Stellungnahmen zum Gesetzentwurf nunmehr bis zum 05.07.2013 in das Verfahren eingebracht werden.
Dr. Backhaus: „Sofern auf Grund des Hochwassers einzelne Stellungnahmen noch zu einem späteren Zeitpunkt eingehen, wird mein Haus die durch das Elbehochwasser ausgelösten Sachzwänge berücksichtigen. Die Zielstellung ist jedoch, die freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligung weitestgehend bis zum 5. Juli abzuschließen, damit die vorgebrachten Anregungen und Bedenken geprüft und noch in den Gesetzentwurf eingearbeitet werden können. In diesem Zusammenhang versichere ich, dass die bereits vereinzelt vorgetragenen Befürchtungen zu weitgehenden Nutzungseinschränkungen unbegründet sind. Der Gesetzentwurf berücksichtigt die Interessen der Region. Im Gesetzgebungsverfahren werde ich diese Prämisse weiterhin im Blick behalten.“
Der Gesetzentwurf mit Übersichtskarte und Abgrenzungskarten des Gebietes ist auch unter
www.lu.mv-regierung.de verfügbar.
Unter http://www.elbetal-mv.de/ gibt es aktuelle Informationen aus dem Biosphärenreservat.
Meldungen zu Energie- und E-Technik 2023
| Meldungen 2011 | Meldungen 2012 | Meldungen 2013 | Meldungen 2014 |
| Meldungen 2015 | Meldungen 2016 | Meldungen 2017 | Meldungen 2018 |
| Meldungen 2019 | Meldungen 2020 | Meldungen 2021 | Meldungen 2022 |
| Juni 2023 |
| Baustart für Deutschlands größte schwimmende Solaranlage auf dem Cottbuser Ostsee |
| März 2023 |
| Neues Verbundvorhaben: Sauberes Wasser mit weniger Energie |
Baustart für Deutschlands größte schwimmende Solaranlage auf dem Cottbuser Ostsee
Dem Ziel ein klimaneutrales Hafenquartier am künftigen Cottbuser Ostsee zu errichten, sind das Energieunternehmen LEAG, der Projektentwickler EPNE und die Stadt Cottbus mit einer weiteren Bauetappe für Deutschlands größte schwimmende Solaranlage auf einem Bergbaufolgesee wieder einen Schritt näher gekommen. Zur sicheren Verankerung der schwimmenden Solar-Module wurden heute im Beisein des LEAG-CEOs Thorsten Kramer, des Cottbuser Oberbürgermeisters Tobias Schick, sowie des EPNE-Geschäftsführers Dominique Guillou die letzten von insgesamt 34 Dalben in den im Winter 2021/2022 verdichteten Tagebauboden eingerammt. „Deutschlands größte schwimmende Solaranlage auf dem größtem Bergbaufolgesee steht für die künftige Nutzung der einzigartigen Flächenpotenziale dieser Region. Dieses Vorhaben reiht sich konsequent in unser Transformationsprojekt GigawattFactory ein, mit der wir die Lausitz zu einem grünen Powerhouse umwandeln wollen“, sagt LEAG-CEO Thorsten Kramer. „Die Anlage soll ein Startpunkt für weitere erneuerbare Projekte im Umfeld des Sees werden. Mit einer Kombination von Floating PV, Windkraft und Seethermie steigt der Cottbuser Ostsee zu einer Modell-Region für eine nachhaltige Energieversorgung auf“, so Kramer.
Das Fraunhofer Institut bestätigte den Flächen auf Bergbaufolgeseen in ehemaligen Kohlerevieren selbst unter Berücksichtigung paralleler Nutzungsaspekte enorme PV-Potenziale von bis zu 2,74 GW. Allerdings müssten Investitionsanreize durch Innovationsausschreibungen geschaffen werden, da die Investitionskosten für schwimmende Solaranlage höher liegen als bei herkömmlichen PV-Freiflächenanlagen. Mit dem Abbau regulatorischer Hürden, sowie der Einordnung von Tagebauseen als Konversionsflächen im EEG könnte die Technologie deutlich zu den Ausbauzielen des Bundes beitragen.
Oberbürgermeister Tobias Schick: „Für mich ist wesentlich für die Transformation: Wir reden und debattieren nicht nur, sondern wir handeln. Wir wagen Neues. Und das gemeinsam in der Region. Und so bleiben Cottbus/Chóśebuz die Stadt der Energie und die Lausitz eine Energieregion auf höchstem und zukunftsträchtigen Niveau. Das ist ein Pfund im Strukturwandel, der eine sichere, stabile und grüne Versorgung mit Energie braucht und bekommen wird. Der Anspruch bleibt, dass all das mit Blick auf Industrie, Unternehmen und nicht zuletzt die Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlbar bleiben muss. Wer neues wagt, macht auch Fehler. Aber der erste Fehler wäre, nichts Neues mehr zu wagen. Transformation und Klimaschutz funktionieren nur gemeinsam und im Konsens auf dem Weg in eine nachhaltige und klimaschonende Zukunft. Unser Leben wird sich ändern, sei es bei der Mobilität oder beim Energieverbrauch. Letztlich gewinnen wir durch solche Vorhaben für uns alle an Lebens- und Stadtqualität.“
„Das Floating-PV-Projekt ist neben seiner Größe und Bedeutung für die künftige Modell-Region Cottbuser Ostsee, auch aus Sicht der Projektentwicklung ein Highlight“, betont Dominique Guillou, Geschäftsführer der EPNE. „Die Anlage wird auf dem trockenen Seeboden gebaut und schwimmt dann mit steigendem Wasserspiegel auf. Das ist bisher einmalig und der Grund für das innovative Verankerungssystem. Die Anlage soll sich gut in das Gesamtbild des Sees einfügen und auch in Einklang mit der touristischen Nutzung stehen. Darauf haben wir bei der Planung großen Wert gelegt. Nach zwei Jahren intensiver Planung und einer sehr guten Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern freuen wir uns, dass es jetzt in die Realisierungsphase startet“.
Im Laufe der Projektentwicklung konnten LEAG und EPNE die Leistung der schwimmenden Solar-Anlage auf 29 MW erhöhen (vorab 21 MW), wodurch sich die Jahresstromerzeugung auf 29.000 MWh steigert. Strom, mit dem der Jahresverbrauch von rund 8.250 Haushalten gedeckt werden kann. Die Anlagenfläche wird mit 16 Hektar (rund 22 Fußballfelder) weniger als ein Prozent der Seefläche ausmachen und steht damit im Einklang mit den touristischen Nutzungszielen des Sees. Die Inbetriebnahme der Floating-PV-Anlage ist für die zweite Jahreshälfte 2024 vorgesehen.
Die innovative Verankerung auf Basis von eingerammten Dalben ist das technologische Highlight des Projekts. Dalben sind eine bewehrte Technologie zur Verankerung von Seebrücken, bei einem Floating-PV-Projekt werden sie allerdings erstmalig angewendet. An 15 Meter langen Stahlrohren werden die Solar-Module während und nach Abschluss der Flutung auf dem 1900 Hektar großen See sicher verankert sein.
Vorteil des Verfahrens ist die wartungsarme Verankerung aufgrund weniger notwendiger Anker und der Verzicht auf eine Vielzahl von Ankerketten, welche beim an- und absteigenden Wasserspiegel nachjustiert werden müssten. Rund 51.000 Solarmodule auf fast 1.900 Schwimmkörpern werden an den 34 Dalben befestigt sein.
Neues Verbundvorhaben: Sauberes Wasser mit weniger Energie
Ein neues Verbundvorhaben, „ANAJO”, entwickelt eine besonders energieeffiziente Klärtechnik, die auf einer Abwasservorbehandlung ohne Sauerstoff basiert. Diese soll zunächst in der MENA-Region (Mittlerer Osten/Nordafrika) in Jordanien implementiert und etabliert werden. Das Projekt wird vom Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft der TU Berlin koordiniert und gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Industrie umgesetzt. Es wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz im Rahmen des Förderprogramms „Exportinitiative Umweltschutz” gefördert. Der Energiebedarf für Wasser und Abwasser in Jordanien entspricht etwa 16 Prozent des gesamten Energiebedarfs aller Sektoren. Rund 33 der jordanischen Kläranlagen werden mit dem Belebungsverfahren betrieben, das zu 50 bis 70 Prozent für den besonders hohen Energieverbrauch verantwortlich ist. Durch die Integration einer anaeroben Behandlungseinheit in die bestehenden Abwasserkläranlagen kann das Potenzial zur Energieeinsparung bis zu 50 Prozent betragen. Hier setzt das Projekt ANAJO „Kläranlagen in der MENA-Region: Anaerobvorbehandlung zur Steigerung der Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit” an. Konkret könnte die innovative, klimafreundliche Anaerob-Technologie eine Energieeinsparung von rund 1,5 bis 2,0 Millionen Kilowattstunden jährlich erreichen. Mit der Integration der Anaerob-Technik wird auch die Schlammentsorgung potenziell ökonomischer, ökologischer und nachhaltiger, Betriebskosten werden reduziert. Zur Demonstration des Potenzials einer anaeroben Vorbehandlung in die bestehenden Systeme mit hohem Sauerstoff- und Energieverbrauch in Jordanien installiert die TU Berlin gemeinsam mit ihren Projekt- und Kooperationspartnern eine anaerob-aerobe Pilotanlage und testet diese in zwei verschiedenen Kläranlagen. Verbundpartner sind die Ingenieurgesellschaft p2m berlin GmbH, die TIA Technologien zur Industrie-Abwasser-Behandlung GmbH sowie in Kooperation in Jordanien das Ministerium für Wasser und Bewässerung des Haschemitischen Königreichs Jordanien, die jordanische Wasserbehörde sowie die Universität von Jordanien in Amman und die Balqa Applied University in As-Salt.
Meldungen zu Labor 2023
| Meldungen 2013 | Meldungen 2014 | Meldungen 2015 | Meldungen 2016 |
| Meldungen 2017 | Meldungen 2018 | Meldungen 2019 | Meldungen 2020 |
| Meldungen 2021 | Meldungen 2022 |
| März 2023 |
| Trifluoracetat (TFA) |
| Keine Angst vor hohen Anforderungen Lösungen für die tägliche, zuverlässige TOC-Analytik |
Trifluoracetat (TFA)
Wir haben ein neues Prüfverfahren für die Bestimmung von TFA in Wasserproben entwickelt und in unseren Leistungskatalog aufgenommen. Die Analyse erfolgt mittels IC-MS/MS. Die Vielzahl möglicher Vorläufersubstanzen gilt als Erklärung, warum der Stoff flächendeckend in der Umwelt nachgewiesen werden kann und auch in Schweizer Grund- und Trinkwasser vorkommt. TFA ist persistent und sehr mobil.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Peter Kleinert oder Manuel Mazenauer.
https://laborveritas.ch/de/articles/trifluoracetat-tfa/
Keine Angst vor hohen Anforderungen Lösungen für die tägliche, zuverlässige TOC-Analytik
Im Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinien zur Industrial Emission Directive (IED) erfährt speziell der Parameter TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) einen breiten Eingang in die Abwasserüberwachung verschiedener Industrien. In den Industriepapieren zur Besten Verfügbaren Technologie (BVT) wird der moderne Parameter TOC gegenüber dem klassischen CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) bevorzugt.
Warum wird TOC gegenüber CSB bevorzugt?
TOC ist europaweit einheitlich genormt über die DIN EN 1484
für den Parameter CSB gibt es keine Euronorm
bei der TOC-Bestimmung kommen keine hochtoxischen Verbindungen zum Einsatz
Über standortspezifische Korrelationsfaktoren ist es möglich aus den TOC-Werten auf die bisher bestimmten CSB-Werte umzurechnen und dadurch eine Kontinuität zum bisherigen Verfahren zu wahren
Die deutsche Abwasserverordnung wurde im August 2018 novelliert und an die europäischen Richtlinien angepasst. Der Parameter TOC nimmt nun auch in Deutschland eine zentrale Rolle in der Überwachung von Abwässern ein. Betroffen sind vor allem die Zellstofferzeugung, die Produktion von Papier, Karton und Pappe sowie die Erdölverarbeitung. Weitere Industrien sollen folgen – unter anderem die Abfallbehandlung, die Holzfaserherstellung und die chemische Industrie.
Neue TOC/TNb-Zielwerte für das Abwasser an der Einleitungsstelle je Industrie auf einen Blick:
Zellstofferzeugung TOC 12 kg/t und TNb 20 mg/l
Papier-Karton-Pappe TOC 0,90 kg/t und TNb 20 mg/l
Erdölverarbeitung TOC 25 mg/l und TNb 20 mg/l
Tägliche Messungen von TOC
Die Messfrequenz der Parameter TOC und TNb (gesamter gebundener Stickstoff) erhöht sich im Zuge der neuen Bestimmungen. Heute müssen Abwasserproben täglich auf diese Parameter hin überprüft werden (24-Std. bzw. 2-Std. Mischprobe). Viele Direkteinleiter integrieren inzwischen die entsprechende Geräteanalytik ins betriebseigene Abwasserlabor, da bei derart hoher Messfrequenz eine Vergabe an externe Dienstleister aus zeitlichen und wirtschaftlichen Gründen kaum noch sinnvoll ist. Die betroffenen Industrien benötigen jetzt Analyse-Lösungen, die für hohen Durchsatz und verschleppungsfreies Arbeiten im Abwasserbereich optimiert sind und sich schnell und kosteneffizient in die bestehenden Analyseprozesse der Unternehmen integrieren können.
Keine Angst vor hohen Anforderungen in der TOC-/TNb-Analyse
Analytik Jena bietet mit der multi N/C –Serie eine optimierte Lösung für die simultane Bestimmung der Parameter TOC und TNb. Die von der EU und von der deutschen Abwasserverordnung geforderten täglichen Messungen werden so zur Routineaufgabe.
Auch besonders partikelhaltige und ölige Abwasserproben, wie sie häufig in der Zellstoff- oder Erdölverarbeitung vorkommen, analysiert die multi N/C-Serie problemlos. Analytik Jena setzt hier als einziges Unternehmen bei ihren katalytischen Hochtemperatur-Verbrennungsgeräten auf Injektionstechniken, die Probenverschleppung und Verstopfungsrisiken nahezu vollständig eliminieren.
Küvetten Test-Kits sind ein verbreiteter Weg in vielen Industrien TOC/CSB in Abwässern zu messen. Jedoch bringen sie einige wesentliche Nachteile mit sich:
Nur geringe Probenzahl manuell messbar
Hohe Kosten für Kits und lange Messzeiten resultieren in hohen Kosten per Probe
Testkits für unterschiedliche Konzentrationsbereiche erforderlich (Problem der Messgenauigkeit und Nachweisempfindlichkeit)
Fehlerrisiko durch Anwender hoch
Keine simultane TNbBestimmung
Einsatz toxischer Chemikalien bei der CSBBestimmung, Gefahr für Anwender und Problem der umweltgerechten Entsorgung
Mit den Systemen der multi N/C-Serie erreichen Sie eine höhere Genauigkeit der Ergebnisse und reduzieren mittelfristig Ihre Messkosten erheblich. So sind Sie auch für striktere nationale und internationale Regularien bestens vorbereitet.
Vorteile multi N/C-Serie zur TOC-/TNb-Bestimmung im Überblick:
Höhere Messgenauigkeit
Hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
Hoher Probendurchsatz
Automatisierung schließt menschliche Fehlerquellen aus
Keine schädlichen Chemikalien, mit denen der Anwender in Kontakt kommt
Niedrige Betriebskosten
Simultane TOC und TNb-Bestimmung möglich
Keine Anwendung, keine Probe ist wie die andere. Daher bietet Ihnen Analytik Jena eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre analytische Herausforderung – Analysesystem, Methodenentwicklung und langfristiger Support in einem Gesamtkonzept.
Unsere TOC- Experten beraten Sie gern und bereiten Sie optimal auf die neuen Anforderungen der Abwasserüberwachung vor.
Downloads Applikationsbeispiele für die Abwasserüberwachung
https://www.analytik-jena.de/industrien-loesungen/industrien/umwelt-alt/abwasseranalytik-alt/eu-abwasserrichtlinien-schluesselparameter-toc/
Informationen aus Sachsen-Anhalt 2022
Bessere Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung
In Sachsen-Anhalt sind laut dem Landesverwaltungsamt 95,22 Prozent der rund 2,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen. Aktuell laufen derzeit 29 Vorhaben zur Verlegung von 34,3 Kilometer Schmutzwasserkanal sowie zum Neubau der Kläranlage Treseburg des Zweckverbands Ostharz, wie eine Sprecherin der Behörde in Halle mitteilte. Mehr:
Echtzeit-Überwachung der Wasserqualität für die Rappbodetalsperre
UFZ, Fernwasser Elbaue-Ostharz und Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt intensivieren Kooperation
Die Rappbodetalsperre im Harz ist eine sehr wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung in Mitteldeutschland. Um die Auswirkungen von Landschafts- und Klimaveränderungen wie Waldverlust und Hitzewellen auf den Gewässerzustand, die daran gekoppelten Ökosystemdienstleistungen und die Wasserqualität zu erfassen und für das Talsperrenmanagement nutzbar zu machen, bauen das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt und die Fernwasser Elbaue-Ostharz ihre Zusammenarbeit aus und schaffen einen in Deutschland einmaligen Verbund von Praxis und Forschung: Sie unterzeichneten gestern, am Internationalen Tag des Wassers, einen trilateralen Kooperationsvertrag für ein gemeinsam betriebenes Talsperren-Observatorium, das auf bereits etablierten Messnetzen des UFZ beruht.
Die Rappbodetalsperre in Sachsen-Anhalt ist mit einer Staumauerhöhe von 106 Metern und einem Stauvolumen von mehr als 110 Mio. Kubikmetern die größte Trinkwassertalsperre Deutschlands. Mit dem daraus gewonnenen Trinkwasser werden über eine Million Menschen in Mitteldeutschland versorgt. Die Rappbodetalsperre ist aber auch Forschungsstandort: Im Talsperren-Observatorium Rappbode (TOR) analysieren UFZ-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler die Wechselwirkungen zwischen Beschaffenheit und Nutzung der Einzugsgebiete auf der einen Seite sowie dem ökologischen Zustand und der Wasserqualität der Rappbodetalsperre, der Vorsperren und der Hauptzuflüsse auf der anderen Seite. Das TOR ist Teil von TERENO (TERrestrial ENvironmental Observatories) – einem Projekt, das die Helmholtz-Gemeinschaft im Jahr 2008 zur deutschlandweiten integrierten Erdbeobachtung für ökologische, soziale und ökonomische Folgen des globalen Wandels gegründet hat. „Wir haben zur Untersuchung der Wasserqualität im Talsperren-Observatorium ein umfangreiches Monitoring aufgelegt, in dem die Wasserqualität, die Stoffströme und die Biodiversität der Talsperren und ihrer Zuflüsse in verschiedenen zeitlichen Abständen und auf unterschiedlichen räumlichen Skalen analysiert werden“, sagt Dr. Karsten Rinke, TOR-Leiter und Leiter des UFZ-Departments Seenforschung. Seine Forschungsgruppe hat dafür im Einzugsgebiet der Talsperre zahlreiche Messgeräte wie beispielsweise Multiparametersonden, Datenlogger und automatische Probenehmer zur Überwachung der Wasserqualität installiert. Die daraus gewonnenen Daten fließen in die Forschung ein, werden aber auch dem Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB) und der Fernwasser Elbaue-Ostharz (FEO) bereitgestellt und von diesen genutzt.
Seit 2011 – von Beginn an – kooperieren das UFZ, der TSB und die FEO jeweils bilateral, indem sie bei der Definition von Forschungszielen und der Untersuchung der Talsperren zusammenarbeiten und sich gegenseitig Daten zur Verfügung stellen. Diese Kooperation wird jetzt deutlich ausgebaut, indem der Betrieb des Observatoriums auf eine solide fachliche, wirtschaftliche und organisatorische Basis gestellt wird. Damit entsteht eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis, die über den üblichen Austausch von Daten hinausgeht und auch die anfallenden Kosten und den Arbeitsaufwand für Wartung und Investitionen zwischen den Partnern neu regelt. So übernehmen zum Beispiel der TSB und die FEO die Investitionskosten für den Erhalt der TOR-Infrastruktur und die Wartungskosten aller Messgeräte. Das UFZ verantwortet im Gegenzug dazu die Wartungsarbeiten vor Ort, die Beprobung an ihren Untersuchungsstandorten, die Analyse und die Auswertung der Wasserproben zur Qualitätskontrolle im Einzugsgebiet sowie die zentrale Datenhaltung und -bereitstellung. Das TOR ist damit die erste wissenschaftliche Infrastruktur aus dem breit angelegten Investitionsprogramm der BMBF-geförderten TERENO-Projekte, die den Sprung in eine Praxisanwendung geschafft hat und damit finanziell unabhängig geworden ist.
Prof. Dr. Rolf Altenburger, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), erklärt: „Ziel der Zusammenarbeit ist das Wasserqualitätsmonitoring der Zuflüsse und der Wasserkörper des Rappbode-Talsperrensystems. Auf diese Weise können wir Auswirkungen des Klimawandels und der Nutzung in den Einzugsgebieten auf die Wasserkörper frühzeitig erkennen und wissenschaftlich bewerten. Dass der TSB und die FEO auf diese Weise in das Monitoring eingestiegen sind, unterstreicht und stärkt die Anwendbarkeit und Praxisrelevanz der UFZ-Forschung im Umweltmonitoring.“
Der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt ist für die Planung, den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung aller Talsperren in Sachsen-Anhalt verantwortlich. Er regelt die Wasserabflüsse, vertreibt das Rohwassers, führt die Stauanlagendokumentationen, nutzt das Wasserkraftpotenzial und erarbeitet als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen. Burkhard Henning, Geschäftsführer des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt (TSB), sagt: „Die kontinuierliche Bereitstellung von Rohwasser ist eine große Herausforderung. Die letzte Dekade hat gezeigt, dass der Klimawandel auch Auswirkungen auf die Menge und Qualität des Dargebotes hat. Umso wichtiger ist es bei rückläufigen Zuflüssen, den Speicher der Rappbodetalsperre immer wieder mit hochwertigen Rohwasser zu füllen. Die Daten, die hier gewonnen werden, sind eine solide Grundlage für die Steuerung des Talsperrensystems.“
Die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz gewinnt hochwertiges Trinkwasser aus dem Grundwasserleiter der Elbau und dem Rappbode-Talsperrensystem im Ostharz. Dr. Dirk Brinschwitz, technischer Geschäftsführer der FEO, betont: „Durch die kontinuierliche Überwachung des gesamten Einzugsgebiets können mögliche Eintragsquellen von natürlichen oder anthropogenen Stoffen in das Rohwasser schnell identifiziert und im Idealfall abgestellt werden. Damit beginnt unsere Qualitätssicherung für die Trinkwasserversorgung bereits dort, wo sie am effektivsten und nachhaltigsten ist – an der Quelle. Gleichzeitig erlaubt uns die wissenschaftliche Analyse der langfristigen Entwicklung der Wassergüte des Talsperrensystems, Fragen der Aufbereitungstechnologie vorausschauend im Blick zu haben. Mit dem gestern unterzeichneten Vertrag festigen wir diese wichtige, bereits über viele Jahre bewährte Zusammenarbeit.“
https://www.ufz.de/index.php?de=36336&webc_pm=11/2023
Städtebaufördermittel für Naumburg
Mit gleich zwei Fördermittelbescheiden für verschiedene Baumaßnahmen in Naumburg reiste der Präsident des Landesverwaltungsamtes Thomas Pleye am Freitag nach Naumburg, um diese an den Oberbürgermeister der Stadt Armin Müller zu übergeben.
„Die Städtebauförderung ist nach wie vor eine tragende Säule für die Entwicklung in unseren Städten und Gemeinden. Die Förderung unterstützt die Kommunen, wichtige Investitionen in die Stadt- und Ortsentwicklung zu tätigen, wodurch Ortskerne attraktiv gestaltet werden, brachliegende Flächen aktiviert oder Grün- und Freiflächen geschaffen werden können.“, erläutert Pleye bei der heutigen Übergabe.
Mit den Fördermitteln kann mit dem Rückbau einiger Gebäudeteile der ehemaligen JVA eine wichtige innerstädtische Baumaßnahme fortgesetzt werden.
Nach der Schließung der JVA Naumburg im Jahr 2012 hatte sich die Stadt Naumburg entschlossen, auf dem Gelände ein innerstädtisches Wohnquartier zu entwickeln. Dabei musste die teilweise denkmalgeschützte Bausubstanz (einstiges Wohnhaus des Anstaltsleiters, Freigängerhaus und ursprüngliches Schwurgerichtsgebäude) in die Planungen einbezogen werden. Die JVA Naumburg geht auf das ehemalige königliche Schwurgericht zurück. Insbesondere das ehemalige Gerichtsgebäude aus dem Jahr 1859 ist von besonderer städtebaulicher und geschichtlicher Bedeutung.
Im Jahr 2019 wurden der Stadt Naumburg für den Rückbau der nicht denkmalrelevanten Bausubstanz im Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ Fördermittel in Höhe von rund 830.000 Euro bewilligt. Die Stadt selbst steuerte noch einmal rund 420.000 Euro dazu. Auch der Investor beteiligte sich an den Rückbaukosten.
Nach abschließender Planung und Prüfung durch den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) wurde festgestellt, dass diese Summe für die aufwendigen Rückbaumaßnahmen nicht reichen werden.
„Trotz der angespannten Haushaltslage hatte sich die Stadt Naumburg daraufhin entschlossen, für dieses städtebaulich bedeutsame Vorhaben am Rande der historischen Altstadt einen weiteren Antrag für einen zweiten Finanzierungsabschnitt zu stellen, der die Mehrkosten der erforderlichen Rückbaumaßnahmen auffangen sollte“, so Pleye weiter.
Aufgrund der städtebaulichen und bauhistorischen Bedeutung wurde dieses Vorhaben in das Landesprogramm „Lebendige Zentren“ aufgenommen und weitere Fördermittel in Höhe von rund 420.000 Euro freigegeben.
„Ich freue mich, mit diesem Bescheid die Fortführung dieses für Naumburg wichtigen Projektes sicherstellen zu können, zumal auch der Investor seinen Teil dazu beiträgt und seinerseits mit rund 140.000 Euro unterstützt.“
Die zweite Maßnahme, die seitens des Landesverwaltungsamtes mit Fördermitteln unterstützt wird, ist städtebaulich nicht weniger bedeutend und beinhaltet den Bau eines Regenüberlaufbeckens als sechsten und letzten Abschnitt eines kompletten Systems (RÜB 6). Die historisch gewachsene Entwässerungsstruktur der Stadt Naumburg wurde in den vergangenen Jahren schrittweise an die geänderten gesetzlichen Anforderungen und auch an die Anforderungen aufgrund des Klimawandels angepasst. Mit dem Regenüberlaufbecken wird dieser Transformationsprozess abgeschlossen. Neben den positiven Auswirkungen auf die Umwelt werden im Falle von Starkregenereignissen zukünftig auch die Bürgerinnen und Bürger sowie die wertvolle historische Stadtstruktur und Bausubstanz besser geschützt und vor Schäden bewahrt.
Die Gesamtinvestitionen für das Becken belaufen sich auf mehr als 8,2 Mio. Euro, von denen die Stadt Naumburg ihren Anteil von 2,74 Mio. Euro durch Fördermittel zur Verfügung gestellt bekommt und damit finanziell entlastet wird. Dieser Anteil ist Gegenstand des Förderbescheides. Maßnahmenträger ist der zuständige Abwasserzweckverband. Das RÜB 6 ist der letzte Abschnitt des kompletten Systems im Stadtgebiet Naumburg.
Hintergrund:
Die Städtebauförderung wurde vor 30 Jahren mit ihren verschiedenen Förderprogrammen auch in den neuen Bundesländern eingeführt und entwickelte sich hier zum wohl größten Förderprogramm in der Geschichte Sachsen-Anhalts.
„Das Land hat in den Programmen der Städtebauförderung gemeinsam mit dem Bund und der EU seit 1991 rund vier Mrd. Euro an Fördermitteln für die Finanzierung von Investitionen in den Kommunen bereitgestellt. Zuzüglich der Mindesteigenanteile der geförderten Kommunen in Höhe von insgesamt knapp einer Mrd. Euro konnten die Kommunen Investitionen in Höhe von über fünf Mrd. Euro tätigen, eine beeindruckende Zahl, die widerspiegelt, wie ganze Städte ihr Gesicht zum positiven verändern konnten. In Naumburg werden jetzt Projekte in Angriff genommen, die wesentlich dazu beitragen werden, die Stadt attraktiver und wohnlicher zu machen“, so der Präsident des Landesverwaltungsamtes Thomas Pleye.
Um die Städte bei der Bewältigung des strukturellen Wandels, der sich nicht zuletzt aus der demographischen Entwicklung der Bevölkerung ergibt, zu unterstützen, gewähren Bund und Land auch weiterhin Städtebauförderungsmittel. Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung nachhaltiger Stadtstrukturen, die einerseits den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht werden und andererseits die geschichtliche und gesellschaftliche Entwicklung der Städte als urbane Zentren dokumentieren. Damit die Städte die neuen Aufgaben und Herausforderungen besser bewältigen können, unterstützen Bund und Land die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen mit Programmen zur Städtebauförderung. Dazu gewähren Bund und Land Finanzhilfen, die durch Mittel der Kommunen ergänzt werden.
Ziele der Städtebauförderung sind:
Stärkung von Innenstädten und Ortszentren in ihrer städtebaulichen Funktion, auch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes,
Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten; Kennzeichen für solche Funktionsverluste ist vor allem ein dauerhaftes Überangebot an baulichen Anlagen, wie z.B. Wohnungsleerstand oder Brachflächen in Innenstädten, insbesondere von Industrie-, Konversions- und Bahnflächen,
bauliche Maßnahmen zur Behebung sozialer Missstände.
Zur Verwirklichung dieser Förderziele gewährten Bund und Land im Jahr 2022 Städtebauförderungsmittel aus den folgenden Förderprogrammen:
Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne (rd. 31,6 Mio. Euro)
Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten (rd. 24,9 Mio. Euro)
Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten (rd. 34,7 Mio. Euro)
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (rd. 5,2 Mio. Euro)
Impressum:
Landesverwaltungsamt
Pressestelle
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
Tel: +49 345 514 1244
Fax: +49 345 514 1477
Sachsen-Anhalts Kläranlagen speisen nur wenig Strom ein
Halle (dpa/sa) – In Sachsen-Anhalts Kläranlagen ist im vergangenen Jahr fast genau so viel Strom mit dem dort gewonnenen Klärgas erzeugt worden wie 2020.
Die befragten Anlagen hätten insgesamt 32,2 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag in Halle mit. Im Jahr davor waren es demnach 32,3 Millionen Kilowattstunden. Die Menge stagniert seit etwa vier Jahren.
Fast die gesamte Menge (31,6 Millionen Kilowattstunden) des Klärgas-Stroms sei direkt in den Kläranlagen verbraucht worden, um etwa
Land weitet Corona-Analysen im Abwasser auf Klärwerke aus
Regelmäßige Untersuchungen von Abwasser auf Corona-Viren liefern laut Experten wichtige Informationen über das Infektionsgeschehen. Sachsen-Anhalt will noch mehr darüber wissen – für die Zukunft.
Spurensuche im Abwasser: Sachsen-Anhalt weitet sein Pilotprojekt zum Coronaviren-Screening deutlich aus. Ab Herbst sollen in zwölf statt bisher in vier repräsentativen Klärwerken…mehr:
37,6 Mio. Euro für Naturschutz an Gewässern
Das Umweltministerium Sachsen-Anhalt will die Investitionen in den Naturschutz an Seen und Flüssen 2022 deutlich verstärken. Die entsprechende Förderung von Land, Bund und EU soll in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Vorjahr von 15,5 auf 37,6 Millionen Euro mehr als verdoppelt werden, teilte das Ministerium mit. Ebenfalls steigen sollen die Investitionen in den Hochwasserschutz, und zwar um 29,5 Prozent von 73,6 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 95,3 Millionen Euro im laufenden Jahr.
„Der Klimawandel ist auch für unsere Gewässer ein enormer Stresstest. Einerseits werden Starkregen und Hochwasser zunehmen, andererseits sorgen extrem trockene und warme Sommer dafür, dass Wassertemperaturen steigen, kleinere Gewässer …mehr:
Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.
Landwirte aus Sachsen-Anhalt klagen gegen Landesdüngeverordnung
Sechs Landwirtschaftsbetriebe aus Sachsen-Anhalt haben beim Oberverwaltungsgericht des Bundeslandes eine Normenkontrollklage gegen die Vorschriften des Düngerechts eingereicht. Die Betriebe wehren sich vor allem gegen die mit der Ausweisung von besonders mit Nitrat belasteten Roten Gebieten verbundenen Bewirtschaftungsauflagen, teilte der Bauernbund-Sachsen-Anhalt mit. Ziel der Normenkontrollklage sei es, dass Nitratbelastungen des Grundwassers, sofern sie wissenschaftlich korrekt nachweisbar sind, und deren Verursacher, fachlich korrekt evaluiert werden.
Die Antragsteller hätten erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Daten und der hydrogeologischen Annahmen, heißt es den Angaben zufolge in der Klageschrift, die die Potsdamer Rechtsanwaltskanzlei HSA Rechtsanwälte Hentschke & Partner auf der Grundlage eines Fachgutachtens des Berliner Ingenieurbüros Hydor Consult verfasst hat.
Wegen der zu hohen Nitratbelastung an für sie relevanten Grundwassermessstellen dürften die Landwirtinnen und Landwirte beispielsweise nur noch 80 Prozent des ermittelten Düngerbedarfs aufwenden, den die Nutzpflanzen …mehr:
Kleinkläranlagen: Info
Kleinkläranlagen werden auch in Zukunft als ein wesentlicher Anteil der Abwasserbeseitigung in Sachsen-Anhalt zum Einsatz kommen. Es sind bundesweit einheitliche Mindestanforderungen in der Abwasserverordnung für die Einleitung von Abwasser aus Kleinkläranlagen festgelegt. Zur Einhaltung dieser Anforderungen benötigen die Kleinkläranlagen grundsätzlich eine biologische Reinigungsstufe. Die als Dauerlösung meist im ländlichen Bereich betriebenen Anlagen müssen dem Stand der Technik angepasst werden.
Das Land und die Investitionsbank Sachsen-Anhalt helfen Grundstückseigentümern bei der Finanzierung des Neubaus oder der Umrüstung von Kleinkläranlagen mit dem zinsgünstigen Darlehen „Sachsen-Anhalt KLAR“.
Finanziert werden kann ein Neubau oder eine Umrüstung einer Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgrube
Insbesondere:
Investitionskosten inklusive Planungsleistungen und Kosten für die Erstellung notwendiger Zufahrtswege
Verwaltungsgebühren sowie Ausgaben, die der Abnahme und Freigabe der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgrube dienen.
Antragsberechtigt sind:
private Grundstückseigentümer
Erbbauberechtigte
Zuständige Stelle
Rechtsgrundlage
Weitere Informationen
Typisierung
https://buerger.sachsen-anhalt.de/detail?areaId=&pstId=36662069&ouId=&infotype=0
Neue Landesverordnung für nitratgefährdete Gebiete in Kraft
Seit dem 6. Juli 2019 ist in Sachsen-Anhalt die neue „Verordnung über ergänzende düngerechtliche Vorschriften“ in Kraft. Diese Verordnung regelt die Ausweisung von nitratgefährdeten Gebieten. Dies sind Gebiete von Grundwasserkörpern, die aufgrund von Nitrat in den schlechten Zustand eingestuft wurden. Ziel der Verordnung ist die Verbesserung des Grundwasserschutzes. In Sachsen-Anhalt erfolgt die Ausweisung der Gebietskulisse nach der Methodik der Binnendifferenzierung. Dabei werden die boden-klimatischen Besonderheiten des Landes als mitteldeutsches Trockengebiet mit unter anderem geringen Niederschlägen und Sickerwasserraten in einer Risikoanalyse für erhöhte Nitratkonzentrationen im Grundwasser berücksichtigt. Zum besseren Schutz des Grundwassers gelten in den ausgewiesenen Gebieten strengere Regeln als die allgemein geltenden Anforderungen der Düngeverordnung. Der ermittelte Düngebedarf darf aufgrund nachträglich eintretender Umstände wie zum Beispiel günstige Witterungs- und Wachstumsbedingungen um maximal 10 Prozent überschritten werden. Festmist von Huf- und Klauentieren sowie Kompost dürfen im Zeitraum vom 15. November bis 31. Januar nicht aufgebracht werden. Zusätzlich sind die Betriebe verpflichtet, vor Ausbringung von Wirtschaftsdüngern oder Gärrückständen deren Gehalt an Nährstoffen nach wissenschaftlich anerkannten Messmethoden zu ermitteln oder diese im Auftrag feststellen zu lassen.
Energieeffizienz: Sachsen-Anhalt fördert Wasseranlagen
Das Land Sachsen-Anhalt fördert Investitionen in die Verbesserung der Energieeffizienz von Trink- und Abwasseranlagen. Das teilte das Landesumweltministerium am Donnerstag in Magdeburg mit. Die Landesregierung habe sich das Ziel gesetzt, bis zum kommenden Jahr 1,8 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Deswegen würden sich besonders Investitionen im kommunalen Bereich in die Anlagen der Abwasserbeseitigung und Trinkwasserversorgung lohnen, da diese Anlagen sehr viel Energie verbrauchen.
„Wir können bei unseren Abwasseranlagen viel Energie sparen. Im kommunalen Bereich ist die Abwasserbeseitigung der größte und die Trinkwasserversorgung ein wesentlicher Einzelverbraucher von Energie. Durch neue maschinentechnische Ausrüstung oder durch verfahrenstechnische Umstellungen kann die Energieeffizienz dieser Anlagen gesteigert werden. In vielen Fällen kann mit dem Bau von Faulbehältern die im Klärschlamm enthaltene Energie genutzt und der externe Energiebedarf gesenkt werden. Dadurch wird Energie eingespart, der CO2-Ausstoß verringert und Kosten eingespart. Das schont am Ende auch den Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger“, so Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne).
Die Finanzierung der Förderung wird den Angaben zufolge aus dem EFRE- Fonds erfolgen. Die Richtlinie zur Förderung wasserwirtschaftlicher Vorhaben sei um den Tatbestand „Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von öffentlichen Abwasseranlagen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung“ erweitert worden. Laut Ministerium stehen die Förderperiode 2014 – 2020 rund 16 Millionen Euro bereit.
Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen.
Energieeffizienz und Kläranlagen
Die Kläranlage – ein kommunaler „Energiefresser“
Mit einem jährlichen Energiebedarf von insgesamt rund 3.200 GWh gehören die mehr als 10.000 überwiegend kommunal betriebenen Kläranlagen zu den größten Energieverbrauchern Deutschlands. Ihr Anteil am Stromverbrauch in den Kommunen liegt durchschnittlich bei etwa 20 Prozent und ist damit höher als bei Schulen oder Krankenhäusern.
Das Land Sachsen-Anhalt verfügt derzeit über einen Bestand von rund 230 kommunalen Kläranlagen (Stand Dezember 2015) und eine Vielzahl von Kläranlagen in privater Hand in verschiedensten Größenklassen. Damit stellt sich ganz konkret die Frage nach Energieeinsparpotenzialen: Welche es gibt und wie groß diese sind, konnte durch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung in der Kombination zeitgemäßer Mess- und Prüfverfahren ermittelt werden.
In Kooperation mit dem Institut für Automation und Kommunikation (ifak e. V.) und dem Eigenbetrieb Abwasser Aschersleben hat die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA) ein Pilotprojekt zur Energieeffizienzanalyse durchgeführt. Durch die am ifak entwickelte Software SIMBA# wurden die Prozesse in der Kläranlage Aschersleben simuliert. Mit vorhandenen Parametern und neuen Messdaten konnten die Wissenschaftler Rückschlüsse auf den Zustand der Anlage ziehen und so Einspar- potenziale ermitteln. Im Rahmen der Studie wurden verschiedene Szenarien zur Einsparung untersucht, so unter anderem der Austausch der Gebläse bzw. der Umbau der Anlage. Die Ergebnisse sind bemerkenswert. Bereits mit einfachen Eingriffen in den Betriebsablauf (u. a. die Verringerung der Rotationsgeschwindigkeit der Rührwerke und der Austausch der Gebläse) können unter bestimmten Bedingungen Einsparungen von 183 MWh pro Jahr erzielt werden. Das sind 17 Prozent der verbrauchten Energie .
Ein zweites Fazit der Analyse ist, dass ein Umbau der Anlage zur anaeroben Schlammstabilisierung mit Faulgasnutzung zusätzliche Einsparpotenziale in erheblichem Maße mit sich bringt. Dies zieht einerseits umfangreiche Investitionen nach sich. Anderseits kann Energie eingespart und zum Teil sogar selbst erzeugt werden. Durch die Verstromung des Faulgases könnten etwa 48 Prozent des jährlichen Gesamtstrombedarfes gedeckt werden.
Der Umbau zu einer Anlage zur anaeroben Schlammstabilisierung mit Faulgasnutzung erweist sich ab einem gewissen Einwohnerwert als wirtschaftlich sinnvoll. Der Einwohnerwert ist der Referenzwert der Schmutzfracht in der Wasserwirtschaft. Unter dem Aspekt der demografischen Entwicklung müssen auch die Investitionen betrachtet werden. An dieser Stelle könnten gezielte Fördermaßnahmen motivierend wirken.
Stromerzeugung aus Klärgas um 9 % gestiegen
Im Jahr 2017 wurden in Sachsen-Anhalt 23,0 Millionen Kilowattstunden Strom in Kläranlagen erzeugt. Gegenüber 2016 war das ein Plus von 9,0 %. Von der erzeugten Strommenge verbrauchten die Klärwerksbetriebe 95,5 % selbst, die restliche Menge speisten sie in das öffentliche Netz. Insgesamt gewannen die befragten Kläranlagen 13,4 Millionen m³ Klärgas (Rohgas) mit einem Energiegehalt von 294 238 Gigajoule. Für die Stromerzeugung wurden 11,7 Millionen m³ und zu reinen Heiz- und/oder Antriebszwecken 1,2 Millionen m³ Rohgas eingesetzt. Die Verluste (Fackel- und sonstige Verluste) beliefen sich auf 0,5 Millionen m³.
Die Kläranlage – ein kommunaler „Energiefresser“
Mit einem jährlichen Energiebedarf von insgesamt rund 3.200 GWh gehören die mehr als 10.000 überwiegend kommunal betriebenen Kläranlagen zu den größten Energieverbrauchern Deutschlands. Ihr Anteil am Stromverbrauch in den Kommunen liegt durchschnittlich bei etwa 20 Prozent und ist damit höher als bei Schulen oder Krankenhäusern.
Das Land Sachsen-Anhalt verfügt derzeit über einen Bestand von rund 230 kommunalen Kläranlagen (Stand Dezember 2015) und eine Vielzahl von Kläranlagen in privater Hand in verschiedensten Größenklassen. Damit stellt sich ganz konkret die Frage nach Energieeinsparpotenzialen: Welche es gibt und wie groß diese sind, konnte durch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung in der Kombination zeitgemäßer Mess- und Prüfverfahren ermittelt werden.
In Kooperation mit dem Institut für Automation und Kommunikation (ifak e. V.) und dem Eigenbetrieb Abwasser Aschersleben hat die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA) ein Pilotprojekt zur Energieeffizienzanalyse durchgeführt. Durch die am ifak entwickelte Software SIMBA# wurden die Prozesse in der Kläranlage Aschersleben simuliert. Mit vorhandenen Parametern und neuen Messdaten konnten die Wissenschaftler Rückschlüsse auf den Zustand der Anlage ziehen und so Einspar- potenziale ermitteln. Im Rahmen der Studie wurden verschiedene Szenarien zur Einsparung untersucht, so unter anderem der Austausch der Gebläse bzw. der Umbau der Anlage. Die Ergebnisse sind bemerkenswert. Bereits mit einfachen Eingriffen in den Betriebsablauf (u. a. die Verringerung der Rotationsgeschwindigkeit der Rührwerke und der Austausch der Gebläse) können unter bestimmten Bedingungen Einsparungen von 183 MWh pro Jahr erzielt werden. Das sind 17 Prozent der verbrauchten Energie (vgl. Abbildung Energieverbrauch).
Ein zweites Fazit der Analyse ist, dass ein Umbau der Anlage zur anaeroben Schlammstabilisierung mit Faulgasnutzung zusätzliche Einsparpotenziale in erheblichem Maße mit sich bringt. Dies zieht einerseits umfangreiche Investitionen nach sich. Anderseits kann Energie eingespart und zum Teil sogar selbst erzeugt werden. Durch die Verstromung des Faulgases könnten etwa 48 Prozent des jährlichen Gesamtstrombedarfes gedeckt werden.
Der Umbau zu einer Anlage zur anaeroben Schlammstabilisierung mit Faulgasnutzung erweist sich ab einem gewissen Einwohnerwert als wirtschaftlich sinnvoll. Der Einwohnerwert ist der Referenzwert der Schmutzfracht in der Wasserwirtschaft. Unter dem Aspekt der demografischen Entwicklung müssen
https://lena.sachsen-anhalt.de/oeffentlicher-sektor/energieeffizienz-und-klaeranlagen/
Umbau der Kläranlage in Rollsdorf kurz vor Abschluss, zwei Drittel der Investition durch EU-Fonds ELER gefördert
Baden, Duschen, Geschirr spülen, Wäsche waschen, Kochen … oder das Betätigen der Toilettenspülung: Etwa 135 Liter Wasser verbraucht jeder Mensch in Deutschland pro Tag. Und jeder von uns ist dabei an eine hohe Wasserqualität gewöhnt. Damit – wie vom Umweltbundesamt bezeichnet – „unser Trinkwasser das reinste Lebensmittel“ bleibt und mit den Ressourcen verantwortungsvoll umgegangen wird, stellen die Kläranlagen einen wichtigen „Baustein“ der Wasserwirtschaft dar. Der Bau und die Sanierung von Abwasseraufbereitungsanlagen erfolgt unter dieser Prämisse sowie unter der Berücksichtigung von Einwohnerprognosen und gewerblicher Ansiedlung. Die Kläranlage in Rollsdorf, unweit des Süßen Sees, ist eine der Anlagen, die derzeit umgebaut wird. Die mehrere Millionen Euro umfassende Maßnahme wird durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) gefördert.
Die hochkomplexe Kläranlage sorgt dafür, dass das gereinigte Abwasser in die Salza eingeleitet werden kann. Seit zwei Jahren wird die Anlage, die bisher mit aerober Schlammstabilisierung gearbeitet hat, zu einer Kläranlage mit anaerober Schlammbehandlung umgebaut. Daraus ergibt sich neben der dringend erforderlichen Kapazitätserhöhung eine erhebliche Energieeinsparung.
Kläranlage Rollsdorf. Das neugebaute Schlammsilo geht 19 Meter in die Tiefe
Derzeit werden die Systeme Schritt für Schritt getestet, bevor die Kläranlage Anfang 2012 vollständig in Betrieb gehen wird. „Das Abwasser aus Eisleben wird durch eine 15 km lange Überleitung nach Rollsdorf gepumpt“, berichtet Steffen Girnus. Der Diplomingenieur der Pöyry Deutschland GmbH ist Projektleiter für die Baumaßnahme in Rollsdorf. Besonders stolz ist er darauf, dass die gesamte Überleitungsstrecke mit nur einem Pumpwerk betrieben wird. „Das ist unter Beachtung aller Randbedingungen im Einzugsgebiet in Europa bisher einmalig“, meint er. Der Umbau der Kläranlage fand unter laufendem Betrieb statt. Eine schwierige Aufgabe war es, in der ganzen Zeit dafür zu sorgen, dass die Abwasserreinigung nicht unter den Baumaßnahmen leidet.
rweiterung der Kläranlage Rollsdorf. Die Gestaltung der Außenanlagen – wie hier rund um den neuen Faulturm – gehört zu den letzten Arbeitsschritten vor Inbetriebnahme Anfang 2012.
Durch das neue Schlammsilo braucht der Schlamm nicht mehr offen gelagert werden. Das hat eine Geruchsminderung zur Folge, die allerorts begrüßt wird. Und in Rollsdorf, das von Gärten und Weinhängen umgeben ist, erst recht. Die zwei neu errichteten Blockheizkraftwerke werden im Übrigen mit dem aus der Abwasserreinigung gewonnen Methangas gespeist. Der energetische Betrieb der Kläranlage aus eigener Kraft ist somit gesichert.
Zu den „Herren über die Baustelle“ gehört neben Steffen Girnus auch Andreas Gimpel. Seines Zeichens Verbandsgeschäftsführer des AZV „Eisleben – Süßer See“, hat er insbesondere die Nachhaltigkeit der Baumaßnahme im Blick. „Zukünftig können alle fünf Verwaltungsgebiete des AZV ihr Abwasser hier zentral klären lassen. Neben Eisleben gehören die Verwaltungsgemeinschaft Mansfelder Grund-Helbra, das Gebiet Süßer See, Farnstädt und Höhnstedt dazu. Die Reinigungsleistung wird auf 65.000 Einwohnerwerte erhöht. Das ist eine Steigerung um gut 44 Prozent.“, berichtet er. Das Investitionsvolumen gehe in die Millionen Euro. Von den über 7,5 Millionen Euro förderfähigen Kosten übernimmt der EU-Fonds ELER 75 Prozent. Das restliche Viertel wird aus kommunalen Mitteln finanziert.
Der ELER trägt in Sachsen-Anhalt mit rund 904 Millionen Euro EU-Mittel – ein Viertel der gesamten dem Land von der EU zugewiesenen Fördergelder – dafür Sorge, dass die Entwicklung des ländlichen Raums sich als integraler Bestandteil der Gesamtpolitik für Beschäftigung und Wachstum vollzieht. Zusammen mit der nationalen Kofinanzierung stehen öffentliche Ausgaben in Höhe von 1,16 Milliarden Euro bereit. Zusätzlich will Sachsen-Anhalt 240 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt beisteuern, so dass das Land rund 1,326 Milliarden Euro für die Entwicklung des ländlichen Raums einsetzen kann.
Weniger Klärschlämme auf die Felder verbracht
Im Jahr 2016 wurden in Sachsen-Anhalt 57 814 Tonnen Klärschlamm aus den kommunalen Kläranlagen entsorgt. Das waren 582 Tonnen bzw. 1,0 Prozent mehr als im Jahr 2015. Seit 2012 (20 612 t) wurde immer weniger Klärschlamm auf die Felder verbracht. Im Jahr 2016 waren es 15 661 Tonnen. Bezogen auf das Jahr 2015 (16 381 t) verringerte sich das Aufkommen um 720 Tonnen (-4,4 %). Trotz Erhöhung des Gesamtklärschlammaufkommens gegenüber 2015 hat sich der Anteil des Klärschlamms, der auf die Felder aufgebracht wurde, im Jahr 2016 verringert (2015: 42,3 % des stofflich verwerteten Schlamms; 2016: 40,9 %).
Mit 38 255 Tonnen wurden fast zwei Drittel dieses Klärschlammaufkommens (66,2 %) stofflich verwertet. Hiervon wurden 15 661 Tonnen (40,9 %) zu Düngezwecken auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht, 17 181 Tonnen (44,9 %) für landschaftsbauliche Maßnahmen (zum Beispiel Rekultivierung) und Kompostierung eingesetzt und 5413 Tonnen (14,2 %) wurden einer sonstigen stofflichen Verwertung (zum Beispiel Vererdung) zugeführt.
Des Weiteren wurden 17 891 Tonnen Klärschlamm (30,9 %) nach vorheriger Entwässerung/Trocknung verbrannt. Davon gingen mit 9699 Tonnen mehr als die Hälfte (54,2 %) in die Monoverbrennung. In Kohlekraftwerken, Zementwerken oder Abfallverbrennungsanlagen wurden 6952 Tonnen (38,9 %) mitverbrannt. Die thermische Entsorgung nahm damit gegenüber dem Jahr 2015 um 596 Tonnen (3,4 %) zu.
Für landschaftsbauliche Maßnahmen und Kompostierung wurde im Jahr 2016 weniger Klärschlamm verwendet. Im Vergleich zum Jahr 2015 kamen 781 Tonnen (-4,3 %) weniger zum Einsatz.
Wasserqualität in Sachsen-Anhalt
Fünf Fließgewässer-Wasserkörper und elf Seen in Sachsen-Anhalt befinden sich gegenwärtig in einem guten ökologischen Zustand im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Einen sehr guten Zustand erreicht kein Wasserkörper in dem Bundesland. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung (Bundestags-Drucksache 18/13168) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hervor. 71 Fließgewässer-Wasserkörper und sechs Seen sind demnach in einem mäßigen, 142 Fließgewässer-Wasserkörper und drei Seen in einem unbefriedigenden sowie 82 Fließgewässer-Wasserkörper und fünf Seen in einem schlechten ökologischen Zustand. Vier Fließgewässer- Wasserkörper und sechs Seen wurden nicht bewertet.
Abwasser wird Fall fürs Gericht
Sachsen-Anhalts Verfassungsgericht verhandelt am 18. Oktober über Altanschließerbeiträge
Dessau-Roßlau. Sachsen-Anhalts Landesverfassungsgericht wird sich am 18. Oktober mit den umstrittenen Abwasserbeiträgen befassen, die teils viele Jahre im Nachhinein eingetrieben worden sind. Die LINKE-Landtagsfraktion hat einen Normenkontrollantrag zur zeitlichen Obergrenze für die Erhebung der sogenannten Altanschließerbeiträge gestellt. Wie ein Gerichtssprecher am Dienstag in Dessau-Roßlau sagte, wird es binnen drei Monaten nach der Verhandlung dann einen Verkündungstermin geben. Zahlreiche Zweckverbände …mehr:
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1026985.abwasser-wird-fall-fuers-gericht.html
Landtag: Kompromiss im Abwasser-Streit
Der Landtag hat Erleichterungen für viele Hausbesitzer in Sachsen-Anhalt beschlossen. Kommunen und Zweckverbände müssen vorerst die Kosten für Abwasseranschlüsse aus den neunziger Jahren nicht eintreiben. Zunächst soll die Entscheidung von Verfassungsrichtern abgewartet werden. Unterdessen hat die AfD im Landtag mit einem Zwischenruf über Homosexuelle erneut für Wirbel gesorgt.
Im Streit um die Abwasser-Kosten in Sachsen-Anhalt gibt es einen Kompromiss. Der Landtag …mehr:.
Preis der Umweltallianz Sachsen-Anhalt für Industriekläranlage und Wäscherei
Das Unternehmen Leuna-Harze GmbH aus Leuna erhielt für ihre Abwasserreinigungsanlage einen der beiden mit je 10 000 Euro dotierten Hauptpreise der Umweltallianz Sachsen-Anhalt. Der mit 5000 Euro dotierte Sonderpreis ging an die Wäscherei Edelweiß Ordel OHG & Co. für ihre Reinigung von industriellem Wäscherei-Abwasser mit direkter thermischer Nutzung. Die Leuna-Harze GmbH betreibt eine katalytische Abwasserreinigungsanlage. Die produktionsbedingten Abwässer enthalten Natriumchlorid und organische Bestandteile. Letztere werden in der Abwasserreinigungsanlage unter stark oxioxidativen Bedingungen abgebaut und der überwiegende Anteil der gereinigten Lösung als Rohstoff dem eigenen Produktionskreislauf zugeführt. Neben der Rückgewinnung eines Rohstoffs aus einem Abfallprodukt wird bei diesem neuen Verfahren die Abgabemenge salzhaltiger Prozessabwässer wesentlich verringert. Bei der Wäscherei Edelweiß Ordel aus Burg bei Magdeburg erfolgt die Reinigung des industriellen Wäscherei-Abwassers unter Ausnutzung der im Abwasser gebundenen thermischen Energie. Somit dient das Verfahren dem effizienten Einsatz der Ressource Wasser, gleichzeitig wird die Abwasserqualität deutlich gesteigert, hochreines Wasser entsteht für den weiteren Wasserkreislauf der Wäscherei.
142 000 Einwohner in Sachsen- Anhalt ohne öffentlichen Kanalanschluss
In Sachsen-Anhalt wird das Abwasser von 142 000 Einwohnern (6 % der Bevölkerung) nicht in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet, sondern über dezentrale Anlagen beseitigt. Diese dezentralen Anlagen sind private Kleinkläranlagen mit mechanisch-biologischer Reinigungsstufe oder abflusslose Sammelgruben. Das Abwasser aus den abflusslosen Sammelgruben wird zur Behandlung kommunalen Kläranlagen zugeführt. Zum Vergleich: In den ostdeutschen Ländern betrug der Anteil der Einwohner, die über keinen Anschluss an die öffentliche Kanalisation verfügten, 9,6 Prozent. Deutschlandweit sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 3,4 Prozent der Gesamtbevölkerung nicht an ein öffentliches Kanalnetz angeschlossen.
Sachsen-Anhalt veröffentlicht Hochwasser-Gefahrenkarten
Magdeburg. Um sich auf ein mögliches Hochwasser optimal vorbereiten zu können, müssen Behörden, Wirtschaft und Bevölkerung wissen, wohin das Wasser im Fall von Überschwemmungen fließen wird und welche hochwasserbedingten nachteiligen Folgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe sowie wirtschaftliche Tätigkeiten eintreten können. Diese Informationen bieten Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten, die jetzt im Internet unter www.hwrmrl.sachsen-anhalt.de einsehbar sind.
Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Hermann Onko Aeikens sagte am Dienstag in Magdeburg, es genüge nicht, Hochwasserschutz auf Deiche und Polder zu beschränken. Zu einem umfassenden Management von Hochwasserrisiken und vorbeugendem Hochwasserschutz gehören auch die Informationen über die mögliche Ausdehnung und Tiefe von Überschwemmungsflächen. Die Karten helfen so zum Beispiel bei kommunalen Planungen für Wohn- oder Gewerbegebieten, bei der Hochwasservorsorge für Industriebauten. Sie bieten auch dem Katastrophenschutz wichtige Informationen.
Die Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten für Sachsen Anhalt wurden anhand von drei Szenarien erstellt:
– Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit bzw. Extremereignisse (HQ200/ HQExtrem)
– Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (HQ100)
– Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (HQ10/ an der Elbe HQ20)
Den Hochwassergefahrenkarten kann die Intensität der Hochwassergefährdung in Form klassifizierter Wassertiefen entnommen werden.
Bei den für das Extremszenario ausgewiesenen Flächen handelt es sich um die Gebiete, die bei einem Abfluss HQ200 überschwemmt werden würden, wenn keine Hochwasserschutzanlagen (Deiche) vorhanden wären oder diese infolge des Extremereignisses total versagten. Das totale Versagen ist mit den Deichbrüchen 2013 oder während des Hochwassers 2002 nicht vergleichbar, sondern übersteigt diese Schäden um ein Vielfaches.
Das Szenario „Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit“ stellt die Flächen dar, die bei einem Abfluss HQ100 und unter Berücksichtigung vorhandener Hochwasserschutzanlagen (Deiche) überschwemmt werden können. Diese Flächen entsprechen weitestgehend den festgesetzten Überschwemmungsgebieten.
Im 3. Szenario werden die Flächen dargestellt, die bei einem Abfluss HQ10 (an der Elbe HQ20) und unter Berücksichtigung vorhandener Hochwasserschutzanlagen (Deiche) überschwemmt werden können. Diese Flächen werden am häufigsten überflutet.
Die Hochwasserrisikokarten enthalten in Sachsen Anhalt
– die Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner
– die Flächennutzung in den potenziell betroffenen Gebieten als Ausdruck der wirtschaftlichen Tätigkeiten
– Anlagen, von denen eine potentielle Verschmutzung der Umwelt im Hochwasserfall ausgehen kann
– Schutzgebiete (FFH-, Vogelschutz-, Trinkwasserschutzgebiete) und Badegewässer
– Auswirkungen auf das Kulturerbe (UNESCO-Welterbestätten, Bauensembles, Baudenkmale, Bodendenkmale)
Den überwiegenden Anteil der Überschwemmungsflächen nehmen land- und forstwirtschaftliche genutzte Flächen ein (85 % – 88 %). Auf die Flächen mit ausgeprägter Infrastrukturausstattung (Wohnbau-, Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen) entfallen lediglich 1,7 bis 7,1 Prozent der Flächenanteile. Hier besteht allerdings oft ein sehr hohes Schadenspotential.
Aktualisierung arbeitet Juni-Hochwasser 2013 ein
Wesentliche fachliche Grundlagen für die Kartenerstellung bilden umfangreiche hydraulische Modellierungen der Gewässer. Sie fanden von 2009 bis 2012 statt, um eine fristgemäße Erstellung der Karten wie von der EU gefordert zum 22.12.2013 zu gewährleisten. Demzufolge konnten jedoch die Erkenntnisse des Extremhochwassers vom Mai/Juni 2013 an Elbe, Mulde, Saale und Weißer Elster für die erste Veröffentlichung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten noch nicht berücksichtigt werden.
An einer zeitnahen landesinternen Aktualisierung der Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten wird derzeit gearbeitet. Das erfolgt unabhängig von dem von der EU vorgegebenen Aktualisierungstermin 2019.
Bei der Aktualisierung sind nachfolgende Aufgaben und Arbeitsschritte zu berücksichtigen: Infolge der Auswertung der Hochwasserereignisse 2013 wird es zur Festlegung neuer statistischer Abflusswerte für die dargestellten Szenarien kommen. Diese Neufestlegung kann aber nicht im Alleingang durch Sachsen Anhalt sondern nur in Abstimmung mit den Nachbarbundesländern und dem Bund erfolgen.
Bereits während des Hochwasserereignisses erfolgten an Saale, Weißer Elster und Mulde Befliegungen während der Scheitelwasserstände. Die Befliegung der Elbe wurde durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) koordiniert. Während die Befliegungsergebnisse für die erstgenannten Gewässer bereits vorliegen und bei den aktuellen Auswertungen berücksichtigt werden, liegen die Daten der BfG für die Elbe erst Mitte 2014 vor.
Anhand der Befliegungsergebnisse und von über 4.000 Wasserstandseinmessungen, die während des Hochwassers 2013 vorgenommen wurden, werden die bestehenden Wasserspiegellagenmodelle kalibriert. Diese Arbeiten sind nahezu abgeschlossen.
Erst nach Vorlage der länderübergreifend abgestimmten Abflusslängsschnitte können neue hydraulische Modellierungen erfolgen. Die Ergebnisse münden letztendlich in ggf. aktualisierte Gefahren- und Risikokarten.
Die heute der Öffentlichkeit präsentierten Karten entsprechen dem derzeitigen Wissensstand und bilden weitgehend den aktuellen Sachstand ab. Rund 75 Prozent der ca.1.850 km Gewässerlänge, die in der Stufe 1 als potenziell hochwassergefährdet ausgewiesen wurden, werden jetzt schon vollständig von den Karten abgedeckt und müssen nicht aktualisiert werden.
Sachsen-Anhalt: neues Wassergesetz beschlossen
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 22. Februar 2013 ein neues Wassergesetz des Wasserhaushaltsgesetzes und des Abwasserabgabengesetzes des Bundes auf Länderebene umgesetzt. Eine Novellierung des Landeswassergesetzes war aber auch nötig, weil das bisherige Gesetz zum 31. März 2013 außer Kraft tritt. Auf einen weiteren Aspekt macht die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) aufmerksam: Im neuen Wassergesetz von Sachsen-Anhalt ist die Möglichkeit einer Aufgabenübertragung nicht mehr enthalten. Bisher war dies möglich unter der Voraussetzung, dass eine Rechtsverordnung dazu ergeht, was jedoch nicht geschehen war. Eine Aufgabenübertragung an Private sei somit auch in Sachsen-Anhalt endgültig nicht mehr möglich. Allerdings ist ein Passus eingefügt worden, wonach der zur „Erfüllung“ beauftragte Dritte privatrechtliche Entgelte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erheben darf. Damit wird eine rechtliche Grundlage für die Entgeltbeziehung zwischen einem Erfüllungsgehilfen und dem Kunden geschaffen. Sie beschränkt sich jedoch nicht allein auf private Unternehmen, sondern betrifft alle „Dritte“. Nach Auffassung der AöW sind mit dem neuen Gesetz auch „Abwasserkonzessionen“, die eine Beauftragung zur „Aufgabenerfüllung“ und eine Dienstleistungskonzession an private Unternehmen vorsehen, im Abwasserbereich rechtlich nicht möglich. Eine solche Konstruktion wäre als eine Aufgabenübertragung zu qualifizieren, wofür aber eine rechtliche Grundlage fehlt, so die AöW.
www.gfa-news.de Webcode: 20130307_001
Kabinett billigt Entwurf für neues Wassergesetz
Sachsen-Anhalt bekommt ein neues Wassergesetz. Einen entsprechenden Entwurf stellte Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Hermann Onko Aeikens am Dienstag im Kabinett vor. Hintergrund ist, dass das alte, im März 2011 beschlossene Wassergesetz am 31. März 2013 außer Kraft tritt. Das Kabinett billigte den Entwurf und gab ihn zur Anhörung bei.
Aeikens sagte: „Wir haben die Chance genutzt, mit dem Entwurf eines neuen Wassergesetzes auch auf die Probleme mit den in vielen Teilen des Landes auftretenden Vernässungen und hohen Grundwasserständen zu reagieren. So wollen wir künftig wo immer möglich Gewässerunterhaltung und -ausbau aus einer Hand mit klaren Zuständigkeiten.
Es sollen rund 15 Prozent der Gewässer der ersten Ordnung mit einer Gewässerlänge von insgesamt 328 Kilometern künftig als Gewässer 2. Ordnung ausgewiesen werden.“ Grundlage dafür sei ein Rechtsgutachten, wonach einige Gewässer nicht (mehr) die Bedingung für eine Einstufung als Gewässer 1. Ordnung erfüllten. Mit der Neuregelung entfielen bisher notwendige aufwendige Abstimmungen zwischen dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und den Unterhaltungsverbänden.
Gewässer werden in die erste Kategorie eingestuft, wenn sie eine erhebliche wasserwirtschaftliche Bedeutung haben. Das ist grundsätzlich dann der Fall, wenn
• das Einzugsgebiet des Gewässers größer als 150 km² ist,
• das Gewässer von Hochwasserschutzdeichen des Landes begleitet wird,
• Hochwassermeldepegel, wichtige Gütemessstellen und abflussbedeutsame Anlagen vorhanden sind
• oder von diesen Gewässern eine potenzielle Hochwassergefährdung ausgeht
• oder das Gewässer eine außerordentliche Bedeutung für den Natur- und Gewässerschutz oder Hochwasserschutz hat.
Aeikens sagte, die Unterhaltungsverbände bekämen 2015 die Gewässer in einem guten Zustand. Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz sei 2012 und 2013 mit deutlich mehr Mitteln als in der Vergangenheit (ca. 10 Mio. € für 2012) ausgestattet worden für die Gewässer- und Anlagenunterhaltung. Für das jeweils zu übergebende Gewässer würde dann eine Zustandsanalyse erstellt.
Das Land Sachsen-Anhalt unterhält derzeit 2.314 km Gewässer erster Ordnung. Knapp 24.000 km sind Gewässer 2. Ordnung und werden von den Unterhaltungsverbänden unterhalten.
Aeikens sagte weiter, der Gesetzentwurf ziele auch auf mehr Beitragsgerechtigkeit mit Blick auf die Gewässerunterhaltung ab. So sollen künftig auch für die Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung Beiträge erhoben werden; bislang geschieht das nur bei Gewässern unter der Obhut der Unterhaltungsverbände, also denen zweiter Ordnung.
Der Gesetzentwurf regelt auch neu, unter welchen Voraussetzungen die Gemeinde die Beseitigung des Niederschlagswassers ganz oder teilweise an sich ziehen kann. Aeikens: „Das ist kein globaler Anschlusszwang zur Beseitigung von Regenwasser. Wir müssen aber Gemeinden und Zweckverbänden für Einzelfälle die Möglichkeit einräumen, Grundstücke mit anzuschließen, wenn es hier Probleme mit der Entwässerung gibt und es dadurch zu hohen Grundwasserständen kommt.“ Aeikens wies darauf hin, dass die Gemeinden oder Zweckverbände einen sachlichen Grund vorweisen müssen, wenn sie den Anschluss verlangten.
Das neue Gesetz stellt außerdem klar, dass für die Beseitigung von Straßenoberflächenwasser die Straßenbaulastträger und nicht die Gemeinden oder Abwasserzweckverbände zuständig sind. Hierdurch würde eine vorhandene rechtliche Schieflage beseitigt.
Aeikens sagte weiter, die Novellierung des Wassergesetzes sei auch ein Beitrag zur Entbürokratisierung. So müssten die Zweckverbände künftig nicht mehr die Konzepte zur Beseitigung von Niederschlagswasser mit denen der Abwasserbeseitigung in einem Stück vorlegen. Dies habe in der Vergangenheit zu erheblichem Mehraufwand geführt, da die Angaben zu den Regenwasserbeseitigungskonzepten grundstückgenau aufgeführt werden mussten. Da aber in den meisten Fällen die Grundstückseigentümer selbst für die Entsorgung von Regenwasser zuständig sind, entfällt dies nun.
Sachsen-Anhalt: Landesregierung beschließt Wasserentnahmeentgelt
Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat am 20. Dezember 2011 eine Verordnung zum Wasserentnahmeentgelt beschlossen. Damit ist Sachsen-Anhalt das zwölfte Bundesland, in dem die Entnahme von Grund- oder Oberflächenwasser entgeltpflichtig ist, Rheinland-Pfalz bereitet dies vor. Die in Sachsen-Anhalt aus dem Wassercent erwarteten Einnahmen in einer Höhe von netto rund zehn Millionen Euro im Jahr sollen vollständig für wasserwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden, insbesondere auch für den Hochwasserschutz. Die Verordnung gilt ab dem Jahr 2012. Haushaltswirksam werden die Einnahmen ab 2013. Der Wassercent wird generell erhoben für das Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern und das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser. Brunnen in Kleingärten sind nicht von der Verordnung berührt, da diese eine Bagatellgrenze von 3000 Kubikmetern pro Kalenderjahr oder bei einem zu entrichtenden Entgeltbetrag von 100 Euro vorsieht. Befreit sind auch dauerhafte Grundwasserabsenkungen im Interesse des Gemeinwohls, also bei Vernässungsproblemen. Der Wassercent wird nicht erhoben in Hessen, Bayern und Thüringen
Sachsen-Anhalt: Bericht zur Vernässung vorgelegt
Sachsen-Anhalts Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Hermann Onko Aeikens hat am 13. Dezember 2011 im Kabinett einen Bericht zur Vernässungssituation in Sachsen-Anhalt vorgelegt. Es gebe nun für die betroffenen Regionen Ursachenanalysen und insgesamt rund 1900 Maßnahmenvorschläge. Ziel müsse es sein, so der Minister, zu einem intelligenten Wassermanagement zu kommen, das in nassen und in trockenen Jahren funktioniere. Die Landesregierung wolle für die kommenden Jahre 30 Millionen Euro für Maßnahmen gegen die Vernässung zur Verfügung stellen; darüber müsse aber noch der Landtag entscheiden. Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt hat für 2012 und 2013 jeweils 0,5 Millionen Euro bereitgestellt, die in die Unterstützung von bereits laufenden Pilotprojekten fließen. Als einen Schwerpunkt der kommenden Arbeiten nennt der Bericht Maßnahmen an Fließgewässern. Die Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit dieser Gewässer kann Vernässungen land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen entgegenwirken und auch die Situation in besiedelten Bereichen erheblich beeinflussen. Neben Ausbau und Unterhaltung von Gewässern können auch Anlagen zur Wasserstandsregulierung (Schöpfwerke, Stauanlagen) erforderlich sein. Maßnahmen gegen Vernässungen und Erosion auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen werden künftig einen Schwerpunkt der Maßnahmen im Zuge von Flurneuordnungsverfahren darstellen.
In betroffenen Wohnbereichen und Gewerbegebieten kommen entsprechend den konkreten Verhältnissen vor Ort eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen in Frage. Dazu kann die Verbesserung des oberflächigen Wasserabflusses in Gewässern, Gewässern, der Bau und Betrieb von Drainagen, die Sicherung von Einzelobjekten, die geregelte Entsorgung von Niederschlagswasser und letztlich auch die Absenkung des Grundwasserspiegels durch den Betrieb von Brunnen gehören. Auch die Straßenentwässerung müsse überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Große Bereiche Sachsen-Anhalts weisen nach Angaben des Umweltministeriums spätestens seit dem Jahr 2010 außergewöhnlich hohe Grundwasserstände auf, die Landwirtschaft und Bürger belasten.
www.mlu.sachsen-anhalt.de
Sachsen-Anhalt hat LAWA-Vorsitz übernommen
Sachsen-Anhalt hat zum 1. Januar 2012 den Vorsitz der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) übernommen. LAWA-Vorsitzender ist Ministerialdirigent Dr. Wolfgang Milch. Milch gehört seit dem 1. Januar 2012 auch dem Vorstand der DWA an. Der LAWA-Vorsitz wechselt alle zwei Jahre in alphabetischer Reihenfolge zum nächsten Bundesland.
Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt
„Die Zielsetzungen der Flora-Fauna-Habitat- und der Wasserrahmenrichtlinie sollen durch kooperative Zusammenarbeit von Verwaltung, Land- und Forstwirtschaft, Grundeigentümern, Naturschutz und Wasserwirtschaft erreicht werden. Die Fördermöglichkeiten im Bereich der Wasserrahmenrichtlinie sollen nach Möglichkeit auch für Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, -pflege und -entwicklung genutzt werden.“ So steht es im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD in Sachsen-Anhalt für die Jahre 2011 bis 2016. Und weiter: „Die Koalitionspartner bekennen sich zu einer nachhaltigen Wasserwirtschaft. Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie soll unter Berücksichtigung einer breiten Beteiligung entsprechend der Vorgaben der EU ‚eins zu eins‘ mit möglichst geringem Verwaltungs- und Kostenaufwand für alle Beteiligten erfolgen. Die Investitionen auf dem Gebiet des Hochwasserschutzes sollen auf dem hohen Niveau der Vorjahre fortgesetzt werden. Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass Hochwasserschutzmaßnahmen wichtige Infrastrukturaufgaben sind. Die konsequente Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption des Landes bis 2020 ist finanziell aus EU-, Bundes- und Landesmitteln abzusichern. Die Koalitionspartner wollen, dass bei der bis Ende 2012 vorgesehenen Novellierung des Wassergesetzes die Klassifizierung der Gewässer (1. und 2. Ordnung) sowie die Aufgabenteilung im wasserwirtschaftlichen Bereich überprüft werden. …
Es wird angestrebt, flächendeckend das Gewässerunterhaltungskataster wieder einzurichten. Im Bereich der Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung ist die weitere Unterstützung der Verbände im Hinblick auf ein bis 2013 zu entwickelndes Leitbild zu den Verbandsstrukturen zu gewähren.“
www.sachsen-anhalt.de/index.php?id525014
Neues Wassergesetz in Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt gilt seit dem 1. April 2011 ein neues Wassergesetz (WG LSA). Das Gesetz tritt am 1. April 2013 außer Kraft. Veröffentlicht wurde es im Gemeinsamen Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt, Nr. 8/2011 vom 24. März 2011, Seite 492-529. Das Gesetz steht zum Download im Internet bereit, ebenso die 130 Seiten umfassende Empfehlung des Umweltausschusses des Landtags, die als Gesetz beschlossen wurde (Landtags-Drucksache 5/3078 vom 25. Januar 2011). Beschlossen wurde das neue Wassergesetz am 2. Februar 2011 in der 87. Sitzung des Landtags; das Stenografische Protokoll kann ebenfalls aus dem Internet heruntergeladen werden:
www.landesrecht.sachsen-anhalt.de
www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/parlamentsdokumentation/d3078vbe_5.pdf
www.landtag.sachsen-anhalt.de/intra/landtag3/ltpapier/plenum/5/087stzg_5.pdf
Vergleich der Abwasserentgelte in Sachsen-Anhalt
Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilt, war am Stichtag 01.01.2010 für den Kubikmeter Abwasser im Durchschnitt 3,15 EUR zu bezahlen. Im Vergleich zum 01.01.2008 waren damit durchschnittlich für den Kubikmeter Abwasser sieben Cent weniger zu entrichten. Die Grundgebühr stieg dagegen an. Für die Abwasserbeseitigung betrug die durchschnittliche Grundgebühr 100,28 EUR (3,59 EUR mehr als 2008).
Wie auch beim Trinkwasser wurden bei den Abwasserentgelten beträchtliche Unterschiede zwischen den Gemeinden registriert. Diese reichten von 1,34 EUR je Kubikmeter in Gutenborn (OT Heuckewalde) im Burgenlandkreis bis zu 5,40 EUR in der Gemeinde Neudorf im Landkreis Harz.
Für die Grundgebühren, als verbrauchsunabhängiges Entgelt, wurde für 2010 folgendes Ergebnis erstellt:
Während in allen Gemeinden Sachsen-Anhalts eine Trinkwassergrundgebühr erhoben wurde, war in 288 Gemeinden eine verbrauchsunabhängige Grundgebühr für Abwasser zu entrichten.
Mit 24,60 EUR Grundgebühr im Jahr zahlten die Haushalte in den Gemeinden Klein Wanzleben und Wefensleben (Bördekreis) die geringste Grundgebühr. Im Burgenlandkreis war in vier Gemeinden, mit 300,00 EUR die höchste Grundgebühr im Land Sachsen-Anhalt zu zahlen.
Die hier genannten Komponenten der Kosten für die Abwasserbeseitigung sind:
– die verbrauchsunabhängige Grundgebühr und
– die verbrauchsabhängige Schmutzwassergebühr
Ein Vergleich der in den kreisfreien Städten und Gemeinden erhobenen Gebühren wird durch die unterschiedlichen Gebührensysteme erschwert. Die Struktur der Bestandteile der verbrauchsabhängigen und -unabhängigen Entgelte für die Abwasserbeseitigung wies, wie oben dargestellt, beachtliche regionale Unterschiede auf.
Den Abwassergebührenvergleich erstellten die Statistiker für einen dreiköpfigen Musterhaushalt. Auf der Grundlage eines durchschnittlichen Frischwasserverbrauchs von 99 Kubikmeter, der die Basis zur Berechnung der verbrauchsabhängigen Schmutzwassergebühren bildet, wurden die anfallenden Kosten pro Haushalt ermittelt. Bei einem landesweiten Durchschnitt von 412 EUR, schwankten die Kosten der Beseitigung der definierten Abwassermenge einschließlich Grundgebühr in den Städten und Gemeinden von 150 EUR bis 637 EUR, also um fast 490 EUR.
Weiterreichende Informationen und Ergebnisse aller Gemeinden enthält das Internetangebot des Statistischen Landesamtes (www.statistik.sachsen-anhalt.de) sowie der demnächst erscheinende statistische Bericht „Wasser- und Abwasserentgelte in Sachsen-Anhalt – Berichtsjahr 2010″.
1) Die Ergebnisse zu den Entgelten beziehen sich auf Abwässer, die über ein öffentliches Kanalnetz in einer zentralen Abwasserbehandlungsanlage entsorgt werden.
(Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt)
http://www.umweltruf.de/news/111/news3.php3?nummer=1093
675 Millionen Euro für Hochwasserschutz bis 2020
Für den Hochwasserschutz in Sachsen-Anhalt sind bis 2020 weitere 675 Millionen Euro erforderlich. „Hochwasserschutz bleibt in Sachsen-Anhalt eine Schwerpunktaufgabe. Wir möchten bis 2020 alle Deiche des Landes saniert haben“, sagte Landwirtschafts- und Umweltminister Hermann Onko Aeikens am 7. Dezember 2010 in Magdeburg bei der Vorstellung der Hochwasserschutzkonzeption des Landes Sachsen-Anhalt bis 2020 (HWSK 2020). Die HWSK 2020 ersetzt die bisherige Hochwasserkonzeption (HWSK 2010), die wenige Monate nach dem schweren Elbhochwasser 2002 erarbeitet und in den Folgejahren umgesetzt worden war. In den Jahren 2002 bis 2006 dominierte die Hochwasserschadensbeseitigung. Als Ergebnis der intensiven Arbeit an den Deichanlagen mussten die Fachleute feststellen, dass die Schäden an den Deichanlagen größer waren und die Standsicherheit der bestehenden Deiche schlechter war, als im Ansatz in der Konzeption 2010 ausgewiesen. Daher kamen neben der Schadensbeseitigung zunehmend Deichsanierung, Deichneubau und Deichrückverlegung in den Fokus. Mit der neuen Konzeption folge Sachsen-Anhalt der seit 2007 geltenden Europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, so Aeikens. Die aktuelle Hochwasserschutzkonzeption steht im Internet zum Download bereit:
www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=13352
www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=2033
www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=2032
Stromerzeugung aus Klärgas im Jahr 2009 leicht gestiegen
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt ist die Stromerzeugung aus Klärgas im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent gestiegen. Insgesamt wurden 19 Millionen kWh elektrischer Strom gewonnen. 13 Klärwerke im Land Sachsen-Anhalt nutzen Klärgas zur Wärme- und Stromerzeugung. In den Anlagen dieser Unternehmen konnten im Jahr 2009 insgesamt elf Millionen Kubikmeter Klärgas gewonnen werden, das ausschließlich in den Klärwerken selbst zu Wärme und Strom weiterverarbeitet wurde. Unter Berücksichtigung des Methangehalts entsprach dies einem Energiegehalt von rund 266 000 Gigajoule (GJ). Davon wurden 17 000 GJ zur Wärmeerzeugung genutzt. Der größte Anteil des Klärgases wurde für die Stromerzeugung eingesetzt. Aus 9,8 Millionen m³ Klärgas konnten 19 Millionen kWh Strom erzeugt werden. Davon wurden 17 Millionen kWh in den Betrieben selbst eingesetzt. An Elektrizitätsversorgungsunternehmen wurden 2 Millionen kWh abgegeben. Im Jahr 2008 lag die Stromabgabe noch bei 4 Millionen kWh. Damit wurde der seit Jahren anhaltende Trend zur verstärkten Eigennutzung des erzeugten Stroms fortgesetzt.
Neues Wassergesetz für Sachsen-Anhalt in Vorbereitung
Sachsen-Anhalt bekommt ein neues Landeswassergesetz. Umweltminister Hermann Onko Aeikens hat am 20. Juli 2010 dem Kabinett den Entwurf eines entsprechenden Gesetzes vorgelegt. „Bei diesem Gesetzgebungsverfahren steht nicht eine inhaltliche Novellierung des Wasserrechts im Vordergrund“, sagte Aeikens. „Das bisherige Landeswassergesetz soll in die neue Systematik des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes überführt werden. Dies bedeutet, dass bewährte Regelungen des bisherigen Landesrechts möglichst unverändert beibehalten werden, wobei die Verteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten fortgeführt wird.“ Mit 118 Paragraphen ist das neue Gesetz weniger umfangreich und übersichtlicher als sein Vorgänger, das es auf 197 Paragraphen brachte. Ein wesentliches Anliegen des neuen Gesetzes ist die Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes.
Quelle: dwa
Neues Wassergesetz in Sachsen-Anhalt
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 12. November 2009 einem neuen Wassergesetz für Sachsen-Anhalt zugestimmt. Die Landtags-Drucksache 5/2238 vom 30. Oktober 2009, die letztlich vom Parlament angenommen wurde, ist eine Synopse, der man leicht entnehmen kann, was sich künftig ändert. Ein wesentlicher Punkt sind neue Regelungen zur Verteilung der Kosten der Gewässerunterhaltung. Das Gesetz trat am 1. Januar 2010 in Kraft.
www.landtag.sachsen-anhalt.de/intra/landtag3/ltpapier/drs/5/d2238vbe_5.pdf
Große regionale Unterschiede bei den Kosten für Wasser und Abwasser in Sachsen-Anhalt
Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt im Dezember 2009 mitteilte, wurden in Sachsen-Anhalt im Jahr 2009 für einen Kubikmeter Trinkwasser durchschnittlich 1,60 Euro gezahlt. Für die gleiche Menge Abwasser waren 3,19 Euro zu zahlen.
Die niedrigsten Kubikmeterpreise (verbrauchsabhängig) für Trinkwasser werden mit 0,86 Euro in 36 Gemeinden des Altmarkkreises Salzwedel und des Landkreises Stendal gezahlt. Dagegen müssen die Einwohner von acht Gemeinden im Landkreis Harz 3,89 Euro je Kubikmeter Trinkwasser zahlen. Bei den Abwassergebühren liegen diese Spannen zwischen 1,34 Euro je Kubikmeter in der Gemeinde Heuckewalde im Burgenlandkreis und 6,43 Euro in der Stadt Sandersleben (Anhalt) im Landkreis Mansfeld-Südharz.
Anhand der ermittelten Daten hat das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt eine Kostenrechnung für einen Drei-Personen-Haushalt durchgeführt. Es wurde von einem Pro-Kopf-Verbrauch von 90 Liter Trinkwasser pro Tag ausgegangen. Durchschnittlich ergeben sich für einen sachsen-anhaltinischen Haushalt jährliche Kosten in Höhe von 677 Euro. Dabei belaufen sich die Kosten für Trinkwasser auf 258 Euro und für Abwasser auf 419 Euro.
www.statistik.sachsenanhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/3/32/322/32271/index.html
Abwasser als Dünger auf den Feldern
Abfallanstalt will Kompostwerk-Umweltproblem mit Hilfe der Landwirtschaft lösen.
GÖRSCHEN. Seit der Umstellung des Betriebs auf eine Vergärungstechnologie ist das Kompostwerk der heutigen Anstalt öffentlichen Rechts Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd (AW) ein Umweltproblemfall. Genauer gesagt, sein Abwasser. Wurde doch festgestellt, dass die in die öffentliche Kanalisation fließende Brühe nicht nur zu viele feste Schmutzbestandteile sowie mineralische Stoffe enthielt, sondern auch die Einleitgrenzwerte des Abwasserzweckverbands Weißenfels für Stickstoff- und Phosphorverbindungen regelmäßig überschritt. Durch Einsatz eines so genannten Dekanters – er soll Feststoffe aus dem Abwasser entfernen – konnte man das Problem auch nicht in den Griff bekommen. Denn die mineralischen Bestandteile im Abwasser, so informierte jüngst Gundram Mock, amtierender Anstaltsvorstand, den AW-Verwaltungsrat, stellen nach wie vor eine zu hohe Belastung für eine Einleitung ins öffentlich Weißenfelser Abwassernetz dar.
Zur endgültigen Lösung der Abwasserfrage wurden verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten untersucht. So die Errichtung einer eigenen Kläranlage mit biologischer Abwasserbehandlung im Kompostwerk, …mehr unter:
Kostenvergleich : Abwasserbeseitigung in Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt liegt die Belastung der Bürger für die Abwasserentsorgung mit 133 Euro pro Einwohner und Jahr unter dem Bundesdurchschnitt von 145 Euro. Das ergibt eine Erhebung der Abwasserkosten für Sachsen-Anhalt. Darin wurden erstmals die tatsächlichen Kosten für Abwasser in allen Regionen des Bundeslandes erfasst. Es flossen neben dem Wasserverbrauch auch einmalige Entgelte wie Abwasserbeiträge und Hausanschlusskosten ein.
Ursache für die unterdurchschnittliche Kostenbelastung ist in der Hauptsache der geringe Wasserverbrauch in Sachsen-Anhalt. Während im Bundesdurchschnitt ein Einwohner etwa 125 Liter Wasser am Tag verbraucht, sind es in Sachsen-Anhalt nur rund 90 Liter. Dabei gibt es allerdings große regionale Unterschiede. Während der Wasserverbrauch in Aschersleben bei 44 Kubikmetern pro Einwohner und Jahr liegt, beträgt er in der nördlichen Börde nur 24 Kubikmeter. Hinzu kommt eine zum Teil erhebliche Spanne der Kostenbelastung in den einzelnen Entsorgungsgebieten. Sie reicht von nur 62 Euro je Einwohner und Jahr in der Gemeinde Lostau bis zu etwa 230 Euro beim Abwasserzweckverband Hasselbach-Thierbach im Burgenlandkreis. Angesichts der demografischen Entwicklung in Sachsen-Anhalt beeinflusst der rückläufige Wasserverbrauch auch in Zukunft die Kostenentwicklung. Ein geringer Wasserverbrauch hat einen mittelbaren Einfluss auf die Abwasserkosten. Dadurch kommt es zu dem ungewollten Effekt, dass gerade durch Wasser sparendes Verhalten Preise steigen.
Der Anschlussgrad der Bevölkerung Sachsen-Anhalts an die öffentliche Kanalisation und Kläranlagen hat inzwischen 91 Prozent erreicht (Stand Ende 2007). Während im ländlichen Bereich der Anschlussgrad bei rund 83 Prozent liegt, beträgt er in den Städten 98 Prozent. „Der hohe Anschlussgrad widerspiegelt natürlich die immensen Investitionen, die hier geleistet wurden“, so Wernicke. Durchschnittlich 1814 Euro je an eine Kläranlage angeschlossenen Einwohner wurden investiert, das sind insgesamt rund vier Milliarden Euro. Das Land hat die Investitionen mit mehr als 1,1 Milliarde Euro (Ende 2006) sowie Sanierungs- und Teilentschuldungshilfen von 353 Millionen Euro unterstützt.
http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=33731
„Qualität der Gewässer wird immer besser“
Mit über 3.000 Einzelmaßnahmen soll bis zum Jahr 2015 die Qualität der Gewässer in Sachsen-Anhalt verbessert werden. Umweltministerin Petra Wernicke stellte den Entwurf eines Maßnahmepakets am heutigen Dienstag im Kabinett vor. Seit der Wende seien die sachsen-anhaltischen Gewässer deutlich sauberer geworden, sagte sie. So zögen nun wieder Lachse die Elbe hinauf. Wernicke: „Wir können die Elbe heute wieder als Lebensader bezeichnen. Das war nicht immer so.“ Auch im Abwasserbereich habe Sachsen-Anhalt große Schritte nach vorn gemacht; über 90 Prozent der Haushalte seien mittlerweile an ein zentrales Entsorgungsnetz angeschlossen.
Trotzdem müsse noch viel getan werden, schränkte Wernicke ein. Die EU setze hohe Normen hinsichtlich der Wasserqualität. So liege in Sachsen-Anhalt die Nährstoffbelastung vieler Gewässer noch über den europäischen Anforderungen. Auch den Altlasten gilt ein besonderes Augenmerk. Nach Aussagen der Ministerin standen 80 Prozent der chemischen Industrie der DDR auf dem Gebiet Sachsen-Anhalts. Daraus resultiert lokal eine hohe Belastung des Grundwassers und der Flusssedimente mit Schadstoffen. Jährlich fließen in unserem Land 70 Millionen Euro in die Altlastensanierung. Die Summe wird auch in den kommenden Jahren so hoch bleiben.
Sachsen-Anhalt richtet sein Maßnahmepaket an der sogenannten Wasserrahmenrichtlinie aus. Mit dieser Richtlinie will die Europäische Union europaweit alle Oberflächengewässer und das Grundwasser nach einheitlichen Kriterien bewerten und pflegen.
Das Paket umfasst die Erfüllung geltender Richtlinien (z.B. Kommunalabwasserrichtlinie und Nitratrichtlinie) und darüber hinausgehende Maßnahmen etwa zur Verbesserung der Durchgängigkeit von Flüssen für Wanderfische oder der Wiederanbindung von Nebengewässern.
Bereits im Vorfeld erfolgten umfangreiche Vorarbeiten. So hat sich Sachsen-Anhalt in den vergangenen vier Jahren intensiv mit den Anrainerstaaten der Flussgebiete von Elbe und Weser abgestimmt. Im Ergebnis liegen Bewirtschaftungsplan- und Maßnahmenprogrammentwürfe für alle Gewässer vor. Ein halbes Jahr lang können Verbände und Einzelpersonen ihre Stellungnahmen dazu abgeben. Sachsen-Anhalt hat bei der Erstellung der Pläne und Programme der Flussgebiete einen wichtigen Beitrag geleistet. Die Unterlagen zur Anhörung können beim Landesverwaltungsamt und bei den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten ab dem 22.Dezember 2008 eingesehen werden, alle Maßnahmen sind ab Dezember auch im Internet zu finden. Die Ministerin: „Hier wird nicht mit geschlossenen Schubladen gearbeitet. Je mehr Bürger und Wassernutzer sich in die Diskussion einbringen, um so besser ist es für unsere Gewässer.“„Viele Maßnahmen können nur gemeinsam entwickelt werden, viele Bereiche müssen unter einen Hut gebracht werden. So darf der Hochwasserschutz genauso wenig aus den Augen verloren werden wie etwa die Belange der Landwirte.“
Staatskanzlei – Pressemitteilung Nr.: 618/08
KLAR – das Darlehen der IB für Kleinkläranlagen
Wernicke: Mehr als 50.000 Kleinkläranlagen sind umgerüstet
In Sachsen-Anhalt müssen bis Ende 2009 50.000 bis 70.000 Kleinkläranlagen umgerüstet werden. Dann sollen alle dauerhaft zu betreibenden Anlagen den bundesweit einheitlichen Anforderungen und damit dem heutigen technischen Stand entsprechen. Dieser sieht eine biologische Aufbereitung des Abwassers vor. Um die Betreiber von Kleinkläranlagen dabei finanziell zu unterstützen, hat das Land und die Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) das Darlehensprogramm KLAR aufgelegt.
Anträge können ab dem 01. September bei der IB eingereicht werden. Im Internet sind ab sofort Informationen und Antragsunterlagen unter www.ib-sachsen-anhalt.de abrufbar.
Quelle: http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=1743
Bioenergie in Kommunen
Zweitägige Veranstaltung mit Ausstellung und Tagen der offenen Tür im Rahmen der Europäischen Biomassetage der Regionen 2008
Endlichkeit und Verteuerung fossiler Energieträger wie auch die Probleme der Freisetzung von klimaschädlichem CO2 durch ihre Nutzung sind allgemein bekannt. Insofern ist es zwingend notwendig, auf alternative Energiequellen – wie zum Beispiel die Bioenergie – zurückzugreifen.
Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Nutzung von Bioenergie in Kommunen stärker bekannt zu machen und die Etablierung konkreter Projekte in Sachsen-Anhalt zu unterstützen. Dabei geht es insbesondere um die Erschließung und Nutzung regionaler Kreisläufe, der Schaffung von mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bei der Energieversorgung und einer stärkeren Identifikation mit der Region.
Die Veranstaltung und Ausstellung in Bernburg (29./30.09.08) sowie die Tage der offenen Tür (01.10.-05.10.08) wollen deshalb ein breitgefächertes und vielseitiges Informationsangebot zum Thema „Bioenergie in Kommunen“ bereitstellen. Die zu den Tagen der offenen Tür vor Ort zu besichtigenden, kommunalen Bioenergieprojekte geben Praxisbeispiele für realisierte Anlagen in Sachsen-Anhalt.
Um entsprechende Informationen zu erhalten und weiterzugeben sowie sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen, sollten auch Sie sich an den geplanten Aktivitäten beteiligen.
Nennen Sie uns Projekte, die in der Veranstaltung oder Ausstellung vorgestellt werden können! Nennen Sie uns Projekte, die vor Ort besichtigt werden können!
Eine Programmskizze zur geplanten Veranstaltung sowie ein Formblatt zur Anmeldung finden Sie unter:
1. Wasser- und Abwassertag Sachsen-Anhalt und Brandenburg
Mehr als 100 Gäste diskutierten in Dessau über Folgen des demographischen Wandels für die Wasserwirtschaft
Bevölkerungsrückgang erfordert rasches Handeln
Der demographische Wandel macht vor der Wasserwirtschaft in Sachsen-Anhalt und Brandenburg nicht halt. Der Rückgang der Bevölkerungszahlen auf Grund sinkender Geburtenzahlen, zunehmender Überalterung und anhaltender Abwanderung wird die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung in beiden Bundesländern nachhaltig verändern, so das Ergebnis des 1. Wasser- und Abwassertages der envia AQUA GmbH, Chemnitz, für Sachsen-Anhalt und Brandenburg am 2. Juni in Dessau. Auf Einladung des Unternehmens diskutierten mehr als 100 Wasserexperten im Bundesumweltamt über Lösungen für die drängenden Probleme.
Nach Angaben von Dr. Joachim Hoffmeister, Geschäftsführer Ver- und Entsorgung der Progros AG, geht in Deutschland bis 2050 jedes Jahr eine Großstadt mit 230.000 Einwohnern durch den demographischen Wandel verloren. „In Folge des Bevölkerungsrückgangs rechnen wir im Bundesdurchschnitt mit einem Rückgang des Wasserbrauches von 14 Prozent bis 2030. In Sachsen-Anhalt wird der Rückgang mit 28 Prozent und in Brandenburg mit 21 Prozent deutlich höher ausfallen.“
Nach Angaben der Statistischen Landesämter ist der Wasserbrauch je Einwohner in Brandenburg seit 1990 um 31 Prozent auf durchschnittlich 99 Liter und in Sachsen-Anhalt um 43 Prozent auf durchschnittlich 91 Liter zurückgegangen.
Folge des rückläufigen Wasserbrauchs ist ein Absatzrückgang und Kostenanstieg für die Wasserwirtschaft. Der Kostenanstieg ist vor allem auf einen erhöhten Betriebsaufwand auf Grund der mangelnden Auslastung der Anlagen und Netze, einen zunehmenden Instandhaltungsaufwand als Abwehr gegen mögliche Funktions- und Hygieneprobleme und einen verstärkten Investitionsbedarf für den Um- und Rückbau zurückzuführen. Rund 70 Prozent der Kosten in der Abwasserentsorgung sind nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft Fixkosten. Bei weiterem Bevölkerungsrückgang verteilen sich diese auf immer weniger Einwohner.
Nach Auffassung von Jürgen Leindecker, Erster Beigeordneter des Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt sind die demographischen Entwicklungen und Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft durch schnelles Handeln und eine verstärkte Zusammenarbeit zu lösen. „Eine bunte Landschaft der Wasserversorger ist gefordert, sich den demographischen Veränderungen durch Kooperation und Vorsorge zu stellen. Bündelung der Kräfte heißt, alle Möglichkeiten zu nutzen, vorhandene Systeme auszulasten und neue Nutzer in die Netze einzubinden.“
Für Sebastian Kunze, Referatsleiter wirtschaftliche Betätigung und Energiewirtschaftsrecht beim Städte- und Gemeindebund Brandenburg, heißt Zusammenarbeit neben Informations- und Erfahrungsaustausch auch Kooperation in Bereichen wie Aus- und Weiterbildung, Datenverarbeitung, Einkauf oder Personalverwaltung sowie Integration durch Bildung neuer Rechtsträger und den Zusammenschluss von Organisationseinheiten.
Aus Sicht von Dr. Michael List, Geschäftsführer envia AQUA, sind in die Zusammenarbeit auch private Unternehmen der Wasserwirtschaft einzubeziehen. „Der demographische Wandel macht eine verstärkte Kooperation zwischen Kommunen und privaten Unternehmen notwendig. Gemeinsam gilt es, unsere Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsnetze an die demographischen Gegebenheiten auszurichten und die zur Verfügung stehenden Mittel wie z. B. Finanzen, Netze, Wasserressourcen dabei so effizient wie möglich einzusetzen. Für uns als envia AQUA heißt das in erster Linie mit unseren Partnern neue und effektive Strategien für eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft in Sachsen-Anhalt und Brandenburg zu entwickeln.“
Hintergrund
Die envia AQUA GmbH, Chemnitz, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM). Das Unternehmen ist Dienstleister für Aufgabenträger der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung in den neuen Bundesländern. Es ist in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Wassergeschäft tätig.
Die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, ist der führende regionale Energiedienstleister in den neuen Bundesländern. Das Unternehmen bedient in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rund 1,6 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme, Wasser und energienahen Dienstleistungen. 53 Prozent der Wertschöpfung und 80 Prozent des Einkaufs- und Investitionsvolumens verbleiben in Ostdeutschland. Knapp 50 Prozent des Strombedarfes werden durch die heimische Braunkohle gedeckt.
Ihre Ansprechpartnerin bei der envia AQUA GmbH:
Anja Liefers
Pressesprecherin
Telefon: (03 71) 4 82 – 86 14
Fax: (03 71) 4 82 – 86 05
E-Mail: Anja.Liefers@enviaM.de
6. Biomasseworkshop der Stadtwerke in Halle/Wernicke: Forschung kann Biomassepotential erhöhen
Die Forschung kann dazu beitragen, die Biomassepotentiale besser nutzen zu können. Deshalb hat Landwirtschafts- und Umweltministerin Petra Wernicke heute beim 6. Biomasseworkshop der Stadtwerke in Halle den Ausbau der Biomasseforschung gefordert.
Wernicke: „Die derzeit geführten Diskussionen um gestiegene Nahrungsmittelpreise und die stoffliche und energetische Nutzung von Biomasse tragen allein nicht dazu bei, die Konkurrenzsituation und die Lage am Markt zu entschärfen.“ Die Problematik auf ein Pro oder Contra Klimaschutz oder Lebensmittelproduktion zu reduzieren sei nicht Ziel führend. Es gäbe keine einfachen Lösungen für volle Teller und volle Tanks, so die Ministerin. Wernicke sagte, dass Forschung und Entwicklung zu einer effektiveren Verwendung der land- und forstwirtschaftlichen Biomasse-Potentiale beitragen kann. Auch sollten viel stärker als bisher biogene Rest- und Abfallstoffe, beispielsweise aus Landschaftspflegemaßnahmen, zur Energieerzeugung eingesetzt werden. Wernicke: „Viele Ackerfrüchte sind einfach zu schade, um sie zu verbrennen.“
Die Ministerin verwies auf die 2008 vom Land erstellte Biomassepotentialstudie. Diese belege, dass regional noch weitere Potentiale nutzbar sind. Sie machte aber auch unmissverständlich deutlich, dass die noch frei verfügbaren Biomassepotentiale geringer sind als die gegenwärtig bereits genutzten. Damit sei der Erweiterung der Biomassenutzung Grenzen gesetzt, so die Ministerin. Deshalb müssten Forschung und Entwicklung dazu beitragen, dass durch züchterische und verbesserte Anbaumethoden ertragsreichere Pflanzen zum Einsatz kommen, so die Ministerin. Wernicke sagte mit Blick auf das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ) mit Sitz in Leipzig, dass die Erwartungen an Forschung und Entwicklung hoch seien. Die Unternehmen der Landwirtschaft und im Energiesektor brauchen zeitnahe und praktikable Lösungsansätze.
Der Biomasseworkshop der Stadtwerke Halle (Saale) wird zum sechsten Mal in Folge unter der Schirmherrschaft von Ministerin Wernicke durchgeführt. Im Mittelpunkt steht die Vorstellung der Ergebnisse der Biomassepotentialstudie Sachsen-Anhalt sowie die Diskussion um praxisorientierte Lösungen zur regionalen Nutzung der Biomasse. Der Workshop findet am 10.07.2008 ab 13.00 Uhr im Vollversammlungssaal der IHK Halle-Dessau, Franckestrasse 5, in Halle (Saale) statt.
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt – Pressemitteilung Nr.: 094/08
Impressum:
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
Pressestelle
Olvenstedter Straße 4
39108 Magdeburg
Tel: (0391) 567-1950
Fax: (0391) 567-1964
Mail: pr@mlu.lsa-net.de
Veranstaltung „Bioenergie in Kommunen“
Europäische Biomassetage der Regionen 2008
Im Rahmen der Europäischen Biomassetage der Regionen 2008 werden in Bernburg eine zweitägige Veranstaltung mit Ausstellung (29. und 30. September 2008) sowie Tage der offenen Tür (01.-05. Oktober 2008) durchgeführt.
Ziel ist es, die Nutzung von Bioenergie in Kommunen stärker bekannt zu machen und die Etablierung konkreter Projekte in Sachsen-Anhalt zu unterstützen.
Auch Sie können sich an den geplanten Aktivitäten mit Ihrem kommunalen Bioenergieprojekt beteiligen.
Das Formblatt zur Anmeldung sowie eine Programmskizze finden Sie unter :
http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=1743
Biomassepotenzialstudie für Sachsen-Anhalt vorgestellt
Wernicke: Vorrang hat Nahrungsmittelproduktion
Für Sachsen-Anhalt liegen flächendeckend aktuelle Daten zur stofflichen und energetischen Nutzung von Biomasse vor. Dazu sind in der Biomassepotentialstudie Sachsen-Anhalt die Daten regional und auf das Jahr 2006 bezogen untersetzt worden. Landwirtschafts- und Umweltministerin Petra Wernicke hat in Magdeburg die Ergebnisse der Studie dem Landeskabinett vorgestellt. Wernicke: „Die Studie gibt einen detaillierten Überblick über die derzeitige Nutzung der Biomasse und zeigt mögliche Potenziale auf.“
Alle Informationen unter:
http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=1743
Neue Möglichkeiten Biogas in Erdgasnetze einzuspeisen
Sachsen-Anhalt: Fachtagung informiert über veränderte Rahmenbedingungen
Die Möglichkeiten für den Einsatz von Biogas als Energiequelle werden sich wesentlich verbessern. Mit dem vorliegenden Entwurf der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie den Bedingungen für die Einspeisung von aufbereitetem Biogas in die Gasnetze sollen sich die Rahmenbedingungen dafür verändern. Auf welche Änderungen sich die Biogasbranche einstellen muss, wurde am 08. April 2008 in Bernburg auf einer Fachtagung vorgestellt und diskutiert.
Hochwasservorhersage mit neuem Internetauftritt
Magdeburg. Sie wollen wissen, wie hoch der Pegel an Elbe, Saale, Unstrut oder Bode ist? Sie möchten sich über die Prognosen und das Hochwasser informieren? Das ist ab sofort möglich – auf der neu gestalteten Internetseite der Hochwasservorhersage Sachsen-Anhalts.
Ein gut organisierter Hochwassermeldedienst schaffe die Voraussetzungen für das rechtzeitige Handeln Betroffener, so Umweltministerin Petra Wernicke: „Wer die richtigen Informationen hat, kann sich besser vor Hochwasser schützen.“ Nun könne man sich unabhängig von Tageszeit und Ort ein Bild über die Hochwassersituation in einer betroffenen Regionen Sachsen-Anhalts machen, so die Ministerin.
Das Internetportal bietet täglich Informationen über die aktuellen Wasserstände, Durchflüsse und Niederschläge an hochwasserrelevanten Pegeln des Landes und ausgewählter Pegel der Bundeswasserstraße sowie der Nachbarländer. Hochwasserwarnungen, Hochwasserinformationen, Prognosen und Hochwasserberichte halten über das Geschehen im Lande auf dem Laufenden. Darüber hinaus können Bürger Hinweise für die eigene Verhaltensvorsorge bei Hochwasser erhalten und erfahren Wissenswertes über den Hochwasserschutz in Sachsen-Anhalt.
Die Internetplattform kann unter www.hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de aufgerufen werden.
MVV Energiedienstleistungen nimmt in Mechau klimafreundliche Biogasanlage in Betrieb
24. Januar 2008. JACKON Insulation GmbH nutzt die entstehende Wärme – Projektentwicklung durch ABO Wind – 2.100 Tonnen Kohlendioxid eingespart
Am heutigen Donnerstag, 24. Januar 2008, hat MVV Energiedienstleistungen mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft in Mechau in Sachsen-Anhalt ihre erste Biogasanlage in Betrieb genommen. In umweltfreundlicher Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt das Unternehmen aus nachwachsenden Rohstoffen nun jährlich 4.600 Megawattstunden Strom – genug für mehr als 1.000 Haushalte. Die anfallende Abwärme von etwa 2.300 Megawattstunden Nutzwärme nutzt der ortsansässige international tätige Hersteller von Dämmstoffen, die JACKON Insulation GmbH, als Prozesswärme. Pro Jahr werden so 2.100 Ton-nen Kohlendioxid aus der Verbrennung von Erdgas eingespart. MVV Energiedienstleistungen hat die Anlage vom Wiesbadener Projektentwickler ABO Wind erworben.
Bei einer installierten Motoren-Leistung von insgesamt 740 Kilowatt kommen jährlich etwa 10.000 Tonnen nachwachsender Rohstoffe, insbesondere Maissilage, zur Biogaserzeugung zum Einsatz. Die Anlage besteht aus zwei Blockheizkraftwerken mit jeweils gleicher Leistung und einem großen Gasspeicher, wodurch das entstehende Biogas vollständig genutzt und eine gleichmäßige Erzeugung von Strom und Wärme möglich wird. Die Biogasanlage kommt ohne den Einsatz von Gülle aus.
„Dadurch, dass die die benachbarte JACKON Insulation GmbH die Wärme nutzt, ist eine nachhaltige, grundlastfähige und besonders effiziente Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung am Standort Mechau möglich“, betonte Hans-Werner Greß, Leiter der Abteilung Bioenergie bei der ABO Wind. Dr. Frank Lichtmann, Leiter des Kompetenz-Centers Biogas von MVV Energiedienstleistungen GmbH, ergänzte: „Damit stellt die Biogasanlage in Mechau nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein lohnendes Projekt dar, sondern leistet auch im Hinblick auf den Klima- und Ressourcenschutz einen effektiven Beitrag.“ Das Unternehmen mit Hauptsitz in Mannheim will sein Engagement im Bereich klimafreundlicher Energieerzeugung, speziell mit Biogas und Biomasse, bundesweit intensivieren. Unter anderem wird sie deutschlandweit in weitere Biogasanlagen mit elektrischen Leistungen vorwiegend zwischen 500 und 1.000 Kilowatt investieren.
Sowohl Dr. Frank Lichtmann als auch Hans-Werner Greß lobten bei der feierlichen Inbetriebnahme „die gute Zusammenarbeit aller Akteure und vor allem die Unterstützung durch Mechaus Bürgermeister Hartmut Baier“. Ihr ausdrücklicher Dank galt auch Burkhard Thiede von der Dienstleistung und Stromerzeugung Mahlsdorf GmbH, der das Projekt mitinitiierte und als Hauptlieferant und Betriebsführer vor Ort maßgeblich zum Gelingen beiträgt.
Die Investitionssicherheit der Anlage ist durch die gesetzliche Einspeisevergütung für den erzeugten Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gewährleistet. Der Strom wird vollständig ins Stromnetz eingespeist. Die Wärmenutzung durch die benachbarte JACKON ist über einen langfristigen Vertrag geregelt. „In Zeiten steigender Energiepreise stellt die damit verbundene Preissicherheit für JACKON einen wertvollen Vorteil dar, der die Produktion am Standort Mechau nachhaltig sichert“, unterstrich Achim Nied, Finanzdirektor der JACKON Insulation GmbH.
Die Biogasanlage in Mechau umfasst ein Fahrsilo zur Lagerung der Silagen, zwei Gärbehälter und ein Lager aus Stahlbeton. Das in den Behältern gesammelte Gas wird in den beiden Motoren verbrannt und so in Strom und Wärme umgewandelt. Um die Geräuschentwicklung möglichst gering zu halten, sind beide in einem gemeinsamen Gebäude untergebracht. Die Infrastruktur der Biogasanlage ist speziell für den Einsatz der relativ trockenen Einsatzstoffe ausgelegt, dazu kommen die Heizungsinstallationen zur Versorgung der JACKON Insulation GmbH. Das ausgefaulte Substrat wird zunächst gesammelt und dann auf landwirtschaftlichen Flächen als wertvoller Dünger ausgebracht.
Sämtliche Behälter sind abgedeckt und dienen zugleich als Gasspeicher, um das entstehende Gas komplett nutzen zu können. Die Anlage wird per Fernabfrage ständig überwacht und von erfahrenen Betriebsführern vor Ort täglich kontrolliert. Sie ist auf einem rund 1,7 Hektar großen Grundstück entstanden, das bisher der JACKON Insulation GmbH gehörte. Diese ausgewiesene Gewerbegebietsfläche hinter den Industrieanlagen stellt sich auch wegen ihrer Entfernung zu den Ortslagen als günstig dar, so Dr. Frank Lichtmann vom Betreiber MVV Energiedienstleistungen.
Bei der Auswahl des Anlagentyps und der Motoren kommen mit der Biogas Nord AG und der MDE Dezentrale Energiesysteme GmbH zwei erfahrene Hersteller zum Einsatz. Für die übrigen Arbeiten wurden bewusst Firmen aus der Umgebung beauftragt: Für die Tiefbauarbeiten und Elektroinstallationen Firmen aus Salzwedel, für das Gebäude und die Heizungstechnik Firmen aus der Region. Die Planung der Anlage hat das Büro PROMA Ingenieure aus Burg bei Magdeburg durchgeführt. Die Silage liefern verschiedene Landwirte in der Umgebung, wobei langfristige Lieferverträge den Absatz der Produkte über Jahre sichern und damit eine langfristige Anbauplanung ermöglichen.
Fachfortbildungsprogramm 2008
vielfältiges und bedarfsorientiertes Angebot
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
Das Fachfortbildungsprogramm des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt liegt für das Jahr 2008 vor.
Konstante Fortbildung ist ein wichtiges Instrument, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes an die dauernden Veränderungen in Staat und Gesellschaft heranzuführen. Sie werden dadurch in die Lage versetzt, ihre Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger stets sachgerecht, kompetent sowie bürger- und zeitnah zu erbringen.
Arbeitsgruppe „Klimawandel“ legte ersten Zwischenbericht vor
Wernicke: Regionale Klimaauswirkungen werden ab 2008 analysiert
Ab 2008 werden für sachsen-anhaltinische Regionen wie Harz und Altmark Szenarien des Klimawandels erstellt. Dazu soll die am Landesamt für Umweltschutz in Halle installierte Klimadatenbank für Sachsen-Anhalt regionalspezifisch ausgewertet werden. Das kündigte Landwirtschafts- und Umweltministerin Petra Wernicke in Magdeburg an. Wernicke: „Wir wissen dann nicht nur wie sich Temperatur und Niederschlag voraussichtlich entwickeln. Wir können dann auch Konzepte für die einzelnen Regionen entwickeln, wie auf die Folgen des Klimawandels reagiert werden kann.“
Sachsen- Anhalt legt Abwasserbericht 2007 vor
Wie man dem aktuellen Bericht entnehmen kann, hat sich die Qualität der Abwasserbeseitigung weiter erhöht. Waren es 2004 nur 81,8 Prozent der Kläranlagen, die über eine weitergehende Nährstoffeliminieren verfügten, so konnte die Zahl bis Ende 2006 auf 86,3 Prozent gesteigert werden. Es gibt auch keine Anlagen mehr, die das Wasser entgegen den gesetzlichen Anforderungen nur mechanisch reinigen konnten. Der Anschlussgrad an eine öffentliche Kläranlage beträgt inzwischen 89,9 Prozent. Im Ausblick wird Handlungsbedarf genannt, der besonders den Ausbau der Ortskanalisationen und der Sanierung von Mischsystemen betrifft. In ländlichen Gebieten, in denen ein Anschluss an eine Kläranlage nicht sinnvoll erscheint, müssen die Hauskläranlagen dem aktuellen Standard angepasst werden.
Weitere Informationen unter www.sachsen-anhalt.de
Ursache von Fischsterben gefunden
Ende September wurde der Köhnsee im Landkreis Stendal Ort eines Fischsterbens. Wie das Umweltamt des Landkreises jetzt mitteilte, wurde als Verursacher das Sickerwasser einer Biogasanlage identifiziert. Dem Betreiber der Biogasanlage droht ein Bußgeldverfahren, da um mehr als 1000 Fische verendet waren.
Br 10-07
Keine Förderung ohne Benchmarking
So lautet die Botschaft der Umweltministerin von Sachsen-Anhalt. Eine Förderung von Investitionen für die Trinkwasser- sowie die Wasser -und Abwasserverbände werde es nur noch geben, wenn diese sich am Benchmarking beteiligen, kündigte die Ministerin in Magdeburg an. Damit sollen die 150 Wasserverbände des Landes zu mehr Wettbewerb, zu Mehrkosten- und Qualitätskontrolle “ überzeugt “ werden. Die Erwartung ist, dass in vielen Fällen das Verfahren zu niedrigeren Betriebs- und Verwaltungskosten führen wird.
Dezentrale Abwasserbeseitigung in Sachsen-Anhalt
Dezentrale Lösungen sind immer dort sinnvoll, wo sie im Vergleich zur zentralen Lösung Kostenvorteile bringen und unter Umweltaspekten möglich sind. Diese Aussage machte die Umweltministerin Ende Februar im Landtag in Magdeburg, bekräftigte aber, dass das nicht bedeute zukünftig nur noch dezentrale Lösungen zu planen. Wasserqualität und Wirtschaftlichkeit sind die Entscheidungskriterien, die über zentrale ortsnahe Kläranlagen oder dezentrale Abwasserbeseitigung über Hauskläranlagen entscheiden. Grund für die aktuelle öffentliche Diskussion sei die Änderung des Wassergesetzes von 2005, mit der die Gemeinden verpflichtet wurden, ihre Abwasserbeseitigungskonzepte bis 2006 zu überarbeiten und genehmigen zu lassen.
Derzeit seien etwa 88 Prozent der Einwohner von Sachsen-Anhalt an eine öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen. Nach Auswertung der Konzepte der Gemeinden und Verbände werden Aussagen möglich, wie sich der Anschlussgrad weiter entwickeln wird. Zurzeit sei davon auszugehen, dass auf Dauer 50.000 bis 70.000 Kleinkläranlagen in Sachsen-Anhalt Bestand haben werden.
Sachsen-Anhalt meldet erhöhten Anschlussgrad
Ende 2006 waren 89,9 Prozent der Bevölkerung an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen, das sind 30.000 Anwohner mehr als 2004.Für die Errichtung und Sanierung von Abwasseranlagen wurden in Sachsen-Anhalt etwa 4,4 € Milliarden seit 1990 investiert. Handlungsbedarf bestehe in den kommenden Jahren besonders im weiteren Ausbau der Ortskanalisationen und der Sanierung von Mischsystemen, heißt es in einem Lagebericht der im Internet abgerufen werden kann.
“ Beseitigung von kommunalem Abwasser in Sachsen-Anhalt „ findet man unter www.sachsen-anhalt.de