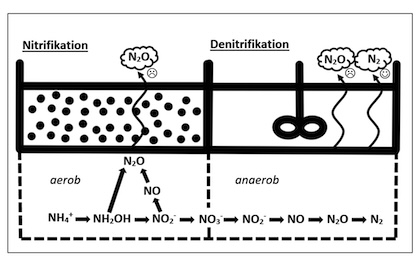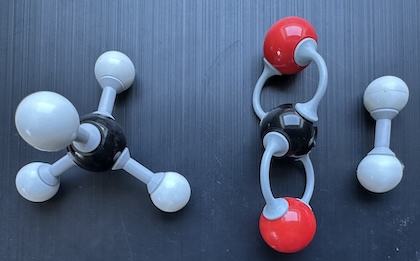DWA-Themenband zum Einsatz der Ozonung zur Spurenstoffentfernung auf kommunalen Kläranlagen
Die DWA hat den Themenband „Einsatz der Ozonung zur Spurenstoffentfernung auf kommunalen Kläranlagen – Erfahrungen, verfahrenstechnische Aspekte und offene Fragen“ (T2/2022) veröffentlicht.
In der Fachwelt wird derzeit für kommunale Kläranlagen sowohl die Anwendung von Aktivkohle als auch der Einsatz von Ozon bzw. eine kombinierte Anwendung beider Betriebsmittel als Möglichkeit angesehen, um gelöste organische Spurenstoffe aus dem zuvor mechanisch-biologisch gereinigten Abwasser zu entfernen.
Ende des Jahres 2021 waren im deutschsprachigen Raum bereits 16 Kläranlagen vorhanden, auf denen eine großtechnische Ozonung dauerhaft zur gezielten Spurenstoffentfernung eingesetzt wird. Darüber hinaus ist von mindestens 15 Kläranlagen bekannt, dass sie in den kommenden Jahren ebenfalls eine Ozonung einsetzen wollen.
Der Themenband gibt einen Überblick über den gegenwärtigen Wissensstand zum Einsatz einer Ozonung auf Kläranlagen mit dem Ziel einer gezielten Spurenstoffentfernung und umfasst folgende Punkte:
- Grundlagen der Ozonung
- Entfernung von Spurenstoffen durch Ozon
- Bildung von Transformations- und Oxidationsnebenprodukten
- Ökotoxikologische Aspekte
- Desinfektionswirkung
- Verfahrenstechnische Aspekte
- Nachbehandlung des Ozonanlagenablaufs
- Wirtschaftliche Aspekte
Die aufgeführten Auslegungsgrößen der bereits in Betrieb befindlichen Ozonanlagen sind hierbei nicht als allgemeingültige Bemessungsvorgaben zu verstehen. Jedoch ist nach den bisherigen Erfahrungen bei Einhaltung dieser Angaben ein stabiler Anlagenbetrieb gegeben.
Der Themenband „Einsatz der Ozonung zur Spurenstoffentfernung auf kommunalen Kläranlagen – Erfahrungen, verfahrenstechnische Aspekte und offene Fragen“ wurde von der DWA-Arbeitsgruppe KA-8.5 „Ozonung auf Kläranlagen“ (Sprecher: Dr.-Ing. Ulf Miehe) im DWA-Fachausschuss KA-8 „Verfahren der weitergehenden Abwasserreinigung nach biologischer Behandlung“ erstellt und richtet sich an Betreiber, Planer und genehmigende Behörden.
DWA-Themen, T2/2022 „Einsatz der Ozonung zur Spurenstoffentfernung auf kommunalen Kläranlagen – Erfahrungen, verfahrenstechnische Aspekte und offene Fragen“, November 2022, 81 Seiten ISBN 978-3-96862-533-1 Ladenpreis: 85,50 Euro fördernde DWA-Mitglieder: 68,40 Euro
Herausgeberin und Vertrieb
DWA-Bundesgeschäftsstelle Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef Tel. 0 22 42/872-333 Fax 0 22 42/872-100 E-Mail: info@dwa.de DWA-Shop: www.dwa.de/shop
(nach oben)
DWA-Themenband „Hygiene in der Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft“
Die DWA hat den Themenband „Hygiene in der Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft“ (T1/2022) veröffentlicht.
Das Thema Hygiene spielt in der Gesellschaft inzwischen eine bedeutende Rolle. In vielfältigen Bereichen wird es deshalb auch von vielen verschiedenen Akteuren betrachtet und diskutiert. Seine aktuelle Bedeutung spiegelt sich wider – neben dem Corona-Diskurs – zum Beispiel in der Diskussion um Mängel in der Krankenhaushygiene oder der Wichtigkeit von hygienischen Maßnahmen in der Produktion von Lebensmitteln und somit des Verbraucherschutzes sowie im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz.
Weltweit betrachtet ist der Wasserpfad einer der bedeutendsten Übertragungswege von krankheitsauslösenden Mikroorganismen wie zum Beispiel Pilzen, Bakterien oder Sporentierchen, aber auch von Viren. Diese Krankheitserreger können auf sehr unterschiedlichen Wegen ins Wasser gelangen, zum Beispiel durch Abwässer oder als diffuse Einträge, beispielsweise durch Abschwemmungen von Flächen (unter anderem aus der Landwirtschaft). Menschen und Tiere können auch Krankheitserreger indirekt oder direkt ins Wasser ausscheiden.
In den letzten Jahren haben sich die Verwendungspfade von Wasser und damit die genutzten Wasserquellen auch in Deutschland immer mehr erweitert. Beispiele sind Wasserspiele als typisches Siedlungselement oder die verstärkt notwendige Bewässerung von Grünflächen im öffentlichen Raum. Hier stellt die Einhaltung von Hygienestandards gegebenenfalls eine besondere Herausforderung für die Wasserwirtschaft dar. Neben Trinkwasser kommt in diesen Bereichen zunehmend Brauchwasser zur Verwendung. Dieses wird zum Beispiel aus Regenwasser-Reservoirs, aus Flusswasser oder aus oberflächennahem Grundwasser gewonnen.
In Europa und in Deutschland gibt es eindeutige Rechtsgrundlagen für bestimmte, genau definierte Arten der Wassernutzung (Trinkwasser, Badewasser etc.); oft ist auch die Art der möglichen Wasserquellen und der Wassergewinnung geregelt. Bei der Nutzung von Wasser im öffentlichen Raum dagegen (vor allem indirekter Wassergebrauch) können die Ressourcen mannigfaltig sein. Die Rechtslage in Bezug auf Anforderungen an die hygienisch-mikrobiologische Qualität des verwendeten Wassers ist dabei nicht immer eindeutig.
Der vorliegende von der DWA-Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Hygiene in der Wasser- und Abfallwirtschaft“ (Sprecherin: Priv.-Doz. Dr. Christiane Schreiber) erarbeitete Themenband setzt hier seinen Fokus. Er ordnet die aktuelle Situation mit ihren Herausforderungen und dem möglichen zukünftigen Handlungsbedarf ein. Ein Ziel des Themenbands ist es, Lücken zwischen den bestehenden gesetzlichen Regelungen und zu fordernden „Sicherheitsaspekten“ aufzuzeigen. Es werden zudem mögliche technische Standards und Maßnahmen des Wassereinsatzes in den genannten Anwendungen beschrieben.
DWA-Themen, T1/2022 „Hygiene in der Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft“ April 2022, 68 Seiten ISBN 978-3-96862-199-9 Ladenpreis: 82 Euro fördernde DWA-Mitglieder: 65,60 Euro
Herausgeberin und Vertrieb
DWA-Bundesgeschäftsstelle Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef Tel. 0 22 42/872-333 Fax 0 22 42/872-100 E-Mail: info@dwa.de DWA-Shop: www.dwa.de/shop
(nach oben)
Chemikalieneintrag in Gewässer vermindern – Trifluoracetat (TFA) als persistente und mobile Substanz mit vielen Quellen
Quellen, Eintragspfade, Umweltkonzentrationen von TFA und regulatorische Ansätze
Trifluoracetat (TFA) ist ein mobiler und persistenter Stoff, der primär durch den Abbau verschiedener Fluorchemikalien in den Wasserkreislauf eingetragen wird und dort auf unabsehbare Zeit verbleibt. Bereits jetzt besteht eine hohe Grundbelastung vieler Gewässer mit TFA mit einigen regionalen Hotspots. Dieses Hintergrundpapier präsentiert aktuelle Daten und Abschätzungen zu Quellen, Eintragspfaden, Belastungen, Auswirkungen und Maßnahmen zu TFA. Es gibt einen Ausblick auf erste Aktivitäten und Optionen zur umfassenden Minimierung von TFA-Einträgen in die Umwelt. Trotz Wissenslücken wird deutlich, dass kurzfristig eine konsistente Regulation und eine übergreifende Minimierungsstrategie auf den Weg gebracht werden müssen.
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/chemikalieneintrag-in-gewaesser-vermindern
(nach oben)
Titandioxidbasiertes photokatalytische Material für den Abbau von Pharmaka aus dem Kläranlagenablauf
Themen: Abwasserbehandlung | Nachhaltigkeit & Umweltschutz
Publikationsform: Fachartikel
Artikelnummer: 05399_2020_03_02
Zeitschrift: Titandioxidbasiertes photokatalytische Material für den Abbau von Pharmaka aus dem Kläranlagenablauf
Erscheinungsdatum: 11.03.2020
Autor: Tobias Schnabel, Christian Springer, Stefanie Hörnlein, Simon Mehling, Silvio Beier, Jörg Londong
Verlag: Vulkan-Verlag GmbH
Seiten: 12
Publikationsformat: PDF
Sprache: Deutsch
Themenbereich: Wasser & Abwasser
Preis: 4,90 €
Details
Pharmazeutische Mikroschadstoffe sind in jedem Kläranlagenablauf zu finden und werden über die Kläranlagen in die Umwelt eingetragen. Verfahren der weitergehenden Oxidation mit Hydroxylradikalen (AOP-Verfahren) können organische Schadstoffe oxidieren. Derartige photokatalyse- und titandioxidbasierte, trägerbasierte Photokatalysatoren sind in der Lage, pharmazeutische Mikroschadstoffe aus der Abwassermatrix zu entfernen. Dabei kann nur gereinigtes Abwasser mit einem neutralen pH-Wert sowie moderaten Konzentrationen von CSB/DOC und Gesamtphosphat ausreichend effektiv behandelt werden. Die verfahrenstechnische Lösung des photokatalytischen Rotationstauchkörpers hat sich als eine funktionale Möglichkeit der photokatalytischen Abwasserbehandlung erwiesen.
(nach oben)
Leitfaden Machbarkeitsstudien zur Spurenstoffelimination auf kommunalen Kläranlagen
Aus Vorsorgegründen werden in Baden- Württemberg schon seit einigen Jahren Anlagen zur Spurenstoffelimination an kommunalen Kläranlagen gefördert. Eine Machbarkeitsstudie ist ein erster Schritt bei der Planung einer solchen Anlage. Zur Unterstützung der Beteiligten in diesem Prozess hat das Kompetenzzentrum Spurenstoffe Baden-Württemberg (KomS BW) daher in Abstimmung mit dem Umweltministerium Baden- Württemberg sowie mit den Regierungspräsidien Anforderungen an die inhaltliche Ausarbeitung zukünftiger Machbarkeitsstudien erarbeitet. Mit diesem Leitfaden wird auch eine bessere Vergleichbarkeit der Machbarkeitsstudien untereinander gewährleistet sowie ein Mindeststandard für deren Erarbeitung garantiert.
Leitfaden Machbarkeitsstudien zur Spurenstoffelimination auf kommunalen Kläranlagen, September 2020, 12 Seiten, DIN A4
Bestellbar sowie zum Download verfügbar unter:
https://koms-bw.de/publikationen/koms/leitfaeden-broschueren
(nach oben)
Energieeinsatz auf Kläranlagen in Mecklenburg-Vorpommern
Leitfaden zur Optimierung unter:
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Service/Publikationen/?id=2385&processor=veroeff
(nach oben)
Starkregen-Vorsorge in Sachsen und Europa – neue Website informiert zu geeigneten Maßnahmen
Heike Hensel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V.
Ab sofort steht Kommunen und Interessierten eine Sammlung von Informationen, Werkzeugen und Praxisbeispielen zum Umgang mit der Naturgefahr Starkregen zur Verfügung. Mit der Freischaltung des „Werkzeugkastens“ im Internet geht das EU-Projekt RAINMAN zu Ende. Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) hat zur RAINMAN-Toolbox unter anderem räumlich hochauflösende Gefahrenhinweiskarten beigesteuert.
Aktuell treffen Starkregenereignisse wieder Städte, Dörfer und ganze Landstriche in Sachsen und Mitteleuropa. Auch Orte, die nicht in der Nähe von Gewässern liegen, können von Überflutungen und Schäden betroffen sein. Wann und wo genau bei Unwettern extreme Regenfälle niedergehen, ist schwer abzuschätzen, meist bleibt kaum Zeit zur Vorwarnung. Umso wichtiger ist es, mögliche Risiken durch Starkregenfälle im Vorfeld abzuschätzen und geeignete Maßnahmen zu treffen, um potenzielle Schäden zu minimieren.
Auf einer neuen Website (https://rainman-toolbox.eu/de) findet sich nun ein Überblick über geeignete Maßnahmen und gute Beispiele aus der Praxis. Die Toolbox ist Ergebnis des Projektes RAINMAN. Insgesamt zehn Partner und viele Kommunen und Fachbehörden aus Österreich, Deutschland, Ungarn, Tschechien, Polen und Kroatien haben sie in drei Jahren Projektlaufzeit zusammengetragen. Gefördert wurde das Projekt durch das Interreg CENTRAL EUROPE-Programm der Europäischen Union.
Die Toolbox enthält neben einer Sammlung von Methoden zur Abschätzung und Kartierung von Starkregenrisiken auch Orientierungshilfen für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Risikominderung sowie Inspiration und Anleitung zur Risikokommunikation. Zahlreiche Steckbriefe informieren über Beispiele guter Praxis für das integrierte Management von Starkregenrisiken in den sechs beteiligten europäischen Ländern.
Die im Projekt gesammelten Erfahrungen zu den vielfältigen Möglichkeiten kommunaler Starkregen-Vorsorge stehen mit der neuen Internetseite als Wissensbasis primär für Verantwortliche in Kommunen und Regionen bereit. Die Werkzeuge zur Risikoabschätzung und Kartierung zeigen kommunalen Entscheide¬rinnen und Entscheidern Methodenbeispiele, wie sich erfassen lässt, wo sich im Fall von Starkregen Wasser sammelt und auf seinem Weg zum nächsten Gewässer Menschen, Infrastruktur und Eigentum schädigen kann. Auf Basis dieses Wissens können Verantwortliche für ihre Region Vor-Ort-Untersuchungen beauftragen sowie passende Vorsorgemaßnahmen treffen. Mögliche Ansatzpunkte zur Risikominderung reichen von lokalen Maßnahmen der Flächennutzungsplanung, über natürliche oder technische Maßnahmen zum Rückhalt der plötzlich auftretenden Wassermassen oder zur sicheren Ableitung des Wassers. Auch die Berücksichtigung von Starkregenszenarien im Katastrophenschutz kann Risiken durch Starkregenereignisse minimieren.
Gute Beispiele aus Sachsen
Damit sich Bevölkerung, Kommunen und Regionen in Sachsen schon im Vorfeld auf die wachsende Gefahr durch Starkregen vorbereiten und Schäden künftig besser vermeiden können, haben das IÖR, das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) und das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR) gemeinsam mit einigen Pilotgemeinden in den zurückliegenden drei Jahren gute Beispiele der Vorsorge geschaffen. Im Leutersdorfer Ortsteil Spitzkunnersdorf (Landkreis Görlitz) etwa hatte 2017 nach starken Regenfällen eine Sturzflut große Schäden verursacht. Wild abfließendes Wasser schoss über großräumige Feldflächen auf das nächste Gewässer zu, riss dabei Schlamm mit und überflutete die dazwischengelegenen Siedlungsbereiche großflächig. Erstmals werden nun in Spitzkunnersdorf Starkregenereignisse in eine Fachplanung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes einbezogen. Zur Unterstützung der Gemeinde hat das IÖR räumlich hochauflösende Gefahrenhinweiskarten mit Wasserständen und Fließgeschwindigkeiten für verschiedene Starkregenszenarien erstellt. Dies ist nur eines der Praxisbeispiele, die sich auf der Website in der Rubrik „Unsere Geschichten“ nachlesen lassen.
Hintergrund
Im Projekt RAINMAN (Integrated Heavy Rain Risk Management) haben die Partner im Projektzeitraum Juli 2017 bis Juni 2020 innovative Methoden und Werkzeuge für ein integriertes Starkregenrisikomanagement in Mitteleuropa entwickelt und diese Instrumente in verschiedenen Pilotregionen getestet. Ziel war es, die Schäden durch Starkregenereignisse im urbanen und ländlichen Raum durch ein verbessertes Risikomanagement zu reduzieren. Das Projekt wurde durch das Interreg CENTRAL EUROPE-Programm der Europäischen Union mit insgesamt 2,5 Millionen Euro gefördert. Lead-Partner war das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Dr. Regine Ortlepp, E-Mail: R.Ortlepp@ioer.de
Dr. Axel Sauer, E-Mail: A.Sauer@ioer.de
Weitere Informationen:
https://rainman-toolbox.eu/de – Link zur RAINMAN-Toolbox-Website
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/RAINMAN.html – Weitere Informationen zum Projekt RAINMAN
(nach oben)
Systemvergleich speicherbarer Energieträger aus erneuerbaren Energien
Eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Energieversorgung und Treibhausgasneutralität in Deutschland und weltweit ist die vollständige Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Hierbei sind Wind und Sonne die Quellen mit dem größten Bereitstellungspotenzial. Diese Energiequellen weisen jedoch eine geringe Energiedichte auf und sind nicht gleichförmig und überall in gleichem Umfang verfügbar. Deswegen wird ein System für die zeitliche und räumliche Verbindung zwischen Energiebereitstellung und -nutzung benötigt, welches die Bereitstellung der Primärenergie aus Sonne und Wind, ihre Umwandlung in speicherbare Energieträger und deren Transport zum Nutzungsort bewerkstelligt. Neben dem Übergang zu klima- und umweltverträglichen Energiequellen und deren effizienter Nutzung muss auch dieses verbindende System möglichst geringe Umwelteffekte aufweisen. Dieses Forschungsprojekt untersucht solche Bereitstellungspfade mit der Methode der Ökobilanzen und liefert damit Hinweise, welche Maßnahmen vorangetrieben werden müssen, um die Umwelteffekte der Bereitstellung, der Speicherung und des Transports speicherbarer Energieträger zu reduzieren. Wesentlich bleibt dabei, Energie möglichst sparsam und effizient zu nutzen, um die erforderliche Menge an speicherbaren Energieträgern aus erneuerbaren Energien und damit deren Umwelteffekte so weit wie möglich zu reduzieren. Neben dem Abschlussbericht als Zusammenfassung wesentlicher Methoden und Ergebnisse und dem Anhang mit einer ausführlichen Darstellung der durchgeführten Arbeiten werden nachstehend auch die Datentabellen mit den Eingangsdaten für die Ökobilanzrechnung, deren Ergebnisse und die Ergebnisse der Kostenschätzungen für weitere Arbeiten in diesem Themenfeld bereitgestellt.
Abschlussbericht „Systemvergleich speicherbarer Energieträger aus erneuerbaren Energien“ (5 MB)
Anhang zum Abschlussbericht „Detailanalysen zum Systemvergleich speicherbarer Energieträger aus erneuerbaren Energien“ (38 MB)
Datentabellen:
Eingangsdaten für die Ökobilanzrechnungen (Exceldatei, 1 MB)
Ergebnisse der Ökobilanzrechnungen (zip-Ordner, Exceldateien, 4 MB)
Ergebnisse der Kostenschätzungen (zip-Ordner, Exceldateien, 300 KB)
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/systemvergleich-speicherbarer-energietraeger-aus
(nach oben)
Neue digitale Wege in den Nachbarschaften
Neben all den Beeinträchtigungen, die das Corona-Virus im Alltag mit sich bringt, stehen die Betreiber und Mitarbeiter auf den Kläranlagen und in den Abwasserbetrieben vor bislang nicht dagewesenen Herausforderungen.Es gibt viele Fragen organisatorischer und personeller Art für diesen Pandemiefall, die zu klären sind.Bereits Mitte März hat der DWA-Landesverband Nord im Rahmen der Nachbarschaftsarbeit dazu aufgerufen, Pandemiepläne und/oder weitere hilfreiche Dokumente den Kollegen aus den Nachbarschaften zur Verfügung zu stellen.Diese Dokumente, ergänzt um Erfahrungsberichte und Ansprechpartner, wurden kurzfristig für Mitglieder der Nachbarschaften veröffentlicht.
Da sich die Nachbarschaftsteilnehmer aufgrund der derzeitigen Lage nicht persönlich treffen können, hat der Landesverband Nord im April zwei digitale Nachbarschaftstreffen durchgeführt.Unter dem Motto „Umgang mit der Corona- Krise“ teilten Mitarbeiter von Abwasserbetrieben ihre Erfahrungen.Anschließend diskutierten die Teilnehmer über verschiedenste Fragestellungen.Unterstützt wurden diese Veranstaltungen von den Ministerien der Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
Für beide Veranstaltungen, insgesamt haben fast 180 Personen teilgenommen, gab es eine sehr positive Resonanz.Digitale Angebote wird der DWA-Landesverband Nord in Zukunft auch in anderen Bereichen etablieren.
Weitere Informationen:
http://www.dwa-nord.de
So geht es auch: Digitales Nachbarschaftstreffen des DWA-Landesverbands Nord Ladenpreis: 37,00 Euro fördernde DWA-Mitglieder: 29,60 Euro
Mit dem Erscheinen des Merkblatts DWA-M 256-8 (05/2020) wird das Merkblatt DWA-M 256-8 (07/2013) zurückgezogen.
Herausgeber und Vertrieb
DWA-Bundesgeschäftsstelle Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef Tel. 0 22 42/872-333 Fax 0 22 42/872-100 E-Mail: info@dwa.de DWA-Shop: http://www.dwa.de/shop
(nach oben)
Beobachten, wie Mikroorganismen zusammenspielen
Über mikrobielle Gemeinschaften weiss man zwar, dass sie für unseren Planeten unverzichtbar sind. Darüber wie sie funktionieren, weiss man aber erstaunlich wenig. Forschende des Wasserforschungsinstituts Eawag bringen nun mit einer neuen Methode etwas Licht ins Dunkel: Eine neue Methode erlaubt ihnen die Interaktion zwischen Mikroorganismen zu beobachten.
Ohne sie gäbe es keinen Sauerstoff, Mensch und Tier könnten nicht verdauen, und die Stoffkreisläufe auf der Erde gerieten ins Stocken: Mikroorganismen. Auch in aquatischen Systemen führen mikrobielle Gemeinschaften wichtige Funktionen aus. Diese kommen oft durch Interaktionen zwischen Organismen innerhalb der Gemeinschaft zustande. Bekannt etwa ist, dass Mikroorganismen Stoffwechselprodukte oder Signalmoleküle austauschen: Einige Bakterien produzieren bestimmte Aminosäuren, die andere nicht herstellen können. Diese für das Wachstum wichtigen Substanzen werden über Diffusion ausgetauscht. Das gelingt aber nur bis zu einer gewissen Entfernung zwischen den Bakterienindividuen. Die Grösse dieses Interaktionsbereichs war bisher unbekannt – Alma dal Co, Martin Ackermann und anderen Mitarbeitenden aus der Abteilung Umweltmikrobiologie ist es gelungen, diese Interaktionen nun messbar zu machen. Wie, präsentieren sie heute im Fachmagazin Nature Ecology & Evolution.
Interaktion nur über Tausendstel Millimeter
Die neuartige Methode kombiniert Mikrofluidik, Mikroskopie und automatisierte Bildanalyse. Die Forschenden haben ein Gerät entwickelt, in dem sie Zellen von zwei Bakterienstämmen kontrolliert wachsen lassen und dieses Wachstum unter dem Mikroskop beobachten können. Messungen zeigen, dass diejenigen Zellen schneller wachsen, die sich direkt neben Zellen des anderen Bakterienstamms befinden. Denn gewisse Aminosäuren, die das Wachstum fördern, produziert nur der eine Bakterienstamm und werden über Diffusion an die benachbarten Zellen weitergeleitet. Diese Interaktion funktioniert allerdings nur über Distanzen von wenigen Tausendstel Millimetern. Bereits ab einem Abstand von zwei Zelllängen bricht diese Interaktion fast vollständig zusammen. «Ein Mikrobiom ist somit nicht immer in der Lage, Stoffwechselprozesse kollektiv durchzuführen, da seine Aktivitäten fast ausschliesslich auf Interaktionen zwischen einzelnen benachbarten Bakterienzellen beruhen», sagt Ackermann.
Um diese Wechselwirkungen und ihren Einfluss auf die Eigenschaften der mikrobiellen Verbände leichter zu verstehen, entwickelten die Forschenden ein mathematisches Modell, das die Wachstumsraten anhand der vorhandenen Aminosäuren vorhersagt. Auf diese Weise lassen sich fast alle Mikroben-Gemeinschaften untersuchen: So wenden die Forschenden die Methode unter anderem nun bei Mikroorganismen an, die in aquatischen Lebensräumen am Kohlenstoffzyklus beteiligt sind.
Publikation
Short-range interactions govern the dynamics and functions of microbial communities
https://www.nature.com/articles/s41559-019-1080-2
https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/beobachten-wie-mikroorganismen-zusammenspielen/
(nach oben)
Neuartige Wasserinfrastrukturen – Optionen für Unternehmens-strategien und Innovation
Im aktuellen netWORKS Paper stellen Jan Trapp und Jens Libbe vom Difu vor, welche Strategieoptionen und damit verbundene Chancen für Unternehmen der Wasserwirtschaft in der Einführung innovativer Wasserinfrastruktursysteme liegen können.
Seit Jahren wird sowohl in der akademischen Fachwelt als auch in der verbandlichen Praxis eine Diskussion über neuartige Wasserinfrastrukturen und „Neuartige Sanitärsysteme“ (NASS) geführt. Im Forschungsvorhaben netWORKS 3 werden insbesondere die Nutzung der im Abwasser enthaltenen Wärme und die getrennte Erfassung und Behandlung von Abwasserteilströmen (Schwarzwasser zur Optimierung der Klärgasgewinnung und energetischen Nutzung sowie Grauwasser zur Aufbreitung von Betriebswasser) auf unterschiedlichen räumlichen Ebene (Haus, Block, Quartier und überquartierlich) behandelt. Auch dezentrales Niederschlags¬wassermanagement ist Gegenstand der Untersuchungen. Diese verschiedenen Ansätze werden vielfach mit semi- oder dezentralen Anlagen realisiert. Mit diesen Systemen verbunden ist die Erwartung an flexible
Das netWORKS-Paper „Neuartige Wasserinfrastrukturen – Optionen für Unternehmens-strategien und Innovation“ zum Nachlesen gibt es hier: Download (pdf, 675 kB)
https://networks-group.de/de/news/2016-06-08/aktuelle-neuerscheinung-networks-paper.html
(nach oben)
Bundes-Oberflächengewässerverordnung nach Ende der Übergangsfrist für Richtlinie 2006/11/EG und Fortschreibung der europäischen Umweltqualitätsziele für prioritäre Stoffe
Auf Grundlage der EU-Wasserrahmenrichtlinie 60/2000/EG (WRRL) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, zur Überprüfung des angestrebten guten Zustandes der Oberflächengewässser Qualitätsnormen für flussgebietsspezifische Schadstoffe festzulegen (Artikel 4 der WRRL). Zur Bewertung
des Zustandes der Oberflächengewässer sind daher die Stoffe aus dem „Nichterschöpfenden Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe“ (siehe Anhang VIII WRRL) zu überprüfen und fortzuschreiben sowie Qualitätsnormen festzulegen. 2013 endete die Übergangsfrist für Richtlinie 2006/11/EG. Vor diesem Hintergrund initiierte das Umweltbundesamt ein Projekt, um für 10 ausgewählte Schadstoffe (flussgebietsspezifische Schadstoffe nach Oberflächengewässerverordnung (OGewV)) die Umweltqualitätsnormen zu aktualisieren und für 20 neue Stoffe Vorschläge für Umweltqualitätsnormen erarbeiten zu lassen.
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/revision-der-umweltqualitaetsnormen-der-bundes
(nach oben)
Integrierte Wasserbewirtschaftung in Flusseinzugsgebieten – DWA-Themenband T4/2015 erschienen
Die DWA hat den Themenband T4/2015 „Integrierte Wasserbewirtschaftung in Flusseinzugsgebieten Deutschlands – Ausgewählte Ergebnisse von BMBF-Forschungsprojekten“ veröffentlicht.
Die Wasserwirtschaft des vergangenen Jahrhunderts war bis in die 80er-Jahre hinein von technischen Lösungen ….
Themenband T4/2015 „Integrierte Wasserbewirtschaftung in Flusseinzugsgebieten Deutschlands – Ausgewählte Ergebnisse von BMBF-Forschungsprojekten“, August 2015 ISBN 978-3-88721-239-1, mit CD-ROM
(nach oben)
9. Rostocker Abwassertagung 2014
Infrastruktur- und Energiemanagement – ein Geschwisterpaar der Wasserwirtschaft
Am 12. November 2014 wurde durch die Professur für Wasserwirtschaft, der „Verein der Freunde und Förderer des Institutes für Kulturtechnik und Siedlungswasserwirtschaft“ und mit Unterstützung der EURAWASSER Nord GmbH die 9. Rostocker Abwassertagung veranstaltet.
Vortragsblock 1. Infraenergetische Anpassungsoptionen
Der erste Vortragsblock widmete sich der Darstellung beispielgebender Ansätze für ein integrales Infrastruktur- und Energiemanagement. Dr. Weilandt erläuterte in sehr strukturierter Form die strategisch-operativen Ansätze der Emschergenossenschaft zur Energieoptimierung. Diese lassen sich in die drei ineinander greifende Schwerpunkte gliedern:
• Optimierung der Strombeschaffung
• Reduzierung des Energieverbrauchs
• Steigerung der Energieerzeugung gliedern.
Konkrete Beispiele führten dabei auch zu interessanten Diskussionen zur Übertragbarkeit auf die Aufgabenträger in Mecklenburg-Vorpommern. Interessant war dabei auch, dass Maßnahmen, die noch vor einigen Jahren als unwirtschaftlich galten, durch den überdurchschnittlichen Anstieg der Energiepreise an Bedeutung gewonnen. Derartige Entwicklungen machen eine langfristige wirtschaftliche Planung schwierig. Für große Anlagen wird neben der Hauptaufgabe der Abwasserreinigung auch die Einbettung der Anlage in das regionale Energienetz und Betrieb eines Hybridkraftwerks wesentliche Aufgabe einer modern ausgestatteten Kläranlage sein. Kristian Höchel vom Fachgebiet Fluidsystemdynamik und Strömungstechnik an der TU Berlin, stellte anschließend das BMBF-geförderte Verbundforschungsprojekt KURAS (Konzepte für urbane Regenwasserbewirtschaftung und Abwassersystem) vor. Forschungsschwerpunkt sind betriebliche und konstruktive Maßnahmen im Abwassersystem, die gezielt auf die zwei Lastfälle Über- und Unterlast im Abwassernetz ausgerichtet sind. Berlin ist dabei aufgrund seiner besonderen infrastrukturellen Situation – Abwasserzufluss in Freigefällesystem Richtung Stadtmitte und pumpengestützte Abwasserförderung in die peripher gelegenen Kläranlagen – zahlreiche Ansatzpunkte für ein integriertes Wasser- und Energiemanagement. Von besonderem Interesse für das Auditorium waren die sehr detaillierten Ausführungen zur anlagentechnischen und betrieblichen Optimierung von Abwasserpumpstationen.
Der erste Themenblock wurde durch die Ausführungen über eine „strategische Netzentwicklung“ in Rostock durch Herrn Hoche von der EURAWASSER Nord GmbH abgerundet. Insbesondere durch Starkniederschläge induzierte Abflüsse stellen momentan eine Gefährdung da. Herr Hoche zeigte, wie in enger Zusammenarbeit mit allen wesentlichen Akteuren der Wasserwirtschaft und der Hansestadt, nachhaltige Lösungswege erarbeitet wurden. Ein besonderer Ansatzpunkt ist dabei die gezielte Entflechtung des Mischsystems im Innenstadtbereich und die geplante künftige Ableitung des Niederschlagswasser und ehemaliger Fließgewässer in historisch bekannten Entwässerungsachsen. Durch die positiven Erfahrungen bestärkt, entwickelte dasselbe Konsortium, in enger Kooperation mit der Uni Rostock, einen BMBF-Forschungsantrag für ein stadtübergreifendes Gewässerentwicklungskonzept („KOGGE“), welcher zwischenzeitlich zur Förderung vorgeschlagen wurde und ab Mitte 2015 bearbeitet werden soll.
https://abwassertagung.auf.uni-rostock.de/
(nach oben)
Abwasser – Rohstoff statt Reststoff
Bis heute wird Abwasser meist noch als „Abfallprodukt“ gesehen, für dessen Entsorgung Energie und Hilfsstoffe eingesetzt werden müssen und bei dessen Abbau Reststoffe wie Klärschlamm entstehen. Erst
langsam setzt sich, insbesondere aufgrund zunehmend globaler Anforderungen
z.B. bezüglich Klimaschutz und nachhaltigem Umgang mit Ressourcen, die Erkenntnis durch, dass Abwasser als „Rohstoff“ einiges zu bieten hat…mehr:
http://www.uni-stuttgart.de/hkom/publikationen/themenheft/08/abwasser.pdf
Autor:
Prof . Dr. – Ing. Heidrun Steinmetz hat nach dem Studium der Biologie an der Universität
Kaiserslautern sechs Jahre als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft an der Universität Kaiserslautern gearbeitet und dort 1996 zum Dr.-Ing. promoviert.
Nach sechsjähriger Berufspraxis in leitenden Positionen im Anlagenbau (Frankenthal) und in einem
Ingenieurbüro (Saarbrücken) kehrte sie als Geschäftsführerin des Zentrums für Innovative Abwassertechnologien an die Universität Kaiserslautern zurück. Seit 2007 leitet Sie den Lehrstuhl für
Siedlungswasserwirtschaft und Wasserrecycling an der Universität Stuttgart.
Kontakt
Universität Stuttgart,
Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte und Abfallwirtschaft
Lehrstuhl Siedlungswasserwirtschaft und Wasserrecycling
Bandtäle 2
70569 Stuttgart
Tel. 0711/685-63723
Fax 0711/685-63729
E-Mail: heidrun.steinmetz@iswa.uni-stuttgart
(nach oben)
Klimarelevante Emissionen von Abwasseranlagen
Der Förderverein der Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft an der Universität Essen hat in seiner Reihe „Forum Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft Universität Duisburg-Essen“ die von Sebastian Schmuck verfasste Dissertation „Entwicklung einer Methodologie zur Quantifizierung der klimarelevanten Emissionen von Abwasseranlagen in Deutschland“ veröffentlicht. Die von Schmuck vorgestellte Methodologie zur ganzheitlichen Bilanzierung der CO2-Emissionen von Abwasseranlagen über deren gesamten Lebenszyklus ermöglicht eine einheitliche Berechnung und basiert im Wesentlichen auf den normativen Grundlagen der DIN EN ISO 14040:2006.
Sebastian Schmuck: Entwicklung einer
Methodologie zur Quantifizierung
der klimarelevanten Emissionen von
Abwasseranlagen in Deutschland
(nach oben)
„Klärschlammentsorgung in der Bundesrepublik Deutschland“
Die neue Broschüre des Umweltbundesamtes „Klärschlammentsorgung in der Bundesrepublik Deutschland“ zum Download. Zwei Mio Tonnen Klärschlammtrockensubstanz fallen jährlich zur Entsorgung an. Bei durchschnittlich 25% TS also 8 Mio Tonnen Transportmasse mit 6 Mio Tonnen Wasser!
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4280.pdf
(nach oben)
Energie aus Abwasser – Ein Leitfaden für Kommunen
Ziel des Leitfadens ist es, den Kommunen Möglichkeiten aufzuzeigen, im Bereich der Kanalisation und der Kläranlage einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Dazu informiert der Leitfaden über grundsätzliche Zusammenhänge und stellt die erforderlichen Schritte zur Erkennung von Potenzialen zur Energieeinsparung, zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Gewinnung von Energie aus regenerativen Quellen bei Abwasseranlagen dar.
Herausgeber : Bayerisches Landesamt für Umwelt
Erscheinungsjahr : 2013
Umfang : 40 Seiten
Typ : Broschüre
Kommunen/Behörden : Ja
Breite Öffentlichkeit : Ja
PDF : 3,6 MB
Artikel-Nr: lfu_was_00083
(nach oben)
Handbuch informiert erstmals umfassend über ökonomische Anforderungen des europäischen Gewässerschutzes
HANNOVER. Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz informiert in einem Handbuch über den Charakter und die Inhalte der ökonomischen Anforderungen der Gewässerpolitik; es zeigt die bis heute noch nicht vollständig ausgeschöpften Potenziale im europäischen Gewässerschutz auf und berichtet über den Stand der Richtlinienumsetzung in Niedersachsen. In dieser zusammenfassenden und komprimierten Form ist es europaweit das erste Handbuch seiner Art. „Mit der Verabschiedung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und der Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL) sind neue Wege für einen noch stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Gewässerschutz geebnet worden“, erklärt Umweltminister Stefan Wenzel. Ökonomische Betrachtungen hätten durch die Vorgaben an Bedeutung gewonnen Zum ersten Mal in der Geschichte der Gewässerpolitik sei der Einsatz ökonomischer Methoden, Instrumente und Verfahren expliziter Bestandteil europäischer Richtlinien.
Die ökonomischen Anforderungen, das heißt ihre Inhalte, der Hintergrund und die damit verbundenen Möglichkeiten eines verbesserten Gewässerschutzes sind bisher über die Fachkreise hinaus kaum bekannt. In Niedersachsen ist die Berücksichtigung der Potenziale und auch der Grenzen der ökonomischen Anforderungen regulärer Bestandteil der Umsetzung der Richtlinien. Denn die Fachdisziplin Ökonomie bringt zusammen mit anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen bewährte und neue Möglichkeiten mit sich, um die gesellschaftlichen Interessen verschiedener Gruppen, wirtschaftliche Interessen sowie die Aspekte des Naturschutzes miteinander zu vereinen. „Somit können sämtliche, am und um das Gewässer relevanten Aspekte methodisch fundiert mit in die Betrachtung einbezogen werden“. so der Minister.
Das Handbuch steht auf unseren Seiten im Internet als PDF-Datei zum Herunterladen bereit:
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/80362
(nach oben)
Der Leitfaden „Energie aus Abwasser – Ein Leitfaden für Kommunen“
kann hier kostenlos heruntergeladen werden [extern]:
http://www.bestellen.bayern.de/application/stmug_app000008?SID=328136825&DIR=stmug&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:1,AARTxNR:lfu_was_00083,USERxBODYURL:artdtl.htm)=X
(nach oben)
«Umweltrecht kurz erklärt»
Die Broschüre des BAFU gibt Ihnen einen Überblick über die vielfältige und über Jahrzehnte gewachsene schweizerische Umweltgesetzgebung. Das nationale und das einschlägige internationale Recht sind umfassend und in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit dargestellt. Innovative grafische Darstellungen erlauben dabei auch einen visuellen Zugang zur abstrakten Welt des Rechts. Mehr:
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01720/index.html?lang=de
(nach oben)
Nachhaltige Sanitärsysteme und Bürogebäude – Wie ist das vereinbar?
Ob nachhaltige Sanitärsysteme auch in einem normalen Bürogebäude einsetzbar sind, hat das Projekt SANIRESCH (SANItärRecycling ESCHborn) im Frankfurter Hauptsitz der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH erprobt. Dort wurde über drei Jahre ein Abwassertrennkonzept von einem interdisziplinären Team betrieben und erforscht – mit einem besonderen Blick auf die notwendige Betriebssicherheit für diesen Gebäudetyp.
Autor(en):
Winker, Dr.-Ing. M.
Der vollständige Beitrag ist erschienen in:
UmweltMagazin 3-2013, Seite 20-23
Sie können diese Ausgabe gerne bei uns bestellen:
http://www.umweltmagazin.de/umwelt/currentarticle.php?data%5Barticle_id%5D=72419
(nach oben)
„Praxisleitfaden: Betrieb von Regenüberlaufbecken“ erschienen
Der Betrieb von Regenüberlaufbecken ist ein wichtiger Baustein im Gewässerschutz. Das Augenmerk darf nicht nur auf der Reinigungsqualität der Kläranlagen liegen, sondern das System Kanäle, Rückhalteräume und Kläranlage muss als Ganzes betrachtet werden. Nur so kann die Güte der Gewässer erhalten und stetig verbessert werden. Eine wesentliche Voraussetzung für einen effektiven Betrieb von Abwasseranlagen ist, dass das verantwortliche Personal hinreichend mit den Systemen und den Prozessen der Abwasserreinigung und insbesondere der Regenwasserbehandlung vertraut ist. Im ersten Teil werden daher die fachlichen Grundlagen der Regenwasserbehandlung im Mischsystem dargestellt. Der zweite Teil enthält konkrete Empfehlungen für den ordnungsgemäßen Betrieb von Regenüberlaufbecken. Er zeigt Möglichkeiten auf, wie im Rahmen des Betriebs, der Wartung und Unterhaltung auch die Anforderungen der Eigenkontrollverordnung unter möglichst effektivem Einsatz von Personal und sonstiger Ressourcen mit erfüllt werden können.
Christian Klippstein, Ulrich Dittmer:
Betrieb von Regenüberlaufbecken,
Handbuch für den Betrieb von Regenüberlaufbecken in Baden-Württemberg
Fachliche Grundlagen und Empfehlungen für die Praxis,
Stuttgart, 2012
DIN A4,
74 Seiten,
4-farbig, broschiert
ISBN 978-3-942964-51-7
30 Euro (20 % Rabatt für fördernde DWA-Mitglieder), zzgl. Versand
(nach oben)
Anforderungen an die Einleitung von Deponiesickerwasser
Empfehlungen für die Beurteilung, Behandlung und Einleitung von Deponiesickerwasser
Jahr 2012
Beschrieb Die Vollzugshilfe soll schweizweit einheitliche und für den Vollzug der Gewässerschutzgesetzgebung sowie für die Praxis ausreichende Empfehlungen für die Beurteilung, Behandlung und Einleitung von Deponiesickerwasser schaffen. Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf neue, in Betrieb stehende oder abgeschlossene Deponien mit gefasstem Sickerwasser.
Seiten 62
Nummer UV-1223-D
Hrsg. Bundesamt für Umwelt BAFU
Reihe Umwelt-Vollzug
Download unter:
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01703/index.html?lang=de
(nach oben)
Stadtwerke. Grundlagen, Rahmenbedingungen, Führung und Betrieb
Die Versorgungswirtschaft befindet sich im Umbruch. Insbesondere kommunale Unternehmen werden mit ständig neuen Rahmenbedingungen konfrontiert und sehen sich in vielen Bereichen einen zunehmenden Privatisierungs- und Liberalisierungsdruck ausgesetzt. Für den Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen (bvöd), Berlin, ein guter Grund, die Denkschrift „Stadtwerke. Grundlagen, Rahmenbedingungen, Führung und Betrieb“ herauszugeben. Erschienen ist sie als Band 56 der Schriftenreihe „Öffentliche Dienstleistungen“ im Nomos-Verlag. Die Autoren aus Praxis und Wissenschaft setzen sich dabei mit allen Aspekten der öffentlichen Wirtschaft auseinander, die Themenpalette reicht von den Strukturen und der Organisation von Stadtwerken über deren ökonomische Legitimation bis zu den Rahmenbedingungen in den einzelnen Wirtschaftszweigen. Auch das Management von Stadtwerken steht in der Denkschrift im Fokus, besonders wirtschaftliche Aspekte wie Controlling und Rechnungslegung stehen hier im Fokus.
Bräunig, D., Gottschalk, W. (Hrsg.):
Stadtwerke. Grundlagen, Rahmenbedingungen, Führung und Betrieb
gebunden, 437 Seiten,
96,00 Euro
Nomos-Verlag,
Baden-Baden ISBN 978-3-8329-7250-9
(nach oben)
Strategien zur Integration ressourcenorientierter Abwasserbewirtschaftung
Die über mehr als 100 Jahre gewachsenen komplexen Strukturen der Wasserver- und Abwasserentsorgungssysteme müssen sich zunehmend neuen Herausforderungen stellen. Die Forderung nach einer Anpassung hin zu flexiblen und nachhaltigen Systemen bedingt einen hohen Neu- und Umbaubedarf im Bestand. Als Alternativen und Ergänzung bestehender Systeme werden neben einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung auch Neuartige Sanitärsysteme diskutiert. Eine Umstellung bestehender Systeme auf Siedlungsebene findet hierbei allerdings äußerst selten statt. Hierfür ist die Erarbeitung von Umgestaltungsstrategien erforderlich, um finanzielle Mittel und ökologischen Nutzen zu optimieren. Die Dissertation „Strategieentwicklung zur Integration ressourcenorientierter Abwasserbewirtschaftung durch mathematische Optimierung“ von Inka Kaufmann Alves beschäftigt sich mit einer solchen weitreichenden Umgestaltung siedlungswasserwirtschaftlicher Systeme. In ihrer Arbeit wird ein multikriterielles lineares Optimierungsmodell genutzt, in dem Methoden der Projektplanungs- und Netzwerkflussprobleme verknüpft werden. Als wesentliche Nebenbedingung wird die Einhaltung der Funktionsfähigkeit der sich wandelnden Systeme und als Zielfunktionen werden ökonomische und ökologische Kosten eingeführt. Lösungen des formulierten mathematischen Problems sind Paretooptimale funktionsfähige und zulässige Strategien der weitreichenden Integration einer ressourcenorientierten Abwasserbewirtschaftung. Als Ergebnis liegt ein Instrument vor, dass die Entscheidungsfindung zur Umgestaltung von bestehenden siedlungswasserwirtschaftlichen Infrastrukturen unterstützt und mögliche Kosten und Folgewirkungen zeitlich und räumlich differenziert aufzeigen kann. Das Optimierungsmodell wurde an zwei Untersuchungsgebieten angewandt und optimale Umgestaltungsstrategien zu unterschiedlichen nachhaltigen Zielzuständen analysiert sowie eine Sensitivitätsanalyse bezüglich wichtiger Optimierungsparameter durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die generelle Umsetzbarkeit einer weitreichenden Teilstromseparation gewährleistet ist, wenn neue Elemente zur Bewirtschaftung, Behandlung und Ableitung zeitlich optimiert integriert werden. Mögliche Umgestaltungen werden keine linearen Anpassungen an Zielwerte, Veränderungen von Umweltauswirkungen oder Kostenflüsse verursachen. Es ergeben sich vielmehr über den Umsetzungszeitraum veränderliche Verläufe, die je nach Zielgewichtung von ökonomischen und ökologischen Kosten große Wirkungen zu Beginn oder zum Ende der Betrachtungsdauer zeigen. Vor allem die Gewi chtung der beiden Zielfunktionen (ökonomische und ökologische Kosten) und die Auswahl der zu minimierenden ökologischen Kriterien haben einen großen Einfluss auf die gefundenen Umgestaltungsstrategien. Die jeweiligen Empfehlungen zum Umgestaltungszeitraum, der Zielgewichtung und zur allgemeinen Vorgabe der Optimierungskriterien leiten sich vor allem aus der Veranlassung für eine Systemumgestaltung ab. Die für den spezifischen Anwendungsfall optimale Umgestaltungsstrategie kann sich nur durch Diskussion mit den Entscheidungsträgern vor Ort ergeben. Das Modell hat sich hierbei als sehr gut geeignetes Werkzeug zur Analyse der Systeme herausgestellt. Es konnte gezeigt werden, dass eine Erweiterung derzeitiger Bewertungsmethoden hin zu Methoden, die zeitlich und räumlich differenzierte Aussagen für den ökologischen und ökonomischen Zustand ermöglichen, erforderlich ist. Die alleinige Planung und Betrachtung des zukünftigen Systemzustandes ist nicht ausreichend zur Beurteilung der Wirkungen einer weitreichenden Implementierung ressourcenorientierter Abwasserbewirtschaftungskonzepte.
Strategieentwicklung zur Integration ressourcenorientierter Abwasserbewirtschaftung durch mathematische Optimierung,
Dissertation von Inka Kaufmann Alves
Gutachter:
Prof. Dr.-Ing. Theo G. Schmitt, Technische Universität Kaiserslautern
Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz, Universität Stuttgart.
Die Dissertation ist erschienen als Band 34 der Schriftenreihe des Fachgebietes Siedlungswasserwirtschaft an der Technischen Universität Kaiserslautern
(zu beziehen über silja.worreschk@bauing.uni-kl.de).
(nach oben)
Leitfaden zum Technischen Sicherheitsmanagement überarbeitet
In bewährter Zusammenarbeit zwischen den Verbänden AGFW, DVGW, DWA und FNN wurde der allgemeine Teil des Leitfadens zum Technischen Sicherheitsmanagement aktualisiert. Erweiterungen erfolgten im Abschnitt 4, wo einige Fragen zur elektronischen Dokumentation und Nachweisführung ergänzt wurden. Weiterhin wurde der gesamte Leitfaden einer umfassenden redaktionellen Überarbeitung unterzogen, sodass er nun noch anwenderfreundlicher formuliert und leichter verständlich ist.
Ziele des Technischen Sicherheitsmanagements
Ziel des Technischen Sicherheitsmanagements ist die Unterstützung der Betreiber im Hinblick auf eine rechtssichere Aufbau- und Ablauforganisation im technischen Bereich der Unternehmen (Planung, Bau, Betrieb). Die Anforderungen an Qualifikation und Organisation sind dabei in den Merkblättern DWAM 1000 (Abwasseranlagen), DWAM 1001 (Gewässerunterhaltung) und DWA-M 1002 (Stauanlagen) zusammengefasst. Die Umsetzung der dort formulierten Anforderungen erfolgt anhand der Leitfäden. Diese sind modular aufgebaut und inhaltlich aufeinander abgestimmt. Anhand der Leitfäden führt das Unternehmen zunächst eine Selbstanalyse durch, nach dieser kann eine Überprüfung durch Experten der DWA erfolgen. Das Unternehmen erhält eine Urkunde und darf das TSM-Logo führen, sofern die Überprüfung durch die TSM-Experten positiv abgeschlossen werden konnte. Die Urkunde gilt in der Regel für fünf Jahre.
Leitfäden zum TSM – verfügbar für jedermann
Im Internet sind unter www.dwa.de neben dem allgemeinen, organisatorischen Teil des Leitfadens auch die fachspezifischen Leitfäden für die Sparten Abwasser, Gewässerunterhaltung und Stauanlagen verfügbar. Auf Nachfrage werden diese auch im Word-Format kostenlos zur Verfügung gestellt.
(nach oben)
Entwicklung und Stand der Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen
Juli 2010 – Nordrhein-Westfalen ist ein wasserreiches Land mit vielen Flüssen, Seen und Bächen. Für einen nachhaltigen Gewässerschutz ist es erforderlich, dass Abwässer umweltverträglich entsorgt werden, d.h. abgeleitet, gereinigt und in den Wasserkreislauf zurückgeführt.
Die Gewässerqualität in Nordrhein-Westfalen hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Dies ist insbesondere auf die intensiven Anstrengungen bei der Verbesserung der Abwasserbeseitigung zurückzuführen.
Dies spiegelt sich auch in der vorliegenden Veröffentlichung „Entwicklung und Stand der Abwasserbeseitigung, 14. Auflage“ wieder. Der vorliegende Bericht stellt den (gemäß Artikel 16 der EU-Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser vom 21. Mai 1991; 91/271/EWG) regelmäßig zu erstellenden Lagebericht für die Öffentlichkeit dar. Er informiert über die Entwicklung und den Stand der Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen und dokumentiert damit die erfolgte Umsetzung der EU-Richtlinie.
Die Broschüre wird mit einer umfassenden flussgebietsbezogenen Darstellung der Abwasseranlagen und ihrer Einleitungen in Gewässer ergänzt, die auf der der gedruckten Broschüre beigefügten CD enthalten ist.
Die zur Abwasserbehandlung in Nordrhein-Westfalen eingesetzte Technik zeichnet sich heute auch im nationalen und internationalen Vergleich durch einen hohen Standard aus. Von den 18 Mio. Einwohnern sind 97 % an die Kanalisation verbunden mit einer Abwasserbehandlung in einer Kläranlagen angeschlossen. Das Abwasser des verbleibenden Teils der Bevölkerung wird über private Kleinkläranlagen gereinigt oder in abflusslosen Gruben gesammelt und zur kommunalen Kläranlage abgefahren.
Die Anforderungen der EU-Kommunalabwasserrichtlinie an die kommunale Abwasserbehandlung sind in Nordrhein-Westfalen flächendeckend umgesetzt.
In allen Kläranlagen für mehr als 2.000 Einwohner wird im Sinne der EU-Kommunalabwasserrichtlinie eine biologische Abwasserbehandlung durchgeführt. Alle Kläranlagen für mehr als 10.000 Einwohner sind in der Lage, die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor zu eliminieren. Die Mindestanforderungen gemäß Anhang 1 der Abwasserverordnung an die Einleitungen aus kommunalen Kläranlagen bezüglich Nährstoffe werden flächendeckend eingehalten. Dies spiegelt sich auch in den guten Eliminationsraten wieder. Im Jahr 2008 wurden in den kommunalen Kläranlagen in Nordrhein-Westfalen Eliminationsraten von 93 % für Phosphor und 83 % für Stickstoff erzielt. Damit wird die Anforderungen der EU-Kommunalabwasserrichtlinie in Nordrhein-Westfalen deutlich übertroffen.
Trotz der bisherigen Anstrengungen und Erfolge in der Abwasserbeseitigung stehen weitere Handlungsfelder an. Hierzu gehört die weitere Optimierung der Abwasserbeseitigung. Die Broschüre geht in Kapitel 8 auf aktuelle Projekte – wie das Jahrhundertprojekt Emscher – und zukünftige Herausforderungen ein. Ein wichtiges Thema für zukünftiges Handeln, das auch die Abwasserbeseitigung betreffen kann, sind Mikroschadstoffe in der aquatischen Umwelt, deren Bewertung, Überwachung und Vermeidung.
Aus dem Klimawandel und seinen Folgen für die Abwasserbeseitigung ergibt sich eine besondere Herausforderung. Zudem sind auch in der Abwasserbeseitigung zukünftig der demografische Wandel und seine Folgen zu berücksichtigen.
Broschüre PDF: http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/abwasser09.pdf
(nach oben)
WasserWirtschafts-Kurse N/5: Behandlung von Industrie- und Gewerbeabwasser
März 2011 in Kassel, 508 Seiten, 138 Bilder, 61 Tabellen, broschiert, DIN A5
ISBN 978-3-941897-75-5
Einzelpreis EUR 52,00 / Preis für fördernde DWA-Mitglieder EUR 41,60
Steigende Anforderungen an die Abwasserreinigung, Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und der rationale Umgang mit der Ressource Wasser führten in der Vergangenheit zu einer weiteren Entwicklung von spezifischen Verfahren zur industriellen Abwasserbehandlung. Aufgrund unterschiedlicher Abwassercharakteristik sowie branchenspezifischer Anforderungen gibt es dabei ständig interessante Neuerungen und Weiterentwicklungen im Bereich der Verfahrenstechnik. Auch die Anforderungen und rechtlichen Vorgaben werden ständig erweitert und überarbeitet und beschränken sich nicht mehr ausschließlich auf die Parameter Kohlenstoff und Stickstoff, sondern z. B. auch auf gefährliche Stoffe und Spurenstoffe. Im Tagungsband sind sowohl die neuesten rechtlichen Vorgaben als auch eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren für die Behandlung industrieller Abwässer zusammengestellt. In konkreten Praxisbeispielen werden insbesondere d ie Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit verschiedener Techniken sowie damit gewonnene Betriebserfahrungen vorgestellt.
(nach oben)
UFZ-Spezial „In Sachen Wasser“ erschienen
Ob Wassermangel, Hochwasser, Verunreinigungen, Übernutzung oder schlechtes Wassermanagement – sie stellen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vor große Herausforderungen. Das UFZ leistet mit seiner breiten Expertise in der interdisziplinären Wasserforschung einen wichtigen Beitrag für ein nachhaltiges Management von Wasserressourcen.
Die 2011er Spezialausgabe des UFZ-Newsletters ist daher unter dem Titel „In Sachen Wasser“ erschienen.
„In Sachen Wasser“
Die 2011er Spezialausgabe des UFZ-Newsletters befasst sich mit dem Thema „Wasser“.
Themen dieser Ausgabe sind:
Wasser – Beobachten, Erkunden, Verstehen und Modellieren
* Mit TERENO die Umwelt beobachten
* Den Untergrund effizienter erforschen
* Standpunkt: Giftige Chemikalien in unseren Gewässern – Ein Problem von gestern?
* Der Fluss der Stoffe
* Interview: Führende Wasserforscher verbinden sich
* Den Dürren auf der Spur
* Dreidimensionaler Blick in den Untergrund
* SARISK macht Hochwasser berechenbar
Wasser – Ressourcen managen
* Teuren Altlasten innovativ begegnen
* Smarte Lösungen für die Abwassernutzung
* Nomadenleben adé
* Wasserbilanzen präzise ermitteln
* So schnell verzeiht die Aue nicht
* Interview: Wir haben keine Zeit mehr zu diskutieren
* Standpunkt: Wassernutzungsabgaben erhalten und weiterentwickeln!
* Gemeinsam zu guten Gewässern
* Standpunkt: Zehn Jahre Umsetzung WRRL – Ein kritisches Fazit
Den UFZ-Spezial vom Juni 2011 können Sie hier als PDF herunterladen:
http://www.ufz.de/data/UFZ_Spezial_Jun11_Dt_2011053015100.pdf
oder
kostenfrei bestellen unter
http://www.ufz.de/index.php?de=14958
Weitere Informationen:
http://www.ufz.de/index.php?de=10690
(nach oben)
Bärtierchenforschung im Wandel der Zeit
Sonderband mit Tagungsbeiträgen erschienen
Bärtierchen (Tarchigraden) sind in der Lage, schlechte Umweltbedingungen getrocknet oder gefroren unbeschadet zu überdauern. Die erstaunlichen Eigenschaften dieser Winzlinge standen im Mittelpunkt des 11. Weltsymposiums der Bärtierchenforscher, zu dem sich im Sommer 2009 an der Universität Tübingen über 70 Teilnehmer aus 15 Ländern trafen. Initiiert hat das weltweite Treffen der Zoologe Dr. Ralph O. Schill vom Biologischen Institut der Universität Stuttgart. Zu den Tagungsbeiträgen ist jetzt ein Sonderband erschienen, in dem 58 Autoren 20 wissenschaftliche Beiträge aus allen Bereichen der Bärtierchenforschung präsentieren.*)
Der Band zeigt eindrucksvoll die fast revolutionären Veränderungen in der Bärtierchenforschung in den letzten Jahrzehnten, vor allem unter dem Einfluss der molekularenTechniken. Seit der ersten Beschreibung eines Bärtierchen im Jahr 1773 durch den deutschen Pastor Johann August Ephraim Goeze in Quedlinburg wächst die Zahl der Wissenschaftler, die sich für Bärtierchen interessieren, ständig. Während zu Beginn die Bärtierchengemeinde ausschließlich aus taxonomisch arbeitenden Zoologen bestand, die neue Arten beschrieben und deren Lebensgewohnheiten untersucht haben, stehen heute vor allem interdisziplinäre Forschungsansätze im Vordergrund, bei denen mit Genen und Proteinen gearbeitet wird. Deshalb beinhaltet der Sonderband auch einige Publikationen von Biochemikern, Molekularbiologen und Bioinformatikern. Wichtige Impulse, Bärtierchen als neuen Modelorganismus zu verwenden, gab das an der Uni Stuttgart beheimatete Projekt „Funktionelle Analyse dynamischer Prozesse in cryptobiotischen Tardigraden“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde.
*) Water Bears Today, Proceedings of the 11th Symposium of Tardigrada, Tübingen 3-6 August 2009″, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. Volume 49 (Suppl. 1),
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzs.2011.49.issue-s1/issuetoc
Weitere Informationen bei
Dr. Ralph O. Schill, Universität Stuttgart,
Biologisches Institut/Abt. Zoologie,
Tel. 0172/7304726,
e-mail: ralph.schill@bio.uni-stuttgart.de
Abteilung Hochschulkommunikation
Universität Stuttgart
(nach oben)
Beuteilungkonzept für organische Spurenstoffe aus kommunalem Abwasser
Einen Bericht, der bei der schweizerischen EWAG erarbeitet wurde, findet man unter:
http://www.eawag.ch/forschung/uchem/Bericht_Beurteilungskonzept.pdf
(nach oben)
Stickstoff – lebensnotwendiger Nährstoff und gefährlicher Schadstoff
UBA veröffentlicht neue Broschüre „Stickstoff – Zuviel des Guten?“
Stickstoff hat zwei Gesichter: Er ist zum einen – als Grundbaustein der Natur – ein lebensnotwendiger Nährstoff, zum anderen ein gefährlicher Schadstoff für Menschen und Ökosysteme. Hauptverursacher so genannter reaktiver Stickstoffemissionen in alle Umweltmedien ist die Landwirtschaft mit mehr als 50 Prozent. Doch auch Emissionen aus dem Verkehr, aus Industrie und Energiegewinnung sowie aus Abwässern tragen jeweils mit annähernd 15 Prozent bei.
In der neuen Broschüre „Stickstoff – Zuviel des Guten?“ stellt das Umweltbundesamt (UBA) die verschiedenen Wirkungen des Stickstoffs vor, benennt die wichtigsten Quellen und zeigt Möglichkeiten auf, schädliche Stickstofffreisetzungen zu reduzieren.
Stickstoff ist für die Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung – seine Verfügbarkeit bestimmt die Erträge auf den Feldern. Die Verwendung stickstoffhaltiger Düngemittel ist daher in der Landwirtschaft gängige Praxis. So nützlich reaktiver Stickstoff auf den Feldern ist, so schädlich kann er sich in anderen Bereichen auswirken. Reaktive Stickstoffverbindungen gefährden die menschliche Gesundheit (Stickstoffoxide), vermindern die Qualität unseres Grundwassers (Nitrat) und verschärfen den Klimawandel (Lachgas); sie führen zur Versauerung und Überdüngung naturnaher Ökosysteme und damit zu einem Verlust an biologischer Vielfalt (Ammoniak). Zudem fördern sie auch die Zerstörung von Bauwerken.
UBA-Präsident Jochen Flasbarth sagt dazu: „Die Reduktion der Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft kommt zu langsam voran. Wir brauchen deshalb weitergehende Maßnahmen, um die damit verbundenen Umwelt- und Gesundheitsgefahren zu vermindern. Längerfristig muss es das Ziel sein, regionale Stoffkreisläufe zu schließen.“
Das Umweltbundesamt stellt die neue Broschüre „Stickstoff – Zuviel des Guten?“ in Berlin auf der Grünen Woche, der Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, vor.
Die-UBA-Broschüre: „Stickstoff – Zuviel des Guten?“ steht auch unter http://www.uba.de/uba-info-medien/4058.html zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Weitere Informationen und Links
Integrierte Strategie zur Minderung von Stickstoffemissionen
UBA-Broschüre: „Gewässerschutz mit der Landwirtschaft“
Weitere Informationen zu Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie
Weitere Informationen zu reaktivem Stickstoff in der Umwelt
(nach oben)
Transformationen für eine nachhaltige Wasserwirtschaft
Forschungsverbund netWORKS veröffentlicht Handreichung zur Realisierung
neuartiger Infrastrukturlösungen im Bereich Wasser und Abwasser. Online-
Simulationstool zur Planung von Infrastrukturänderungen freigeschaltet.
Berlin und Frankfurt/Main. Der Umbau der Systeme für Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung ist Gegenstand einer aktuellen Veröffentlichung
des Forschungsverbundes netWORKS. Der Band bündelt die Ergebnisse eines
dreijährigen Forschungsprojekts gemeinsam mit sechs Modellkommunen.
Darin wurden verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, wie eine
langfristige Neuauslegung der vorhandenen Infrastruktur gestaltet
werden kann. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass solche
Transformationen wirtschaftlich tragfähig sind.
Die Veröffentlichung des Forschungsverbundes netWORKS richtet sich an
Entscheidungsträger aus den Bereichen Stadtentwicklung, Stadtplanung
und Siedlungswasserwirtschaft. Den verantwortlichen Planern wird ein
Konzept zur mehrdimensionalen Bewertung von möglichen Umbaustrategien
an die Hand gegeben. Das Buch macht deutlich, dass die Transformation
der siedlungswasserwirtschaftlichen Infrastruktur nur in enger
Abstimmung zwischen diesen Akteuren im Sinne eines
Transformationsmanagements erfolgen kann. Zahlreiche Hinweise zur
Umsetzung und rechtlichen Flankierung ergänzen die Publikation.
Außerdem sind die mit dem Umbau verbundenen Chancen für die
Kommunalwirtschaft erläutert und innovative Wege des Umgangs mit
Wasser und Abwasser durch Fallbeispiele illustriert.
Die Publikation kann beim Deutschen Institut für Urbanistik zum Preis
von 22,00 Euro bezogen werden.
http://www.difu.de/publikationen/2010/transformationsmanagement-fuer-eine-nachhaltige.html
Der Forschungsverbund „netWORKS“ wird vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderschwerpunkts
„Sozial-ökologische Forschung“ gefördert.
Die Arbeit des Forschungsverbunds netWORKS wird im Internet unter
http://www.networks-group.de/ dokumentiert.
Kontakt:
Jens Libbe
Deutsches Institut für Urbanistik
Zimmerstraße 13-15
10969 Berlin
(nach oben)
Praxisleitfaden für Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg
Überprüfung und Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen; Preis: € 10,00 zzgl. Versandkosten
Die Publikationen können über www.dwa-bw.de online bestellt werden.
Kontakt und Infos:
DWA-Landesverband Baden-Württemberg
Rennstr. 8, 70499 Stuttgart
Tel.: 0711 89 66 31-0, Fax: 0711 89 66 31-11
E-Mail: info@dwa-bw.de
Internet: www.dwa-bw.de
(nach oben)
Transformationen für eine nachhaltige Wasserwirtschaft
Forschungsverbund netWORKS veröffentlicht Handreichung zur Realisierung
neuartiger Infrastrukturlösungen im Bereich Wasser und Abwasser. Online-
Simulationstool zur Planung von Infrastrukturänderungen freigeschaltet.
Berlin und Frankfurt/Main. Der Umbau der Systeme für Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung ist Gegenstand einer aktuellen Veröffentlichung
des Forschungsverbundes netWORKS. Der Band bündelt die Ergebnisse eines
dreijährigen Forschungsprojekts gemeinsam mit sechs Modellkommunen.
Darin wurden verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, wie eine
langfristige Neuauslegung der vorhandenen Infrastruktur gestaltet
werden kann. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass solche
Transformationen wirtschaftlich tragfähig sind.
Die Veröffentlichung des Forschungsverbundes netWORKS richtet sich an
Entscheidungsträger aus den Bereichen Stadtentwicklung, Stadtplanung
und Siedlungswasserwirtschaft. Den verantwortlichen Planern wird ein
Konzept zur mehrdimensionalen Bewertung von möglichen Umbaustrategien
an die Hand gegeben. Das Buch macht deutlich, dass die Transformation
der siedlungswasserwirtschaftlichen Infrastruktur nur in enger
Abstimmung zwischen diesen Akteuren im Sinne eines
Transformationsmanagements erfolgen kann. Zahlreiche Hinweise zur
Umsetzung und rechtlichen Flankierung ergänzen die Publikation.
Außerdem sind die mit dem Umbau verbundenen Chancen für die
Kommunalwirtschaft erläutert und innovative Wege des Umgangs mit
Wasser und Abwasser durch Fallbeispiele illustriert.
Die Publikation kann beim Deutschen Institut für Urbanistik zum Preis
von 22,00 Euro bezogen werden.
http://www.difu.de/publikationen/2010/transformationsmanagement-fuer-eine-nachhaltige.html
Der Forschungsverbund „netWORKS“ wird vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderschwerpunkts
„Sozial-ökologische Forschung“ gefördert.
Die Arbeit des Forschungsverbunds netWORKS wird im Internet unter
http://www.networks-group.de/ dokumentiert.
Kontakt:
Jens Libbe
Deutsches Institut für Urbanistik
Zimmerstraße 13-15
10969 Berlin
(nach oben)
„Korrosion im Wasser- und Abwasserfach“ veröffentlicht
ÖWAV-Arbeitsbehelf aus Österreich
Der ÖWAV hat im November 2010 den ÖWAV-Arbeitsbehelf 39 „Korrosion im Wasser- und Abwasserfach“ veröffentlicht.
Korrosionsfragen nehmen im Wasser- und Abwasserfach einen bedeutenden Platz ein. Kenntnisse bezüglich Ursachen, Auswirkungen und Abhilfe sind sowohl für die Planung als auch für den Betrieb und die Langlebigkeit aller Anlagen und Netze von wesentlicher Bedeutung. Der ÖWAV hat sich deshalb entschlossen, sich diesem umfangreichen Fragenkomplex in Form der Herausgabe eines Arbeitsbehelfs zu widmen.
Hauptzweck dieses Arbeitsbehelfs soll es sein, praxisgerechte Unterlagen bereitzustellen, in denen Fragen der Korrosion aus allen vorgesehenen Bereichen behandelt werden.
Der Arbeitsbehelf steht zum Gratisdownload unter http://www.oewav.at/page.aspx?target=144557
zur Verfügung.
(nach oben)
„Innovationsforum Wasserwirtschaft“: Neue Tagungsreihe zum „Blauen Gold“
Franz-Georg Elpers
Pressestelle
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
BMBF, DWA und DBU wollen aktuelle Forschungsergebnisse stärker in Praxis verbreiten – 2011 in Osnabrück
München/Osnabrück. „Innovationsforum Wasserwirtschaft“: Heute wurde die neue jährliche Veranstaltungsreihe des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) bei der IFAT ENTSORGA 2010 in München von DWA-Geschäftsführer Johannes Lohaus und DBU-Generalsekretär Dr. Fritz Brickwedde offiziell vorgestellt. „Ziel ist es, Ergebnisse aktueller Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von BMBF und DBU regelmäßig national wie international systematisch zu verbreiten und in die Praxis umzusetzen“, so Brickwedde. „Wir werden die Strukturen der drei Partner nutzen und so den Austausch zwischen Forschung und Entwicklung einerseits und der Praxis der Wasserwirtschaft andererseits noch stärker fördern“, ergänzt Lohaus. Das nächste „Innovationsforum Wasserwirtschaft“ ist für den 10. und 11. Oktober 2011 im Zentrum für Umweltkommunikation (ZUK) der DBU in Osnabrück geplant.
Wasser, das Blaue Gold: benötigt, begehrt und eines der Schlüsselthemen des 21. Jahrhunderts. Bevölkerungswachstum, Industrialisierung, Verstädterung und der Klimawandel wirken sich auf den Wasserkreislauf aus und machen den lebenswichtigen Stoff knapp. Mit Folgen: Weltweit steigt der Wasserbedarf, die Wasserqualität sinkt vielerorts. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation haben bereits heute 1,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Trinkwasser zu gewinnen, ist in Regionen, in denen heute Wasserknappheit herrscht, nur mit hohem Energieaufwand und einer entsprechend hohen Umweltbelastung möglich.
Das BMBF unterstützt Forschungsvorhaben zum Thema Wasser mit jährlich rund 60 Millionen Euro. Der Eingang dieser Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in die Praxis ist eines der gemeinsamen Ziele, die durch die neue Veranstaltungsreihe besser als bisher erreicht werden sollen, so die Initiatoren. „Diese Resultate müssen in Anwendungen und Innovationen auf Unternehmensebene münden, damit die erwünschten Umwelt- und Kostenentlastungseffekte eintreten“, erklärt Brickwedde. Die DBU hat als weltweit größte Umweltstiftung seit Aufnahme der Fördertätigkeit im Jahr 1991 über 7.600 Projekte aus Umwelttechnik, Umweltforschung und Naturschutz sowie Umweltkommunikation und Kulturgüterschutz mit über 1,34 Milliarden Euro gefördert, davon über 1.000 Wasser-Projekte mit mehr als 160 Millionen Euro. „Auf der anderen Seite müssen aber auch Anforderungen aus der Praxis an die Forschungsverantwortlichen herangetragen werden“, begründet Lohaus das strategische Engagement in Sachen „Innovationsforum Wasserwirtschaft“. Als technisch-wissenschaftlicher Fachverband mit rund 14.000 Mitgliedern – von Kommunen, Hochschulen, Behörden über Ingenieurbüros und Unternehmen bis hin zu deren Fach- und Führungskräften – setze sich die DWA für eine nachhaltige Wasserwirtschaft ein. Sie fungiere unter anderem als Scharnier zwischen Forschung und Praxis und schule zum Beispiel jährlich rund 35.000 Wasserfachleute.
Mit dem gemeinsamen Engagement von BMBF, DBU und DWA im „Innovationsforum Wasserwirtschaft“ sollen die Ergebnisse aus laufenden und abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf jährlich stattfindenden Fachtagungen systematisch verbreitet werden. Das Ziel: insgesamt noch mehr Forscher, Entwickler und Praktiker der Zielgruppe „Wasserwirtschaft“ zu erreichen.
In geraden Jahren (2010, 2012, 2014) würden insbesondere die internationalen Forschungsthemen und -ergebnisse auf der weltgrößten Umweltfachmesse IFAT ENTSORGA in München einem internationalen Fachpublikum vorgestellt werden. Die nationalen Themen würden in den ungeraden Jahren (2011, 2013, 2015) im jährlichen Wechsel bei der DBU (Osnabrück) oder beim BMBF (Bonn) präsentiert. Dabei können sich auch Nachwuchswissenschaftler aus dem DBU-Stipendienprogramm, dem BMBF-Stipendienprogramm „Internationale Aufbaustudiengänge im Wasserfach“, dem Young Scientists and Professionals Programm (DWA), dem Stipendienprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), der DAAD-Alumniprogramme und auch Gastwissenschaftler besser vernetzen.
Weitere Informationen zum „Innovationsforum Wasserwirtschaft“ finden sich unter www.dbu.de/550artikel30681_135.html und www.dwa.de.
(nach oben)
Neuer Parameter anstelle von TS oder o-TS?
Kommunale Abwasserreinigung ist im Wesentlichen biologische Abwasserreinigung. Bakterien sind die Hauptträger des biologischen Umsatzes. Die Quantifizierung der am biologischen Umsatz beteiligten Biomasse ist durch die Angabe der Trockensubstanz (TS) bzw. der organischen Trockensubstanz (oTS) nur relativ und recht ungenau möglich. Besteht doch zum Beispiel Torf oder Stroh fast nur aus organischer Substanz, so würde das Vorhandensein genannter Substanzen zwar eine hohe oTS, aber keine biologische Aktivität zeigen. Die Quantifizierung der Bakterien selber stößt schnell an methodische Grenzen und ist zurzeit für belebten Schlamm (BS) nicht zielgerichtet umsetzbar. Messungen von DNA, ATP oder anderen Intermediaten des bakteriellen Stoffwechsels bieten Alternativen, sind aber mit vielen methodischen und anderen Nachteilen verbunden. Aussichtsreicher Kandidat für die Messung des biologisch aktiven Teils des BS ist das Protein, das immer an strukturelle und katalytische Eigenschaften gekoppelt ist. Die Proteinmessung in BS ist einige Male beschrieben worden, systematische Untersuchungen fehlen allerdings. Zielsetzung der Arbeit war es zunächst zu prüfen, ob Proteine prinzipiell als Parameter in Frage kommen. Danach sollten mithilfe von Laborfermentern Experimente durchgeführt werden, bei denen sich zum Beispiel durch Mangelzustände der Zustand der Biomasse ändert. Aus praktischen Erwägungen wurde mit Sequencing- Batch-Reaktoren (SBR) gearbeitet. Die Proteinbestimmung selber – auch wenn die prinzipielle Methode aus der Literatur von Frølund bekannt ist – wurde in der Arbeit systematisch aufgearbeitet, optimiert und validiert. Erst nach der systematischen Überprüfung des Tests wurden Proteinmessungen an belebtem Schlamm vorgenommen. In ersten einfachen Studien konnte gezeigt werden, dass die Proteinmessung im Prinzip geeignet ist, die Biomasse zu bestimmen. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Lowry-Methode gegenüber der Bradford-Messung besser geeignet ist. Die Proteingehalte wurdenauch sinnvoll in Beziehung gesetzt mit den Abbauleistungen der jeweiligen Reaktoren. Die Bildung des Proteins in der aeroben Phase des SBR wurde gezeigt. Mit der Hilfe von Mangelexperimenten (C, N, P und K) wurde zusätzlich noch die oxygen uptake rate (our) bestimmt, um Korrelationen zwischen Aktivität und Protein, VSS (flüchtige suspendierte Stoffe) sowie TS zu erhalten. In allen Experimenten war die Korrelation zwischen Proteingehalt und der biologischen Aktivität signifikant, während dies bei den Parametern TS und oTS – wenn überhaupt – nur schwach vorhanden war. Eine Korrelation zwischen Gasentstehung und Protein konnte auch bei Anaerobschlämmen nachgewiesen werden. Der Schlammindex (ISV) der untersuchten Schlämme sinkt signifikant mit der Zunahme des Proteingehalts. Eine Messung an Kläranlagen des Ruhrverbands ergab eine Korrelation zwischen Schlammalter und Proteingehalt. Es zeigte sich, dass sich das Verhältnis von Protein zu TS mit zunehmendem Schlammalter zu ungunsten des Proteins verschiebt. Die Arbeit liefert erste brauchbare Hinweise darauf, dass ein neuer Parameter die gewohnten, aber zum Teil aussageschwachen TS bzw. oTS ablösen könnte. Wahrscheinlich werden viele Kläranlagen mit einem zu hohen Schlammalter und einem zu hohen Anteil an nicht aktiver Biomasse im belebten Schlamm betrieben. Wenn der Parameter „Protein“ zum Zuge käme, kann hier sicherlich noch Optimierungspotenzial realisiert werden.
Die interdisziplinär ausgelegte Arbeit wurde im Juni 2010 mit dem Doktorandenpreis des Zentrums für Wasser- und Umweltforschung der Universität Duisburg- Essen ausgezeichnet.
Estimation of Microbial Biomass in
Sequencing Batch Reactor by Determination
of Protein Content of Activated Sludge,
Dissertation von Ergün Yücesoy, M. Sc.
Betreuer: Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dr.-Ing.
habil. Martin Denecke, Fachgebiet
Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft
der Universität Duisburg-
Essen, erschienen im Shaker-Verlag
Aachen, 2010, ISBN 978-3-8322-9110-5
(nach oben)
Einfluss des pH-Werts auf die Nitrifikation
Beim Belebungsverfahren beeinflussen sich der mikrobielle Prozess der Nitrifikation und das Kohlensäuresystem wechselseitig über den pH-Wert. Bei der Nitrifikation entstehen Säuren. Diese senken, wenn sie nicht abgepuffert werden, den pH-Wert. Ein niedriger pH-Wert hemmt wiederum die Nitrifikation. An der Pufferung der entstehenden Säuren hat das Gleichgewichtssystem der Kohlensäure einen entscheidenden Anteil. Es ist das bedeutendste Puffersystem im aquatischen Milieu. Da die Bestandteile des Kohlensäuresystems und der pH-Wert sich wechselseitig beeinflussen, besteht über den pH-Wert ein direkter Zusammenhang zur Nitrifikation.
Für eine stabile Nitrifikation fordern einschlägige Bemessungsgrundlagen leicht alkalische pH-Werte und eine Mindestkonzentration an Säurekapazität von 1,5 mmol/l. Neuere Untersuchungen zeigen, dass es auch bei Säurekapazitäten größer 4 mmol/l zu einem Anlösen der Belebtschlammflocken und zu Störungen der biologischen Stoffwechselprozesse kommen kann, falls der Anteil an überschüssiger freier Kohlensäure entsprechend hoch und der pH-Wert niedrig ist. Das heißt, dass hier Wechselwirkungen zwischen dem Kohlensäuresystem und der Mikrobiologie bestehen, die bislang wenig beachtet werden, jedoch bei der Nitrifikation in pufferschwachem Abwasser von entscheidender Bedeutung sind. Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss des pH-Werts auf den mikrobiellen Prozess der Nitrifikation unter Beachtung der wechselseitigen Wirkung durch das Kohlensäuresystem zu untersuchen. An einer Belebungsanlage im Aufstauverfahren wurden hierzu halbtechnische Untersuchungen mit gezielter Anhebung der Säurekapazität pufferschwachen Abwassers durchgeführt.
Die kontinuierliche Messung der einflussnehmenden Parameter war Voraussetzung für die Auswertungen, die dieser Arbeit zugrunde liegen. Darüber hinaus konnten weitere Fragestellungen hinsichtlich den Absetzeigenschaften und der Flockenstruktur des belebten Schlamms geklärt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur für Regionen mit pufferschwachem Wasser bedeutsam, wie es im Urgestein und im Dünenwasser an den Küsten vorkommt, sondern auch hinsichtlich der Auswirkungen verschiedener Optimierungsprozesse in der Betriebsführung kommunaler Kläranlagen. Durch tiefere Belebungsbecken, effizientere Belüftungssysteme oder den Einsatz von Metallsalzen als Fällmittel werden das Kohlensäuresystem und der pH-Wert negativ beeinflusst.
Die Ergebnisse der Untersuchungen bestätigen die Erkenntnisse, dass bei sinkendem pH-Wert auch die Umsatzgeschwindigkeit der Nitrifikation zurückgeht. Es zeigte sich, dass die Beeinträchtigung der Umsatzgeschwindigkeit infolge des pH-Werts auch von der Pufferungsintensität abhängt. Sie ist umso stärker, je geringer der pH-Wert und je geringer die Pufferungsintensität sind. Zur Beurteilung der Schädigung der Belebtschlammflocken bei einer Säurekapazität größer als 1,5 mmol/l erweist sich der Sättigungsindex als geeignet. Er ist ein Maß für die Einhaltung des Kalk- Kohlensäure-Gleichgewichtes.
Für die Anwendung im Bereich der kommunalen Abwasserreinigung wurden vereinfachte Berechnungsgrundlagen abgeleitet. Eine mögliche Absenkung des pHWerts und die damit einhergehende Beeinträchtigung der Nitrifikation kanndurch eine entsprechende Erhöhung des dimensionslosen Sicherheitsfaktors bei der Berechnung des erforderlichen Bemessungsschlammalters berücksichtigt werden. Dieser ist von der Pufferungsintensität abhängig. Alternativ können auch Maßnahmen ergriffen werden, die ein Absinken des pH-Werts verhindern, wie beispielsweise die Zugabe von Alkalien. Halbtechnische Untersuchungen zum Einfluss des pH-Wertes auf die Nitrifikation beim Belebungsverfahren in Abhängigkeit des Kohlensäuresystems…
Dissertation von Falk Schönherr
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. F. Wolfgang
Günthert (Universität der Bundeswehr
München) und Prof. Dr.-Ing. Matthias
Barjenbruch (TU Berlin).
Die Dissertation
ist erschienen als Heft 101 der Reihe
Mitteilungen des Instituts für Wasserwesen,
Shaker-Verlag, Aachen
ISBN 978-3-8322-8888-4
1061
(nach oben)
Tagungsband: Demografischer Wandel – Herausforderungen für die Wasserwirtschaft
Gemeinschaftstagung 22./23. Juni 2010, Weimar 2010, 188 Seiten, 79 Bilder, 9 Tabellen, broschiert, DIN A5, ISBN 978-3-941897-33-5
Einzelpreis: EUR 52,00 / Preis für fördernde Mitglieder: EUR 41,60
Demografische Entwicklungen und ihre möglichen Folgen gewinnen für Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Gerade die Wasserwirtschaft entscheidet und plant in Zeithorizonten, die durchaus Spannen von mehreren Generationen umfassen können. Neubau-, Umbau- oder Sanierungsplanungen technischer Anlagen müssen flexibel gestaltet werden. Dort, wo es die demografische Entwicklung zulässt, ist die langfristige Weiternutzung der vorhandenen Anlagen die wirtschaftlichste Alternative. Wie die Prognosen zeigen, wird dies nicht überall eine tragfähige Lösung sein. Die Tagung zeigt die Herausforderungen des demografischen Wandels, sowohl im technischen Bereich als auch bei der Gestaltung der Finanzierung. Anhand konkreter Projekte werden Möglichkeiten gezeigt, wie auf die sich verändernden demografischen Randbedingungen angemessen reagiert werden kann. Mehr:
http://www.dwa.de/dwa/shop/shop.nsf/Produktanzeige?openform&produktid=P-DWAA-89K7AZ&navindex=2
(nach oben)
Demografischer Wandel als Herausforderung für die Sicherung und Entwicklung einer kosten- und ressourceneffizienten Abwasserinfrastruktur
KURZFASSUNG
Hintergrund
Der demografische Wandel wird in Deutschland zu einem deutlichen Rückgang der
Bevölkerungszahlen führen. Dabei werden sich die Bevölkerungszahlen sowohl regional
als auch lokal sehr unterschiedlich entwickeln. Die großen, bereits seit den 1990er
Jahren bestehenden Unterschiede in der Entwicklung im Osten und im Westen
Deutschlands werden bestehen bleiben. Gleichzeitig werden in enger räumlicher
Nachbarschaft Wachstums- und Schrumpfungsprozesse stattfinden. Für die raumbezogenen
technischen Infrastrukturen wie Wasser, Abwasser oder Fernwärme bedeutet
diese Entwicklung Anpassungsbedarf vor dem Hintergrund, dass die Effizienz dieser
Infrastrukturen maßgeblich von der Bevölkerungsdichte abhängt und dass bei abnehmenden
Nutzerzahlen zusätzliche technische Veränderungen aufgrund betrieblicher
Probleme notwendig werden können.
Aufgrund der sehr langen Nutzungsdauer wichtiger Komponenten konventioneller Abwasserinfrastruktursysteme
(Kanäle bis zu 100 Jahre), verbunden mit hohen Investitions-
und Unterhaltungskosten, sind weit vorausschauende Planungen und die langfristige
Berücksichtigung aller sich verändernden Umfeldbedingungen notwendig.
Relevanz des demografischen Wandels für die Abwasserinfrastruktur
und Identifizierung besonders betroffener Gebiete
Die demografischen Entwicklungen interferieren mit Veränderungen sonstiger Randbedingungen
von Abwasserinfrastruktursystemen. Hierzu zählen klimatische Veränderungen,
die Entwicklung des Trinkwasserverbrauchs sowie sich verändernde Siedlungsstrukturen
und Nutzerdichten der Abwasserinfrastruktursysteme. Naturräumliche
Gegebenheiten wie die Topografie gehören ebenso dazu.
Zur Beurteilung der Auswirkungen demografischer Veränderungen auf die Abwasserinfrastruktur
und zur Überlagerung mit den genannten interferierenden Randbedingungen
wurde eine demografische Typisierung der Kreise und kreisfreien Städte des Bundesgebietes
erarbeitet. Die auf Basis der vergangenen und zukünftigen Entwicklung
der Bevölkerungszahlen in 12 Typen (6 Haupttypen jeweils für alte Bundesländer und
neue Bundesländer) eingeteilten Kreise und kreisfreien Städte wurden hinsichtlich ihrer
Siedlungsdichte, der Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche, der Entwicklung
des Wasserverbrauchs, klimatischer Veränderungen und topografischer Randbedin2
gungen sowie der Auslastung der Abwasserbehandlungsanlagen charakterisiert. Danach
lassen sich für Deutschland Parameterkonstellationen und teilweise auch –
ausprägungen aufzeigen, die sich problematisch auf die Abwasserinfrastruktur auswirken
bzw. zukünftig auswirken könnten. Damit wurde eine Grundlage zur Beurteilung
von Verbreitung und Intensität von Problemgebieten erarbeitet und grafisch aufbereitet,
die eine erste Beurteilung des potenziellen zukünftigen Handlungsbedarfs im Bereich
der Abwasserinfrastruktur…mehr:
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-k/k3779.pdf
Nr. 36/2010
UBA-FBNr: 001386
Förderkennzeichen: 3708 16 305
Herausgeber:
Umweltbundesamt
Postfach 14 06
06813 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/2103-0
Telefax: 0340/2103 2285
E-Mail: info@umweltbundesamt.de
Internet: http://www.umweltbundesamt.de
Redaktion: Fachgebiet III 2.5 Überwachungsverfahren, Abwasserentsorgung
Christine Galander
(nach oben)
Abflüsse aus extremen Niederschlägen
Ergebnisse einer Bestandsaufnahme: Hochwasserereignisse und Modellansätze zu ihrer Abbildung
Juli 2010, 38 Seiten, 5 Tabellen, 4 Anhänge, DIN A4, ISBN 978-3-941897-30-4
Einzelpreis: EUR 38,00 / Preis für fördernde Mitglieder: EUR 30,40
Für die Ermittlung extremer Abflüsse aus extremen Niederschlägen mit Wiederkehrintervallen von über 100 Jahren fehlt Wissen über die Verbindung extremer Niederschlagsdargebote mit realistischen Abfluss-Szenarien. In dem vorliegenden Themenband werden auf der Basis einer umfassenden Befragung einschlägig tätiger Institutionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz praxisnahe Lösungsansätze für Bemessungsfragen in extremen Abflussbereichen zusammengestellt. Das Umfrageergebnis gibt einen Überblick über die Modellvielfalt mit ihren unterschiedlichen Einsatzgebieten, wobei die jeweilige Modelltechnik kurz dargestellt wird. Den interessierten Fachleuten in Behörden, Büros und Verbänden wird hiermit eine wertfreie Darstellung der Verfahren an die Hand gegeben, die als Informationsquelle für weitergehende Fragestellungen dient.
Bestellservice für Abonnenten der DWA-Themen auf CD-ROM
Abonnenten der DWA-Themen auf CD-ROM können Neuerscheinungen auch zwischen den Update-Lieferungen ohne Zusatzkosten beziehen. Dieser Link führt zu einem E-Mail-Formular, mit dem Sie die neuen DWA-Themen bestellen können. Bitte füllen Sie das Formular aus. Sie erhalten nach Prüfung Ihrer Berechtigung ein Passwort, mit dem Sie die seit Erhalt der letzten Update CD-ROM mit Stand Mai 2010 herausgegebenen Neuerscheinungen der DWA-Themen herunterladen können. Die Bezahlung erfolgt im Rahmen der nächsten regulären Update-Lieferung.
Quelle: www.dwa.de
(nach oben)
Tagungsband zum Symposium Aktivkohle erhältlich
Mit rund 200 Teilnehmern fand am 23. und 24. Juni 2010 in Mannheim das Symposium „Aktivkohle in der Abwasserreinigung“ statt. An der vom DWA-Landesverband Baden-Würt temberg in Kooperation mit der Hochschule Biberach und dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg angebotenen Veranstaltung nahmen Fachleute aus dem ganzen deutschsprachigem Raum sowie aus Luxemburg und den Niederlanden teil, um sich über die Anwendung von Aktivkohle in der kommunalen Abwasserbehandlung im großtechnischen Maßstab zu informieren und auszutauschen. Der Tagungsband, der auf 170 Seiten alle Fachbeiträge des Symposiums zusammenstellt, ist für 25,00 Euro (zuzüglich Versandkosten) erhältlich.
Zu beziehen über:
DWA-Landesverband Baden-Württemberg
Rennstraße 8, 70499 Stuttgart
Tel. (07 11) 89 66 31-0, Fax 89 66 31-111
E-Mail: info@dwa-bw.de
www.dwa-bw.de
(nach oben)
Niederschlagswasserbehandlung
Dissertationen/Habilitationen an der TU München
Dr. Brigitte Helmreich hat am 10. Februar 2010 ihr Habilitationsverfahren im Bereich Siedlungswasserwirtschaft an der TU München abgeschlossen. Die Habilitationsschrift zum Thema „Stoffliche Betrachtungen der dezentralen Niederschlagswasserbehandlung“ stellt die Ergebnisse der Forschungsarbeiten der von ihr geleiteten Arbeitsgruppe zusammen. Sie stellt damit ein Werk zur physikalisch-chemischen Behandlung von Regenwässern von Dach- und Straßenflächen zur Verfügung, dass einerseits die Herkunft und Dynamik des Schadstoff eintrags beschreibt und andererseits die zugrundeliegenden Prozesse in den Behandlungsanlagen abbildet. Das Hauptaugenmerk lag auf der stofflichen Belastung der Regenwasserabflüsse mit Schwermetallen auf der einen Seite und organischen Schadstoffen aus dem Bereich Verkehr auf der anderen Seite. Neben einer fundamentalen Betrachtung der Sorptions- und Austauschvorgänge an verschiedensten Materialien wird auch die technische Umsetzung von Behandlungsanlagen zur Reinigung von Niederschlagsabflüssen abgedeckt. Die Forschungsarbeiten wurden zum weitaus größten Teil aus Drittmitteln finanziert, die beim Freistaat Bayern, der DBU, der DFG und der Oswald-Schulze- Stiftung eingeworben wurden. Im Laufe der letzten drei Jahre wurden in diesem Bereich drei Promotionen erfolgreich abgeschlossen (Dr.-Ing. Konstantinos Athanasiadis, Dr. Alexander Schriewer, Dr.-Ing. Rita Hilliges). Die Vorgehensweise zur Entwicklung von Behandlungsanlagen für Niederschlagsabflüsse erfolgte dabei systematisch: Qualitative und quantitative Erfassung der Quellen, Verständnis des Reinigungsprozesses und technische Umsetzung auf der Basis der vorangegangenen Schritte. Im Besonderen die Umsetzung der im Labor erzielten Eliminationsleistung in eine technische Anlage (das verfahrenstechnische Scale-up) ist hierbei nicht zu gering einzuschätzen und ist nur dann erfolgreich, wenn die einzelnen Prozesse gut verstanden wurden. Ein wichtiger Aspekt für die Auslegung von Behandlungsanlagen ist der sogenannte First-Flush-Effekt. In den 1980er-Jahren wurde davon ausgegangen, dass ein wesentlicher Teil der Schmutzfracht in den ersten Minuten von den befestigten Flächen herunter gespült wird. Da es sich bei den Abschwemmungen von Metalldächern im Wesentlichen um Korrosionsprodukte handelt, wäre dies auch zu erwarten. Tatsächlich wurde in der Arbeitsgruppe von Brigitte Helmreich festgestellt, dass nur bei älteren Metalldächern und längeren Trockenperioden tendenziell ein solcher Effekt messbar ist. Für die Auslegung der Behandlungsanlagen hat dies keine Auswirkungen, da der Effekt nicht signifikant ist, also der gesamte Abfluss behandelt werden muss. Von Verkehrsflächen sind neben einigen Schwermetallen auch organische Schadstoffe und relativ hohe organische Schmutzfrachten zu erwarten. Diese erfordern eine andere Form der Behandlung. Darüber hinaus ist die Belastungssituation bei Niederschlagsabflüssen von Straßenflächen von anderen Faktoren abhängig. Die Verkehrsdichte schien lange Zeit eine wichtige Größe zur Abschätzung der Schmutzfracht von Verkehrsflächen. Die detaillierten Untersuchungen in der Arbeitsgruppe von Brigitte Helmreich zeigen, dass dieser Ansatz zu kurz greift. Offensichtlich wird ein Großteil der Schadstoffe bei Bremsvorgängen freigesetzt, die in der Regel verstärkt an Ampelanlagen oder bekannten Staustellen auftreten. Auch hängt die Belastung der Niederschlagsabflüsse von den Straßenreinigungsintervallen ab. Dies ist damit zu erklären, dass zum Beispiel bei den Schwermetallen der weitaus größte Teil der Fracht partikulär gebunden ist. Die Belastung der Niederschlagsabflüsse mit organischen Schmutzstoffen und speziell mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen ist nicht unerheblich. Die größere Bandbreite der möglichen Schmutzstoffe im Vergleich zu Dachflächenabflüssen stellt eine höhere Anforderung an die Behandlungsanlage, dies wurde im Labormaßstab intensiv untersucht. Daher sind für die Behandlung von Straßenabläufen reine Ionenaustauschmaterialien ungeeignet, da auch die organischen Bestandteile entfernt werden müssen. Hierfür wurden ebenfalls im Labormaßstab verschiedene Materialien getestet. Tonmaterialien haben sich, ebenso wie verschiedene Oxide, Hydroxide und Biosorbentien, als weitestgehend ungeeignet herausgestellt. Der beste Erfolg kann im Hinblick auf die Behandlung von Niederschlagsabflüssen mit Kohlematerialien erzielt werden. Die getestete Braunkohle liefert sowohl bei der Entfernung von Schwermetallen als auch bei den organischen Komponenten sehr gute Ergebnisse. Dies konnte an einer Pilotanlage am Mittleren Ring in München sehr gut gezeigt werden. An dieser Pilotanlage hat sich jedoch gezeigt, dass ein erheblicher Teil der partikelgebundenen Schwermetallfracht bereits in einer speziellen Entwässerungsrinne abgetrennt wird und gar nicht erst in die eigentliche Behandlungsanlage mit dem Braunkohlenkoks gelangt. Alle Untersuchungen zur Adsorption von Schadstoffen wurden im Labor detailliert abgebildet. Abschließend werden im letzten Kapitel der vorgelegten Habilitationsschrift die Scaleup- Probleme dargestellt und diskutiert. In diesem Abschnitt werden deutlich die verschiedenen Aspekte des Up-Scalings herausgearbeitet. Dies ist vor allen Dingen deswegen möglich, weil die Arbeitsgruppe in den letzten Jahren eine Vielzahl von Pilotanlagen realisiert hat. Stoffliche Betrachtungen der dezentralen Niederschlagswasserbehandlung, Habilitationsschrift von Dr. Brigitte Helmreich, erschienen als
Band 199 der Berichte aus der Siedlungswasserwirtschaft,
TU München
ISSN 0942-914X (38,00 €,
Tel. (089) 289-1 37 00
Fax 289-1 37 18
E-Mail: wga@bv.tum.de
Quelle: DWA
(nach oben)
Leitfaden zur Herausbildung leistungsstarker kommunaler und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen der Wasserver- und Abwasserentsorgung
EINFÜHRUNG
Eine funktionierende Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind wesentliche
Bestandteile der Infrastruktur, ohne welche eine gesunde Wirtschaft als Voraussetzung
für sozialen Frieden und Umweltschutz nicht möglich wäre.
Die enorme Bedeutung, welche ein gut funktionierender Wassersektor für die
Volkswirtschaft und Volksgesundheit hat, ist vor allem dort sichtbar, wo es Probleme
gibt. Dramatisch sind die Verhältnisse in manchen Entwicklungs- und Transformationsländern
erfahren, die mit Wassernot und Seuchen kämpfen (vgl. Kapitel 5). In
Deutschland haben die Wasserunternehmen zweifellos einen hohen technischen Leistungsstand
erreicht. Dies gilt für die Zuverlässigkeit und Qualität der Wasserversorgung
im laufenden Betrieb, aber auch hinsichtlich der Anschlussquoten an ordnungsgemäß
betriebene Abwasserbehandlungsanlagen mit hohem Reinigungsgrad.
Gleichwohl müssen sich die Wasserunternehmen entsprechend den sich ändernden
Rahmenbedingungen weiterentwickeln, um die Zukunftsfähigkeit der Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung auch unter wirtschaftlichen Aspekten nachhaltig zu
sichern.
In Deutschland obliegt es den Kommunen, über die Organisation der Wasserve rsorgung
und Abwasserentsorgung zu entscheiden. Es gibt eine Vielzahl an organisatorischen
Konzepten und technischen Lösungen, die den jeweiligen örtlichen Bedingungen
gemäß entstanden sind. Diese Konzepte und Lösungen müssen zukunftsorientiert und
fallspezifisch weiterentwickelt bzw. modernisiert werden.
Ein besonderes Anliegen des vorliegenden Leitfadens für Wasserunternehmen ist
es, Lösungsalternativen und Lösungsansätze mit Praxisbeispielen darzustellen, welche
kommunalen Gesellschaftern bzw. ihren Wasserunternehmen im Zusammenhang mit
einer zukunftsorientierten Unternehmensentwicklung und einer sinnvollen Modernisierungsstrategie
zu behandeln sind. Der Leitfaden richtet sich darüber hinaus an alle, die
mit der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in diesem Sinne befasst
sind.
Neben einer kurzen Darstellung des Status Quo …mehr unter:
http://www.publicgovernance.de/pdf/PGI_wasserleitfaden_bmwa_juli05.pdf Nr. 547
(nach oben)
Faltblatt zu fluorhaltigen Löschmitteln
„Fluorhaltige Schaumlöschmittel umweltschonend einsetzen“ lautet der Titel eines Faltblatts des Deutschen Feuerwehrverbands, des Bundesverbands Technischer Brandschutz und des Umweltbundesamts.
http://bit.ly/93sCRU
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3956.pdf
Quelle: http://www.dwa.de/portale/dwa_master/dwa_master.nsf/home?readform&objectid=0FB23AC453591E12C12573C500445187
(nach oben)
Gutachten zur Hygienisierung von Klärschlämmen erschienen
Klärschlämme können eine Vielzahl von Krankheitserregern enthalten. Trotzdem gibt es bei der Verwertung von Klärschlämmen in der Landwirtschaft noch keine Hygieneanforderungen. Das am 8. Juni 2010 veröffentlichte Gutachten „Anforderungen an die Novellierung der Klärschlammverordnung unter besonderer Berücksichtigung von Hygieneparametern“ dokumentiert den aktuellen Wissensstand und zeigt Möglichkeiten für die Einführung strengerer Hygienevorschriften bei der bevorstehenden Novellierung der Klärschlammverordnung auf. Das Gutachten wurde im Auftrag des Umweltbundesamts von Mitarbeitern des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL, Darmstadt) und des Ingenieurbüros iat (Stuttgart und Darmstadt) erarbeitet. Es steht im Internet zum kostenlosen Download bereit:
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3742.pdf
Quelle: http://www.dwa.de/portale/dwa_master/dwa_master.nsf/home?readform&objectid=0FB23AC453591E12C12573C500445187
(nach oben)
Ingolstadt: Innovative Rechengutbehandlung auf der ZKA
70 % weniger Kosten für die Rechengutentsorgung
Sehr oft wird heutzutage über Nachhaltigkeit, Kostensenkung und neuen Innovationen nachgedacht und gesprochen. Die Realität zeigt jedoch, dass es leider sehr häufig beim Nachdenken und Sprechen bleibt. Nicht so bei der Zentralkläranlage Ingolstadt, die nicht nur über Einsparpotenziale gesprochen hat, sondern auch das Kostenmonster an der Wurzel packte.
Die ZKA Ingolstadt, mit einer Ausbaugröße von 235.000 EW, befasste sich bereits im Jahre 2000 sehr intensiv mit Rechengut. Die Ingolstädter, die ihr Rechengut in die benachbarte MVA liefern und bis Mitte 2001 mit einfachen Schneckenwaschpressen ihr Rechengut behandelten, erkannten hier ein hohes Einsparpotenzial. Natürlich sollte neben dem Ziel der Rechengutreduktion das Material auch sehr gut ausgewaschen werden, so dass die Fäkal- und suspendierbaren, organischen Stoffe der Kläranlage als Kohlenstoffquelle weiter zur Verfügung stehen. Kohlenstoff erst teuer zu verbrennen, der dann in der Denitrifikationszone nicht mehr genutzt werden kann, macht keinen Sinn, so Rudolf Beck, der Leiter der Verfahrenstechnik in der ZKA Ingolstadt.
Nach diversen, lang angelegten Versuchen mit unterschiedlichen Wettbewerbern und auf Grund der Ausschreibungsergebnisse entschied sich die Geschäftsleitung der ZKA Ingolstadt für zwei HUBER Hochdruckintensivwaschpressen vom Typ WAP/SL/HP. Das gesamte Rechengut von zwei 40 mm Grobrechen, zwei 8 mm Feinrechen im Hauptgerinne und zwei 6 mm Stufenrechen im Entlastungsgerinne wird mittels diverser Schneckenförderer zusammengefasst und punktgenau über den beiden Waschpressen in einen großen Einwurftrichter abgeworfen. Eine automatische Klappe im Trichter portioniert das Rechengut dabei entsprechend auf die jeweilige Waschpresse.
Im Waschtrichter wird das Rechengut einem zielgerichteten, energiereichen Waschwasserstrom ausgesetzt, welcher durch ein Pumpenlaufrad erzeugt wird. Je nach Dauer des Waschvorganges erhöht sich die mechanische Beanspruchung des Rechengutes, sodass ein vollständiger Auswaschgrad bereits nach sehr kurzer Zeit erreicht wird. Nach dem Waschen wird das Rechengut in eine in die Anlage integrierte Presszone gefördert. Dort wird das Rechengut mittels einer robusten Pressschnecke und einer hydraulisch geregelten Hochdruckpresszone auf einen sehr hohen TR-Gehalt entwässert. Das gewaschene Produkt erreicht dabei einen Trockenrückstand [TR] von > 50 %.
Ergebnisse
Seit Inbetriebnahme werden durch die hervorragende Intensivwäsche und der integrierten Hochdruckpressung konstant hohe TR-Werte erzielt. Dadurch wird eine Gewichtsreduktion der Rechengutmenge, wie in Abbildung 1 ersichtlich, erreicht. Durch die intelligente Niveauführung im Waschtrichter wird dabei immer die gleiche Rechengutmenge gewaschen. Unnötige Waschzyklen mit wenig Material sind dadurch nicht möglich.
Fazit
Durch die hohe Gewichtsreduktion des zu entsorgenden Rechengutes wurden die Entsorgungskosten im Zeitraum 2000 bis 2006 um ca. 70% reduziert Mit der Investition …mehr:
http://www.huber.de/de
(nach oben)
Leitfaden zur Abwärmenutzung in Kommunen
Der Leitfaden beschreibt die Vorgehensweise und Identifizierung von Abwärmequellen und Abwärmenutzern.
Mehr unter:
http://www.lfu.bayern.de/luft/fachinformationen/co2_minderung/doc/leitfaden_abwaermenutzung.pdf
(nach oben)
Nordrhein-Westfalen: Broschüre zu Dichtheitsprüfungen
Das Umweltministerium Nordrhein-Westfalen hat eine neue Broschüre zur Prüfung von Abwasserleitungen herausgegeben. Sie informiert vor allem Hausbesitzer über die Pflicht, die Leitungen regelmäßig auf Dichtheit zu kontrollieren. Die Broschüre „Dichtheitsprüfungen privater Abwasserleitungen“ gibt viele Tipps, wie unzugängliche Rohre untersucht werden können und wer die Prüfung vornehmen kann. Zudem informiert sie über Fristen, Kosten und das weitere Vorgehen bei defekten Rohren.
www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse100228.php
(nach oben)
Wärmeverbund Ingolstadt
Mit dem Projekt „Wärmeverbund Ingolstadt“ soll untersucht werden, ob und ggf. wie Abwärmeströme von Produktionsbetrieben ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll zur Deckung des Wärmebedarfes anderer Industriebetriebe und ggf. sonstiger Wärmeverbraucher genutzt werden können.
Unter den nachfolgenden Links finden Sie weitere Infos:
http://www.lfu.bayern.de/luft/forschung_und_projekte/waermeverbund_in/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/luft/fachinformationen/co2_minderung/doc/waermeverbund_ingolstadt_detailstudie.pdf
(nach oben)
München :Informationen zum Dichtheitsnachweis privater Grundstücksentwässerungen
Aufgrund der vielen Anfragen zum Thema Dichtheitsnachweis privater Grundstücksentwässerungsanlagen sind dazu ab sofort zwei Informationsbroschüren der Münchner Stadtentwässerung erhältlich. Die Faltblätter „Wiederkehrende Dichtheitsprüfung und Sanierung von bestehenden Grundstücksentwässerungsanlagen“ und „Dichtheits-nachweis bei bestehenden Grundstücksentwässerungsanlagen – weitere Informationen für den Normalfall“ sind in der Stadt-Information im Rathaus oder an der Infotheke im Technischen Rathaus (Friedenstraße 40, 81671 München) erhältlich. Außerdem stehen sie unter www.muenchen.de/mse zum Download zur Verfügung.
Quelle: http://www.muenchen.de/Rathaus/bau/wir/mse/presse/271023/presse_02.html
(nach oben)
Die vier umwelttechnischen Berufe – Titel Vier Mal berufliche Zukunft
Ausgabe: 02 2010
Verlag: DWA
Format: A 4
Seitenzahl: 24
Preis: 1,50 €
Die neu erschienene Broschüre „Die vier umwelttechnischen Berufe – Vier mal berufliche Zukunft“ löst die alte Broschüre „Nix für Dumme“ ab.
(nach oben)
Studie „Nanotechnologie für den Umweltschutz“
Eine neu aufgelegte und aktualisierte Studie des Fraunhofer IAO, die im Auftrag des Hessischen Wirtschaftsministeriums erstellt wurde, zeigt die Innovationspotenziale der Nanotechnologie für Umwelttechnologien auf. Unternehmen bietet die Broschüre praktische Ansatzpunkte für einen Technologietransfer sowie eine Auflistung der wichtigsten Kontakte.
Die Nanotechnologie eröffnet Innovationspotenziale für viele zukunftsträchtige Anwendungsbereiche. Auch die Umwelttechnologien profitieren von Innovationen aufgrund der Eigenschaften von Nanomaterialien. Beispielweise durch neuartige Sensoren, verbesserte Reinigungssysteme oder durch die Einsparung wertvoller Ressourcen: Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.
Praktische Beispiele für diese Potenziale hat das Fraunhofer IAO in Zusammenarbeit mit den Aktionslinien Hessen-Umwelttech und Hessen-Nanotech des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in der aktualisierten und neu aufgelegten Broschüre „Einsatz von Nanotechnologie in der hessischen Umwelttechnologie – Innovationspotenziale für Unternehmen“ zusammengefasst. Darin werden die technischen Grundlagen der Nanotechnologie erläutert und konkrete Beispiele und Anwendungsgebiete innerhalb der Umwelttechnologien beleuchtet. Ob in der Katalyse, der Sensorik oder in der Wasseraufbereitung – die interessanten Oberflächen- und Funktionseigenschaften nanoskaliger Materialien ermöglichen die Entwicklung von neuen, innovativen Produkten und Verfahren. Umweltschutz kann dadurch noch besser und wirtschaftlicher werden. Für die Nanotechnologie ergeben sich marktnahe Anwendungen, die in der Broschüre vorgestellt werden.
Für Unternehmen bietet die Broschüre praktische Ansatzpunkte für einen Technologietransfer sowie eine Auflistung der wichtigsten Kontakte und Adressen. Vor allem erhalten aber auch die Entwickler und Anbieter aus dem Bereich der Nanotechnologie eine Übersicht über interessante Anwendungsfelder der Technologie und Vorprodukte der Umwelttechnik.
Die Broschüre kann kostenlos entweder im IAO-Shop unter https://shop.iao.fraunhofer.de oder direkt bei der Aktionslinie Hessen-Nanotech als Printversion bestellt bzw. als vollständige PDF-Version unter http://www.hessen-nanotech.de/veroeffentlichungen bezogen werden.
Ihr Ansprechpartner:
Fraunhofer IAO
Dr. Daniel Heubach
Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart
Telefon +49 711 970-2354
Fax +49 711 970-2287
daniel.heubach@iao.fraunhofer.de
Claudia Garád, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO
(nach oben)
Tagungsband: WasserWirtschafts-Kurse N/2
Kommunale Abwasserbehandlung
Oktober 2009 in Kassel, 454 Seiten, 152 Abbildungen, 57 Tabellen, broschiert, DIN A5
ISBN 978-3-941089-96-9
Einzelpreis: EUR 52,00 / Preis für fördernde DWA-Mitglieder: EUR 41,60
Der Tagungsband enthält sowohl die neuesten Bemessungsgrundlagen für den Neu- und Umbau von kommunalen Kläranlagen als auch Beiträge für den Betrieb und die Instandhaltung bestehender Anlagen. Ausgehend von der für eine wirtschaftliche Lösung notwendigen Grundlagenermittlung werden die Teilprozesse der mechanischen und biologischen Abwasserbehandlung ausführlich behandelt. Auf verschiedene Varianten, Verfahren und Ausrüstung der Anlagen wird anschließend eingegangen. Auswirkungen der Prozessbelastung, der Einsatz der Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie die dynamische Simulation runden den Inhalt des Kurses ab. Sowohl auf technische als auch betriebliche Lösung von Problemen (z. B. Bläh- und Schwimmschlamm, u. a.) wird eingegangen.
Weitere Informationen und Bestellung:
http://www.dwa.de/
(nach oben)
Retentionsbodenfilter zur Mischwasserbehandlung. Untersuchung von Sandsubstraten und Betriebsweisen
Uhl, Mathias; Jübner, Matthias;
In Retentionsbodenfiltern werden seit einigen Jahren fast ausschließlich Sandsubstrate eingesetzt. Der Artikel beschreibt Untersuchungsergebnisse zur Reinigungsleistung von Sandsubstraten der Körnungen 0/2 mm und 0/4 mm mit unterschiedlichen Carbonatgehalten, Kornformen und Aufenthaltszeiten. Eine Körnung 0/2 mm mit hoher spezifischer Oberfläche und ausreichender Durchlässigkeit ist eine günstige Basis für hohe Reinigungsleistungen. Durch eine Drosselung des Filterablaufes lässt sich auch bei gröberen Substraten die Aufenthaltsdauer verlängern und somit die Reinigungsleistung deutlich erhöhen und stabilisieren. Die Adsorption von Ammonium wird durch hohe Carbonatgehalte langfristig begünstigt. Für die Adsorption von Phosphor sind ausreichende Eisenoxidgehalte im Substrat eine Mindestvoraussetzung.
Artikel aus der Zeitschrift: KA ABWASSER ABFALL
ISSN: 1616-430X
Jg.: 51, Nr.3, 2004
Seite 261-270, Abb.,Tab.,Lit.
Standort in der IRB-Bibliothek: IRB Z 1958
EUR 4.00 (* inkl. MwSt.)
Quelle: http://www.baufachinformation.de/zeitschriftenartikel.jsp?z=2004039011708
(nach oben)
Tagungsband: Industrietage – Wassertechnik
Management und Behandlung industrieller Prozess- und Abwässer
Gemeinschaftsveranstaltung am 30.11./01.12.2009 in Fulda
2009, 382 Seiten, 163 Abbildungen, 54 Tabellen, broschiert, DIN A5
ISBN 978-3-941089-99-0
Einzelpreis: EUR 52,00 / Preis für fördernde DWA-Mitglieder: EUR 41,60
Die Vorträge beschäftigen sich mit stofflichen Abwasserbelastungen aus der Industrie und mit der Energierückgewinnung. Von den stofflichen Belastungen werden insbesondere prioritäre Stoffe, schwerabbaubare Stoffe, Spurenstoffe, Mikroverunreinigungen und Industriechemikalien behandelt. Die Schwerpunkte liegen bei produktionsintegrierten Ansätzen zur Abwasserverminderung und -vermeidung in Verbindung mit neuen Entwicklungstrends in der Prozess- und Behandlungstechnik, dem Stoffstrommanagement und der Energierückgewinnung.
Eine weitere Problematik stellen Abwässer mit hohen Salzgehalten dar. Die Möglichkeiten und Grenzen der biologischen Behandlung sind Gegenstand einiger Beiträge dieses Buches. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und im Sinne einer Ressourcen schonenden, kosteneffizienten Produktion gewinnen Fragen der Energierückgewinnung im Rahmen der industriellen Fertigung sowie der Industrieabwasserbehandlung zunehmend an Bedeutung. Verschiedene Konzepte aus der Praxis zum Energierecycling werden im Tagungsband vorgestellt.
Quelle: http://www.dwa.de/
(nach oben)
Schlammbettreaktoren zur nachgeschalteten Denitrifikation
In der Dissertation von Jörn Einfeldt wurden
das Betriebsverhalten und die Leistungsfähigkeit
von Schlammbettreaktoren
zur nachgeschalteten Denitrifikation
untersucht. Im Ergebnis wurde anhand
von Laboruntersuchungen, großtechnischen
Messungen und der mathematischen
Modellierung mit einem geringfügig
modifizierten ASM3 (Activated
Sludge Model No. 3) für dieses Verfahren
ein Bemessungsansatz aufgestellt. Außerdem
ist es mit den erarbeiteten
Grundlagen nun möglich, das Verfahren
gezielt hinsichtlich Leistung und Substrateinsatz
zu optimieren.
Ein wichtiges Element in der biologischen
Abwasserreinigung ist die Stickstoffelimination,
bestehend aus den Teilschritten
Nitrifikation und Denitrifikation.
Für die Denitrifikation ist ausreichend
verfügbares Substrat verfahrenstechnisch
zur Verfügung zu stellen. Das
kostengünstigste Substrat für die Denitrifikation
von Nitrat sind normalerweise
die im Rohabwasser enthaltenen Kohlenstoffverbindungen.
Um das gebildete Nitrat
mit Rohabwasser in Kontakt zu bringen
und dieses Substrat für die Denitrifikation
zu nutzen, existiert bereits eine
Reihe bewährter Verfahren mit Kreislaufoder
Kaskadenführung des Abwasserstroms
oder mit zeitabhängigen Steuerungsmechanismen.
Unter besonderen
räumlichen Randbedingungen oder im
Zuge der Erweiterung bestehender Anlagen
kann es jedoch ein Vorteil sein, zusätzliche
Verfahrensstufen einzuführen,
die sich unabhängig vom übrigen Verfahren
modular ergänzen und optimieren
lassen, so dass an den vorhandenen, zum
Teil komplexen Verfahrensführungen keine
größeren Modifikationen vorgenommen
werden müssen. Hierzu zählt das
Verfahren der nachgeschalteten Denitrifikation.
Bei allen Varianten zur nachgeschalteten
Denitrifikation ist die Zugabe einer
internen oder externen Kohlenstoffquelle
erforderlich. Bei internen Kohlenstoffquellen
wie Rohabwasser, Primär- oder
Überschussschlamm haben die Schwankungen
der Substratqualität …
Den ganzen Artikel lesen Sie In der Korrespondenz Abwasser Heft 12-2009 ab Seite1280
Schlammbettreaktoren zur nachgeschalteten
Denitrifikation:
Bemessung, Betrieb und Modellierung
Dissertation von Jörn Einfeldt
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Ralf Otterpohl
Institut für Abwasserwirtschaft und
Gewässerschutz der TU Hamburg-Harburg
erschienen als Band 65 der Hamburger
Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft
30 Euro, ISBN 978-3-930400-39-3
Gesellschaft zur Förderung und
Entwicklung der Umwelttechnologien an
der Technischen Universität Hamburg-
Harburg e. V. (GFEU), Hamburg, 2008
kostenloser Download:
www.tu-harburg.de/aww/publikationen/
pdf/diss/Dissertation-Joern-Einfeldt-
TUHH-AWW-Band-65.pdf
(nach oben)
Nachbetrachtung DWA-Landesverbandstagung 2009 in Baden-Baden
Am 22. und 23. Oktober 2009 fand in Baden-Baden die gemeinsame Tagung des DWA-Landesverbandes Baden-Württemberg und des Wasserwirtschaftsverbandes Baden-Württemberg (WBW) statt. Ein sehr umfangreiches und vielseitiges Programmangebot gab den mehr als 620 Teilnehmern die Möglichkeit, sich über die aktuellsten Entwicklungen der Wasserwirtschaft im Südwesten Deutschlands zu informieren. Parallel zur zeitweise zweizügigen Fachtagung hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, eine mit 110 Ausstellern ebenfalls sehr umfangreiche Industrieausstellung sowie ein Ausstellerforum zu besuchen. Abgerundet wurde die Tagung durch die Mitgliederversammlung des Landesverbandes, das Studentenforum und zwei Fachexkursionen.
Der Tagungsband mit 423 Seiten kann zum Preis von € 10,00 zzgl. Versandkosten beim DWA-Landesverband Baden-Württemberg schriftlich bestellt werden.
Kontakt:
DWA-Landesverband Baden-Württemberg
Rennstr. 8, 70499 Stuttgart
Tel.: 0711 89 66 31-0, Fax: 0711 89 66 31-11
E-Mail: info@dwa-bw.de
http://www.dwa.de
(nach oben)
Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung Heft 26.09
Hydrologische Systeme im Wandel
Beiträge zum Tag der Hydrologie am 26./27. März 2009 in Kiel
Herausgeber: Nicola Fohrer, Britta Schmalz, Georg Hörmann, Katrin Bieger
2009, 196 Seiten, 85 Abbildungen, 14 Tabellen, 4 Figuren, broschiert, DIN A4, mit Poster-CD
ISBN 978-3-941089-54-9
Einzelpreis: EUR 48,00 / Mitglieder der FgHW: EUR 38,40
Preis der digitalen Fassung auf CD-ROM:
Einzelpreis: EUR 29,00 / Mitglieder der FgHW: EUR 23,20
Globaler und regionaler Klima- und Landnutzungswandel beeinflussen nachhaltig das Verhalten hydrologischer Systeme. Durch die enge Kopplung mit dem Wasserkreislauf sind sowohl die Wassermenge und -qualität als auch die ökologischen Verhältnisse großflächig und langfristig davon betroffen. Die Herausforderung von Forschung und Praxis besteht daher darin, sowohl neue Werkzeuge und Methoden zur Erfassung des hydrologischen Wandels zu liefern als auch nachhaltige Konzepte zum Umgang mit dessen Auswirkungen abzuleiten. Der Tagungsband enthält insgesamt 26 Beiträge zu den Themen Methoden zur Erfassung und Analyse des hydrologischen Wandels, Auswirkungen des hydrologischen Wandels auf Wassermenge und -qualität, wasserwirtschaftliche Anpassungsstrategien an den Wandel sowie gesellschaftlich und ökologisch relevante Konsequenzen von hydrologischem Wandel.
Weitere Informationen und Bestellung:
http://www.dwa.de
(nach oben)
„Nanotechnik für Mensch und Umwelt – Chancen fördern und Risiken mindern“.
Umweltbundesamt informiert zu umweltrelevanten Aspekten
Nanotechnik gewinnt bei der Entwicklung neuer Produkte und Anwendungen zunehmend an Bedeutung. Nanotechnisch optimierte Kunststoffe können etwa das Gewicht bei Autos oder Flugzeugen senken und somit helfen, Treibstoff zu sparen. Neue, nanotechnisch optimierte Lampen – so genannte Licht emittierende Dioden (LED) – haben eine hohe Lebensdauer, wandeln den elektrischen Strom effizienter in Licht um und sparen somit Energie. Dies sind nur zwei Beispiele aus einer rasch wachsenden Zahl von Produkten, die auf den Markt kommen und sich vermutlich positiv auf Umwelt und Wirtschaft auswirken. Der zunehmende Einsatz synthetischer Nanomaterialien in Produkten führt jedoch auch zu einem vermehrten Eintrag dieser Materialien in die Umweltmedien Boden, Wasser und Luft. Die Wirkungen der Nanomaterialien in der Umwelt und mögliche gesundheitliche Risiken für den Menschen sind derzeit noch unzureichend erforscht. Das Umweltbundesamt (UBA) fasst in einem Hintergrundpapier relevante Aspekte über Umweltentlastungspotentiale zusammen, benennt Risiken für Mensch und Umwelt und formuliert Handlungsempfehlungen.
Der Bericht steht im Internet zum kostenlosen Download bereit unter
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?
(nach oben)
Mitarbeitermotivation für umweltbewusstes Verhalten – Ein Leitfaden für Umweltbeauftragte in Unternehmen
Wie gut ein Unternehmen beim Umweltschutz ist, hängt entscheidend von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab. Auf ihr Handeln kommt es an, wenn es darum geht, durch viele kleine Maßnahmen eine kontinuierliche Verbesserung zu bewirken und Ressourcen einzusparen. Deshalb möchte Ihnen das Bayerische Landesamt für Umwelt einen Leitfaden an die Hand geben, der zeigen soll, wie Sie mit einfachen Maßnahmen das Umweltbewusstsein Ihrer Mitarbeiter stärken und die Umweltbilanz Ihres Unternehmens weiter verbessern können.
Ergänzt wird der Leitfaden durch 10 Poster, die ebenfalls im Shop erhältlich sind.
Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt
Ausgabe: 2009
Umfang :60 Seiten
Quelle.
http://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=STMUGV&DIR=stmugv&ACTIONxSETVAL(index.htm,APGxNODENR:1354,USERxBODYURL:artdtl.htm,AARTxNR:lfu_agd_00058)=X
(nach oben)
Europäische Untersuchung der Leistungsfähigkeit verschiedener Rohrleitungssysteme bzw. Rohrmaterialien für städtische Entwässerungssysteme unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen Auswirkungen während der Nutzungszeit
Die hier vorgestellte „Untersuchung der Leistungsfähigkeit verschiedener Rohrleitungssysteme
bzw. Rohrmaterialien für städtische Entwässerungssysteme unter besonderer Berücksichtigung
der ökologischen Auswirkungen während der Nutzungszeit“ wurde von der Prof. Dr.-Ing. Stein &
Partner GmbH, Deutschland durchgeführt. Ein externer europäischer Sachverständigenausschuss
war maßgeblich an dem Projekt beteiligt: Durch das Einbringen der verschiedenen Ansichten über
die Lage der Kanalisationssysteme in den jeweiligen Ländern wurde ein ganzheitlicher
europäischer Blick auf das Projekt gewährleistet. Das spezielle Wissen der einzelnen
Sachverständigen erleichterte die Angleichung der analytischen Verfahrensregeln von „STATUS
Kanal“ an die spezifischen Anforderungen des Projekts. Die vom Sachverständigenausschuss
durchgeführte Überprüfung des analytischen Ansatzes des Projekts führte zu repräsentativen
Ergebnissen.
Der Ausschuss bestand aus …mehr unter:
http://www.krv.de/images/stories/docs/bersetzung_kurzfassung_smp-bericht.pdf
Von: S & P Consult GmbH
Konrad-Zuse-Str. 6, 44801 Bochum
(nach oben)
Kunststoffrohrsysteme für die kommunale Abwasserentsorgung
Immer wieder hört und liest man über den maroden Zustand
von Abwasserkanälen in Deutschland. Der Umweltausschuß
des Deutschen Bundestages z.B. hat am 16.
Juni 1999 in einer Beschlußempfehlung festgestellt, daß
ca. 22 % des öffentlichen Kanalnetzes in Deutschland
schadhaft sind und daß von den festgestellten Schäden
20-25 % einer dringenden Schadensbehebung bedürfen.
Der gesamtdeutsche Sanierungsbedarf des Abwassernetzes
wird von der Bundesregierung nach Länderumfragen
auf rd. 80 Mrd. Euro geschätzt.
Nach den Ergebnissen der ATV-DVWK-Umfrage 2001
sind ca. 17 % der öffentlichen Kanalisation kurz- bzw.
mittelfristig sanierungsbedürftig. Hierfür müßten rund
45 Mrd. Euro veranschlagt werden. Weitere 14 % des
Netzes weisen geringfügige Schäden aus und müssen
langfristig saniert werden.
Eine Studie des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungswirtschaft
e.V. geht bis zum Jahr 2015 für die öffentliche
Kanalisation von einem Neubau- und Instandhaltungsbedarf
zwischen jährlich 2.573 und 6.081 km
aus bei einem geschätzten Investitionsvolumen zwischen
3,31 und 7,57 Mrd. DM jährlich. Viele Fachleute befürchten
auch eine zumindest ähnliche Schadensrate auf
dem Gebiet der privaten Abwasserleitungen. Professor
Dietrich Stein von der Ruhr-Universität Bochum schätzt
auf der Grundlage lokaler Untersuchungen notwendige
Sanierungskosten auf 4.000 Euro pro Grundstück.
Die Sanierungsnotwendigkeit ergibt sich vor allem aus
der Überlastung und damit dem Bruch der Rohre. Das
kann auf Planungs- und Verlegefehler zurückgeführt
werden, betrifft aber vor allem Rohre aus traditionellen
Werkstoffen. Dennoch werden auch heute gerissene/gebrochene
Rohre unbeschadet der gemachten Erfahrungen
meistens durch solche gleicher Bauart ersetzt. Bei
Kunststoffrohren hingegen trägt aufgrund ihrer Flexibilität
das umgebende Erdreich die Lasten; Brüche treten nicht
auf.
Angesichts dieser Zahlen, des Kostendrucks auf die öffentlichen
Haushalte und der allgemein sehr hohen Abwassergebühren
sind technisch ausgereifte und wirtschaftliche
Problemlösungen in der Abwasserentsorgung
wichtiger denn je, wie sie von modernen Kunststoffrohrsystemen
geboten werden. Diese Publikation soll dies in
geraffter Form durch ein breites Spektrum an Informationen
deutlich machen. Schließlich setzen sich Kunststoffrohre
trotz ihrer ausgezeichneten Produkteigenschaften
im kommunalen Bereich – bei deutlicher Steigerung in
den letzten Jahren – zu langsam durch. Während in
Nordamerika ca. 85 % und in Nordeuropa 60 % bis
90 % der Neubauten in der öffentlichen Abwasserentsorgung
in Kunststoffrohren ausgeführt werden, vergibt die
öffentliche Hand in Deutschland – vielleicht aus Tradition?
– nur zwischen 10 % und 20 % ihrer Aufträge an die
Kunststoffrohrbranche. Hingegen sind Kunststoffrohre auf
dem Gebiet der Grundstücksentwässerung mit ca. 90 %
Marktanteil dominant. Und wenn es zu notwendigen Reparaturen
kommt, werden auch diese zu etwa 80 % mit
Kunststoffrohrsystemen verwirklicht.
1. Öffentliche Kanäle und
Grundstücksentwässerung
1.1 Öffentliche Kanäle
Kanalisationsanlagen stellen ein langlebiges Wirtschaftsgut
dar mit Abschreibungszeiträumen bis zu 100 Jahren.
Deshalb verlangen z.B. Kommunen als Auftraggeber von
den Rohrleitungssystemen mit Recht gleichbleibend hohe
Qualität über lange Zeiträume. Mehr unter:
http://www.krv.de/images/stories/docs/abwasserentsorgung.pdf
(nach oben)
Broschüre Sandfilteranlagen – Handbuch für den Betrieb von Kläranlagen
Die neue Broschüre Sandfilteranlagen
des DWA-Landesverbands Baden-Württemberg
wurde in Zusammenarbeit mit
dem Umweltministerium Baden-Württemberg
und der Hochschule Biberach
erstellt und ist im Juli 2009 erschienen.
Die aktuelle Auflage beinhaltet die Betriebsparameter
und Leistungen von
Sandfilteranlagen in Baden-Württemberg.
In diesem Heft werden Hilfen für
einen effizienteren Betrieb der vorhandenen
Anlagen und praxisorientierte Hinweise
für die Planung neuer Anlagen gegeben.
Inhalte der Broschüre:
● Übersicht über die Sandfilteranlagen
in Baden-Württemberg,
● Betrieb der Sandfilteranlagen,
● Entnahmeleistung,
● Erkenntnisse zum Einsatz der Sandfiltration
nach adsorptiver Behandlung von Abwasser.
Die Broschüre umfasst 55 Seiten und ist
für 25 Euro inkl. MwSt. beim Landesverband
Baden-Württemberg erhältlich:
DWA-Landesverband Baden-Württemberg
Rennstraße 8, 70499 Stuttgart
Tel. (07 11) 89 66 31-0, Fax 89 66 31-11
E-Mail: info@dwa-bw.de, www.dwa-bw.de
(nach oben)
Energieeinsatz auf Kläranlagen in Mecklenburg-Vorpommern
Leitfaden zur Optimierung
Disen Leitfaden können Sie bestellen oder kostenlos herunterladen. Unter
Quelle: http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Wasser/index.jsp?&publikid=2385
(nach oben)
Abwasser als Energiequelle
Abwasser ist eine noch wenig genutzte Wärmequelle. Doch die Wärmerückgewinnung aus Abwasser wurde in der Forschung lange stiefmütterlich behandelt. Eines der Probleme ist die Verschmutzung von Wärmetauschern. Sie hat dazu geführt, dass gut gemeinte Pionieranlagen bereits nach kurzer Zeit nicht mehr oder nur noch mit einem sehr schlechtem Wirkungsgrad funktionieren. Die Forschung, welche an der Eawag gemeinsam mit Partnern betrieben wurde zeigt nun, dass das Problem gelöst oder zumindest stark gemildert werden kann. Technische Entwicklungen, zum Beispiel selbstreinigende Vorfiltersysteme, und Innovationen der Anlagenbetreiber haben dazu beigetragen. Im soeben erschienenen Bericht «Wärmerückgewinnung aus Abwasser» zeigt Autor Oskar Wanner die Möglichkeiten und Grenzen der Abwasserenergienutzung auf. Auf die Wärmetauscherverschmutzung sowie Gegenmassnahmen in der Praxis geht der Bericht vertieft ein. Untersuchungen und Bericht wurden unterstützt vom Axpo-Naturstromfonds.
Erschienen in der Schriftenreihe Eawag, Nr. 19; ISBN 978-3-905484-13-7
(nach oben)
Kleinkläranlagen für bis zu 50 Einwohnerwerte (EW)
Mitvertrieb DIN EN 12566-7 (Entwurf)
Teil 7: Im Werk vorgefertigte Einheiten für eine dritte Reinigungsstufe
August 2009, 32 Seiten, DIN A4
Einzelpreis: EUR 87,40 / Preis für DWA-Mitglieder: EUR 78,44
Die Europäische Norm legt Anforderungen, Prüfverfahren, die Kennzeichnung und die Konformitätsbewertung für vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Einheiten für eine dritte Reinigungsstufe fest, die entweder für den separaten Einbau oder den Einbau in einen bestehenden Behälter vorgesehen sind. Sie gilt für vollständige Produkte auf den Markt gebrachte Einheiten für eine dritte Reinigungsstufe von Schmutzwasser folgender Herkunft durch biologische, physikalische oder elektrische Verfahren: Anlagen nach EN 12566-3 oder EN 12566-6 sowie Anlagen, die nach CEN/TR 12566-5 ausgelegt und gebaut wurden.
Weitere Informationen und Bestellung:
http://www.dwa.de/
(nach oben)
WasserWirtschafts-Kurse N/1
Entwässerungskonzepte
März 2009 in Kassel, 388 Seiten, 177 Abbildungen, 48 Tabellen, broschiert, DIN A5
ISBN 978-3-941089-55-6
Einzelpreis: EUR 52,00 / Preis für fördernde DWA-Mitglieder: EUR 41,60
Der Tagungsband stellt die Zusammenhänge zwischen Verschmutzung des Regen- und Mischwasserabflusses, dessen Bewertung und die Wechselwirkungen zwischen Kanalnetz, Kläranlage und Gewässer vor. Handlungsanweisungen, Beispiele und Erfahrungen zum Umgang mit Regenwasser werden aufgezeigt. Mehrere Beiträge befassen sich ausführlich mit der hydraulischen Dimensionierung und der Bemessung von Abwasserkanälen und Entwässerungssystemen. Neben diesen klassischen Themen greifen die Vorträge auch Fragestellungen der Bewirtschaftung von Abwassersystemen, der Investitions- und Betriebskosten, der Zustandserfassung und Bewertung von Entwässerungssystemen sowie der Detektion von Lagerungsdefekten und Sanierungsstrategien auf. In bewährter Weise werden also Grundlagen in Bezug auf die Entwässerungskonzepte zur Auffrischung des Wissens dargestellt und gleichermaßen neue aktuelle Themen behandelt.
Weitere Informationen und Bestellung:
http://www.dwa.de
(nach oben)
Eawag-News: Spurenstoffe
„Anthropogene Spurenstoffe im Wasser – Effekte, Risiken, Massnahmen“ ist der Titel von Heft 67 (Juni 2009) der Eawag-News. Die Publikation wird kostenlos verschickt, die einzelnen Beiträge stehen aber auch im Volltext kostenlos zum Download im Internet:
www.eawag.ch/medien/publ/eanews/news_67
(nach oben)
Hintergrundpapier zu polyfluorierten Verbindungen
„Per- und polyfluorierte Chemikalien: Einträge vermeiden – Umwelt schützen“ ist der Titel eines 17-seitigen Hintergrundpapiers des Umweltbundesamts, das im Juli 2009 veröffentlicht wurde.
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3812.pdf
(nach oben)
Notifizierungsverfahren im Bereich Abwasser und Abfall
Vorträge der Jahrestagung 2008/2009 Die AQS-Leitstelle Baden-Württemberg , 18. März 2009
Bericht von:
Dr. Claudia Hornung
Referat 71, Labor für Wasser und Boden
AQS-Jahrestagung 2009
Quelle: http://www.iswa.uni-stuttgart.de/ch/aqs/jt/index.html
(nach oben)
Titel: Erfahrungen zum Betrieb von Abwasserfilteranlagen
DWA-Themen KA 8.3 – Mai 2009
Ausgabe: Mai 2009
Verlag: DWA
ISBN: 978-3-941089-59-4
Format: DIN A4
Seitenzahl: 26
Preis: 21,00 € *
In dem vorliegenden Themenband werden die Betriebserfahrungen der letzten 20 Jahre mit rund 120 Abwasserfilteranlagen ausgewertet. Es geht dabei im Wesentlichen um nachgeschaltete Raumfilter nach Arbeitsblatt ATV-A 203 „Abwasserfiltration durch Raumfilter nach biologischer Reinigung“, die der Suspensaelimination und der damit verbundenen P-Elimination dienen. Aus den Erfahrungen werden Hinweise für Planung, Bau und Betrieb zukünftiger Anlagen abgeleitet. Die Konzeption der gesamten Filteranlage ist ein entscheidendes Kriterium für den leistungsfähigen Betrieb und die Bedienbarkeit der Anlage. Folgende wichtige Aspekte sind zu beachten und werden imThemenband erläutert: •Die Anzahl der Filterkammern ist nach wirtschaftlichen und betrieblichen Kriterien zu optimieren. •Die richtige Anordnung und Betriebsweise der Schlammwasserklappen bei Klappenfilteranlagen sind zu beachten, um frühzeitigen Verschleiß zu vermeiden. •Bei diskontinuierlich betriebenen Anlagen mit Düsenboden muss einem unkontrolliertem Druckaufbau durch Verstopfung der Düsen entgegengewirkt werden. •Für den Reparaturfall oder notwendigen Austausch von Aggregaten müssen diese auch ohne Hilfskonstruktionen gut zugänglich sein. •Offene Abwasserflächen innerhalb von Gebäuden sind wegen der Ungezieferproblematik zu vermeiden. •Bei Rohrleitungen ist abhängig von den verwendeten Materialien besonders auf dichte Montage und Korrosionsschutz an den Schweißnähten zu achten. •Beim Nachfüllen von Filtermaterial ist darauf zu achten, dass altes und neues Material nicht gemischt werden. •Bei der Auslösung der Spülung über den Klappenöffnungsgrad ist die aktuelle Durchflussmenge zu berücksichtigen. •Es ist zu berücksichtigen, dass bis zum Errreichen der notwendigen Spülgeschwindigkeit lange Anlaufphasen in Abhängigkeitvon der Spülwasserpumpe und der Leitungsführung entstehen können. •Die Rückführung des bei der Filterspülung entstehenden Schlammwassers in den Hauptstrom der Kläranlage kann im Mischwasserfall zu einer hydraulischen Überlastung führen.
(nach oben)
Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung Heft 25.09
Die neue EG-Hochwasserrichtlinie – In drei Schritten zur Umsetzung
Beiträge zum Seminar am 19. Februar 2009 in Magdeburg
Herausgeber: Heribert Nacken
2009, 137 Seiten, 49 Abbildungen, 13 Tabellen, broschiert, DIN A4
ISBN 978-3-941089-53-2
Einzelpreis: EUR 48,00 / Mitglieder der FgHW: EUR 38,40
Preis der digitalen Fassung auf CD-ROM: EUR 29,00 / Mitglieder der FgHW: EUR 23,20
Die Belange des Hochwasserschutzes mit all seinen Auswirkungen und Implikationen waren in der EG-Wasserrahmenrichtlinie nicht integriert. Inzwischen wurde dieses Manko durch die Einführung einer eigenständigen Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken behoben. Neu dabei ist speziell der durchgehende Leitgedanke des Hochwasserrisikomanagements. Der Tagungsband erläutert, in welche Teilschritte sich die Umsetzung der EG-Richtlinie aufgliedern lässt, welche Lösungsansätze bereits heute bestehen und mit welchen neuen Herausforderungen sich die Wasserwirtschaft in den Folgejahren beschäftigen wird. Die neun Beiträge behandeln die Grundlagen der Risikobewertung im Kontext der EG Richtlinie, die vorausschauende Bewertung des Hochwasserrisikos, Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten sowie Pläne für das Hochwasserrisikomanagement.
http://www.dwa.de
(nach oben)
Perspektiven dezentraler Infrastrukturen im Spannungsfeld von Wettbewerb, Klimaschutz und Qualität
Seit einigen Jahren haben sich die Geschäftsgrundlagen für kommunale Unternehmen der Ver- und Entsorgungsbranche in grundlegender Weise verändert. Durch die Liberalisierung des Wettbewerbsrechts auf nationaler und europäischer Ebene und aufgrund der desolaten Finanzsituation vieler Städte und Gemeinden stehen sie unter Druck. Sie müssen sich einerseits dem verschärften Wettbewerb stellen und andererseits ihren Aufgaben, für die Lebensqualität in den Kommunen zu sorgen und zum Klimaschutz beizutragen, gerecht werden.
Welche nachhaltigen Perspektiven sich aus diesem Spannungsfeld entwickeln lassen, das war Gegenstand der Forschungspartnerschaft zwischen dreizehn kommunalen Unternehmen der Ver- und Entsorgungsbranche und dem Wuppertal Institut in Kooperation mit dem Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) und der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW).
Die Forschungsaufgabe war, die Unternehmenspartner durch wissenschaftliche Beratung darin zu unterstützen, Strategien und Maßnahmen für die nachhaltige Gestaltung ihrer dezentralen Infrastrukturen zu entwickeln. Das betrifft die Geschäftsfelder Energieversorgung, Trinkwasser/Abwasser sowie Hausmüllentsorgung und Konsumgüterrecycling. 32 Strategien und 25 konkrete Maßnahmenbündel für einen öko-effizienten und qualitätsorientierten Entwicklungspfad, der die komparativen Stärken dezentraler Infrastrukturen im Wettbewerb besser zur Geltung bringt, wurden entwickelt. Dies geschah in enger Verknüpfung mit den regionalwirtschaftlichen Zielsetzungen (z. B. Standort- und Wohnortqualität, regionaler Arbeitsmarkt).
Die drei Spartenberichte für die Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft können beim Wuppertal Institut bestellt werden. Näheres siehe Internetportal von INFRAFUTUR
http://www.wupperinst.org/de/projekte/proj/index.html?&projekt_id=137&bid=163
(nach oben)
Ergebnisse für die Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft
Endbericht der Forschungspartnerschaft INFRAFUTUR
In drei Spartenberichten werden die Ergebnisse der Forschungspartnerschaft INFRAFUTUR im Detail präsentiert. Die Methoden der Forschungspartnerschaft können so auch von anderen kommunalwirtschaftlichen Unternehmen gewinnbringend eingesetzt werden. Auch die strategischen Empfehlungen stehen hiermit einem breiteren Kreis für die Umsetzung zur Verfügung.
Zum Bestellen der Ergebnisse für die Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft und zum erhalten weiterer Informationen schreiben Sie bitte eine Email an: info@infrafutur.de oder nutzen Sie einfach das Bestellformular und senden Sie uns dieses per Fax: 0202/2492-250 oder Email zu.
Energie
Die Ergebnisse für die Energiewirtschaft werden auf 440 Seiten präsentiert und enthalten 45 Abbildungen und 36 Tabellen, Preis 890,- Euro
Wasser/ Abwasser
Die Ergebnisse für die Wasser- und Abwasserwirtschaft werden auf 220 Seiten präsentiert und enthalten 18 Abbildungen und 21 Tabellen, Preis 490,- Euro
Weitere Informationen unter:
http://www.infrafutur.de/index.php?main=16⊂=0&call=Endbericht
(nach oben)
Energie- und Umweltbericht 2008
EEA Report No 6/2008 (2008)
Der Bericht bewertet die wichtigsten Faktoren, Umweltbelastungen und einige Auswirkungen von Energieerzeugung und -verbrauch und berücksichtigt dabei die Hauptziele der europäischen Energie- und Umweltpolitik: Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, erhöhte Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie ökologische Nachhaltigkeit.
Der Bericht befasst sich mit sechs politischen Fragestellungen, stellt gegenwärtige Entwicklungen in der EU vor und vergleicht diese mit anderen Staaten.
Fragestellungen:
1.Welche Auswirkungen haben Energieerzeugung und -verbrauch auf die Umwelt?
2.Welche Trends sind hinsichtlich des Energiemixes in Europa zu beobachten und welche Umweltauswirkungen sind damit verbunden?
3.Wie schnell können Technologien für erneuerbaren Energien umgesetzt werden?
4.Wird das europäische System der Energieerzeugung effizienter?
5.Spiegeln sich die Umweltkosten auf angemessene Weise im Energiepreis wider?
6.Welche Rolle spielt der Haushaltsektor bei der Notwendigkeit einer Reduzierung des Endenergieverbrauchs und welche Trends lassen sich beobachten?
Herausgeber
Europäische Umweltagentur (EUA)
http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2008_6/de/DE_EnergyAndEnvironment_executiveSummary.pdf
(nach oben)
Faltblätter Hochwasserschutz
Neuerscheinung
Was ist vor, während und nach einem Hochwasserereignis zu tun? Welche Bedeutung haben die Hochwasseralarmstufen? Welche Materialien zur Hochwasserabwehr gibt es und wie sind diese einzusetzen? Welche Schäden können an Deichen auftreten und wie ist mit diesen umzugehen? Wie können Gebäude effektiv vor Hochwasser geschützt werden? Zur Antwort auf diese und weitere Fragen wurden Themenfaltblätter zu Teilbereichen des präventiven Hochwasserschutzes, schwerpunktmäßig für den Freistaat Sachsen, erstellt.
Teil I: Allgemeine Informationen, Alarmstufen, Hochwasserabwehr, Verhalten, Ansprechpartner
Teil II: Deiche und Deichverteidigung
Teil III: Schutz von Gebäuden vor Oberflächen-, Grund- und Kanalisationswasser
Details zum Inhalt und Bezug sowie über weitere Publikationen zur naturnahen Gewässerunterhaltung
Kontakt
DWA-Landesverband Sachsen/Thüringen
Niedersedlitzer Platz 13
01259 Dresden
Tel.: 0351 2032025
Fax: 0351 2032026
E-Mail: info@dwa-st.de
(nach oben)
Technische Möglichkeiten der alternativen Gestaltung städtischer Wasser- und Abwasserinfrastruktur
Eine Technikrecherche im Rahmen des Projekts „Transformationsmanagement für eine nachhaltige Wasserwirtschaft“.
Von Nadine Staben, Berlin 2008, 100 S
http://edoc.difu.de/edoc.php?id=0iz7ml64
(nach oben)
Phosphorrückgewinnung bei der Abwasserreinigung – Entwicklung eines Verfahrens zur Integration in kommunale Kläranlagen
Montag, David
Band 212
Hrsg. von J. Pinnekamp
Aachen: Ges. z. Förderung d. Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen e.V. (2008),
23,00 Euro
Auskünfte und Bestellungen
Gesellschaft zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft
an der RWTH Aachen e.V.
Templergraben 55
52056 Aachen
Telefon: 0241 / 80 250 72
Telefax: 0241 / 80 222 85
E-Mail: Schriftenreihen@isa.rwth-aachen.de
Quelle: http://www.isa.rwth-aachen.de
(nach oben)
9. Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium am 13./14.10.2008
Tagungsband
EURO 40,00
Auskünfte und Bestellungen
Gesellschaft zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft
an der RWTH Aachen e.V.
Templergraben 55
52056 Aachen
Telefon: 0241 / 80 250 72
Telefax: 0241 / 80 222 85
E-Mail: Schriftenreihen@isa.rwth-aachen.de
(nach oben)
Bewertung zentraler und dezentraler Abwasserinfrastruktursysteme
Herbst, Heinrich
Band 213
Hrsg. von J. Pinnekamp
Aachen: Ges. z. Förderung d. Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen e.V. (2008),
23,00 Euro
Auskünfte und Bestellungen
Gesellschaft zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft
an der RWTH Aachen e.V.
Templergraben 55
52056 Aachen
Telefon: 0241 / 80 250 72
Telefax: 0241 / 80 222 85
E-Mail: Schriftenreihen@isa.rwth-aachen.de
(nach oben)
Strategien zum Umgang mit Arzneimittelwirkstoffen im Trinkwasser
Humanarzneimittelwirkstoffe: Handlungsmöglichkeiten zur Verringerung von Gewässerbelastungen
Arzneimittel sind in vielen Fällen unverzichtbarer Bestandteil eines unbeschwerten und
gesunden Lebens. Mittlerweile ist jedoch auch eine Schattenseite des verbreiteten Einsatzes
von Medikamenten belegt: ihre Umweltrelevanz. Seit Anfang der 1990er Jahre
bestätigen Forschungsergebnisse das Vorkommen eines breiten Spektrums von Humanund
Veterinärpharmaka in Oberflächengewässern, im Grundwasser und vereinzelt sogar
im Trinkwasser. Immer mehr Daten zeigen zudem, dass bestimmte Stoffe auch negative
Effekte in der Tier- und Pflanzenwelt auslösen können.
Wissenschaftlich ist derzeit noch unklar, welche Risiken für Mensch und Umwelt tatsächlich
bestehen. Zu erwarten ist aber, dass sich das Problem in den kommenden Jahren
weiter verschärft, da mit der demografischen Entwicklung in Deutschland und
Europa hin zu immer älteren Gesellschaften ein deutlicher Anstieg des Arzneimittelverbrauchs
einhergehen wird. Vorsorgendes Handeln ist daher mehr und mehr angezeigt.
Besondere Bedeutung kommt dabei einer langfristigen Stärkung des Trinkwasserschutzes
zu. Unter einer Nachhaltigkeitsperspektive bedeutet dies, schon die Belastungen
der Gewässer zu verringern. Denn nur so können die Trinkwasserquellen auch für die
Nutzung durch künftige Generationen geschützt und gleichzeitig Umweltrisiken minimiert
werden.
Systematische Untersuchungen …
Den ganzen Bericht lesen Sie unter http://www.start-project.de/downloads/start.pdf
(nach oben)
Neue Broschüre „Energieeffizienz im Abwasserbereich“ erschienen
Die Veröffentlichung ist als Heft 51 in der Schriftenreihe der U.A.N. erschienen und fasst die Inhalte und Vorträge der gleichnamigen Informationsveranstaltung „Energieeffizienz im Abwasserbereich“ in aufbereiteter Form zusammen, welche am 12.06.2008 erfolgreich in der Stadthalle Walsrode durchgeführt wurde.
Interessenten können die Veröffentlichung zum Preis von 17,10 Euro (zzgl. Porto + Verpackung) bestellen.
Genaue Informationen unter:
http://www.umweltaktion.de/magazin/artikel
(nach oben)
Funktionsstörungen auf Kläranlagen
Praxisleitfaden
Funktionsstörungen auf Abwasserreinigungsanlagen haben häufig die Überschreitung von Überwachungswerten zur Folge und können dadurch zu strafrechtlichen wie abgaberechtlichen Konsequenzen für den Betreiber führen. Eine frühzeitige Information und die Einbindung aller Beteiligten (Dienstvorgesetzte, Wasserbehörde etc. gemäß Alarmplan) bei relevanten Störungen kann helfen, die daraus resultierenden Auswirkungen auf das Gewässer und die Konsequenzen für den Anlagenbetreiber zu minimieren.
In diesem Leitfaden werden Empfehlungen für das Betriebspersonal von Abwasserreinigungsanlagen und für die zuständige Wasserbehörde bei Unfällen (Abwehr einer unmittelbaren Gefahr) und im Rahmen der amtlichen Überwachung gegeben, mit deren Hilfe auf Abwasserreinigungsanlagen ein systematisches Vorgehen zur Ermittlung und Behebung von Funktionsstörungen möglich wird. Das Vorgehen orientiert sich an den Symptomen und ermöglicht so einen raschen Einstieg in die Lösungsfindung mit dem Ziel, im Zuge der Fehlerbehebung Zeit und Kosten zu sparen.
Das 140 Seiten umfassende DIN A4-Buch ist beim DWA-Landesverband Baden-Württemberg zum Preis von 35,00 Euro (fördernde DWA-Mitglieder: 28,00 Euro), zzgl. Versandkosten, unter der ISBN-Nr. 978-3-940173-46-1 erhältlich (siehe unten).
———————————————————————————
Kontakt
DWA-Landesverband Baden-Württemberg
Rennstr. 8
70499 Stuttgart
Tel.: 0711 896631-0
Fax: 0711 896631-11
E-Mail: info@dwa-bw.de
(nach oben)
Hydrologie
Die Beiträge widmen sich den drei großen wasserwirtschaftlichen Aufgaben „zu viel“, „zu wenig“ und „zu schmutzig“. Von diesen drei Problemen hat in Deutschland das erstere gegenwärtig das größte Gewicht. Dies zeigt sich z. B. an den enormen Schäden, die die großen Hochwässer von Oder, Elbe, Rhein und Donau der vergangenen Jahre verursacht haben. Doch auch bezüglich der Themen „Wassermangel“ und „Gewässerbelastung“ gibt es nationale Aufgaben, die vor dem Hintergrund des Klimawandels oder der aktuellen Entwicklung der Energiepflanzenproduktion zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Die 34 Beiträge des Tagungsbandes befassen sich mit der Identifikation und Modellierung von hydrologischen Prozessen, der Prognose von Veränderungen hydrologischer Variablen und dem Management kritischer wasserwirtschaftlicher Situationen vorwiegend auf der Einzugsgebietsskala. Im Vordergrund stehen dabei innovative Ansätze, die auch eine erfolgreiche Übertragung in die wasserwirtschaftliche Praxis erlauben.
Weitere Infos unter:
www.dwa.de
(nach oben)
Kurzfassung Ergebnisbericht Benchmarking Abwasser Bayern
Mit dem Benchmarking Abwasser Bayern 2007 wurde die bayerische Wasserwirtschaft untersucht. Alle Ergebnisse sind in dem Bericht zusammengefasst und geben Auskunft über die bayerische Positionierung mit dem Blick über den „Tellerrand“ zu weiteren erfolgreichen Landesprojekten. Die Gesamtversion können Sie mit einer Schutzgebühr von 15,- € plus Versandkosten und MWST bei Frau Vogt a.vogt@aquabench.de.bestellen.
Weitere Informationen unter: http://www.abwasserbenchmarking-bayern.de/
(nach oben)
Stehen wir vor einem Systemwechsel in der Wasserver- und Abwasserentsorgung?
Sektorale Randbedingungen und Optionen im stadttechnischen Transformationsprozess
Gesamtbericht des Analysemoduls „Stadttechnik“ im Forschungsverbund netWORKS. Von Matthias Koziol, Antje Veit und Jörg Walther, Berlin 2006, 148 S., kostenlos
(netWORKS-Paper, Nr. 22)
Als Download (PDF, 1,4 MB) unter:
http://www.networks-group.de/veroeffentlichungen/index.phtml
(nach oben)
Technische Möglichkeiten der alternativen Gestaltung städtischer Wasser- und Abwasserinfrastruktur
Eine Technikrecherche im Rahmen des Projekts „Transformationsmanagement für eine nachhaltige Wasserwirtschaft“. Von Nadine Staben, Berlin 2008, 100 S., kostenlos
(netWORKS-Paper, Nr. 24)
Als Download (PDF, 1.02 MB unter:
http://www.networks-group.de/veroeffentlichungen/index.phtml
(nach oben)
Biogasindustrie in Deutschland: Neue Publikation stellt Fakten und Unternehmen vor
Die erstmals aufgelegte Broschüre „Biogas – Neue Chancen für
Landwirtschaft, Industrie und Umwelt“ ist ab sofort erhältlich. Die ersten zehn Kapitel
stellen die wichtigsten wirtschaftlichen, ökologischen und technischen Fakten und
Zusammenhänge vor. In den drei folgenden Kapiteln präsentieren sich insgesamt 54
Unternehmen – vom kompletten Anlagenanbieter bis zum hochspezialisierten
Ingenieurbüro.
Die Broschüre und die dazugehörige Website www.multitalent‐biogas.de entstanden auf
Initiative des Fachverbandes Biogas e.V. Entwickelt, produziert und herausgegeben wurde
die Publikation von der Sunbeam GmbH und der Solarpraxis AG in Berlin.
„Biogas – Neue Chancen für die Landwirtschaft, Industrie und Umwelt“ wird während der
Pressekonferenz des Fachverbandes Biogas e.V. am 5. Mai 2008 auf der Internationalen
Abfall‐ und Abwasser‐Messe Ifat in München offiziell vorgestellt. Die Pressekonferenz
beginnt um 14.00 Uhr im Konferenzraum, Pressezentrum West, Messegelände München.
Anmeldung wird erbeten unter ho@biogas.org.
Pressevertreter können die Broschüre kostenfrei unter der Internetadresse
www.multitalent‐biogas.de bestellen, dort kann auch ein PDF der Publikation
heruntergeladen werden.
Rückfragen:
German Lewizki, Sunbeam GmbH, Tel 030 26554380
Andrea Horbelt, Fachverband Biogas e.V., Tel 08161 984663
Über den Fachverband Biogas e.V.:
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit knapp 3.000 Mitgliedern die deutsche
Interessenvertretung der Biogas‐Branche. Er vereint Betreiber, Planer und Anlagenbauer.
Über die Solarpraxis AG:
Die Berliner Solarpraxis AG ist eines der führenden Beratungs‐ und Dienstleistungsunternehmen der
Solarbranche. Sie generiert und vermarktet Wissen aus der Branche der erneuerbaren Energien in Form von Engineering‐Dienstleistungen, Konferenzen und Verlagsprodukten für Unternehmen, Handwerk, Verbände,Politik und eine breite Öffentlichkeit. Mit ihrer Tochterfirma, der Sunbeam GmbH, hat die Solarpraxis AG direkten Zugriff auf professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Public Relations, Neue Medien und Kommunikationsdesign.
http://www.biogas.org/
(nach oben)
Vergleichende Statistik zum Stand der Regenwasserbehandlung in den verschiedenen Bundesländern und ein Blick zu den Anrainerstaaten an der Ost- und Nordseeküste
7. DWA-Regenwassertage
Schleswig, Juni 2008.
Quelle:
http://www.uft-brombach.de/
(nach oben)
Politikmemorandum 2008 der DWA erschienen
Das neue Politikmemorandum 2008 der DWA ist erschienen. Damit bezieht die DWA medienübergreifend Stellung zu Wasserwirtschaft, Klimaschutz, Energiewirtschaft, Bodenschutz und Abfallwirtschaft. Das Politikmemorandum ist jetzt seit 2005 zum vierten Mal in Folge erschienen. Es ist Grundlage für die Politikberatung der Vereinigung, innerhalb derer die DWA ihre Sachargumente den Politikern von Bund und Ländern vermittelt und den Sachverstand der in ihr organisierten Fachleute der Politik anbietet.
Wasserwirtschaft – neues Wasserrecht praxisgerecht gestalten
Die Neugestaltung des Wasserrechts auf Bundesebene im Rahmen des Gesetzgebungsprojekts Umweltgesetzbuch (UGB) wird von der Bundesregierung intensiv betrieben. Die DWA begrüßt diese Aktivitäten und begleitet sie intensiv. Eine frühzeitige Diskussion über das untergesetzliche Regelwerk zum UGB sieht die DWA als notwendig an. Dazu kann sie erhebliche fachliche Kenntnisse, zum Beispiel bei der Vereinheitlichung der Regelungen zu wassergefährdenden Stoffen auf Bundesebene, einbringen.
Klimaschutz – Anpassungsstrategien verantwortungsbewusst mitentwickeln
Der Klimawandel erfordert Anpassungsstrategien, um den hydrologischen Extremen (Hochwasser und Niedrigwasser) zu begegnen und die Nutzung des Wassers durch den Menschen (Wasserbewirtschaftung) zu sichern. Mit ihrer interdisziplinären Fachkompetenz will die DWA Folgen für die Wasserwirtschaft sichtbar machen sowie Handlungsoptionen für die Aufgabenbereiche Hochwasser und Niedrigwasser, Wasserverfügbarkeit und Wasserqualität, Siedlungswasserwirtschaft, Wasserkraft und Schifffahrt entwickeln.
Energiewirtschaft – Energienutzung nachhaltig gestalten
Neue Herausforderungen ergeben sich aus dem Klimaschutz, der erhebliche Veränderungen und großen Anpassungsbedarf mit sich bringen wird. Eng verbunden hiermit sind Energiegewinnung und Energieverbrauch. Die DWA begrüßt die Klimaschutzinitiativen der Bundesregierung und weist darauf hin, dass die Wasserwirtschaft Lösungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Energiegewinnung bietet: zum Beispiel die Nutzung von Wasserkraft und Klärgas (einschließlich Co-Vergärung) sowie die energetische Nutzung von Abfällen einschließlich Klärschlamm bis hin zur Wärmerückgewinnung aus Abwasser. Dem sparsamen und effizienten Einsatz von Energie kommt gleichfalls hohe Bedeutung zu.
Bodenschutz – effektiv gestalten
Die EU hat im September 2006 einen Entwurf für eine EU-Bodenschutzrichtlinie vorgelegt, die im Dezember 2007 zunächst im EU-Ministerrat nicht die notwendige Mehrheit gefunden hat. Dieser Vorschlag würde für Deutschland keine Verbesserungen, sondern zusätzliche bürokratische Vorgaben mit sich bringen. Das seit 1998 bestehende deutsche Bodenschutzrecht hat sich als flexibles Instrument bewährt.
Abfallwirtschaft – Klärschlammverwertung qualitativ sichern
Seit dem Inkrafttreten der Klärschlammverordnung ist die Belastung kommunaler Klärschlämme mit Schadstoffen – anorganischer und organischer Art – deutlich gesunken. Eine Entwicklung, die auf gemeinsames Handeln von Politik, Industrie, Wissenschaft, Landwirtschaft und Kläranlagenbetreiber zurückzuführen ist. Die Novellierung der Klärschlammverordnung zur Anpassung an diese Entwicklung wird von der DWA begrüßt. Dabei ist den Belangen des Boden- und Grundwasserschutzes sowie der Kreislaufwirtschaft und damit dem Ressourcenschutz – insbesondere bezüglich Phosphor – Rechnung zu tragen.
Ausblick
Neben den zuvor dargestellten neuen Herausforderungen muss sichergestellt sein, dass weiterhin die wichtigen Aufgaben zum Erhalt der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur im Sinne der Daseinsvorsorge erfüllt werden. Der Staat muss hierfür die notwendigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Das soll zum einem durch ein neues Umweltrecht auf Bundesebene erfolgen (UGB).
Das DWA-Politikmemorandum 2008 kann bei der DWA-Bundesgeschäftsstelle angefordert oder von der DWA-Website heruntergeladen werden:
Tel. (0 22 42) 872-333, www.dwa.de
(nach oben)
Funktionsstörungen auf Kläranlagen
Praxisleitfaden
Funktionsstörungen auf Abwasserreinigungsanlagen haben häufig die Überschreitung von Überwachungswerten zur Folge und können dadurch zu strafrechtlichen wie abgaberechtlichen Konsequenzen für den Betreiber führen. Eine frühzeitige Information und die Einbindung aller Beteiligten (Dienstvorgesetzte, Wasserbehörde etc. gemäß Alarmplan) bei relevanten Störungen kann helfen, die daraus resultierenden Auswirkungen auf das Gewässer und die Konsequenzen für den Anlagenbetreiber zu minimieren.
In diesem Leitfaden werden Empfehlungen für das Betriebspersonal von Abwasserreinigungsanlagen und für die zuständige Wasserbehörde bei Unfällen (Abwehr einer unmittelbaren Gefahr) und im Rahmen der amtlichen Überwachung gegeben, mit deren Hilfe auf Abwasserreinigungsanlagen ein systematisches Vorgehen zur Ermittlung und Behebung von Funktionsstörungen möglich wird. Das Vorgehen orientiert sich an den Symptomen und ermöglicht so einen raschen Einstieg in die Lösungsfindung mit dem Ziel, im Zuge der Fehlerbehebung Zeit und Kosten zu sparen.
Das 140 Seiten umfassende DIN A4-Buch ist beim DWA-Landesverband Baden-Württemberg zum Preis von 35,00 Euro (fördernde DWA-Mitglieder: 28,00 Euro), zzgl. Versandkosten, unter der ISBN-Nr. 978-3-940173-46-1 erhältlich.
(nach oben)
Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung Heft 24/08
Klimawandel – Was kann die Wasserwirtschaft tun?
Beiträge zum Symposium am 24./25. Juni 2008 in Nürnberg Herausgeber: Hans-B. Kleeberg
2008, 251 Seiten, 121 Abbildungen, 17 Tabellen, broschiert, DIN A4
ISBN 978-3-940173-97-3
Ladenpreis: EUR 48,00 / Mitglieder der FgHW: EUR 38,40
Preis der digitalen Fassung auf CD-ROM: EUR 29,00 / Mitglieder der FgHW: EUR 23,20
Weitere Informationen und Bestellung: In den vergangenen Jahren sind die Zusammenhänge, die zum jetzigen Klimawandel führen, intensiv untersucht worden. Es konnten Folgen für die Physik unserer Erde, für die Biosphäre und für die menschlichen Lebensumstände abgeleitet werden. Heute wissen wir, dass es keine einfache und umfassende Lösung des Problems gibt und dass wir uns weder der Vorsorge noch der Anpassung an die Folgen der Klimaänderung entziehen können. Die 17 Beiträge des Symposiums reichen von den Grundlagen und Wirkungen des Klimawandels über die Maßnahmen und Aktivitäten in allen Bereichen der Wasserwirtschaft (Modellierung, Hochwasserschutz, Küstenschutz, Wasserkraftnutzung, Binnenschifffahrt, Landschaft, Forstwirtschaft, Trinkwasserversorgung, Stromproduktion) bis hin zu ökonomischen und politischen Folgen.
http://www.dwa.de/news/news-ref.asp?ID=4036
(nach oben)
Klimaschutz durch Energieeffizienz
Ergebnisse der Fachtagung vom 5. Juni 2008
Zusammenfassung
Die Rückmeldungen zu der Veranstaltung waren sehr positiv und es gab wertvolle Hinweise für die Ausrichtung zukünftiger Veranstaltungen, die wir gerne berücksichtigen. Viele Teilnehmer haben an-gegeben, dass sie konkrete Anregungen mitnehmen konnten, andere fühlten sich in ihrem einge-schlagenen Weg bestätigt und motiviert weiterzumachen.
Am Anfang allen Handelns steht die Bestandsaufnahme – möglichst ganzheitlich und systema-tisch, jedoch ohne sich in Details zu verlieren!
Das Controlling der Maßnahmen ist genauso wichtig wie die Umsetzung.
Energieeffizienz ist ein kontinuierlicher Prozess und erfordert wie alle Umweltthemen einen langen Atem, Durchhaltevermögen und immer wieder gute Argumente. Das gilt gleichermaßen für die Kommunikation von der Geschäftsführung zu den Mitarbeitern, sowie von den Mitarbeitern – ge-rade in Produktionsbereichen – zu den Controllern und zum mittleren Management. Die auftreten-den Hemmnisse bei der Umsetzung sind bei allen sehr ähnlich gelagert.
Controller / Geschäftsführer und technische Mitarbeiter müssen sich in dergleichen Sprache verständigen.
Der dauerhafte Erfahrungsaustausch untereinander wird als besonders hilfreich angesehen.
Quelle:
http://www.izu.bayern.de/aktuelles/detail_aktuelles.php?ID=1156&kat=1&th=-1
(nach oben)
Energieeffizenz auf Kläranlagen
Senkung des Stromverbrauchs auf Kläranlagen
Neuerscheinung 2. Auflage
Der vorliegende Leitfaden wurde mit der 2. Auflage neu überarbeitet und befasst sich in 10 Kapiteln mit insgesamt 150 Seiten insbesondere mit folgenden Themen:
– Bewertung des Gesamtstromverbrauchs einer Kläranlage
– Orientierungswerte für den Strombedarf einzelner Verbrauchsstellen
– Möglichkeiten zur Erfassung des Stromverbrauchs einzelner Antriebe
– Grenzen der Einflussnahme durch das Betriebspersonal
– Maßnahmen zur Senkung des Stromverbrauches im Laufenden Betrieb
– Detailgestaltung im Zuge von Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
– Energiemanagementsysteme.
Der Schwerpunkt der Inhalte liegt auf der Verbrauchsseite – dem Stromverbrauch. Durch die ausführlichen Anleitungen, Erläuterungen und Hintergrundinformationen, die in diesem Leitfaden gegeben werden, soll jeder Betriebsleiter in die Lage versetzt werden, schrittweise und systematisch
– den Gesamtstromverbrauch seiner Anlage zu bewerten und das theoretische Einsparpotenzial insgesamt grob abzuschätzen,
– die energetischen Schwachstellen im Betrieb durch vergleichende Betrachtungen bzw. durch einfache Kontrollen und Messungen aufzuspüren sowie
– die erkannten Schwachstellen mit den dazu vorgeschlagenen Mitteln soweit wie möglich selbst zu beheben oder aber die erforderlichen Maßnahmen dem Dienstvorgesetzten gegenüber sachlich zu begründen, damit diese möglichst zügig in die Wege geleitet werden.
Das Buch ist ab August 2008 beim DWA-Landesverband Baden-Württemberg zum Preis von 30,00 Euro (20 % Rabatt für fördernde DWA-Mitglieder), zzgl. Versandkosten, unter der ISBN 978-3-94017-47-8 erhältlich. Bestellungen sind bereits möglich (siehe unten).
Kontakt
DWA-Landesverband Baden-Württemberg
Rennstr. 8
70499 Stuttgart
Tel.: 0711 896631-0
Fax: 0711 896631-11
E-Mail: info@dwa-bw.de
http://www.dwa.de/news/news-ref.asp?ID=4046
(nach oben)
Klimaschutz durch Energieeffizienz in Unternehmen
Dokumentation der Fachtagung vom Juni 2008 des Bayer. Landesamtes für Umwelt:
Es kommt was auf Sie zu¿.Worauf sich Betriebe aus globaler und volkswirtschaftlicher Sicht einstellen müssen; Effizienzbeispiele aus der Praxis – systematisches Vorgehen führt zum Erfolg; Am Anfang war die Erkenntnis; Die Grundlagen einer gewerblichen Energieberatung; Warum es nicht nur auf die Hülle ankommt; Muss ich mich denn um alles kümmern? – Wer hilft Ihnen bei Fragen zu Förderung, Beratung und Technik; So gelingt der Einstieg ins Energiemanagement; Solararchitektur und Passivhaus im Gewerbebau; Integrale Sanierung des ebök-Bürogebäudes zum Passivhaus – Konzept und Messergebnisse; 10 Grundprinzipien energieeffizienter Büro- und Verwaltungsgebäude; So rechnen Sie richtig! Bewertungsverfahren für Investitionsentscheidungen; Wie kommt das Neue in die Welt? – Warum es schwerfällt, was dran gut ist, warum es notwendig ist; Veränderungen – wie ein Unternehmer davon profitieren kann
Herausgeber:Bayerisches Landesamt für Umwelt
Ausgabe:2008
Umfang:124 Seiten
Typ:Sonstige Publikation
ISBN: 978-3-940009-75-3
(nach oben)
Mehr junge Leute in Umweltberufe!
DIHK-Präsident und Bundesumweltminister stellen Broschüre vor
Unternehmen im Umweltschutz bieten abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten. Darauf weisen der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und das Bundesumweltministerium in einer neuen Veröffentlichung hin.
Mit der Broschüre wollen DIHK-Präsident Ludwig Georg Braun und Bundesumweltminister Sigmar Gabriel Schülerinnen und Schüler ermuntern, sich in dieser Boom-Branche auf Lehrstellen zu bewerben.
Gabriel: „Eine gesunde Umwelt und wirtschaftliche Perspektiven sind auf das Können und die Ideen der jungen Leute angewiesen. Wer die Zukunft mitgestalten will, braucht eine solide Berufsausbildung.“
Braun sagte: „Kein Beruf kommt mehr ohne Kenntnisse im Umweltschutz aus. Wir können uns den nationalen und internationalen Herausforderungen erfolgreich stellen, wenn wir dafür sorgen, dass Deutschland auch in Zukunft über gut ausgebildete und kreative Fachleute verfügt.“
Allein zwischen 1998 bis 2004 ist der Umsatz der Umweltbranche von 1 Milliarde Euro auf 12 Milliarden Euro gestiegen. Der Trend setzt sich fort – damit wächst auch der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften.
Inzwischen werden allein im Bereich der Industrie- und Handelskammern über 2.500 Lehrstellen in vier Umweltberufen angeboten. Die neue gemeinsame Broschüre „Umwelt schafft Perspektiven“ stellt diese Berufe ausführlich vor: Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, für Abwassertechnik, für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie für Rohr-, Kanal- und Industrieservice.
Umweltschutz ist inzwischen in fast jedem der rund 340 anerkannten Ausbildungsberufe ein fester Bestandteil der Berufsausbildung der Jugendlichen. Gabriel und Braun wiesen darauf hin, dass die Bedeutung des Klima- und Ressourcenschutzes in der Berufsausbildung weiter zunehmen wird.
Sie finden die Broschüre „Umwelt schafft Perspektiven „
zum Download: unter:
http://www.dihk.de/
(nach oben)
Informationsveranstaltung „Energieeffizienz im Abwasserbereich“ erfolgreich durchgeführt
Über 100 interessierte Teilnehmer, die sich überwiegend aus kommunalen Vertretern und Betreibern von Abwasseranlagen zusammensetzten, hatten sich aus ganz Niedersachsen auf den Weg gemacht, um sich bezüglich Energieeffizienz auf den aktuellen Stand zu bringen.
Die einzelnen Vorträge beschäftigten sich schwerpunktmäßig mit den aktuellen Themen Energieverbrauch, Energieeinsparung und Möglichkeiten zur Energieerzeugung.
Intensiv verfolgten die Zuhörer die Ausführungen der Referenten, die sowohl aus Ingenieurbüros und großen Abwasserentsorgungsbetrieben bzw. Verbänden stammten, wie auch aus den Bereichen Wissenschaft und Forschung.
Das ausgewogene Verhältnis zwischen Theorie und praktischer Erfahrung war also gegeben und machte die Veranstaltung für die Teilnehmer besonders interessant.
Ausführungsbeispiele von erfolgreich umgesetzten Projekten rundeten das Programm ab.
Wer nach den detaillierten Vorträgen noch weitere Informationen einholen wollte, konnte dies in den Pausen an den Info-Ständen im Foyer tun. Hier präsentierten Hersteller und Ingenieurbüros ihre konkreten Lösungen zur Energieeinsparung und -erzeugung im Abwasserbereich.
Zur Veranstaltung wird in Kürze im Rahmen der Schriftenreihe der U.A.N. eine Broschüre erscheinen, die sämtliche Vorträge der Referenten zusammenfasst und aufbereitet.
Interessenten können die Veröffentlichung bereits jetzt mit dem unten stehenden Bestellformular zum Preis von 17,10 Euro (zzgl. Porto + Verpackung) bestellen.
Weitere Infos unter:
http://www.umweltaktion.de/magazin/artikel.php?artikel=366&type=2&menuid=14&topmenu=14
(nach oben)
Umweltgutachten 2008
Umweltschutz im Zeichen des KlimawandelsGewässerschutz
Botschaften
Im Gewässerschutz sind in den vergangenen Jahren durchaus einige Fortschritte zu
verzeichnen. Das betrifft insbesondere die Schad- und Nährstoffemissionen aus
Punktquellen, die seit Jahren rückläufig sind. Kommunale Kläranlagen haben sich auf
einem sehr hohen Qualitätsniveau stabilisiert und hinsichtlich der Stickstoffelimination
sogar noch weiter verbessert. Dagegen gelang es nicht, die Nährstoffeinträge aus
diffusen Quellen in gleicher Weise zu reduzieren. So sind die Stoffeinträge aus der
Landwirtschaft mittlerweile das Hauptproblem für die Wasserqualität nicht nur in
Deutschland, sondern in ganz Europa geworden. Neben den diffusen Stoffeinträgen
stellt die Verbesserung der Gewässermorphologie und dabei vor allem die Durchgängigkeit
der Gewässer die zweite große Herausforderung im Gewässerschutz dar.
Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) steht neben den genannten
Herausforderungen vor der Schwierigkeit, eine möglichst effiziente Umsetzung der
Maßnahmenprogramme zu gewährleisten. Hierfür fehlen in den meisten Fällen noch
adäquate Kosten-Nutzen-Betrachtungen. Außerdem ist es unerlässlich, bei der Umsetzung
der Bewirtschaftungspläne folgendes zu beachten:
– die Erstellung umfassender Maßnahmenpakete zur Minderung diffuser Stoffeinträge
und für die Renaturierung der Gewässermorphologie;
– die Einbettung der Bewirtschaftungspläne, in enger Kooperation mit allen Umweltverwaltungen,
in ein integriertes Gesamtkonzept der räumlichen Umweltentwicklung,
das Eingang in die Regional- und Bauleitplanung finden kann;
– eine stärkere Einbeziehung der Akteure auf Ebene der Teilflussgebietseinheiten,
ohne dass dabei die Verantwortung der Länder für die Umsetzung der politischen
Ziele der Wasserrahmenrichtlinie vernachlässigt wird, und
– in Anlehnung an die Umsetzungen der WRRL in Großbritannien und den
Niederlanden sollten Kosten-Nutzen-Betrachtungen als Grundlage für die Bereitstellung
von Finanzmitteln dienen.
Die vielfältigen ökologischen und funktionalen Verflechtungen in Flusseinzugsgebieten
machen ein integriertes Landschaftsmanagement in besonderem Maße notwendig,
um die Ziele im Gewässerschutz zu erreichen.
Zur Verbesserung der Situation sollte die Umsetzung der HochwasserRL in nationales
Recht explizit einen engen Bezug zur Raumplanung und zum Naturschutz und
Bodenschutz . Den ganzen Artikel lesen Sie unter:
http://www.umweltrat.de/02gutach/downlo02/umweltg/UG_2008.pdf
(nach oben)
Umweltschutz im Zeichen des Klimawandels – SRU übergibt Umweltgutachten 2008
Das heute an Bundesumweltminister Gabriel überreichte Umweltgutachten 2008
ist die alle vier Jahre erscheinende Gesamtbilanz der deutschen und
europäischen Umweltpolitik. Mit dem Titel „Umweltschutz im Zeichen des
Klimawandels“ unterstreicht der Sachverständigenrat für Umweltfragen die
zentrale Bedeutung des Klimaschutzes, weist aber auch darauf hin, dass andere
Bereiche der Umweltpolitik, insbesondere der Naturschutz, unter Druck geraten
sind. Der SRU plädiert in seinem Umweltgutachten 2008 für eine deutliche
Aufwertung des Naturschutzes in der deutschen Umweltpolitik. Die
Errungenschaften des flächendeckenden, für Klimaschutz und die Anpassung
an den Klimawandel unerlässlichen Naturschutzes sollten bewahrt und
fortentwickelt werden.
Der SRU begrüßt grundsätzlich die nationalen und internationalen
Anstrengungen der Bundesregierung und ihre Entschlossenheit, das
anspruchsvolle 40%-Ziel zur Verringerung der Treibhausgase umzusetzen.
Dennoch reicht das Klimaprogramm (IKEP) hierzu nicht aus. Zugeständnisse,
wie sie teilweise gemacht wurden, bleiben hinter den Innovationspotenzialen
Deutschlands zurück.
Grundlegende Bedeutung für die Erreichung des Klimaschutzziels hat die
anstehende Reform des europäischen Emissionshandels. Der SRU begrüßt den
Ansatz der Europäischen Kommission für eine strenge europaweite
Emissionsbegrenzung und die vollständige Versteigerung der Emissionsrechte.
Der europäische Emissionshandel darf nun nicht durch vermeintliche
Standortinteressen verwässert werden.
Von entscheidender Bedeutung für den Klimaschutz ist auch eine
Innovationspolitik durch Energieeffizienz. Wegen der hohen Energiepreise ist
Klimaschutz durch Energieeffizienz bei Kfz, Produkten und Gebäuden
besonders wirtschaftlich. Insbesondere bei Kraftfahrzeugen sollte die
Bundesregierung daher deutlich ehrgeiziger werden. Die jüngste deutschfranzösische
Initiative zielt jedoch auf eine Verzögerung und Abschwächung des
seit 1995 feststehenden Zieles, bis 2012 einen Durchschnittswert von 120 g
CO2/km zu erreichen.
Die Landwirtschaft trägt in vielen Bereichen maßgeblich zu Umweltbelastungen
bei. Neben einem aktiveren Agrarumweltschutz ist auch eine konsequente
Fortsetzung der Reform der europäischen Agrarpolitik erforderlich. Die
Europäische Kommission hat im Rahmen des sogenannten „Health Check“
Regulierungsvorschläge gemacht, die eine Mittelumverteilung für
Agrarumweltprogramme zur Verbesserung des Klima-, Gewässer- und
Naturschutzes fordern. Deutschland sollte diese Reformvorschläge unterstützen.
Erst eine ausreichende Kofinanzierung der zusätzlichen
Agrarumweltmaßnahmen durch Bund und Länder wird aber zu den angestrebten
Umweltverbesserungen führen können.
Der 1971 eingerichtete Sachverständigenrat für Umweltfragen berät die
Bundesregierung und bewertet die aktuellen politischen Initiativen in allen wichtigen
umweltpolitischen Handlungsfeldern. Das Umweltgutachten 2008 erfasst die
wichtigen Schutzgüter: den Klima-, den Natur- und den Gesundheits- und
Ressourcenschutz.
Die wesentlichen Empfehlungen des Umweltgutachtens 2008 (Kurzfassung), ebenso
wie die Langfassung können unter www.umweltrat.de bezogen werden. Weitere
Informationen erhalten Sie bei Dr. Christian Hey, Tel: 030-26 36 96-0.
Mittwoch, 18. Juni 2008
Pressemitteilung
Sachverständigenrat für Umweltfragen
Reichpietschufer 60 (7. Etage), 10785 Berlin
Telefon 030 / 26 36 96-0; Fax: 030/263696-109
www.umweltrat.de e-mail: sru-info@uba.de
(nach oben)
Membrantechnik zur Abwasserbehandlung
Am 4. und 5. Juni 2007 fand in Berlin die zweite IWA Konferenz zu diesem Thema statt.
Die International Water Association veranstaltet jedes Jahr eine Reihe von Konferenzen und Seminaren zu den Themen Wassermanagement und Abwassertechnik in unterschiedlichen Orten weltweit.
Die Veranstaltung wurde durch das Kompetenzzentrum Wasser Berlin ausgerichtet.Insgesamt 24 technische Vorträge und 30 Posterbeiträge zum Thema und zahlreiche Beiträge von namhaften internationalen Rednern dienten als Basis für einen regen Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern.
Die vollständigen Tagungsunterlagen sind über das Kompetenzzentrum Wasser (ISBN 978 – 3- 9811684 -0 -2 )und zum Download über das Internet verfügbar.
www.mbr-network.eu
Den aussführlichen Artikel kann man in der KA Korrespondenz Abwasser Abfall Heft 7/2008 auf Seite 738 nachlesen
(nach oben)
Wasserwirtschaft stellt neue Leistungsschau vor
Fakten für die politische Diskussion in Europa/
Deutsche Unternehmen bauen hohe Leistungsstandards weiter aus
Die deutsche Wasserwirtschaft hat ihren Leistungsstandard und
ihre wirtschaftliche Effizienz weiter steigern können. Die Zufriedenheit der Kunden
wuchs. Außerdem erreichten die Versorgung mit Trinkwasser und die Abwasserbeseitigung
im internationalen Vergleich vorbildliche Werte. Das zeigt das neue „Branchenbild
der deutschen Wasserwirtschaft 2008″. Die sechs Herausgeber-Verbände* stellten am
Dienstag in Brüssel die englische Ausgabe der neuen Publikation vor. Der 105 Seiten
starke Bericht liefert zum zweiten Mal ein umfassendes Bild der Leistungen und Standards
der deutschen Wasserwirtschaft. Die erste Leistungsschau war 2006 vorgelegt
worden.
„Das Branchenbild entspricht dem Wunsch von Öffentlichkeit und Politik, die Dienstleistungen
der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung transparent zu machen. Wir
sind gespannt, ob sich ähnliche Projekte europaweit durchsetzen werden“, erklärte Tanja
Gönner, Umweltministerin des Landes Baden-Württemberg bei der Präsentation des
neuen Berichtes. Es sei sehr erfreulich, dass die Zahl der Benchmarking-Projekte sowohl
bundesweit als auch in den Regionen stark zugenommen habe.
Nach Angaben der Verbände beteiligten sich 750 Unternehmen der Trinkwasserversorgung
und 1 300 Unternehmen der Abwasserbeseitigung freiwillig an den Projekten. Das
bedeute im Vergleich zu 2005 einen Zuwachs von 15 Prozent. Verglichen wurden sowohl
einzelne Kennziffern als auch gesamte Unternehmen oder Sparten. Außerdem
wurden Prozesse analysiert, um Verbesserungspotentiale zu erschließen.
„Rund sieben Milliarden Euro investierte die deutsche Wasserwirtschaft 2006 in die Infrastruktur“,
betonten die Verbände. Die Branche sei damit ein bedeutender beschäftigungspolitischer
Motor für den Mittelstand. Im europäischen Vergleich, so die Verbände,
weist Deutschland eine hohe Qualität der Leitungsnetze auf und hat die geringsten
Wasserverluste beim Transport zu den Verbrauchern. „Die Verluste konnten seit 1998
nochmals gesenkt werden von rund acht auf knapp sieben Prozent des Brutto-
Wasseraufkommens“, erklärten die Verbände. Das sei der mit Abstand niedrigste Wert
in Europa. Auch bei der Abwasserbeseitigung liege Deutschland mit einem Anschlussgrad
von 96 Prozent an das öffentliche Kanalnetz im europäischen Spitzenfeld. Das Kanalnetz
sei seit 2001 um rund sechs Prozent auf eine Länge von 515 000 Kilometern
ausgebaut worden.
*Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT), Gummersbach; Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft e. V. (BDEW), Berlin; Deutscher Bund verbandlicher Wasserwirtschaft e. V. (DBVW),
Hannover; Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V., Technisch-wissenschaftlicher Verein
(DVGW), Bonn; Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), Hennef;
Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU), Berlin
„Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft 2008“
DIN à 4, farbig, 105 Seiten, Klebebindung, Preis: 29,80 Euro
© 2008 wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Bonn
Weitere Informationen:
Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e.V. (ATT)
Prof. Dr. Lothar Scheuer, Tel. 02261 36-210,
s@aggerverband.de, www.trinkwassertalsperren.de
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)
Patricia Nicolai, Tel. 030 300 199 – 0,
presse@bdew.de, www.bdew.de
Deutscher Bund verbandlicher Wasserwirtschaft e.V.
(DBVW)
Dipl.-Ing. Dörte Burg,Tel. 0511 87966-0,
post@wasserverbandstag.de www.dbvw.de
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.
(DVGW)
Dr. Susanne Hinz, Tel. 0228 9188-610,
presse@dvgw.de, www.dvgw.de
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e.V. (DWA)
Dr. Frank Bringewski, Tel. 02242 872-190,
bringewski@dwa.de, www.dwa.de
Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU)
Rosemarie Folle, Tel. 030 58 58 02 08,
folle@vku.de, www.vku.de/wasser
Baden-Württemberg
UMWELTMINISTERIUM
PRESSESTELLE
Umweltministerium Baden-Württemberg
Pressestelle
Rainer Gessler, Tel. 0711/126-2783
rainer.gessler@um.bwl.de, www.um.baden-wuerttemberg.de
(nach oben)
Wie sie die Abwasserbehandlung der Zukunft aus- 4. 5. 6. Reinigungsstufe?
Am 15. November 2007 veranstaltet der Förderverein des Instituts WAR- Wasserversorgung und Grundwasserschutz, Abwassertechnik, Abfalltechnik, industrielle Stoffkreisläufe, Umwelt- und Raumplanung – der Technischen Universität Darmstadt das 82. Darmstädter Seminar.
Prof. Peter Cornel referierte über potenzielle Anforderungen wie z.B. die weitergehende Entfernung organische Spurenstoffe, die Phosphorrückgewinnung, die Desinfektion des Kläranlagenablauf oder eine weitergehende Nährstoff- Elimination
Brauchen Gewässer noch weitere Behandlungsstufen auf Kläranlagen? Das war Thema von Prof. Dietrich Borchard vom Helmholtz -Zentrum, Magdeburg.
Die Stoff- und Energieströme auf Abwasserbehandlungsanlagen, wurde von Prof. Karl Svardal, Technische Universität Wien vorgetragen
Arzneimittel, Pharmazeutika und endokrinwirksame Stoffe in Abwasserbehandlungsanlagen war das Thema von Prof. Klaus Kümmerer, Universität Freiburg
Ozoneinsatz bei der Abwasserreinigung, Dr. Achim Ried, Wedeco GmbH Herford
Einsatz von Pulveraktivkohle zur Entfernung der organischen Restverschmutzung, Prof. Helmut Kapp, Hochschule Bieberach
Erfolge durch UV-Desinfektion von Kläranlagenabläufen an der Isar, Dr-Ing Bernhard Böhm, München
In dem Tagungsband Nummer 82 sind die Vorträge zusammengefasst und können zum Preis von € 35,- beim Institut WAR, per Fax unter 06151 – 163758 bestellt werden.
(nach oben)
Ökoeffizienz in der Wasserwirtschaft
Ein optimierter und effizienter Energieeinsatz ist für viele Betreiber von kommunalen Kläranlagen stets ein aktuelles Thema. Über 150 Teilnehmer nahmen am 19. November 2007 an der Technischen Universität in Kaiserslautern an einer Tagung teil, die dieses Thema behandelte.
Der Energieverbrauch von Kläranlagen ist in den letzten Jahren bedingt durch die Anforderungen an die Nährstoff-Elimination deutlich gestiegen. Neben den rein wirtschaftlichen Aspekten ist eine energetische Optimierung der Kläranlagen auch unter umweltpolitischen Gesichtspunkten von großem Interesse.
Anerkannte und fachlich ausgewiesenen Referenten gaben den Teilnehmern Information aus erster Hand.
Inhalte waren beispielsweise
– Strategien und Projekte des Landes Rheinland Pfalz
– Energieoptimierung auf Kläranlagen in Rheinland Pfalz ist
– innovative Technologien für einen energieeffizienten Kläranlagenbetrieb
Die Beiträge sind in dem Band 26 der Schriftenreihe SIWAWI der Technischen Universität Kaiserslautern zusammengefasst. Der Band kann für € 20,- bestellt werden bei:
Technische Universität Kaiserslautern
Fachgebietssiedlungswasserwirtschaft
Postfach 3049
67663 Kaiserslautern
(nach oben)
Verfahren für eine zukünftige Klärschlammbehandlung
Klärschlammkonditionierung und Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammasche. So lautet die Dissertation von Christian A. Schaum vom Institut WAR der TU Darmstadt.
In der Dissertation wurden 15 Aschen aus Monoklärschlammverbrennungsanlagen aus Deutschland und von zwei Anlagen aus dem Europäischen Ausland untersucht.
Die Untersuchung ist als Band 185 der WAR -Schriftenreihe erschienen.
Bestellnummer ISBN 3 – 932518 – 81 – 0
(nach oben)
Gezielte Steuerung von Biogasanlagen mittels FOS/TAC
Die optimale Leistung einer Biogasanlage erhält man durch eine gut dosierte,
auf den Vergärungsprozess abgestimmte Zugabe von Substraten. Dafür
muss der Status der Vergärung im Fermenter genau bekannt und über einen
längeren Zeitraum dokumentiert sein. Dies wird mit regelmäßigen, einfach
durchführbaren Labor-Eigenanalysen des FOS/TAC-Wertes erreicht: Der
Betreiber erhält genaue Kenntnis über die Abbauleistung seines Fermenters
und damit über die Biogasproduktion. Potentielle Störungen können durch
eine Änderung des Wertes schnell erkannt und gezielt beseitigt werden. Die
Anlage wird effizienter und kostengünstiger gefahren.
Den ganzen Bericht lesen Sie unter: http://www.hach-lange.de
(nach oben)
Arzneimittel und Industriechemikalien- ein Abwasserproblem
Am 4. September 2007 fand unter diesem Titel das der 25. Bochumer Workshop statt. Die Schwerpunkte waren:
-Toxikologie und Bewertungskriterien für neue Umweltschadstoffe
-Pharmaka und Hormone in der aquatischen Umwelt
-Industriechemikalien in der aquatischen Umwelt
-Müssen die Einträge in Oberflächengewässer reduziert werden
-Was fordern die Europäische Wasser- Rahmen -Richtlinie und anderer Vorschriften
-Bewirtschaftungsansätze zur Reduzierung des Eintrag und Spurenstoffen in den Wasserkreislauf
-Beispiele für Maßnahmen zur Reduzierung des PFT-Eintrags aus Abwasseranlagen in Nordrhein Westfalen
-Spurenstoffelimination im Ablauf kommunaler Kläranlagen
-Membrantechnik, Ozonung und Aktivkohle zur Entfernung von Spurenstoffen aus kommunalem Abwasser
-Elimination von Arzneimitteln in der Kläranlage Neu-Ulm
-separate Erfassung und Behandlung von Krankenhausabwasser am Beispiel des Pilotprojekts Krankenhaus Waldbröhl
Den Tagungsband kann man als Band 54 der Schriftenreihe Siedlungswasserwirtschaft Bochum per Fax unter 0234- 3214503 zum Preis von € 30,- bestellen
(nach oben)
Qualitätsmanagement und in der Wasserwirtschaft
Am 24. und 25. Januar 2008 fand dieses internationales Symposium im Europäischen Patentamt in München mit internationalen Teilnehmern statt.
Eine Kurzfassung der Vorträge sind in einem Band zusammengefasst der beim DWA-Landesverband Bayern unter Telefon 089- 23362590 bestellt werden kann.
(nach oben)
Optimale Nährstoffverhältnisse für die Abwasserreinigung
Um die gesetzlichen Anforderungen an das gereinigte Abwasser einhalten zu können, muss der Kläranlagen-Betreiber den Reinigungsprozess sorgfältig steuern, um möglichen Überschreitungen der Grenzwerte rechtzeitig entgegenzuwirken. Neben den physikalischen und chemischen Verfahren beruht die Abwasseraufbereitung im wesentlichen auf der biologischen Behandlung durch die Mikroorganismen des Belebtschlammes. Für eine optimale Reinigungsleistung sind daher Kenntnisse über die Nährstoffbedürfnisse und die Zusammensetzung des Belebtschlammes von großer Bedeutung. Ursachen, Folgen und Gegenmaßnahmen für ungünstige Nährstoffverhältnisse werden in diesem Bericht dargestellt.
Autor:
Dipl.-Ing. Michael Winkler
Den ganzen Bericht finden Sie unter http://www.hach-lange.de
(nach oben)
Telemetrie für Anlagensicherheit auf höchstem Niveau
Zuverlässigkeit ist besonders bei Regelungen ein zentrales Thema, die entweder
Betriebskosten senken oder Grenzwerte einhalten müssen. Gleich beides wird von der externen Kohlenstoffzugabe auf der Kläranlage in Radolfzell am Bodensee verlangt! Um dieser anspruchsvollen Doppelaufgabe gerecht zu werden, versorgen Prozess-Messgeräte das Leitsystem ständig mit Messdaten und signalisierungen per Telemetrie ihre Einsatzbereitschaft. Deutlich ist seither die Anzahl der Grenzwertüberschreitungen zurückgegangen und die Ersparnis bei der C-Dosierung beläuft sich auf bis zu 8.000 € jährlich.
Den ganzen Bericht findet man unter: http://www.hach-lange.de
(nach oben)