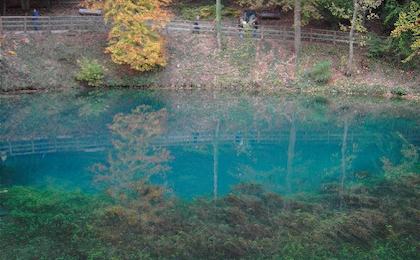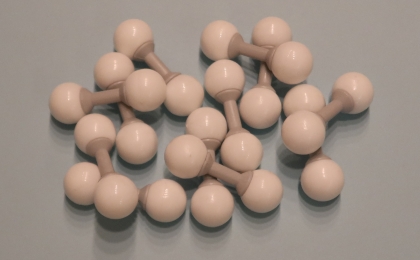Dezember 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
August 2023
Juli 2923
Juni 2023
| BRW | BRW Klärwerk Ohligs – Bau einer Zentratwasseranlage |
| BRW | Ausbildungskooperation für Wasserbauer*innen geschlossen |
Mai 2023
April 2023
März 2023
Februar 2023
Januar 2023
Zweibrücken: So kommt es zu einem Rückstau
Video erklärt Rückstausicherung
Unser Video erklärt Ihnen diese Themen leicht verständlich.
https://www.ubzzw.com/news/neues-video-erklaert-die-rueckstausicherung/
zum Video
Zum Video: https://www.ubzzw.com/servicebereiche/abwasser/rueckstausicherung
Straubinger Stadtentwässerung: Wirtschaftsplan 2024
Werkausschuss beschließt SER-Haushalt
Preissteigerungen in allen Bereichen zwingen die SER zur Anhebung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr
Mitte November wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 der Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung, Eigenbetrieb der Stadt Straubing, dem Werkausschuss vorgestellt. In seiner Sondersitzung beschließt der Stadtrat den Wirtschaftsplan zusammen mit dem Haushalt der Stadt. Neben dem Investitions-, Vermögens-, Finanz- und Stellenplan beinhaltet der Wirtschaftsplan der SER die Ergebnisse aus der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2024 – 2027.
Zum 31.12.2022 weißt die SER eine vorläufige Bilanzsumme von 109,742 Mio. EUR aus.
Für das Jahr 2024 plant die SER mit Umsatzerlösen in Höhe von 18,6 Mio. Euro. Diese beinhalten unter anderem die Einnahmen aus der Veranlagung von Gebühren (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung) sowie aus der Annahme von Fäkalien und Klärschlamm durch Dritte.
https://ser-straubing.de/wirtschaftsplan-2024/
Ruhrverband: Wasserwirtschaft spürt leichte Erholung in krisenhaften Zeiten
Verbandsversammlung in Essen mit positiven Botschaften für die genossenschaftlichen Mitglieder
Die Delegierten der Mitglieder des Ruhrverbands stellten mit ihren Beschlüssen auf der 37. Verbandsversammlung in Essen die Weichen für die wasserwirtschaftliche Arbeit in der Region im kommenden Jahr.
„Der Ruhrverband hat die Auswirkungen der hinter uns liegenden Krisen gut bewältigt und befindet sich stabil auf Kurs. In den nächsten Jahren werden wir massiv in den Substanzerhalt unserer Anlagen investieren, um sie auch für die noch strengeren gesetzlichen Anforderungen, die auf uns zukommen werden, zukunftsfit zu machen.“ Positiv, aber mit der gebotenen Vorsicht bilanzierte Prof. Norbert Jardin, Vorstandsvorsitzender und Technikvorstand des Ruhrverbands, das zu Ende gehende Jahr auf der Verbandsversammlung des Essener Wasserwirtschaftsunternehmens. Traditionell kommen die Delegierten der 60 Städte und Gemeinden, der Trinkwasserwerke und der Industriebetriebe im Einzugsgebiet der Ruhr am ersten Freitag im Dezember zur jährlichen Verbandsversammlung des Ruhrverbands in der Essener Philharmonie zusammen.
Nach mehreren turbulenten Jahren in Folge, die geprägt waren durch Corona, Ukrainekrieg, Energiekrise, massive Lieferengpässe bei wichtigen Betriebsmitteln, Dürre und Hochwasser, erlebte die Wasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 2023 vergleichsweise ruhige Zeiten, in denen unter anderem die im Jahresverlauf spürbaren Rückgänge bei der Inflationsrate, dem Erzeugerpreisindex und dem Strompreis für eine gewisse Entspannung sorgten. Unverändert nach oben zeigen hingegen Baupreise und Bauzinsen mit den höchsten Steigerungen seit über 50 Jahren – durchaus eine Herausforderung für den Ruhrverband, dessen Aufwendungen für den Substanzerhalt seiner Betriebsanlagen schon in den letzten fünf Jahren kontinuierlich gestiegen sind und mit Blick auf den altersbedingten Sanierungsbedarf der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur weiter steigen werden.
Hinzu kommen neue Anforderungen auf politischer Ebene, verdeutlichte der Vorstandsvorsitzende in seinem Vortrag: Unter anderem seien aus der überarbeiteten Kommunalabwasserrichtlinie, der das EU-Parlament in erster Lesung zugestimmt hat, erhebliche Verschärfungen bei den Grenzwerten für die Nährstoff- und Spurenstoffelimination aus dem Abwasser zu erwarten. Um diese zu erfüllen, sind umfangreiche Investitionen notwendig. Ein erstes Beispiel ist die im Herbst 2023 in Betrieb genommene weitergehende Reinigungsstufe auf der Kläranlage Brilon, in die der Ruhrverband rund sechs Millionen Euro investiert hat.
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht erfreulich waren im Jahr 2023 die ergiebigen Regenfälle unter anderem im März, Juli, August und Oktober, die dafür sorgten, dass nach 14 zu trockenen Abflussjahren in Folge erstmals wieder ein Abflussjahr im Ruhreinzugsgebiet mit einem Niederschlagsüberschuss abschloss. Dennoch erinnerte der Vorstandsvorsitzende die Delegierten nachdrücklich daran, dass das in den vorangegangenen 14 zu trockenen Abflussjahren angesammelte Niederschlagsdefizit durch ein einziges nasses Jahr nicht ausgeglichen wird und in der Summe immer noch mehr als ein kompletter Jahresniederschlag in den Böden fehlt. Zudem waren die Abflussjahre 2022 und 2023 die wärmsten, die jemals an der Ruhr gemessen wurden – der Anpassung an die Folgen des menschengemachten Klimawandels bleibt also auch in den nächsten Jahren eine der größten Herausforderungen, denen sich die Wasserwirtschaft an der Ruhr gegenübersieht.
Die Finanz-, Personal- und Verwaltungsvorständin Dr. Antje Mohr konnte für den Finanzbereich trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen ebenfalls Positives verkünden. Denn auch wenn die Inflation, der Tarifabschluss für die NRW-Wasserwirtschaft und weitere wirtschaftliche Herausforderungen ihre Spuren im Wirtschaftsplan hinterlassen haben, liegt die Beitragssteigerung für das Jahr 2024 erneut unter der Inflationsrate. Für die im Verbandsgebiet lebenden Bürgerinnen und Bürger hatte die Finanzvorständin eine besonders gute Nachricht: Obwohl die Siedlungsentwässerung im mittelgebirgsgeprägten Einzugsgebiet des Ruhrverbands mit einem größeren Aufwand verbunden ist als in anderen Gegenden, liegt der Gebührendurchschnitt für einen Vier-Personen-Musterhaushalt im Ruhreinzugsgebiet erstmals seit vielen Jahren sogar wieder unter dem vom Bund der Steuerzahler ermittelten NRW-Durchschnitt.
Auch seinen durch das milliardenschwere Kläranlagenausbauprogramm aufgebauten Schuldenberg, der Mitte der Nullerjahre bei mehr als einer Milliarde Euro gelegen hatte, konnte der Verband im vergangenen Jahr weiter abtragen, so dass die Verschuldung ohne Berücksichtigung der in jüngster Zeit übertragenen Kanalnetze mittlerweile nur noch bei 271 Millionen Euro liegt. Selbst im Wachstumsfeld der Kanalnetzübertragungen konnte die Verschuldung zurückgefahren werden, sie wird allerdings in den kommenden Jahren durch weitere Übertragungen wieder zunehmen. Kanalnetzübertragungen schaffen die Voraussetzung, Siedlungswasserwirtschaft aus einer Hand zu betreiben, Schnittstellen im Kanalsystem vor Ort zu beseitigen und bestehende Einsparpotenziale zu heben. Auch bei der Gewässerunterhaltung kooperiert der Ruhrverband mit mehreren Kommunen in seinem Verbandsgebiet.
Die Delegierten des „Wasserparlaments der Ruhr“ stellten den beiden Vorständen sowie den rund 1.000 Beschäftigten des Ruhrverbands erneut ein gutes Zeugnis aus, denn sie erteilten dem Vorstand für das Wirtschaftsjahr 2022 Entlastung und stimmten den Entwürfen des nächsten Wirtschaftsplans sowie der Finanzplanung für die kommenden fünf Jahre zu. Der Ruhrverband verfügt damit auch weiterhin über den notwendigen Rahmen für seine gesetzliche Kernaufgabe, die Wasserversorgung für 4,6 Millionen Menschen zu sichern.
https://ruhrverband.de/presse/pressemitteilungen/detailansicht/news///ruhrverband-wasserwirtschaft-spuert-leichte-erholung-in-krisenhaften-zeiten/
(nach oben)
Erftverband: 101. Delegiertenversammlung
Die 101. Delegiertenversammlung des Erftverbandes findet am 7. Dezember 2023, 10.30 Uhr, im Bürgerhaus Quadrath, Rilkestraße/Graf-Beißel-Platz, 50127 Bergheim, statt.
Tagesordnung:
Begrüßung sowie Feststellung der form- und fristgerechten Einladung sowie der Beschlussfähigkeit
Niederschrift der 100. (konstituierenden) Delegiertenversammlung
Wahl eines stellvertretenden Verbandsratsmitgliedes
Änderung in der Zusammensetzung der Delegiertenversammlung und ihrer Ausschüsse
Bericht des Vorstandes über die Tätigkeit des Verbandes
Bericht der Rechnungsprüfer über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2023 und Entlastung des Vorstands
Beauftragung einer Prüfstelle für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024
Wahl der Rechnungsprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024
Veranlagungsrichtlinien 2024
Wirtschaftsplan 2024
Bekanntgaben
Terminplan Organ- und Ausschusssitzungen 2024
Presse
Verschiedenes
https://www.erftverband.de/101-delegiertenversammlung-des-erftverbandes/
Erftverband: Naturpark Rheinland bietet kostenfreie Museumstour zur neuen Flut-Ausstellung im Erftmuseum
Im Beisein von Umweltminister Oliver Krischer und zahlreichen, geladenen Gästen eröffnet der Naturpark Rheinland, am Freitag, den 10. November 2023 um 16:00 Uhr, im Erftmuseum die neue Ausstellung „Die Flut 21“.
Rund eineinhalb Jahr dauerte es von der Planung bis zum Umbau der bestehenden Ausstellung im Erftmuseum am Naturparkzentrum Gymnicher Mühle. Die Kosten von rund 120.000 € wurden zu einem großen Teil mit Fördergeld aus dem Landesförderwettbewerb Naturpark.2024.NRW finanziert. Mit Zeitzeugenberichten, interaktiven Stationen und zahlreichem Bild-, Film-, und Tondokumenten werden die Ereignisse der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 an der Erft und ihren Nebenflüssen umfangreich dokumentiert und die komplexen Ursachen und Auswirkungen der Katastrophe erläutert.
Die neue Ausstellung ist im Anschluss für die Öffentlichkeit zugänglich. Damit allen Menschen der Besuch des neuen Museums möglich ist, verzichtet der Naturpark und seine Kooperationspartner Erftverband und Rhein-Erft-Kreis bis Ende 2024 auf den Eintritt.
Darüber hinaus bietet der Naturpark in Kooperation mit der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft REVG unmittelbar nach der Neueröffnung den Bürgerinnen und Bürgern der Anrainerkommunen an Erft und der Swist einen ganz besonderen Service: Im Zeitraum vom 17. November bis zum 9. Dezember werden jeweils freitags und samstags kostenfreie Museumstouren angeboten. Von Nettersheim bis Neuss sowie in Rheinbach und Swisttal starten Busse, die interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Museumsführung ins Erftmuseum bringen. Das Angebot dauert ca. 2 h und besteht aus einer Führung durch die neue Ausstellung und einer kleinen Mitmachaktion, bei der die Renaturierungsmaßnahmen an der Erft im Mittelpunkt steht.
Im Anschluss bringt der Bus die Teilnehmenden wieder an den Ausgangspunkt zurück. Insgesamt stehen 500 Plätze zur Verfügung. Voraussetzung ist ein gültiges Ticket, das ab sofort kostenfrei online gebucht werden kann. Alle Infos unter www.erftmuseum.de
https://www.erftverband.de/naturpark-rheinland-bietet-kostenfreie-museumstour-zur-neuen-flut-ausstellung-im-erftmuseum/
EGLV nehmen Deutschen Nachhaltigkeitspreis entgegen
Offizielle Preisverleihung fand am Donnerstag in Düsseldorf statt
Düsseldorf / Emscher-Lippe-Region. Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) sind am Donnerstagabend in der Landeshauptstadt mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 ausgezeichnet worden. Europas größte Würdigung für ökologisches und soziales Engagement haben die beiden Verbände, gemeinsam der größte Betreiber von Kläranlagen und Pumpwerken in Deutschland, in der Kategorie Unternehmen für die Branche Wasserwirtschaft erhalten.
„Der Preis würdigt nicht nur die ökologische Verbesserung der Wasserläufe in der Emscher-Lippe-Region zu naturnahen Fließgewässern und unseren Beitrag zu mehr biologischer Vielfalt. Für unsere Verbände ist diese Anerkennung durch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ein sehr positives Signal sowohl für unsere kommunalen und industriellen Mitglieder als auch unsere 1.700 Kolleginnen und Kollegen, die täglich an Emscher und Lippe für die Gestaltung einer guten und nachhaltigen Zukunft der Region arbeiten“, sagt Dr. Dorothea Voss. Die Vorständin für Personal und Nachhaltigkeit bei EGLV nahm den Deutschen Nachhaltigkeitspreis am Donnerstag in Düsseldorf entgegen.
Ebenfalls anwesend bei der Preisverleihung waren auch Beschäftigte von EGLV, vom Klärmeister über die Gewässerökologin bis zum Personalrat, sowie der Vorsitzende des Genossenschaftsrates der Emschergenossenschaft. Dr. Frank Dudda, zugleich auch Oberbürgermeister der Emscher-Kommune Herne, sagt: „Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist ein Ritterschlag für das außerordentlich nachhaltige Wirken der beiden Wasserwirtschaftsverbände und ein großer Meilenstein für das Ruhrgebiet auf unserem Weg zur grünsten Industrieregion der Welt.“
Nachhaltige Arbeit zum Wohle der Menschen
Unter den drei Bestplatzierten der Wasserwirtschaft (neben Berliner Wasserbetriebe AöR und hanseWasser Bremen GmbH) hatten sich EGLV in einem stark besetzten Spitzenfeld durchgesetzt. Überzeugt zeigte sich die Fachjury vor allem von den Leistungen von Emschergenossenschaft und Lippeverband zur ökologischen Gewässer- und Auenentwicklung und zur Steigerung der Artenvielfalt in der Region.
Auch das Engagement für die wasserbewusste Stadtentwicklung und die Wiederherstellung des natürlichen Wasserkreislaufs, die bedarfsorientierte wirtschaftliche Betriebsführung von Kanälen und Kläranlagen sowie die zahlreichen Projekte auf dem Weg zum klimaneutralen Unternehmensbetrieb flossen mit in den Jury-Entscheid ein.
Gewürdigt wurde von der Jury zudem, dass EGLV bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in vielen Good-Practice-Beispielen Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft aktiv einbinden und viele Organisationen und Menschen von den Aktivitäten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) profitieren.
Emschergenossenschaft und Lippeverband
Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) sind öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten Emschergenossenschaft sind unter anderem die Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie der Hochwasserschutz. Der 1926 gegründete Lippeverband bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und Lippeverband rund 1.700 Beschäftigte und sind Deutschlands größter Abwasserentsorger und Betreiber von Kläranlagen (rund 782 Kilometer Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle, 546 Pumpwerke und 69 Kläranlagen).
https://www.eglv.de/medien/eglv-nehmen-deutschen-nachhaltigkeitspreis-entgegen/
Dresden: Neues Abwasserbeseitigungskonzept für Dresden
Ein Schwerpunkt ist die Ableitung und Behandlung der Abwässer der im Dresdner Norden ansässigen und sich erweiternden Halbleiterindustrie. Die Produktion von Chips erzeugt große Abwassermengen, deren Ableitung und Behandlung auf der Kläranlage in Kaditz nur durch adäquate Ausbaumaßnahmen zu bewältigen ist. Dazu gehört der im Juli 2023 begonnene Bau des Industriesammlers Nord. Das ist ein etwa elf Kilometer langer Kanal, der fast ausschließlich der Ableitung der Abwässer der Halbleiterindustrie dient. Noch größer sind die Herausforderungen auf der zentralen Kläranlage Kaditz. Sie muss erweitert werden. Die Gesamtinvestitionen für deren Erweiterungen und Erhalt der baulichen Substanz werden sich über die nächsten 13 bis 15 Jahre erstrecken und über 600 Millionen Euro kosten.
Jähnigen weiter: „Das Abwasserbeseitigungskonzept enthält aber auch Antworten auf die aktuellen globalen Fragen unserer Zeit. Wie lässt sich der Energiebedarf reduzieren? Wie können wir den Anteil regenerativer Energien bzw. der Eigenenergieerzeugung erhöhen? Wie lassen sich CO2-Emissionen reduzieren, wie entfernen wir Mikroschadstoffe aus dem Abwasser? Klima- und Umweltschutz spielen in der Abwasserbeseitigung eine große Rolle. Das ist mir besonders wichtig. Und: Trotz all dieser Maßnahmen werden wir die Beiträge im Vergleich zu anderen Preissteigerungen sehr stabil halten können.“
Bis zu 600.000 Einwohner bis 2035
Ralf Strothteicher, Leiter des Eigenbetriebes Stadtentwässerung, ergänzt: „Jetzt geht es darum, das Abwassersystem für weitere Jahrzehnte zukunftssicher zu gestalten. Deshalb wurde mit ‚Dresden 600‘ ein Strategieprojekt entwickelt, um die Anlagen fit für die Zukunft zu machen. Mit diesem Projekt analysieren wir seit Jahren, wie unsere technische Infrastruktur ausgebaut werden muss, um dem Bevölkerungswachstum und dem Zuwachs der Industrie gerecht zu werden“. Der Name des Projekts ist von der Perspektive der Großstadt abgeleitet. Hatte Dresden 2010 noch 517.052 Einwohner, so waren es Anfang 2023 bereits 569.173. Die Bevölkerung könnte insbesondere durch die anstehenden Industrieansiedlungen auf bis zu 600.000 Einwohner im Jahr 2035 anwachsen.
240 Prozent mehr Abwasser in der Industrie
Vor allem wegen großer Industrieansiedlungen im Dresdner Norden zwischen Hellerau, Wilschdorf und Klotzsche sind die Abwassermengen in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Dieser Trend wird sich fortsetzen. 8,7 Millionen Kubikmeter leiten allein die Werke von Globalfoundries, Infineon, Bosch und X-Fab ins Dresdner Kanalnetz ein. Das entspricht 93 Prozent der Dresdner Industrie-Abwässer. Die Abwassermenge aus der Chipindustrie entspricht der von 250.000 Einwohnern. Mit der Erweiterung von Infineon an der Königsbrücker Straße und dem geplanten Werk des taiwanesischen Chipherstellers TSMC im Rähnitzer Gewerbegebiet wird die Abwassermenge aus der Industrie um bis zu 240 Prozent steigen. Zudem soll die Schmutzfracht im Abwasser um 80 Prozent zunehmen, beim Stickstoff sogar um 250 Prozent.
Verschärfte Anforderungen durch EU-Richtlinie
Ende 2022 wurde ein Entwurf der neuen europäischen Abwasserrichtlinie veröffentlicht. „Daraus ergeben sich verschärfte Anforderungen an die Abwasserbehandlung“, so Ralf Strothteicher. So sollen die Grenzwerte für Phosphor und Stickstoff weiter gesenkt werden. „Voraussichtlich müssen wir auch eine vierte Reinigungsstufe zur Behandlung von Mikroschadstoffen bauen“, verweist er auf eine weitere Konsequenz. Damit könnten Medikamente, Haushalts- und Industriechemikalien aus dem Abwasser entfernt werden. Sowohl die Kläranlage Kaditz als auch das Kanalnetz sollen so ausgebaut werden, dass das System nicht überlastet wird und das Abwasser sowie der zusätzliche Klärschlamm entsprechend der Vorgaben behandelt werden können.
Der 1. Plan: Industriesammler für Halbleiterindustrie
Mit der neuen Infineon-Chipfabrik wäre das vorhandene Kanalnetz überlastet. Deshalb baut die Stadtentwässerung bis 2026 den Industriesammler Nord für die Abwässer der Mikroelektronik-Betriebe. Mit dem rund 70 Millionen Euro teuren Großprojekt sollen das rechtselbische Kanalnetz entlastet und die Möglichkeiten für die weitere industrielle Entwicklung geschaffen werden. Künftig wird das Abwasser direkt von den Gewerbegebieten zur Kläranlage geleitet. Damit entsteht neben dem Altstädter und dem Neustädter ein dritter großer Abfangkanal in Dresden.
Der 2. Plan: Neue Becken und dritter Faulturm
Damit das zusätzliche Abwasser im Klärwerk Kaditz ordentlich behandelt werden kann, investiert die Stadtentwässerung zwischen 2024 und 2030 in weitere Anlagen. Strothteicher: „Das Herzstück des Klärwerks, die biologische Reinigung, soll ausgebaut werden. Die Belebungs- und Verteilerbecken fassen insgesamt 144.000 Kubikmeter. Geplant sind zwei weitere Belebungsbecken, die 32.000 Kubikmeter fassen“. Die vorhandenen sechs Nachklärbecken sollen durch zwei weitere ergänzt werden. Geplant ist außerdem, in der Schlammbehandlung einen dritten, 35 Meter hohen Faulturm zu errichten, der rund 10.500 Kubikmeter Schlamm fasst.
Der 3. Plan: Neue Einlaufgruppe und 4. Reinigungsstufe
In einem weiteren Schritt sollen zwischen 2029 und 2036 Anlagen und Gebäude neu gebaut oder ersetzt werden. Am Zulauf zur Kaditzer Kläranlage kommt immer mehr Abwasser an. „Das ist das hydraulische Nadelöhr unserer Kläranlage“, sagt der Eigenbetriebsleiter. „Deshalb soll eine neue, leistungsfähigere Einlaufgruppe mit Sandfang, Rechen und Pumpwerk auf der früheren Vonovia-Fläche vor dem Klärwerk gebaut werden. Die hatte die Stadt 2019 für die der Erweiterung der Kläranlage erworben. Da dortige Grundstücke noch vermietet sind, kann der Bau nicht früher beginnen“, erklärt Strothteicher. Geplant ist zudem, auf der Fläche neben den Nachklärbecken die Anlagen der vierten Reinigungsstufe zu bauen.
Der 4. Plan: Mehr Stauraum zum Gewässerschutz
Regnet es stark, wird derzeit Mischwasser in fünf Regenüberlaufbecken zurückgehalten. So läuft es nicht in die Elbe oder andere Gewässer über und belastet sie. Die beiden größten Regenüberlaufbecken im Klärwerk und neben der Waldschlößchenbrücke in Johannstadt fassen rund 36.000 Kubikmeter. Außerdem wird mit elf Steuerbauwerken das Speichervolumen des Kanalnetzes genutzt. In den Regenüberlaufbecken und im Kanal können derzeit rund 95.000 Kubikmeter Abwasser angestaut werden. „Geplant ist, zwischen 2032 und 2038 unter anderem neun Regenüberlaufbecken in Dresden zu errichten“, kündigt der Eigenbetriebsleiter an. Sie sollen ein Speichervolumen von 35.000 bis 40.000 Kubikmeter haben.
https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/journal-1/detail/neues-abwasserbeseitigungskonzept-fuer-dresden/
BRW: Verbandsversammlung wählt neuen Vorstand, Vorsitzenden und seine beiden Stellvertreter
Der Einladung zur 58. Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands sind in diesem Jahr zahlreiche Mitglieder, Vorstandsmitglieder und weitere Gäste gefolgt. Von den möglichen 1.000 Stimmen sind 99,2% vertreten. Die Delegierten wählen aus ihrer Mitte den neuen Vorstand sowie einen Vorsitzenden und seine beiden Vertreter. Damit kommen die stimmberechtigten Vertreter/innen aus Kommunen und Gewerbe ihrem Wahlrecht nach, für die nächsten 5 Jahre das ehrenamtlich agierende Gremium zu bestimmen, das maßgeblich über die Geschicke des Verbandes entscheidet. Sowohl der neu gewählte Vorsitzende, Herr Thorsten Schmitz, Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Erkrath, als auch hauptamtliche Geschäftsführer, Herr Dipl.-Ing. Engin Alparslan zeigen sich sehr erfreut, dass auch für die nächste Amtsperiode eine große Anzahl engagierter Gremienmitgliedern für die gemeinwohlorientierte Zusammenarbeit ernannt werden können. Sie bedanken sich bei den Mitgliedern ausdrücklich für die aufrichtige Unterstützung. 1. stellvertr. Vorsitzender ist Herr Dipl.-Ing Holger Streuber, Rheinkalk GmbH in Wülfrath und 2. stellvertr. Vorsitzender ist Herr Thomas Küppers, M.Sc., Fachbereichsleiter Stadtentwicklung der Stadt Langenfeld.
Berlin: Mehr Schutz für saubere Seen
Bis 2025 sollen rund 300.000 Kubikmeter unterirdischer Stauraum für Mischwasser in den Innenbezirken geschaffen werden. Dafür investieren das Land Berlin (60%) und wir (40%) rund 140 Millionen Euro. 253.000 Kubikmeter sind schon geschafft. Hinter den Zahlen verbergen sich über 80 spannende Bauprojekte, Anlagen und Technik, die allesamt ein Ziel haben: die Qualität unserer Gewässer, der Flüsse und Seen zu verbessern. Warum, wie und wo wir bauen, erfahren Sie hier.
https://www.bwb.de/de/gewaessergueteprogramm.php
Böblingen – Sindelfingen: Der Weg des Wassers auf der Kläranlage
Zur Reinigung der Gewässer, die in der Kläranlage ankommen werden unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Zunächst gibt es eine mechanische Reinigung, in der maschinell und durch physikalische Verfahren der Grobschmutz entfernt wird. In einem zweiten Schritt durchläuft das Wasser eine biologische Reinigung, während der das Wasser durch Bakterien und biologische Vorgänge weiter gereinigt wird. Bei der chemischen Reinigung im dritten Schritt können durch dosierte Zugabe von Eisensalz die im Wasser gelösten Phosphate ausgefiltert werden.
Die Anlage in Sindelfingen zeichnet sich durch ein vierstufiges Reinigungssystem aus: Im letzten Schritt werden durch Aktivkohlebehandlung Arzneimittelrückstände und hormonwirksame Stoffe gefiltert.
https://www.zvka-bb-sifi.de/klaerwerke/der-weg-des-wassers-in-sindelfingen
OOWV: Lehrkräfte werden AQUA-AGENTEN
Fortbildungsangebot für Lehrkräfte
Nordwesten. Bereits seit 2017 bietet die Abteilung Umweltbildung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) Fortbildungen für Lehrkräfte an, in denen sie den „AQUA-AGENTEN-Koffer“ kennenlernen können. Das interaktive und BNE-zertifizierte (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) Bildungsangebot der Umweltstiftung Michael Otto für dritte und vierte Klassen beinhaltet eine Lernwerkstatt mit umfangreicher Materialsammlung und Aufgaben zu den Themen Wasserversorgung, Wasserentsorgung, Lebensraum Wasser und Gewässernutzung.
Voraussetzung für den Erhalt eines „AQUA-AGENTEN-Koffers“ ist die einmalige, kostenlose Teilnahme an einer etwa dreistündigen Fortbildung.
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2023/september/28/artikel/lehrkraefte-werden-aqua-agenten
Prisdorf: Regenrückhaltebecken Hudenbarg wird entschlammt
AZV Südholstein stellt volle Leistungsfähigkeit wieder her
Voraussichtlich ab Montag werden im Auftrag des AZV Südholstein Entschlammungsarbeiten im Regenrückhaltebecken Hudenbarg in Prisdorf durchgeführt. Die Arbeiten sind notwendig zur Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit des Beckens als abwassertechnischer Anlage. Der Dorfgemeinschaftsplatz ist während der Arbeiten nur eingeschränkt nutzbar, auf der Straße Hudenbarg ist phasenweise mit Beeinträchtigungen durch Baustellenverkehr zu rechnen.
Regenrückhaltebecken erfüllen als technische Anlagen eine wichtige Funktion bei der kontrollierten Ableitung von Regenwasser und damit bei der Verhinderung von Überschwemmungen. Um ihre volle Leistungsfähigkeit zu erhalten, müssen sie regelmäßig gewartet und gereinigt werden: Mit dem Regenwasser aus der Kanalisation gelangen Feststoffe wie Sand und Laub in die Becken. Sie bilden mit der Zeit dort Schlammablagerungen, die das Fassungsvermögen stetig verkleinern und die Reinigungsleistung des Rückhaltebeckens vermindern.
In Prisdorf hat das Regenrückhaltebecken Hudenbarg den Punkt erreicht, an dem durch Entschlammungsarbeiten die Wiederherstellung des notwendigen Volumens erforderlich wird. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich ab dem 16. Oktober und werden im Sinne der erfolgten Abstimmung und Genehmigung verschiedener Behörden (Naturschutz, Wasser, Bodenschutz und Bau) in mehreren Abschnitten durchgeführt. Im Oktober 2024 folgt ein zweiter Abschnitt. Ein vom AZV Südholstein beauftragtes Unternehmen wird mit einem Schwimmbagger den Schlamm aufnehmen und in einen Geotextilschlauch pumpen. Aus diesem kann das Schlammwasser austreten, das trockene Material wird anschließend abgefahren. Dieser Schlauch lagert für einige Wochen auf dem Dorfgemeinschaftsplatz vor dem Becken. Nach Abschluss der Maßnahme wird der ursprüngliche Zustand des Platzes wiederhergestellt.
Während der Entschlammungsarbeiten sind stundenweise Beeinträchtigungen der Zufahrtswege in der Straße „Hudenbarg“ durch Baustellenverkehr möglich. Dafür bittet der AZV Südholstein um Verständnis.
https://www.azv.sh/aktuelles/pressebereich/prisdorf-regenrueckhaltebecken-hudenbarg-wird-entschlammt
Ruhrverband: Abwasserreinigung am Beispiel der Kläranlage Duisburg-Kaßlerfeld
Das Ruhrmündungsgebiet mit der Stadt Mülheim und den zur Ruhr hin entwässernden Teilen von Oberhausen und Duisburg ist eine der bevölkerungsreichsten Regionen des Ruhrgebiets. Im Einzugsgebiet leben rund 300.000 Menschen. Sie produzieren etwa zwei Drittel der Abwassermenge, die in der Kläranlage Duisburg-Kaßlerfeld gereinigt wird. Das übrige Drittel stammt aus gewerblichen und industriellen Betrieben. Insgesamt beträgt der Zufluss bei Trockenwetter 2,3 Kubikmeter pro Sekunde. Der maximale Zufluss bei Regenwetter ist auf 4,1 Kubikmeter pro Sekunde bemessen. Das Einzugsgebiet weist ein äußerst vielschichtiges Bild auf – einerseits mit vielen Waldflächen und Gartenanlagen, andererseits geprägt von der Stahlindustrie. Zudem ist die Region ein Verkehrsknotenpunkt von internationaler Bedeutung, in dem sich die Transportsysteme von Schifffahrt, Schiene und Straße sowie Rohrleitung bündeln. Ein deutliches Zeichen hierfür ist der Duisburger Hafen, auf den die 40 Meter hohen Faulbehälter der Kläranlage einen hervorragenden Rundblick erlauben.
Planung und Genehmigung
Bereits 1954 ging in Duisburg-Kaßlerfeld ein erstes Klärwerk in Betrieb. Es bestand aus einer mechanisch-chemischen Reinigungsstufe mit Rechen, Sandfang und Absetzbecken sowie einem Faulbehälter und Schlammlagerplätzen. Schon Anfang der 1970er-Jahre wurde eine erste Planung für eine mechanisch-biologische Anlage erstellt, die unter anderem eine Schlammverbrennung vorsah. Diese wurde jedoch nicht genehmigt, da damals die vorhandenen Belastungen der Luft die zulässigen Immissionswerte bereits überschritten.
In der 1982 zur Genehmigung eingereichten Neuplanung war die biologische Stufe für den Kohlenstoffabbau bemessen. Sie musste im Zuge des Planfeststellungsverfahrens so geändert werden, dass auch eine Nitrifikation des Ammoniums ermöglicht wurde. Durch den Planfeststellungsbeschluss vom 1. September 1987 wurde der Entwurf des Ruhrverbands zur Erneuerung des Klärwerks Duisburg-Kaßlerfeld genehmigt. Aufgrund von Änderungen der Abwassergesetze werden heute jedoch noch wesentlich schärfere Anforderungen an die Reinigungsleistung von Kläranlagen mit über 100.000 Einwohnerwerten gestellt.
Damit das Klärwerk Duisburg-Kaßlerfeld diese Anforderungen erfüllen kann, wurde der abwassertechnische Teil des Entwurfs nach Erteilung der Genehmigung erneut überarbeitet, sodass eine gezielte Nitrifikation und Denitrifikation sowie die Phosphatelimination möglich sind. Die Umplanungen wurden im Sommer 1989 durch Planfeststellungsänderungsbeschluss in die bereits erfolgte Genehmigung aufgenommen. Wegen ihrer Bedeutung für die infrastrukturelle Entwicklung im Einzugsgebiet förderte das Land Nordrhein-Westfalen die Neubaumaßnahmen in Duisburg-Kaßlerfeld im Rahmen des Programms „Zukunftsinitiative Montanregionen (ZIM)“ mit bis zu 80 Prozent der Investitionskosten. Damit wurde dem Ruhrverband maßgeblich bei der Lösung der vorhandenen wasserwirtschaftlichen Probleme geholfen.
Bautechnik und Projektmanagement
Ende 1988 begannen die Bauarbeiten, Mitte 1992 war der Rohbau abgeschlossen. Eine große Herausforderung bestand darin, dass die bisherige Reinigungsleistung und die Vorflut des Abwassers während der gesamten Bauphase gewährleistet sein mussten.
Zunächst wurde das Klärwerksgelände mit einer umlaufenden, 60 Zentimeter dicken Dicht- und Schlitzwand, die bis zu 45 Meter in den Untergrund hinabreicht, gegen steigendes Grundwasser geschützt. Erforderlich war diese bautechnisch sehr aufwendige Maßnahme, weil aus betriebswirtschaftlichen Gründen auf ein Zulaufpumpwerk verzichtet wurde und die Becken der Abwasserreinigung somit unter dem vorhandenen Geländeniveau liegen.
Der Neubau der Kläranlage Duisburg-Kaßlerfeld war mit veranschlagten 320 Millionen D-Mark die bist dahin größte Einzelinvestition im Abwasserbereich des Ruhrverbands. Um die engen Zeitvorgaben und den Kostenrahmen einzuhalten, wurde für die Gesamtmaßnahme eine EDV-gestützte Termin- und Kostenverfolgung installiert. Das erfolgreiche Projektmanagement und die Qualität der eingesetzten Überwachungs- und Steuerungsmechanismen zeigten sich in der termingerechten Inbetriebnahme der verschiedenen Anlagenteile, der Einhaltung des Kostenrahmens und den späteren Betriebsergebnissen.
Abwasserbehandlung
Die mechanische Reinigungsstufe in Duisburg-Kaßlerfeld umfasst eine vierstraßige Rechenanlage, einen unbelüfteten Sandfang und ein Vorklärbecken. Das Rechengut wird entwässert und über Transportbänder in Container abgeworfen. Die gesamte Anlage ist aus Emissionsgründen und zur Sicherstellung des Winterbetriebes in einem geschlossenen Gebäude untergebracht.
Nach Durchfließen der vier Langsandfangkammern gelangt das Abwasser in die Vorklärung. Diese wurde aufgrund der für die Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphatelimination erforderlichen Umplanungen auf 5.200 Kubikmeter Gesamtvolumen, verteilt auf vier Becken, verkleinert und dient mit 0,6 Stunden Aufenthaltszeit nur noch der Grobentschlammung.
Die biologische Reinigungsstufe nach dem Prinzip des Belebungsverfahrens umfasst zwei Umlaufbecken mit insgesamt 60.000 Kubikmetern Inhalt für simultane Nitrifikation und Denitrifikation. Zusätzlich sind zwei Denitrifikationsbecken mit rund 10.000 Kubikmetern Volumen vorgeschaltet, in denen auch eine biologische Phosphatelimination erfolgen soll. Die Rezirkulation in die Denitrifikationsbecken ist auf den dreifachen Trockenwetterzufluss bemessen. Die Umlaufbecken sind mit einer feinblasigen Druckluftbelüftung und separater Umwälzung ausgerüstet. Pro Becken wurden acht abschaltbare Belüftergruppen installiert. Das gesamte Belüftungssystem ist für 65.000 Normkubikmeter Luft pro Stunde ausgelegt.
Die Trennung des Belebtschlamms vom gereinigten Abwasser erfolgt in der Nachklärung, die aus fünf Rechteckbecken besteht. Die Nachklärbecken sind insgesamt 40.000 Kubikmeter groß. Der abgesetzte Schlamm wird mit jeweils zwei Schildräumern geräumt. Aufgrund der kleinen Vorklärbecken wird der Überschussschlamm separat eingedickt. Das gereinigte Abwasser läuft durch gelochte Rohre ab. Außerdem verfügt die Anlage Duisburg-Kaßlerfeld über eine chemische Reinigungsstufe (Simultanfällung) zur Phosphorelimination.
Betrieb und Kontrolle
Die personelle Besetzung des Klärwerks Duisburg-Kaßlerfeld berücksichtigt eine ständige Überwachung der Anlage im Dreischichtbetrieb. Trotz einer weitgehenden Automatisierung des Betriebes ist die zentrale Warte im Betriebsgebäude stets besetzt. Sämtliche für den Betrieb und die Überwachung der Anlage relevanten Informationen laufen in der zentralen Warte zusammen und werden dort zur Unterstützung des Bedienpersonals von einem Prozessrechner aufbereitet. Neben der zentralen Warte wird der Betrieb wesentlicher Anlagenteile wie Energiestation, Schlammentwässerung, Schlammfaulung und Überschussschlammeindickung von Unterwarten aus bedient.
Um den Reinigungsprozess entsprechend den gesetzlichen Anforderungen zu steuern und zu überwachen sowie eine Optimierung z. B. der Energiekosten zu erzielen, wurden auf dem Klärwerk umfangreiche energie-, mess- und regeltechnische Einrichtungen installiert. Einen besonderen Schwerpunkt bildet hierbei die MSR-Technik für den Betrieb der Belebungsstufe.
Die Neufassung verschiedener Gesetze und Verordnungen verlangt von den Betreibern kommunaler Abwasseranlagen verstärkte Anstrengungen zur Eigenkontrolle. Hierzu gehören u. a. die strenge Überwachung der Mindestanforderungen, die Erfassung zusätzlicher Parameter unterschiedlichster Art und die Dokumentation des ordnungsgemäßen Betriebsablaufes. Zulauf und Ablauf des Klärwerks, aber auch die internen Abwasser- und Schlammströme werden nicht nur durch kontinuierlich arbeitende Analysegeräte überwacht, sondern vor allem vom Betriebslabor des Klärwerks und darüber hinaus vom Zentrallabor des Ruhrverbands in Essen untersucht.
Die Betriebsdaten werden in Protokollen festgehalten, können jedoch auch in Form von Diagrammen ausgedruckt werden.
Durch die intensive Selbstüberwachung des Klärwerks wird sichergestellt, dass die vom Gesetzgeber vorgegebenen niedrigen Ablaufwerte eingehalten werden.
Umweltfreundliche Technik
Die Abwasserreinigung hat umweltpolitische Bedeutung für den Schutz der Oberflächengewässer und die damit verbundenen Ökosysteme. Als ökologische Teildisziplin muss umweltbewusste Abwasserentsorgung heute mehr leisten, als nur die technischen Voraussetzungen zur Abwasserentsorgung zu schaffen. Emissionsschutz, Schonung wertvoller Ressourcen, Recyclingstrategien und Abfallminimierung markieren einige der Umweltaufgaben moderner Abwasserentsorgung.
So wurde beispielhaft zur Verwertung des bei der Schlammfaulung anfallenden Gases auf der Kläranlage Duisburg-Kaßlerfeld ein innovatives Konzept realisiert. Die Energiestation ist mit fünf Gasmotoren bestückt, bei deren Auswahl auf eine verbesserte Umweltverträglichkeit geachtet wurde. Zwei der Motoren sind direkt mit Turbogebläsen (je 500 Kilowatt) und einer mit einem Generator (750 Kilowatt) gekoppelt. Die beiden restlichen Gasmotoren (je 500 Kilowatt) sind als Tandemaggregate ausgerüstet, sodass hiermit einerseits durch Turbogebläse die Druckluft für die Belüftung der Belebungsbecken und andererseits über Generatoren elektrische Energie für den Klärwerksbetrieb erzeugt werden kann. Zur Erzielung eines höheren Wirkungsgrads wird nach dem System der Kraft-Wärme-Kopplung die Abwärme der Gasmotoren über Wärmetauscher zurückgewonnen.
Zur weiteren Verbesserung der Wärmebilanz wird in Duisburg-Kaßlerfeld zudem ein Schlamm-Schlamm-Wärmetauscher (Rekuperator) eingesetzt. In ihm wird der in die Faulbehälter gepumpte Rohschlamm mit dem abfließenden warmen Faulschlamm zum Wärmetausch gebracht. Ziel des gesamten Energiekonzeptes ist es, die Nutzung der vorhandenen Ressourcen wie Klärgas oder Abwärme aus den Gasmotoren oder dem Faulschlamm zu optimieren, um so den Bezug externer Energiequellen auf ein Minimum zu reduzieren. Zur Vermeidung störender Lärmemissionen wurden für die Energiestation ebenso wie für andere Lärmquellen umfangreiche Schallschutzmaßnahmen vorgesehen.
Architektonische Gestaltung
Bestimmend für die Gestaltung der Gesamtanlage und der einzelnen Bauten war die Lage parallel zum Ruhrlauf in einer durch Industriebauten geprägten Umgebung. Die Anlage konnte aufgrund ihrer Ost-West-Ausrichtung und flächenmäßigen Ausdehnungsmöglichkeit entlang der Ruhr sehr konsequent linear durchgeplant werden. Durch den modularen Aufbau der Beckengruppe entstanden deutlich abgegrenzte Funktionsbereiche der Anlage. Die Stellung der Hochbauten setzt die klare Konzeption der Anlage fort: Linearität, Horizontalität und Rechtwinkligkeit, ruhige Silhouetten, Schaffung von klar definierten Räumen.
Die Hochbauten wurden in ihren Dimensionen behutsam gestaltet und als Einzelbauten zu Gruppen zusammengefasst. Dabei wurde durch sich wiederholende Materialien und Formelemente für Einheitlichkeit des Ganzen gesorgt. Dies wird unterstützt durch die Wahl elementarer Formen für die Baukörper (Kubus, Kreissegment und Bogen), wobei gewählte Form und Funktion stets eine in sich schlüssige Einheit bilden sollen. Die so entstandene unverwechselbare technische Architektur lebt in ihrer Zurückhaltung und der Konzentration auf das Wesentliche sowie durch den Gegensatz zur uneinheitlichen Umgebung der Anlage.
Für die äußere Gestaltung wurden vorgehängte, beidseitig pulverbeschichtete Aluminiumfassaden teils als Trapezblech, teils als Formblech verwandt; ein glattes Material, das widerstandsfähig gegen die Industrieluft in dieser Region ist und keine Angriffspunkte für übermäßige Verschmutzung bietet. Die Kombination von Trapezblechen und Glattblechen sowie deren farbliche Abstimmung erbrachte die gewünschte Auflockerung der teils großen Fassadenflächen.
Gestalterisches Element sind zudem die abgerundeten glatten Eckausbildungen der Gebäude sowie als oberer Attikaabschluss die gebogenen Trapezblechelemente. Die sorgfältige Gestaltung dieser Details erschien notwendig, um den Gebäuden einerseits eine ablesbare Einheitlichkeit zu verleihen, andererseits durch Farb- und Materialwahl den Gebäuden einen Ausdruck der Leichtigkeit zu geben. Die Farb- und Materialwahl des Innenausbaues setzte das zurückhaltende äußere Erscheinungsbild fort. Für das farbliche Konzept der maschinellen Anlagenteile wie Pressen, Pumpen, Motoren, Behälter wurden bewusst kräftige, klare Farben gewählt, um einerseits der Eintönigkeit von Betonwänden entgegenzuwirken und andererseits die unterschiedlichen Funktionen der einzelnen Aggregate erkennbar werden zu lassen.
https://www.ruhrverband.de/abwasser/klaeranlagen/beispiel-kasslerfeld/
OOWV: Fast alle Nachwuchskräfte bleiben über Ausbildung hinaus beim OOWV
13 junge Männer feiern Berufsabschluss
Nethen. Zwölf der 13 jungen Menschen, die in diesem Sommer ihre Ausbildung beim Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) erfolgreich abgeschlossen haben, halten dem Verband die Treue. „Das freut uns sehr und macht uns stolz“, sagte OOWV-Geschäftsführer Karsten Specht bei einer kleinen Feierstunde im Wasserwerk Nethen am Donnerstag. Gemeinsam mit den Ausbildungsleiterinnen Sabrina Krüger und Thekla Plump würdigte Specht den Einsatz der 13 jungen Männer – Frauen waren in diesem Abschlussjahrgang nicht vertreten, im aktuellen Jahrgang ist das wieder anders. Fünf der Ausgelernten sind nun Fachkräfte für Abwassertechnik, zwei für Wasserversorgungstechnik. Hinzu kommen je zwei Industriekaufleute, Rohrleitungsbauer und Fachinformatiker. Zu ihnen zählt Frederik Berger, der sich durch seine sehr guten Leistungen eine Auszeichnung der Industrie- und Handelskammer verdiente.
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2023/august/24/artikel/fast-alle-nachwuchskraefte-bleiben-ueber-ausbildung-hinaus-beim-oowv
EVS: investiert rund 10 Millionen Euro in die energetische Optimierung der Kläranlage in Saarbrücken-Brebach
Umweltministerin Petra Berg informierte sich vor Ort über das Projekt
Um künftig den im Rahmen der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlamm bzw. das hieraus zu gewinnende Klärgas energetisch nutzen zu können, wurde im Juli 2021 mit dem Umbau der Kläranlage zu einer Anlage mit Klärschlammbehandlung im Faulturm begonnen.
Am 11. August war Umweltministerin Petra Berg vor Ort, um sich über das komplexe Bauprojekt zu informieren.
„Kläranlagen sind unverzichtbarer Bestandteil der Wasserwirtschaft, denn sie reinigen das Abwasser und sorgen somit für eine höhere Qualität von Gewässern. Für diese Arbeit benötigen sie jedoch eine große Menge Strom“, sagt Berg. „Angesichts des Klimawandels sind die in Brebach durchgeführten Maßnahmen zur Energieoptimierung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes sehr zu begrüßen und können hoffentlich bald auch in anderen Kläranlagen umgesetzt werden. Der EVS leistet so bewusst einen Beitrag zum Klimaschutz.“
Die Kläranlage als Strom- und Wärmeerzeugerin
Der auf der Kläranlage Brebach anfallende Schlamm wird in Faulbehältern so behandelt, dass energiereiches Gas entsteht, das zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden kann. Das bautechnisch anspruchsvolle Verfahren erfordert vergleichsweise hohe Investitionen, jedoch senkt die gewonnene Eigenenergie – ca. 3,2 Millionen kWh/a – die Energiekosten deutlich, zudem wird der ökologische Fußabdruck erheblich verbessert (- 2 Millionen kg/a).
Künftig wird die Kläranlage Brebach ihren Strombedarf zu rund zwei Dritteln und ihren Wärmebedarf komplett durch die Nutzung der Energiepotenziale aus den Abwasserreinigungs- und Klärschlammbehandlungsprozessen decken. Ein weiterer positiver Effekt der Umstellung ist die Reduzierung des Schlammvolumens, die bewirkt, dass die Entsorgungskosten sinken und weniger Transporte über die Straße nötig werden.
Alle im Rahmen der Verfahrensumstellung benötigten neuen Bauwerke und Anlagenteile werden auf der Position eines der drei vorhandenen bisherigen Belebungsbecken errichtet, das dafür außer Betrieb genommen wird. Für die Umsetzung der Baumaßnahme und den Betrieb der Anlage, der zu jeder Zeit unter Einhaltung aller Grenzwerte sicher weiterlaufen muss, stellt das eine große Herausforderung dar. Die Reinigung des Abwassers wird trotzdem auch weiterhin in der gewohnten Qualität erfolgen.
Die für Juni 2024 vorgesehene Fertigstellung der Maßnahme verschiebt sich aufgrund von Materialengpässen und teilweise ungünstigen Witterungsbedingungen bis voraussichtlich Ende 2024.
Zur Baumaßnahme im Einzelnen:
Zur Umsetzung der benötigten Verfahrensänderung wurden im Bereich der Abwasserbehandlung zwei Vorklärbecken (Gesamtvolumen: 1134 m³) erstellt. Aus diesen Vorklärbecken wird der für die Klärgasgewinnung wertvolle Primärschlamm gewonnen.
In Anschluss daran erfolgt die weitere Reinigung des Abwassers in den Belebungs- und Nachklärbecken und auch die Phosphorelimination. Der in den Nachklärbecken anfallende Überschussschlamm wird ebenfalls der Schlammbehandlung zugeführt.
Um das Klärgas verwerten zu können, wird die Schlammbehandlung um die folgenden Prozessstufen erweitert:
• ein Pumpwerk zur Zugabe von Primärschlamm in den Heizschlammkreislauf,
• zwei Faulbehälter mit einem Gesamtvolumen von 3500 m³,
• ein Klärgasspeicher mit einem Volumen von 1000 m³ mit direktem Anschluss an die beiden neuen BHKW-Module und
• eine Gasfackel für Ausnahmefälle, in denen die BHKWs die anfallende Gasmenge nicht abnehmen können.
In einem neuen Technikgebäude wird darüber die benötigte Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik untergebracht.
Die Maßnahme wird in insgesamt vier Bauabschnitten umgesetzt. Hiervon sind die beiden ersten Bauabschnitte und Teile des dritten Bauabschnittes bereits umgesetzt. Das beinhaltete insbesondere den Ausbau bestehender und die Verlegung neuer Leitungen, die Herstellung der beiden neuen Faultürme sowie des dazwischenliegenden Technikgebäudes und die Errichtung der zwei neuen Vorklärbecken.
Es folgen nun insbesondere Restarbeiten an den beiden Vorklärbecken sowie diverse Dämm-, Ausbau-, Schlosser- und Abbrucharbeiten, bis Ende dieses Jahres mit der elektrotechnischen Ausstattung begonnen werden kann.
Im vierten und letzten Bauabschnitt geht es dann insbesondere um die Verlegung zahlreicher Verbindungs- und Rohrleitungen, bevor im Herbst 2024 der dreimonatige Probebetrieb aufgenommen werden kann.
Weitere Ansätze zur Senkung des externen Energiebedarfes
Die energetische Umstellung der Kläranlage Brebach wie oben beschrieben wird flankiert von weiteren Maßnahmen, die dazu beitragen, den Energiebedarf der Kläranlage zu reduzieren.
So bringt der Einsatz von Photovoltaik-Modulen eine jährliche Einsparung von 160.000 kWh/a und eine CO2-Reduktion um 91.200 kg/a.
Um die im Abwasser enthaltene Wärme für das Betriebsgebäude der Kläranlage des EVS in Saarbrücken-Brebach nutzen zu können, wird das Abwasser aus dem Belebungsbecken der Kläranlage über einen Wärmetauscher geleitet, der diesem Wärme entzieht und sie zu einer Wärmepumpe transportiert. Die eingesetzte Gasmotor-Wärmepumpe hebt das Temperaturniveau an und speist die Wärme in das Heizsystem der Kläranlage ein. Die jährliche Einsparung von Erdgas zu Heizzwecken liegt im Durchschnitt bei rund 100.000 Kilowattstunden pro Jahr. Die umweltbelastenden CO2 -Emissionen werden hier um rund 20.000 Kilogramm pro Jahr gesenkt, was eine Reduzierung um 50 Prozent bedeutet.
https://www.evs.de/evs/oeffentlichkeitsarbeit/aktuelle-meldungen/details/evs-investiert-rund-10-millionen-euro-in-die-energetische-optimierung-der-klaeranlage-in-saarbruecken-brebach
Emschergenossenschaft: Hochwasserschutz am Hüller Bach
Neues Becken auf Bochumer Stadtgebiet schützt künftig auch Anliegende in Herne und Gelsenkirchen
Bochum / Herne / Gelsenkirchen. Die Emschergenossenschaft hat am Mittwoch in Recklinghausen ihren Aufsichtsrat über den aktuellsten Stand ihrer zahlreichen Projekte informiert. Mit im Fokus standen dabei die Themen Starkregenvorsorge und Hochwasserschutz. Vorgestellt wurde unter anderem ein Pilotprojekt, bei dem ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren zum Einsatz kam. Die Baumaßnahme am Hüller Bach soll die Überflutungsgefahr in Bochum, Herne und Gelsenkirchen deutlich verringern.
Im Bereich der Straße „An den Klärbrunnen“ auf Bochumer Stadtgebiet, nahe der Stadtgrenze zu Herne, plant die Emschergenossenschaft den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens sowie eines sogenannten Retentionsbodenfilters zur Zwischenklärung von Regenwassermengen. Das Becken wird ein zusätzliches Rückhaltevolumen von rund 90.000 Kubikmeter aufweisen. „Der positive Effekt für die in Fließrichtung unterhalb dieses Beckens anliegenden Gebiete in Bochum, Herne und Gelsenkirchen ist immens, denn die Wasserrückhaltung an dieser Stelle bewirkt eine Reduzierung des Wasserspiegels im Hüller Bach um bis zu 70 Zentimeter“, sagt Dr. Frank Dudda, Vorsitzender des Genossenschaftsrates der Emschergenossenschaft und Oberbürgermeister der von dieser Maßnahme ebenfalls profitierenden Stadt Herne.
Die Lage des Hochwasserrückhaltebeckens ist bewusst und mit Bedacht gewählt worden. „Weit am Oberlauf gelegen, erzielen solche Hochwasserschutzmaßnahmen ihre größte Wirkung für die Region: Was bereits dort zurückgehalten werden kann, entlastet den Hüller Bach in seinem weiteren Verlauf – und letztlich auch die Emscher“, so Dudda weiter. Der Hüller Bach ist der größte Nebenfluss der Emscher. Zu seinem Einzugsgebiet gehören auf den Gebieten von Bochum und Herne unter anderem auch der Dorneburger Mühlenbach, der Hofsteder Bach und der Marbach.
Der Baubeginn für das Hochwasserrückhaltebecken und den Retentionsbodenfilter ist für Anfang 2024 geplant, vorbehaltlich der noch erwarteten Genehmigung. In enger Abstimmung mit den Kommunen Bochum und Herne sowie der Bezirksregierung Arnsberg hatte die Emschergenossenschaft den Genehmigungsantrag im November 2022 eingereicht. „Das gute und gemeinsame Vorgehen sollte die Genehmigungsphase beschleunigen – im Idealfall entsteht damit eine Blaupause für künftige Bauprojekte, denn besonders bei Hochwasserschutzprojekten ist schnelles Handeln zwingend erforderlich“, so Dr. Frank Dudda.
Das Projekt „Hüller Bach – An den Klärbrunnen“ ist eines der Vorhaben, die in der Roadmap Krisenhochwasser beschrieben wurden. Die Roadmap wurde im Frühjahr 2022 vorgestellt, nachdem die Emschergenossenschaft zuvor – als Reaktion auf das verheerende Hochwasser im Ahrtal im Juli 2021 – von ihrem Aufsichtsrat den Auftrag erhielt, den Hochwasserschutz an der Emscher weiter zu verbessern.
Die Emschergenossenschaft
Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Sie wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet und kümmert sich seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie um den Hochwasserschutz.
https://www.eglv.de/medien/hochwasserschutz-am-hueller-bach/
Abwasserlösungen für den Dresdner Norden
Die Dresdner Mikrochip-Industrie wächst rasant. Allein die Werke von Globalfoundries, Infineon, Bosch und X-Fab leiten schon jetzt mit ihren knapp 8,7 Millionen Kubikmetern 93 Prozent der Dresdner Industrie-Abwässer ein. Zum Vergleich: Die Abwassermenge aus der Chipindustrie entspricht jenem von 250.000 Einwohnern.
Seit diesem Jahr baut Infineon mit seinen bisher rund 3.200 Beschäftigten noch seinen Dresdner Standort an der Königsbrücker Straße kräftig aus. An der Südostecke entsteht bis 2026 ein Neubau für rund 1.000 zusätzliche Jobs. Jetzt will auch der taiwanesische Chiphersteller TSMC noch ein Werk im Rähnitzer Gewerbegebiet bauen, in dem 2.000 Jobs entstehen.
Rund 70 Millionen Euro investiert die Stadtentwässerung für Dresdens dritten großen Hauptkanal, den Industriesammler Nord, dessen Bau im Juli begonnen hatte. Der führt ab Ende 2026 vom Klärwerk in Dresden-Kaditz bis zum Infineon Werk an der Königsbrücker Straße. Dazwischen werden noch die Abwässer von Globalfoundries, Bosch und zukünftig auch ESMC eingeleitet.
In Klotzsche wird bereits jetzt ein Großprojekt umgesetzt, damit das Dresdner Kanalnetz viel besser mit den Abwassermengen umgehen kann.
Fertiggestellt ist ein knapp 600 Meter langer, bogenförmiger Stauraumkanal – eine Art unterirdisches Speicherbecken. Die ersten Arbeiten hatten Anfang dieses Jahres begonnen. In dem zwei Meter hohen Kanal, der hinter der Königsbrücker Landstraße beginnt und direkt neben der Eisenbahnstrecke verläuft, können beispielsweise bei Starkregen bis zu 1.800 Kubikmeter Abwasser zurückgehalten werden. So wird in solchen Fällen das Kanalnetz nicht überlastet, erklärt Projektleiter Rainer Aurin von der Stadtentwässerung. Am unteren Ende ist kurz vor der Bahnunterführung an der Langebrücker Straße in einem Steuerbauwerk ein großer Schieber installiert worden. Der kann ganz oder teilweise geschlossen werden, wird automatisch gesteuert und in der Kaditzer Leitwarte überwacht.
Zum Auftakt wurde Ende letzten Jahres neben dem alten Kanal eine 80 Zentimeter hohe Abwasser-Ersatzleitung gebaut. So konnte der alte Kanal dort, wo er den Bau des neuen Kanals behindert, beseitigt werden. Die Ersatzleitung kann abgebaut werden, wenn der neue Staukanal in Betrieb geht. Seit Anfang März sind für den Stauraumkanal 200, jeweils drei Meter lange und zehn Tonnen schwere Stahlbetonrohre mit dem Kettenbagger eingehoben worden. Mittlerweile ist der neue Kanal fertig, noch fließt allerdings kein Abwasser hindurch.
„Derzeit wird noch der Anschluss an das bestehende Kanalnetz vorbereitet“, erklärt der Projektleiter. „Spätestens im Oktober wird Abwasser durch den neuen Stauraumkanal fließen.“ Da in ihm bei Starkregen Abwasser eine Weile zurückgehalten werden kann, profitiert auch das in Richtung Zentrum führende Kanalnetz. So mündet nach gut zwei Kilometern der Infineon-Anschluss ins Kanalnetz ein. Ohne den Staukanal bestände die Gefahr, dass die Kanäle später im Stadtgebiet bei starken Regenfällen überlaufen könnten.
Bis Jahresende wird im Bereich des Staukanals auch noch ein Betriebsweg gebaut, damit die Fahrzeuge der Stadtentwässerung für notwendige Wartungsarbeiten an den Kanal herankommen.
Der Stauraumkanal ist ein Teil eines Großprojekts, das am Abzweig zur Klotzscher Flugzeugwerft beginnt. Durch den alten Kanal unter der Grenzstraße fließt bisher das Abwasser vom Flughafen und der Flugzeugwerft zur Königsbrücker Landstraße. Das ist nicht wenig. Allein beim Enteisen der Flugzeuge im Winter fallen täglich Hunderte Kubikmeter an.
Zusätzlich sind dort Betriebe und Einrichtungen der Mikroelektronik angeschlossen, darunter das Werk X-FAB und das Fraunhofer-Institut. Die Kanäle müssen erneuert werden, da sie zu klein und baufällig sind.
In der Grenzstraße haben die Arbeiten zum Jahresauftakt begonnen. Auf 400 Metern werden seitdem die alten Rohre ausgebaut und durch größere ersetzt. „Wir haben bereits rund 80 Prozent der Arbeiten geschafft“, sagt Projektleiter Aurin. Im Anschluss wird ab Jahresende auf 200 Metern von der Königsbrücker Landstraße bis zum neuen Staukanal der 90 Zentimeter hohe Kanal saniert. Das geschieht, indem ein harzgetränkter Kunststoffschlauch eingezogen wird, welcher sich danach an die alten Wände anlegt. So werden diese neu abgedichtet.
Daran schließt sich der Stauraumkanal bis zur Langebrücker Straße an. Für diesen investiert die Stadtentwässerung rund 2,3 Millionen Euro. Für das gesamte Großprojekt bis zur Grenzstraße sind 4,6 Millionen Euro geplant.
https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/journal-1/detail/abwasserloesungen-fuer-den-dresdner-norden/
Kläranlage Bad Homburg / Ober-Eschbach
Unsere Aufgabe ist das tägliche bis zu 62400m³ anfallende Schmutz- und Regenwasser der Stadt Bad Homburg und dem Ortsteil Oberursel Oberstedten zu reinigen.
Da das Schmutzwasser nicht von selbst zur Kläranlage fließt, überwachen und betreuen wir zusätzlich 7 Regenüberlaufbecken, 5 Pumpstationen. In der Kläranlage findet eine mechanisch-biologischchemische Reinigung des Abwassers von bis zu 80.000 Einwohnerwerten statt. Unser Ziel ist, nicht nur die gesetzlich geforderte Mindestreinigungsleistung zu erreichen, sondern unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit eine möglichst hohe Reinigungsleistung zu erzielen, damit die Gewässerbelastung niedrig bleibt.
Neubau der Kläranlage Ober-Eschbach
Bad Homburg bekommt eine neue Kläranlage! Die aktuelle Kläranlage ist den künftigen Aufgaben und Einwohnerwerten nicht mehr gewachsen und wird durch eine moderne und fortschrittliche ersetzt. Die Dauer dieses Mammutprojekts ist auf etwa sechs Jahre angelegt.
Hier halten wir Sie über den Baufortschritt auf dem Laufenden.
https://www.bad-homburg.de/de/stadt/planen-und-bauen/klaeranlage
Ruhrverband: Abwasserreinigung am Beispiel der Kläranlage Duisburg-Kaßlerfeld
Das Ruhrmündungsgebiet mit der Stadt Mülheim und den zur Ruhr hin entwässernden Teilen von Oberhausen und Duisburg ist eine der bevölkerungsreichsten Regionen des Ruhrgebiets. Im Einzugsgebiet leben rund 300.000 Menschen. Sie produzieren etwa zwei Drittel der Abwassermenge, die in der Kläranlage Duisburg-Kaßlerfeld gereinigt wird. Das übrige Drittel stammt aus gewerblichen und industriellen Betrieben. Insgesamt beträgt der Zufluss bei Trockenwetter 2,3 Kubikmeter pro Sekunde. Der maximale Zufluss bei Regenwetter ist auf 4,1 Kubikmeter pro Sekunde bemessen. Das Einzugsgebiet weist ein äußerst vielschichtiges Bild auf – einerseits mit vielen Waldflächen und Gartenanlagen, andererseits geprägt von der Stahlindustrie. Zudem ist die Region ein Verkehrsknotenpunkt von internationaler Bedeutung, in dem sich die Transportsysteme von Schifffahrt, Schiene und Straße sowie Rohrleitung bündeln. Ein deutliches Zeichen hierfür ist der Duisburger Hafen, auf den die 40 Meter hohen Faulbehälter der Kläranlage einen hervorragenden Rundblick erlauben.
Planung und Genehmigung
Bereits 1954 ging in Duisburg-Kaßlerfeld ein erstes Klärwerk in Betrieb. Es bestand aus einer mechanisch-chemischen Reinigungsstufe mit Rechen, Sandfang und Absetzbecken sowie einem Faulbehälter und Schlammlagerplätzen. Schon Anfang der 1970er-Jahre wurde eine erste Planung für eine mechanisch-biologische Anlage erstellt, die unter anderem eine Schlammverbrennung vorsah. Diese wurde jedoch nicht genehmigt, da damals die vorhandenen Belastungen der Luft die zulässigen Immissionswerte bereits überschritten.
In der 1982 zur Genehmigung eingereichten Neuplanung war die biologische Stufe für den Kohlenstoffabbau bemessen. Sie musste im Zuge des Planfeststellungsverfahrens so geändert werden, dass auch eine Nitrifikation des Ammoniums ermöglicht wurde. Durch den Planfeststellungsbeschluss vom 1. September 1987 wurde der Entwurf des Ruhrverbands zur Erneuerung des Klärwerks Duisburg-Kaßlerfeld genehmigt. Aufgrund von Änderungen der Abwassergesetze werden heute jedoch noch wesentlich schärfere Anforderungen an die Reinigungsleistung von Kläranlagen mit über 100.000 Einwohnerwerten gestellt.
Damit das Klärwerk Duisburg-Kaßlerfeld diese Anforderungen erfüllen kann, wurde der abwassertechnische Teil des Entwurfs nach Erteilung der Genehmigung erneut überarbeitet, sodass eine gezielte Nitrifikation und Denitrifikation sowie die Phosphatelimination möglich sind. Die Umplanungen wurden im Sommer 1989 durch Planfeststellungsänderungsbeschluss in die bereits erfolgte Genehmigung aufgenommen. Wegen ihrer Bedeutung für die infrastrukturelle Entwicklung im Einzugsgebiet förderte das Land Nordrhein-Westfalen die Neubaumaßnahmen in Duisburg-Kaßlerfeld im Rahmen des Programms „Zukunftsinitiative Montanregionen (ZIM)“ mit bis zu 80 Prozent der Investitionskosten. Damit wurde dem Ruhrverband maßgeblich bei der Lösung der vorhandenen wasserwirtschaftlichen Probleme geholfen.
Bautechnik und Projektmanagement
Ende 1988 begannen die Bauarbeiten, Mitte 1992 war der Rohbau abgeschlossen. Eine große Herausforderung bestand darin, dass die bisherige Reinigungsleistung und die Vorflut des Abwassers während der gesamten Bauphase gewährleistet sein mussten.
Zunächst wurde das Klärwerksgelände mit einer umlaufenden, 60 Zentimeter dicken Dicht- und Schlitzwand, die bis zu 45 Meter in den Untergrund hinabreicht, gegen steigendes Grundwasser geschützt. Erforderlich war diese bautechnisch sehr aufwendige Maßnahme, weil aus betriebswirtschaftlichen Gründen auf ein Zulaufpumpwerk verzichtet wurde und die Becken der Abwasserreinigung somit unter dem vorhandenen Geländeniveau liegen.
Der Neubau der Kläranlage Duisburg-Kaßlerfeld war mit veranschlagten 320 Millionen D-Mark die bist dahin größte Einzelinvestition im Abwasserbereich des Ruhrverbands. Um die engen Zeitvorgaben und den Kostenrahmen einzuhalten, wurde für die Gesamtmaßnahme eine EDV-gestützte Termin- und Kostenverfolgung installiert. Das erfolgreiche Projektmanagement und die Qualität der eingesetzten Überwachungs- und Steuerungsmechanismen zeigten sich in der termingerechten Inbetriebnahme der verschiedenen Anlagenteile, der Einhaltung des Kostenrahmens und den späteren Betriebsergebnissen.
Abwasserbehandlung
Die mechanische Reinigungsstufe in Duisburg-Kaßlerfeld umfasst eine vierstraßige Rechenanlage, einen unbelüfteten Sandfang und ein Vorklärbecken. Das Rechengut wird entwässert und über Transportbänder in Container abgeworfen. Die gesamte Anlage ist aus Emissionsgründen und zur Sicherstellung des Winterbetriebes in einem geschlossenen Gebäude untergebracht.
Nach Durchfließen der vier Langsandfangkammern gelangt das Abwasser in die Vorklärung. Diese wurde aufgrund der für die Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphatelimination erforderlichen Umplanungen auf 5.200 Kubikmeter Gesamtvolumen, verteilt auf vier Becken, verkleinert und dient mit 0,6 Stunden Aufenthaltszeit nur noch der Grobentschlammung.
Die biologische Reinigungsstufe nach dem Prinzip des Belebungsverfahrens umfasst zwei Umlaufbecken mit insgesamt 60.000 Kubikmetern Inhalt für simultane Nitrifikation und Denitrifikation. Zusätzlich sind zwei Denitrifikationsbecken mit rund 10.000 Kubikmetern Volumen vorgeschaltet, in denen auch eine biologische Phosphatelimination erfolgen soll. Die Rezirkulation in die Denitrifikationsbecken ist auf den dreifachen Trockenwetterzufluss bemessen. Die Umlaufbecken sind mit einer feinblasigen Druckluftbelüftung und separater Umwälzung ausgerüstet. Pro Becken wurden acht abschaltbare Belüftergruppen installiert. Das gesamte Belüftungssystem ist für 65.000 Normkubikmeter Luft pro Stunde ausgelegt.
Die Trennung des Belebtschlamms vom gereinigten Abwasser erfolgt in der Nachklärung, die aus fünf Rechteckbecken besteht. Die Nachklärbecken sind insgesamt 40.000 Kubikmeter groß. Der abgesetzte Schlamm wird mit jeweils zwei Schildräumern geräumt. Aufgrund der kleinen Vorklärbecken wird der Überschussschlamm separat eingedickt. Das gereinigte Abwasser läuft durch gelochte Rohre ab. Außerdem verfügt die Anlage Duisburg-Kaßlerfeld über eine chemische Reinigungsstufe (Simultanfällung) zur Phosphorelimination.
Betrieb und Kontrolle
Die personelle Besetzung des Klärwerks Duisburg-Kaßlerfeld berücksichtigt eine ständige Überwachung der Anlage im Dreischichtbetrieb. Trotz einer weitgehenden Automatisierung des Betriebes ist die zentrale Warte im Betriebsgebäude stets besetzt. Sämtliche für den Betrieb und die Überwachung der Anlage relevanten Informationen laufen in der zentralen Warte zusammen und werden dort zur Unterstützung des Bedienpersonals von einem Prozessrechner aufbereitet. Neben der zentralen Warte wird der Betrieb wesentlicher Anlagenteile wie Energiestation, Schlammentwässerung, Schlammfaulung und Überschussschlammeindickung von Unterwarten aus bedient.
Um den Reinigungsprozess entsprechend den gesetzlichen Anforderungen zu steuern und zu überwachen sowie eine Optimierung z. B. der Energiekosten zu erzielen, wurden auf dem Klärwerk umfangreiche energie-, mess- und regeltechnische Einrichtungen installiert. Einen besonderen Schwerpunkt bildet hierbei die MSR-Technik für den Betrieb der Belebungsstufe.
Die Neufassung verschiedener Gesetze und Verordnungen verlangt von den Betreibern kommunaler Abwasseranlagen verstärkte Anstrengungen zur Eigenkontrolle. Hierzu gehören u. a. die strenge Überwachung der Mindestanforderungen, die Erfassung zusätzlicher Parameter unterschiedlichster Art und die Dokumentation des ordnungsgemäßen Betriebsablaufes. Zulauf und Ablauf des Klärwerks, aber auch die internen Abwasser- und Schlammströme werden nicht nur durch kontinuierlich arbeitende Analysegeräte überwacht, sondern vor allem vom Betriebslabor des Klärwerks und darüber hinaus vom Zentrallabor des Ruhrverbands in Essen untersucht.
Die Betriebsdaten werden in Protokollen festgehalten, können jedoch auch in Form von Diagrammen ausgedruckt werden.
Durch die intensive Selbstüberwachung des Klärwerks wird sichergestellt, dass die vom Gesetzgeber vorgegebenen niedrigen Ablaufwerte eingehalten werden.
Umweltfreundliche Technik
Die Abwasserreinigung hat umweltpolitische Bedeutung für den Schutz der Oberflächengewässer und die damit verbundenen Ökosysteme. Als ökologische Teildisziplin muss umweltbewusste Abwasserentsorgung heute mehr leisten, als nur die technischen Voraussetzungen zur Abwasserentsorgung zu schaffen. Emissionsschutz, Schonung wertvoller Ressourcen, Recyclingstrategien und Abfallminimierung markieren einige der Umweltaufgaben moderner Abwasserentsorgung.
So wurde beispielhaft zur Verwertung des bei der Schlammfaulung anfallenden Gases auf der Kläranlage Duisburg-Kaßlerfeld ein innovatives Konzept realisiert. Die Energiestation ist mit fünf Gasmotoren bestückt, bei deren Auswahl auf eine verbesserte Umweltverträglichkeit geachtet wurde. Zwei der Motoren sind direkt mit Turbogebläsen (je 500 Kilowatt) und einer mit einem Generator (750 Kilowatt) gekoppelt. Die beiden restlichen Gasmotoren (je 500 Kilowatt) sind als Tandemaggregate ausgerüstet, sodass hiermit einerseits durch Turbogebläse die Druckluft für die Belüftung der Belebungsbecken und andererseits über Generatoren elektrische Energie für den Klärwerksbetrieb erzeugt werden kann. Zur Erzielung eines höheren Wirkungsgrads wird nach dem System der Kraft-Wärme-Kopplung die Abwärme der Gasmotoren über Wärmetauscher zurückgewonnen.
Zur weiteren Verbesserung der Wärmebilanz wird in Duisburg-Kaßlerfeld zudem ein Schlamm-Schlamm-Wärmetauscher (Rekuperator) eingesetzt. In ihm wird der in die Faulbehälter gepumpte Rohschlamm mit dem abfließenden warmen Faulschlamm zum Wärmetausch gebracht. Ziel des gesamten Energiekonzeptes ist es, die Nutzung der vorhandenen Ressourcen wie Klärgas oder Abwärme aus den Gasmotoren oder dem Faulschlamm zu optimieren, um so den Bezug externer Energiequellen auf ein Minimum zu reduzieren. Zur Vermeidung störender Lärmemissionen wurden für die Energiestation ebenso wie für andere Lärmquellen umfangreiche Schallschutzmaßnahmen vorgesehen.
Architektonische Gestaltung
Bestimmend für die Gestaltung der Gesamtanlage und der einzelnen Bauten war die Lage parallel zum Ruhrlauf in einer durch Industriebauten geprägten Umgebung. Die Anlage konnte aufgrund ihrer Ost-West-Ausrichtung und flächenmäßigen Ausdehnungsmöglichkeit entlang der Ruhr sehr konsequent linear durchgeplant werden. Durch den modularen Aufbau der Beckengruppe entstanden deutlich abgegrenzte Funktionsbereiche der Anlage. Die Stellung der Hochbauten setzt die klare Konzeption der Anlage fort: Linearität, Horizontalität und Rechtwinkligkeit, ruhige Silhouetten, Schaffung von klar definierten Räumen.
Die Hochbauten wurden in ihren Dimensionen behutsam gestaltet und als Einzelbauten zu Gruppen zusammengefasst. Dabei wurde durch sich wiederholende Materialien und Formelemente für Einheitlichkeit des Ganzen gesorgt. Dies wird unterstützt durch die Wahl elementarer Formen für die Baukörper (Kubus, Kreissegment und Bogen), wobei gewählte Form und Funktion stets eine in sich schlüssige Einheit bilden sollen. Die so entstandene unverwechselbare technische Architektur lebt in ihrer Zurückhaltung und der Konzentration auf das Wesentliche sowie durch den Gegensatz zur uneinheitlichen Umgebung der Anlage.
Für die äußere Gestaltung wurden vorgehängte, beidseitig pulverbeschichtete Aluminiumfassaden teils als Trapezblech, teils als Formblech verwandt; ein glattes Material, das widerstandsfähig gegen die Industrieluft in dieser Region ist und keine Angriffspunkte für übermäßige Verschmutzung bietet. Die Kombination von Trapezblechen und Glattblechen sowie deren farbliche Abstimmung erbrachte die gewünschte Auflockerung der teils großen Fassadenflächen.
Gestalterisches Element sind zudem die abgerundeten glatten Eckausbildungen der Gebäude sowie als oberer Attikaabschluss die gebogenen Trapezblechelemente. Die sorgfältige Gestaltung dieser Details erschien notwendig, um den Gebäuden einerseits eine ablesbare Einheitlichkeit zu verleihen, andererseits durch Farb- und Materialwahl den Gebäuden einen Ausdruck der Leichtigkeit zu geben. Die Farb- und Materialwahl des Innenausbaues setzte das zurückhaltende äußere Erscheinungsbild fort. Für das farbliche Konzept der maschinellen Anlagenteile wie Pressen, Pumpen, Motoren, Behälter wurden bewusst kräftige, klare Farben gewählt, um einerseits der Eintönigkeit von Betonwänden entgegenzuwirken und andererseits die unterschiedlichen Funktionen der einzelnen Aggregate erkennbar werden zu lassen.
https://www.ruhrverband.de/abwasser/klaeranlagen/beispiel-kasslerfeld/
Ennepetal überträgt das Kanalisationsnetz und die Gewässerunterhaltung auf den Ruhrverband
Die Stadt Ennepetal und der Ruhrverband haben naturnahe Gewässer als gemeinsames Ziel
Am 22. August wurde als äußeres Zeichen für die Zusammenarbeit im Bereich der Gewässerunterhaltung und des Kanalisationsnetzes vor dem Ennepetaler Rathaus ein goldener Kanaldeckel niedergelegt.
OOWV: Fast alle Nachwuchskräfte bleiben über Ausbildung hinaus beim OOWV
13 junge Männer feiern Berufsabschluss
Nethen. Zwölf der 13 jungen Menschen, die in diesem Sommer ihre Ausbildung beim Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) erfolgreich abgeschlossen haben, halten dem Verband die Treue. „Das freut uns sehr und macht uns stolz“, sagte OOWV-Geschäftsführer Karsten Specht bei einer kleinen Feierstunde im Wasserwerk Nethen am Donnerstag. Gemeinsam mit den Ausbildungsleiterinnen Sabrina Krüger und Thekla Plump würdigte Specht den Einsatz der 13 jungen Männer – Frauen waren in diesem Abschlussjahrgang nicht vertreten, im aktuellen Jahrgang ist das wieder anders. Fünf der Ausgelernten sind nun Fachkräfte für Abwassertechnik, zwei für Wasserversorgungstechnik. Hinzu kommen je zwei Industriekaufleute, Rohrleitungsbauer und Fachinformatiker. Zu ihnen zählt Frederik Berger, der sich durch seine sehr guten Leistungen eine Auszeichnung der Industrie- und Handelskammer verdiente.
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2023/august/24/artikel/fast-alle-nachwuchskraefte-bleiben-ueber-ausbildung-hinaus-beim-oowv
OOWV: Nach Kanaleinsturz – Neue Schmutzwasserleitung für Berner Deichstraße
Berne. Bereits in dieser Woche beginnen die Arbeiten des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) am neuen Schmutzwasserkanal in der Deichstraße in Berne Im Zuge der Reparatur ersetzt der OOWV auch die vorhandenen Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze. Die Arbeiten werden voraussichtlich sechs Wochen benötigen.
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2023/august/22/artikel/nach-kanaleinsturz-neue-schmutzwasserleitung-fuer-berner-deichstrasse
OOWV: lässt Regenwasserkanal in der Gemeinde Wangerland spülen
Kanalreinigung
Wangerland. Am Montag, dem 28. August 2023, beginnt die Nehlsen GmbH im Auftrag des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) mit der Spülung des 50 Kilometern langen Regenwasserkanalnetzes in der Gemeinde Wangerland. Die Hochdruck-Kanalreinigung findet routinemäßig statt, um jederzeit eine reibungslose Entwässerung zu gewährleisten. Die Arbeiten werden voraussichtlich rund vier Wochen dauern.
https://www.oowv.de/der-oowv/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/archive/2023/august/22/artikel/oowv-laesst-regenwasserkanal-in-der-gemeinde-wangerland-spuelen
Bad Oeynhausen: Energieautarke Kläranlage
Die Kläranlage der Stadtwerke Bad Oeynhausen ist im Jahr 1972 errichtet worden und ist für 79.500 EW ausgelegt. In den letzten Jahren lag die Auslastung der Anlage fast gleichbleibend bei 63.000 EW. In der Kläranlage werden durchschnittlich 11.000 m³ Abwasser pro Tag gereinigt.
Energieautarke Kläranlage
In Bad Oeynhausen findet seit Jahren die Verwandlung des Klärwerks in eine hochmoderne Energie-Plus-Kläranlage statt. Die EnergieAgentur.NRW hat die Kläranlage aufgrund der Energieeinsparungen im Februar 2014 als „Projekt des Monats“ ausgezeichnet.
Nach der Modernisierung der Blockheizkraftwerke erreicht die Kläranlage der Stadtwerke in 2015 einen Eigenversorgungsgrad von 105 Prozent, so dass nicht nur der gesamte Energieverbrauch der Kläranlage gedeckt, sondern auch noch Energie in das Stromnetz abgegeben werden kann.
Insgesamt konnten bislang durch Investitionen von 800.000 Euro in die Energieeffizienz die jährlichen Energiekosten um rund 300.000 Euro/Jahr reduziert werden.
Beitrag der Kläranlage zum Klimaschutz:
Ersparnis 800 t CO2 pro Jahr
Das Projekt „Energieautarke Kläranlage“ ist eingebettet in dem erfolgreichen Klimaschutzkonzept der Stadt Bad Oeynhausen
Eliminierung von Mikroschadstoffen im Abwasser
In einer modernen Gesellschaft ist der Einsatz von Medikamenten unverzichtbar. Mittlerweile geht die Anzahl der entwickelten chemischen Verbindungen in die Millionen. So steigt der Arzneimittelkonsum aufgrund unserer älter werdenden Gesellschaft und des medizinischen Fortschritts kontinuierlich an. Moderne Kläranlagen können nur einen kleinen Teil dieser Schadstoffe zurückhalten. In der Folge steigt durch die menschlichen Ausscheidungen auch der Eintrag in die Gewässer.
Aus Gründen des vorbeugenden Gesundheits- und Umweltschutzes ist es geboten, den Eintrag von Mikroverunreinigungen in die Umwelt zu begrenzen. Insbesondere Bad Oeynhausen als ausgeprägter Gesundheitsstandort bot sich für ein Forschungsvorhaben an.
Mit Förderung durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft. Natur-und Verbraucherschutz des Landes NRW ist seit Oktober 2015 eine Versuchsanlage auf der Kläranlage in Betrieb.
In Bad Oeynhausen wird unter Nutzung vorhandener Bausubstanz ein Filter der vorhandenen Filtrationsanlage mit granulierter Aktivkohle ausgestattet.
Mit dem Forschungsvorhaben soll geprüft werden,
• wie hoch der Eliminierungsgrad der Aktivkohle für das spezifische Abwasser in Bad Oeynhausen ist,
• wie sich der Aktivkohlefilter in die bisherige Bausubstanz integrieren lässt,
• ob sich die Filtrationsleistung trotz reduzierter Filterfläche steigern lässt,
• wie hoch die Betriebskosten für die zusätzliche Reinigungsstufe sind.
•
Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft. Natur-und Verbraucherschutz des Landes NRW.
https://www.stadtwerke-badoeynhausen.de/de/Abwasser-Strassen/Klaeranlage/
(nach oben)
Köln: Stand der Maßnahmen zum Überflutungsschutz in Hahnwald
In den letzten Jahren kam es an verschiedenen Stellen im Kölner Stadtgebiet zu Überflutungen durch wild abfließendes Oberflächenwasser. Auch der Stadtteil Hahnwald und hier insbesondere die tiefliegenden Gebiete innerhalb eines alten Rheinarms (siehe auch Abbildung, Reliefdarstellung Hahnwald) waren stark betroffen. Mithilfe einer hydrodynamisch gekoppelten 1D-Kanalnetz- und 2D-Oberflächenabflusssimulation wurden Maßnahmen zur Reduzierung des Überflutungsrisikos untersucht und im Rahmen einer Machbarkeitsstudie bewertet.
Eine wesentliche Maßnahme zur Verbesserung der Überflutungsvorsorge ist die Schaffung von zusätzlichem Retentionsvolumen. Im Bereich des Kirchbaumweges besteht bereits ein großes unterirdisches Regenrückhaltebecken mit einem Retentionsvolumen von ca. 33.000 Kubikmetern. Dies entspricht ca. 275.000 Badewannen.
Neben diesem unterirdischen Becken soll ein zweites Becken errichtet werden, um zusätzliches Volumen zu schaffen. Erste positive Abstimmungsgespräche mit der zuständigen Genehmigungsbehörde konnten bereits geführt werden, sodass diese Maßnahme nun in die bauliche Planung und konkrete Umsetzung gehen kann. Derzeit läuft die Beauftragung eines Gutachtens, um die Böschungsstabilität der Geländemulde zu überprüfen.
Trotz der geplanten Maßnahme bleiben Grundstücke innerhalb der Tiefenlagen durch wild abfließendes Regenwasser besonders überflutungsgefährdet. Durch zentrale Maßnahmen kann das Überflutungsrisiko für größere Bereiche, z.B. eine ganze Ortslage, insgesamt reduziert werden. Jedoch ist es dadurch nicht möglich, einzelne Objekte vor Regenwasser, das auf dem eigenen Grundstück anfällt oder von Nachbargrundstücken zufließt, zu schützen. Hier ist ein privater Objektschutz an den Gebäuden bzw. Grundstücken zwingend notwendig, um zukünftig Schäden reduzieren zu können. Einen Termin zur persönlichen Objektschutzberatung können Sie unter Anliegenmanagement@StEB-KOELN.DE vereinbaren. Alternativ können Sie auch den Wasser-Risiko-Check unter www.wasser-risiko-check.de durchführen. Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Zusätzlich werden weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Überflutungsschutzes in Meschenich, Rondorf, Immendorf, Godorf, Sürth, Weiss und Rodenkirchen untersucht.
https://steb-koeln.de/Aktuelles/Stand-der-Ma%C3%9Fnahmen-zum-%C3%9Cberflutungsschutz-in-Hahnwald.jsp?ref=/Aktuelle /Aktuelles.jsp
HAMBURG WASSER: Versorger stellt Wasserverbrauchsstudie 2023 und neuen Online-Verbrauchsrechner vor
In diesem und im letzten Sommer ging der Wasserverbrauch im Versorgungsgebiet von HAMBURG WASSER merkbar zurück und das, obwohl mehr als 40.000 Menschen zusätzlich hier leben. Zudem blieben 2022 die Spitzentage mit mehr als 400.000 Kubikmeter Wasserabgabe aus – trotz 14 Tagen mit Temperaturen über 30 Grad Celsius. Welche Faktoren beeinflussen neben der Bevölkerungsentwicklung und dem Wetter den Wasserverbrauch in Hamburg? Sparen die Menschen aktiv Wasser? Ändert sich das Wasserbewusstsein? Um den Fragen auf den Grund zu gehen, hat HAMBURG WASSER Kundinnen und Kunden zum Wasserverbrauch befragt und die Ergebnisse mit Auswertungen aus dem Jahr 2021 verglichen.
• Wenngleich die Mehrheit der Befragten nicht davon ausgeht, dass sich ihr Wasserverbrauch seit Anfang 2022 deutlich geändert hat, zeigt die Studie eine Tendenz für ein geändertes Verbrauchsverhalten.
• Vor allem im Bad gehen die Menschen bewusster mit Wasser um: Seit 2022 duscht etwa ein Drittel der Befragten kürzer oder badet seltener – insbesondere um Wasser- und Energiekosten zu sparen.
• Ökologische Gründe zum Wassersparen sind bei 62 Prozent ausschlaggebend, haben im Vergleich zu 2021 aber abgenommen.
• Während die Jüngeren mehrheitlich eine größere Notwendigkeit zum Sparen sehen, sind es die älteren Befragten, die bereits konkrete Sparmaßnahmen umsetzen.
• 85 Prozent der Befragten haben Vertrauen in die Versorgungssicherheit; mehr als die Hälfte hat keine Sorge vor Wasserknappheit im Versorgungsgebiet.
„Innerhalb des Jahres unterliegt der Wasserverbrauch in einer Großstadt wie Hamburg Schwankungen: Ferienzeiten oder Regenwetter dämpfen den Verbrauch. Erleben wir hingegen eine trockene Wetterperiode mit Temperaturen über 25 Grad Celsius, ist die Wahrscheinlichkeit für Spitzenverbräuche besonders hoch. Im aktuellen und letzten Sommer wurde weniger Wasser verbraucht als in den vergangenen Jahren. Allein mit dem Wettergeschehen und Ferien lässt sich diese Entwicklung nicht erklären. Laut Studie zeichnet sich – insbesondere im Bad und Garten – ein geändertes Verbrauchsverhalten und eine Tendenz zum Wassersparen ab. Die Erkenntnisse aus der Studie helfen uns, Schwankungen in den Verbräuchen besser vorhersagen zu können. Abzuwarten bleibt, ob sich hieraus ein langfristiger Trend entwickelt“, sagt Ingo Hannemann, Geschäftsführer von HAMBURG WASSER, über den Anlass der zweiten Wasserverbrauchsstudie.
Wasserbewusstsein: Wie hoch schätzen Hamburger Haushalte ihren Verbrauch?
69 Prozent der Befragten, die alleine wohnen, schätzen ihren täglichen Wasserverbrauch auf bis zu 100 Liter. Bei einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch am Tag von 111 Litern zeigen die Hamburgerinnen und Hamburger damit ein gutes Gespür. Mit steigender Haushaltsgröße unterschätzt die Mehrheit ihren Wasserverbrauch. Ein Zweipersonenhaushalt hat einen statistischen Durchschnittswert von 222 Litern Wasser am Tag. Einen Verbrauch von mehr als 200 Liter vermuten nur vier Prozent der Befragten, die mit einer weiteren Person zusammenleben. Während die Kosten für Leitungswasser (inkl. Abwasserentsorgung) im Mittel pro Haushalt bei etwa 30 Euro im Monat liegen, schätzen 4 von 10 Befragten ihre Kosten auf unter 25 Euro.
19 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger geben an, ihr Verbrauch sei gestiegen – zumeist, weil der Haushalt gewachsen ist. 20 Prozent geben an, ihr Wasserverbrauch sei gesunken. 40 Prozent davon nennen als Grund, allgemein sparsamer geworden zu sein. Die Mehrheit der Befragten hat nicht den Eindruck, ihr Wasserverbrauch habe sich seit 2022 geändert. Allerdings zeigt die detaillierte Abfrage in der Studie zum Teil signifikante Änderungen beim Verbrauchsverhalten, die auf einen allgemeinen Wasserspartrend hindeuten.
Neue Webanwendung berechnet Wasserverbrauch im Haushalt
„Den eigenen Wasserverbrauch im Haushalt zu schätzen, ist nicht immer einfach. Haushaltsgröße, Lebenssituation oder der Verbrauch der technischen Geräte kann variieren. Um das Wasserbewusstsein der Menschen in Hamburg weiter zu stärken, stellen wir eine neue Funktion auf unserer Website zur Verfügung“, sagt Ingo Hannemann. „Mit dem Wasserverbrauchsrechner können die Nutzerinnen und Nutzer ihren Verbrauch im eigenen Haushalt näherungsweise berechnen und für alle Einflussparameter eine Schätzung abgeben. So bekommen wir ein Gefühl für einen bewussten Umgang mit der Ressource und entdecken möglicherweise noch Sparpotentiale im eigenen Haushalt.“ Die neue Anwendung wird ab sofort auf www.hamburgwasser.de nutzbar sein.
Etwa die Hälfte der Befragten hat ihr Dusch- und Badeverhalten im letzten Jahr geändert
Fast alle Befragten duschen mindestens einmal in der Woche, 51 Prozent der Jüngeren täglich. Bei den Menschen über 65 sind es noch 25 Prozent. Knapp ein Fünftel der Hamburgerinnen und Hamburger badet mindestens einmal pro Woche, drei Prozent steigen täglich in die Wanne. Je jünger die Befragten sind, desto häufiger duschen oder baden sie, Männer baden etwas häufiger als Frauen.
Generell hat sich das Dusch- und Badeverhalten seit Anfang 2022 geändert; 30 Prozent der Befragten geben an, kürzer zu duschen, 33 Prozent seltener zu baden. Hauptgründe für das geänderte Duschverhalten ist vor allem der Wunsch, Wasser- und Energiekosten zu senken. Speziell Energiekosten zu sparen, ist für rund 70 Prozent der Menschen über 40 Jahren ausschlaggebend. Für den Energieeinspareffekt spricht, dass jede und jeder zehnte Befragte angibt, jetzt kälter zu duschen.
Die Selbsteinschätzung stimmt mit den Ergebnissen der Vergleichsstudie 2021 überein: Menschen aus Hamburg duschen 2023 kürzer. Während sie vor zwei Jahren durchschnittlich 9 Minuten unter der Dusche standen, sind es 2023 weniger als acht Minuten. Drei von zehn Befragten duschen außerdem weniger als 5 Minuten. 2021 waren es nur zwei von zehn. Mehr als 20 Minuten duschen nur noch vier Prozent der Befragten. Hier ist ein Rückgang um die Hälfte zu verzeichnen.
Nahezu alle Befragten gaben an, hauptsächlich zur Körperpflege zu duschen. Dieser Wert ist im Vergleich zu 2021 um vier Prozentpunkte auf 97 Prozent gestiegen. Für 13 bis 15 Prozent der Befragten sind auch andere Motive wie Beruhigung, Wachwerden oder Wellness ausschlaggebend. Deutliche Unterschiede liegen in den Altersgruppen vor. Während unter den 18- bis 39-jährigen jede und jeder Vierte zur Beruhigung duscht, sind es unter den 40- bis 64-jährigen nur noch sieben Prozent und null Prozent unter den über 65-jährigen.
Garten und Balkon: Menschen in Hamburg fangen Regenwasser auf und bewässern ihre Grünflächen heute weniger häufig als vor zwei Jahren
62 Prozent der Befragten aus Hamburg besitzen einen Balkon oder eine Terrasse, auf der Pflanzen bewässert werden. 27 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger haben einen Garten, die meisten sind in Harburg zu finden (35 Prozent). Insgesamt ist die Zahl der Menschen mit Bewässerungsbedarf für Pflanzen und Grünflächen um sechs Prozent gesunken. Fast jede und jeder Zweite mit Garten oder sonstiger Fläche bewässert eine Grünfläche, die bis zu 50 Quadratmeter groß ist; mehr als jede und jeder Fünfte eine Fläche, die mehr als 100 Quadratmeter misst. Die Mehrheit der Befragten gießt mindestens drei Mal wöchentlich Pflanzen. Die Dauer beträgt meist bis zu 15 Minuten.
Knapp 70 Prozent der Befragten mit Garten fangen Regenwasser zur Bewässerung auf. Bei 52 Prozent landet das Nass vom Himmel in der Regentonne, 14 Prozent besitzen eine Zisterne und 14 Prozent eine andere Auffangmöglichkeit. Die Studie zeigt, dass Wetter und Tageszeit bei der Bewässerung eine Rolle spielen: Knapp die Hälfte aller Befragten bewässert ihre Grünflächen immer abhängig vom Wetterbericht. Das Gros der Probanden bewässert die Grünflächen abends, knapp ein Drittel morgens. 23 Prozent bewässern ihre Grünflächen mittags oder nachmittags.
„Besonders an heißen Tagen, wenn die Pflanzen viel Wasser brauchen, um nicht unter Trockenstress zu leiden, kann ein Garten den Verbrauch ankurbeln. Den Garten früh morgens und in Abhängigkeit vom Wetterbericht zu bewässern, stellt sicher, dass das Wasser an der Pflanze ankommt und nicht auf dem Weg dorthin verdunstet. Auch wenn Garten und Balkon den Verbrauch erhöhen können, sind sie gute Speicherorte für Regenwasser. Grünflächen leisten einen wichtigen Beitrag, um unsere Städte auch an warmen Tagen zu kühlen“, sagt Ingo Hannemann.
Keine Sorge vor Wasserknappheit oder Versorgungsunsicherheit im Versorgungsgebiet
Für 56 Prozent der Befragten ist das Wasser in Hamburg ausreichend verfügbar, sollte aber dennoch nicht verschwendet und besonders wenn es heiß ist, auch gespart werden. Ein Drittel (33 Prozent) der Befragten glaubt hingegen, dass Wasser knapp sei. Vor allem ältere Befragte und Menschen in Eimsbüttel sehen Wasser als knappe Ressource, die es so weit wie möglich zu sparen gilt. 83 Prozent der Befragten halten einen zukünftigen Wassermangel in anderen Regionen auf der Welt für wahrscheinlich, nur 23 Prozent sehen dieses Szenario in Hamburg als wahrscheinlich an. 83 Prozent der Befragten machen sich keine Sorgen um die Versorgungssicherheit mit Leitungswasser. Lediglich vier Prozent geben an, sehr besorgt zu sein. 2021 waren dies noch sechs Prozent.
„Trinkwasser in Hamburg ist sicher, dafür sorgen wir. Angst vor Wasserknappheit müssen die Hamburgerinnen und Hamburger nicht haben. Grundwasser ist in unserer Region ausreichend verfügbar. Das zeigen uns einschlägige Klimaprognosen. Dennoch ist ein sorgsamer Umgang mit der Ressource geboten, denn die Bevölkerung wächst und Hitzephasen im Sommer werden im Zuge des Klimawandels zunehmen. Die Umfrageergebnisse legen nahe, dass unsere Kundinnen und Kunden dafür ein gutes Gespür haben“, sagt Ingo Hannemann.
Obwohl die Befragten keine große Sorge vor Wasserknappheit oder fehlender Versorgungssicherheit haben, sparen sie dennoch Wasser – meist aus ökologischen Gründen (62 Prozent). Für 53 Prozent der Befragten sind es finanzielle Gründe, warum sie Wasser sparen. 30 Prozent geben soziale Gründe an. Ökologische und soziale Gründe für Wassersparen werden signifikant seltener genannt als noch 2021. Finanzielle Gründe hingegen haben nicht an Bedeutung verloren. Die Gründe für Wassersparen korrelieren teils mit der Lebenssituation: Soziale und finanzielle Gründe nennen Befragte häufiger, wenn sie in Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren wohnen. Von den Befragten in Altona geben 72 Prozent ökologische Gründe zum Wassersparen an. In Bergedorf geben die meisten Befragten (64 Prozent) finanzielle Gründe an.
Bei der Notwendigkeit, den Wasserverbrauch weiter einzuschränken, sind sich die Menschen in Hamburg nicht einig. 30 Prozent geben an, dass sie ihren Verbrauch weiter reduzieren sollten, 30 Prozent glauben dies nicht. Im Vergleich der Altersgruppen sind die Jüngeren eher der Meinung, es sei nötig, den Wasserverbrauch im Alltag weiter zu reduzieren. Die älteren Befragten haben vergleichsweise bereits mehr zum Wassersparen unternommen. Beispielsweise nutzen 74 Prozent der Befragten über 65 Jahre die Sparfunktion der Toilette. Bei einem marktüblichen Produkt lassen sich damit rund 6 Liter Wasser pro Spülvorgang einsparen. Von den Befragten zwischen 18 und 39 nutzen 33 Prozent die Sparfunktion. 23 Prozent dieser Altersgruppe können sich die Nutzung zukünftig vorstellen.
Studienhintergrund:
An der repräsentativen Umfrage mittels Online-Interviews nahmen 921 Menschen in Hamburg im Alter von 18 bis 79 Jahren teil. Die Befragung wurde von mindline energy im Auftrag von HAMBURG WASSER im Zeitraum vom 10. bis 21. Juli 2023 durchgeführt.
Ihre Ansprechpartnerin
Nicole Buschermöhle
Billhorner Deich 2
20539 Hamburg
Tel.: 040 78 88 88 222
E-Mail: presse@hamburgwasser.de
https://www.hamburgwasser.de/presse/pressemitteilungen/hamburg-wasser-verbrauchs-check-sparen-die-menschen-in-hamburg-mehr-wasser
(nach oben)
EVS investiert rund 10 Millionen Euro in die energetische Optimierung der Kläranlage in Saarbrücken-Brebach
Umweltministerin Petra Berg informierte sich vor Ort über das Projekt
Um künftig den im Rahmen der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlamm bzw. das hieraus zu gewinnende Klärgas energetisch nutzen zu können, wurde im Juli 2021 mit dem Umbau der Kläranlage zu einer Anlage mit Klärschlammbehandlung im Faulturm begonnen.
Am 11. August war Umweltministerin Petra Berg vor Ort, um sich über das komplexe Bauprojekt zu informieren.
„Kläranlagen sind unverzichtbarer Bestandteil der Wasserwirtschaft, denn sie reinigen das Abwasser und sorgen somit für eine höhere Qualität von Gewässern. Für diese Arbeit benötigen sie jedoch eine große Menge Strom“, sagt Berg. „Angesichts des Klimawandels sind die in Brebach durchgeführten Maßnahmen zur Energieoptimierung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes sehr zu begrüßen und können hoffentlich bald auch in anderen Kläranlagen umgesetzt werden. Der EVS leistet so bewusst einen Beitrag zum Klimaschutz.“
Die Kläranlage als Strom- und Wärmeerzeugerin
Der auf der Kläranlage Brebach anfallende Schlamm wird in Faulbehältern so behandelt, dass energiereiches Gas entsteht, das zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden kann. Das bautechnisch anspruchsvolle Verfahren erfordert vergleichsweise hohe Investitionen, jedoch senkt die gewonnene Eigenenergie – ca. 3,2 Millionen kWh/a – die Energiekosten deutlich, zudem wird der ökologische Fußabdruck erheblich verbessert (- 2 Millionen kg/a).
Künftig wird die Kläranlage Brebach ihren Strombedarf zu rund zwei Dritteln und ihren Wärmebedarf komplett durch die Nutzung der Energiepotenziale aus den Abwasserreinigungs- und Klärschlammbehandlungsprozessen decken. Ein weiterer positiver Effekt der Umstellung ist die Reduzierung des Schlammvolumens, die bewirkt, dass die Entsorgungskosten sinken und weniger Transporte über die Straße nötig werden.
Alle im Rahmen der Verfahrensumstellung benötigten neuen Bauwerke und Anlagenteile werden auf der Position eines der drei vorhandenen bisherigen Belebungsbecken errichtet, das dafür außer Betrieb genommen wird. Für die Umsetzung der Baumaßnahme und den Betrieb der Anlage, der zu jeder Zeit unter Einhaltung aller Grenzwerte sicher weiterlaufen muss, stellt das eine große Herausforderung dar. Die Reinigung des Abwassers wird trotzdem auch weiterhin in der gewohnten Qualität erfolgen.
Die für Juni 2024 vorgesehene Fertigstellung der Maßnahme verschiebt sich aufgrund von Materialengpässen und teilweise ungünstigen Witterungsbedingungen bis voraussichtlich Ende 2024.
Zur Baumaßnahme im Einzelnen:
Zur Umsetzung der benötigten Verfahrensänderung wurden im Bereich der Abwasserbehandlung zwei Vorklärbecken (Gesamtvolumen: 1134 m³) erstellt. Aus diesen Vorklärbecken wird der für die Klärgasgewinnung wertvolle Primärschlamm gewonnen.
In Anschluss daran erfolgt die weitere Reinigung des Abwassers in den Belebungs- und Nachklärbecken und auch die Phosphorelimination. Der in den Nachklärbecken anfallende Überschussschlamm wird ebenfalls der Schlammbehandlung zugeführt.
Um das Klärgas verwerten zu können, wird die Schlammbehandlung um die folgenden Prozessstufen erweitert:
• ein Pumpwerk zur Zugabe von Primärschlamm in den Heizschlammkreislauf,
• zwei Faulbehälter mit einem Gesamtvolumen von 3500 m³,
• ein Klärgasspeicher mit einem Volumen von 1000 m³ mit direktem Anschluss an die beiden neuen BHKW-Module und
• eine Gasfackel für Ausnahmefälle, in denen die BHKWs die anfallende Gasmenge nicht abnehmen können.
In einem neuen Technikgebäude wird darüber die benötigte Elektro-, Mess- und Steuerungstechnik untergebracht.
Die Maßnahme wird in insgesamt vier Bauabschnitten umgesetzt. Hiervon sind die beiden ersten Bauabschnitte und Teile des dritten Bauabschnittes bereits umgesetzt. Das beinhaltete insbesondere den Ausbau bestehender und die Verlegung neuer Leitungen, die Herstellung der beiden neuen Faultürme sowie des dazwischenliegenden Technikgebäudes und die Errichtung der zwei neuen Vorklärbecken.
Es folgen nun insbesondere Restarbeiten an den beiden Vorklärbecken sowie diverse Dämm-, Ausbau-, Schlosser- und Abbrucharbeiten, bis Ende dieses Jahres mit der elektrotechnischen Ausstattung begonnen werden kann.
Im vierten und letzten Bauabschnitt geht es dann insbesondere um die Verlegung zahlreicher Verbindungs- und Rohrleitungen, bevor im Herbst 2024 der dreimonatige Probebetrieb aufgenommen werden kann.
Weitere Ansätze zur Senkung des externen Energiebedarfes
Die energetische Umstellung der Kläranlage Brebach wie oben beschrieben wird flankiert von weiteren Maßnahmen, die dazu beitragen, den Energiebedarf der Kläranlage zu reduzieren.
So bringt der Einsatz von Photovoltaik-Modulen eine jährliche Einsparung von 160.000 kWh/a und eine CO2-Reduktion um 91.200 kg/a.
Um die im Abwasser enthaltene Wärme für das Betriebsgebäude der Kläranlage des EVS in Saarbrücken-Brebach nutzen zu können, wird das Abwasser aus dem Belebungsbecken der Kläranlage über einen Wärmetauscher geleitet, der diesem Wärme entzieht und sie zu einer Wärmepumpe transportiert. Die eingesetzte Gasmotor-Wärmepumpe hebt das Temperaturniveau an und speist die Wärme in das Heizsystem der Kläranlage ein. Die jährliche Einsparung von Erdgas zu Heizzwecken liegt im Durchschnitt bei rund 100.000 Kilowattstunden pro Jahr. Die umweltbelastenden CO2 -Emissionen werden hier um rund 20.000 Kilogramm pro Jahr gesenkt, was eine Reduzierung um 50 Prozent bedeutet.
https://www.evs.de/evs/oeffentlichkeitsarbeit/aktuelle-meldungen/details/evs-investiert-rund-10-millionen-euro-in-die-energetische-optimierung-der-klaeranlage-in-saarbruecken-brebach
Emschergenossenschaft: Hochwasserschutz am Hüller Bach
Neues Becken auf Bochumer Stadtgebiet schützt künftig auch Anliegende in Herne und Gelsenkirchen
Bochum / Herne / Gelsenkirchen. Die Emschergenossenschaft hat am Mittwoch in Recklinghausen ihren Aufsichtsrat über den aktuellsten Stand ihrer zahlreichen Projekte informiert. Mit im Fokus standen dabei die Themen Starkregenvorsorge und Hochwasserschutz. Vorgestellt wurde unter anderem ein Pilotprojekt, bei dem ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren zum Einsatz kam. Die Baumaßnahme am Hüller Bach soll die Überflutungsgefahr in Bochum, Herne und Gelsenkirchen deutlich verringern.
Im Bereich der Straße „An den Klärbrunnen“ auf Bochumer Stadtgebiet, nahe der Stadtgrenze zu Herne, plant die Emschergenossenschaft den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens sowie eines sogenannten Retentionsbodenfilters zur Zwischenklärung von Regenwassermengen. Das Becken wird ein zusätzliches Rückhaltevolumen von rund 90.000 Kubikmeter aufweisen. „Der positive Effekt für die in Fließrichtung unterhalb dieses Beckens anliegenden Gebiete in Bochum, Herne und Gelsenkirchen ist immens, denn die Wasserrückhaltung an dieser Stelle bewirkt eine Reduzierung des Wasserspiegels im Hüller Bach um bis zu 70 Zentimeter“, sagt Dr. Frank Dudda, Vorsitzender des Genossenschaftsrates der Emschergenossenschaft und Oberbürgermeister der von dieser Maßnahme ebenfalls profitierenden Stadt Herne.
Die Lage des Hochwasserrückhaltebeckens ist bewusst und mit Bedacht gewählt worden. „Weit am Oberlauf gelegen, erzielen solche Hochwasserschutzmaßnahmen ihre größte Wirkung für die Region: Was bereits dort zurückgehalten werden kann, entlastet den Hüller Bach in seinem weiteren Verlauf – und letztlich auch die Emscher“, so Dudda weiter. Der Hüller Bach ist der größte Nebenfluss der Emscher. Zu seinem Einzugsgebiet gehören auf den Gebieten von Bochum und Herne unter anderem auch der Dorneburger Mühlenbach, der Hofsteder Bach und der Marbach.
Der Baubeginn für das Hochwasserrückhaltebecken und den Retentionsbodenfilter ist für Anfang 2024 geplant, vorbehaltlich der noch erwarteten Genehmigung. In enger Abstimmung mit den Kommunen Bochum und Herne sowie der Bezirksregierung Arnsberg hatte die Emschergenossenschaft den Genehmigungsantrag im November 2022 eingereicht. „Das gute und gemeinsame Vorgehen sollte die Genehmigungsphase beschleunigen – im Idealfall entsteht damit eine Blaupause für künftige Bauprojekte, denn besonders bei Hochwasserschutzprojekten ist schnelles Handeln zwingend erforderlich“, so Dr. Frank Dudda.
Das Projekt „Hüller Bach – An den Klärbrunnen“ ist eines der Vorhaben, die in der Roadmap Krisenhochwasser beschrieben wurden. Die Roadmap wurde im Frühjahr 2022 vorgestellt, nachdem die Emschergenossenschaft zuvor – als Reaktion auf das verheerende Hochwasser im Ahrtal im Juli 2021 – von ihrem Aufsichtsrat den Auftrag erhielt, den Hochwasserschutz an der Emscher weiter zu verbessern.
Die Emschergenossenschaft
Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Sie wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet und kümmert sich seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie um den Hochwasserschutz.
https://www.eglv.de/medien/hochwasserschutz-am-hueller-bach/
Emscher wirbt für den Einsatz von Abwasserwärme
EGLV-Chef Paetzel erläutert das gewaltige Potenzial dieser bisher wenig genutzten Energiequelle.
er stetige Strom an Abwasser ist aufgrund seiner konstant hohen Temperatur eine verlässliche Energiequelle. Bisher spielt Abwasser in der Debatte zur Energiewende noch eine untergeordnete Rolle. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Es ist eine lokale, sichere, regenerative und langfristig verfügbare Energiequelle und unkompliziert nutzbar.
Über all diese Vorteile der als Aquathermie bezeichneten Abwasserwärmenutzung informierten Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) am Donnerstag in Bochum unter anderem Vertreter:innen aus der Wohnungswirtschaft, der Politik sowie von Stadtwerken. Eine Impulsrede hielt Mona Neubaur, Wirtschafts- und Klimaschutzministerin des Landes Nordrhein-Westfalen.
Gängige Technologie
Die Aquathermie ist eine gängige Technologie, die hierzulande jedoch kaum genutzt wird. In Frankreich ist man da bereits deutlich weiter: Der Elysée-Palast (Sitz des französischen Präsidenten), der Senat sowie das Gebäude der Assemblée Nationale (Nationalversammlung) werden unter anderem auch mit aus dem Pariser Abwasserkanalnetz gewonnener Wärme geheizt.
In Deutschland fließt täglich eine gigantische Menge Abwasser durch hunderttausende Kilometer Kanalnetz, das bisher weitgehend ungenutzte Restwärme enthält. Mit dieser Restenergie könnten in Deutschland vier bis zwölf Millionen Menschen klimafreundlich heizen.
Ökonomische Alternative zu Öl und Gas
„Die Aquathermie ist gerade im Einzugsgebiet von Emscher und Lippe eine Möglichkeit, um die Wärmewende erfolgreich umzusetzen“, sagte Neubaur. Das Ruhrgebiet ist mit seinen über fünf Millionen Einwohner:innen eines der größten Ballungsgebiete in Europa. Das bedeutet auch: Nirgendwo ist das unterirdische Kanalnetz so dicht wie direkt vor unserer Haustür“ erläuterte Frank Dudda, Vorsitzender des Genossenschaftsrates der Emschergenossenschaft.
„Auch ökonomisch ist die Abwasserwärmenutzung eine ernst zu nehmende Alternative zu fossilen Energieträgern und bietet ein hohes Maß an Versorgungssicherheit“, sagte Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft.
Pilotprojekt in Bochum
Abwasserwärme kann einen nachhaltigen und effizienten Baustein eines ganzheitlichen kommunalen Wärmekonzepts bilden. Insbesondere für Abnehmer wie Seniorenwohnheime, Bäderbetriebe oder Kläranlagenbetreiber ist Abwasserwärme eine sinnvolle Möglichkeit, sich von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen.
Ein gutes Beispiel zeigt ein Pilotprojekt von EGLV in Kooperation mit den Stadtwerken Bochum auf: 2009 wurde die Aquathermie im Bochumer Nord-West-Bad umgesetzt. „Wir nutzen die Abwasserwärme aus dem nahegelegenen Marbach. Mit messbarem Erfolg: Wir decken damit bis zu 65 Prozent des Wärmebedarfs und sparen gleichzeitig bis zu 40 Prozent CO2. Diese Technologie ist sicher dazu geeignet, künftig einen großen Beitrag in der Wärmenutzung zu leisten“, berichtet Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.
Haushaltswasser mit 25 Grad
„Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und Gas – die nur endlich verfügbar sind und über ihre Verbrennung klimaschädliche Emissionen mit erheblichen Folgeschäden und -kosten erzeugen – ist Abwasser fast überall und dauerhaft verfügbar und hat selbst in den Wintermonaten relativ hohe und konstante Temperaturen“, sagt Frank Obenaus, Technischer Vorstand der Emschergenossenschaft.
Das Abwasser verlässt einen Haushalt mit einer Durchschnittstemperatur von 25 Grad. Fließt das Abwasser durch die unterirdischen Kanäle, hat es durch die gute Isolierung des Erdreichs eine Durchschnittstemperatur von rund zehn bis 15 Grad, je nach Jahreszeit.
Installation im Ablauf einer Kläranlage
Wird ein Wärmetauscher im Kanalrohr oder idealerweise im Ablauf einer Kläranlage installiert, überträgt er die Wärme und macht diese in Kombination mit einer Wärmepumpe für den Heizkreislauf nutzbar. Somit kann mit Abwasserwärme geheizt oder im umgekehrten Fall auch gekühlt werden.
„Wenn nur zehn Prozent der potenziellen Abwasserwärme genutzt würden, könnte das EGLV-Netz den Wärmebedarf einer mittelgroßen Stadt mit ca. 30.000 Einwohner:innen decken“, so Paetzel. (hp)
https://www.zfk.de/wasser-abwasser/abwasser/emscher-wirbt-fuer-den-einsatz-von-abwasserwaerme
Emscher-Lippe-Erlebnis für alle
Mach mit am Fluss!
Der größte und wichtigste Meilenstein unseres Generationen-Projektes Emscher-Umbau wurde mit der Abwasserfreiheit im Emscher-System Ende 2021 erreicht. Neben den bereits umgestalteten Gewässern und bestehenden ökologischen Schwerpunkten, stehen weitere Renaturierungsmaßnahmen an der Emscher bevor. Das revitalisierte Emscher-System wird künftig ein wichtiges Beispiel für die Möglichkeiten urbaner Biodiversität im aquatischen Bereich sein – und daneben ein wertvoller Erlebensraum für zukünftige Generationen.
Wir wollen diesen Anlass nutzen: Die Emscher soll erlebbar werden – vom ehemaligen Meideraum zum Naherholungsgebiet mit viel Aufenthaltsqualität und Freizeitangeboten. Auch an der Lippe und den vielen Nebengewässern hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan: Die Lippe ist nicht nur der längste Fluss Nordrhein-Westfalens, sondern auch wunderschön. Dafür sorgen wir gemeinsam mit dem Land NRW unter anderem mit dem Programm „Lebendige Lippe“.
Wichtig für uns sowohl beim Emscher-Umbau als auch beim Programm „Lebendige Lippe“: Wir wollen zu einer sozial ausgewogenen und ökologisch positiven Entwicklung beitragen. Dafür bleibt die Ermöglichung von gesellschaftlicher Teilhabe ebenfalls ein wichtiges Thema für uns – und das Angebot ist vielfältig: Bei „Mach mit am Fluss!“ werden im gesamten Emscher- und Lippe-Einzugsgebiet spannende Orte geschaffen, die einladen, aktiv unterwegs zu sein entlang unserer Gewässer, dabei Kunst zu entdecken, die (neue) Natur und Gewässerlandschaft zu erleben und dort zu lernen. Wir wollen den Menschen die Gewässer zurückgeben und rufen unter „Mach mit am Fluss!“ zum Miterleben und Mitlernen sowie zum weiteren Mitentwickeln und -gestalten auf.
Mehr:
https://www.eglv.de/machmitamfluss/
Dresden: Ich fahre mit Strom aus Klärgas
Christian Reich ist ein Pionier in Sachen Nachhaltigkeit. Der Mitarbeiter der Stadtentwässerung Dresden GmbH fährt seit einem halben Jahr mit seinem neuen Lastenrad mit E-Motor zur Kontrolle seiner Baustellen. Er spart damit nicht nur CO2, sondern auch Zeit und Nerven. Im Interview erzählt er, wie er auf die Idee kam, warum er sein Rad liebt und welche Vorteile es ihm bringt.
Wie nutzen Sie Ihr Lastenrad im Arbeitsalltag?
Ich brauche mein Rad für die täglichen Baustellen-Kontrollen. Also jedes Mal, wenn irgendwo in der Stadt ein Anschlusskanal gebaut wird, bin ich damit unterwegs. Nur bei mehr als 50 Kilometern Gesamtstrecke oder bei Schnee weiche ich auf das Auto aus. Auf der Baustelle angekommen, muss ich keinen Parkplatz mehr suchen und das Gepäckabteil ist mit 260 Liter sogar größer als der Polo Kofferraum, da passen bequem Messrolle, Helm, Kanaldeckelheber, Werkzeug sowie fünf Liter Wasser fürs Händewaschen rein.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Lastenrad zu verwenden?
Mein Kollege und ich hatten uns ein Auto geteilt und sollten ein weiteres bekommen. Ich habe damals zu meiner Chefin Isabella Hofmann gesagt: „Ich würde auch mit einem Lastenrad fahren“. Man könnte die Routen so planen, dass mein Kollege Rick Effenberger für die weiter entfernten Strecken das Auto nutzt und ich für den näheren Umkreis das Rad.
Gesagt, getan?
Es dauerte dann doch noch fast drei Jahre, bis ich starten konnte. Meinem Verbesserungsvorschlag, der im zweiten Versuch durchkam, schlossen sich noch einige Praxistests und Berechnungen an. Der Unterschied bei den Fahrzeiten war gering. Ich war mit dem Fahrrad auf Dauer sogar schneller und günstiger unterwegs als mit dem Auto. Die Anschaffungskosten lagen bei rund 7.000 Euro, sie wurden mit 1.500 Euro gefördert.
Was sind die Vorteile eines Lastenrads gegenüber einem Auto?
Zum einen ist es natürlich umweltfreundlicher. Ich spare pro Jahr etwa eine viertel Tonne CO2 ein. Zum anderen ist es auch gesünder für mich. Ich bewege mich gern an der frischen Luft und halte mich fit. Außerdem macht es einfach Spaß, mit dem Rad zu fahren.
Wie kommen Sie mit dem Wetter zurecht?
Ich fahre auch bei Regen und schlechtem Wetter mit dem Rad, das ist kein Problem. Und bei Schnee und Frost ist auf den meisten Baustellen nicht so viel los. Oder anders gesagt: Bausaison ist gleich Fahrradsaison.
Wie reagieren Ihre Kollegen und Kunden auf Ihr Lastenrad?
Viele Passanten und andere Radfahrer sind positiv überrascht und finden es toll, dass ich mit einem Dienstrad unterwegs bin. Manche KollegInnen fragen mich, ob sie mal eine Probefahrt machen dürfen. Ja, das Rad ist über Outlook buchbar. Es fährt sich natürlich etwas speziell, da es inklusive Ladung bis zu 80 Kilogramm schwer ist (ohne Fahrer) und die Lenkung anders reagiert. Außerdem sieht man das Vorderrad nicht. Beim Wechsel zwischen Fahrbahn und Bürgersteig suche ich mir immer eine Absenkung.
Wo steht das Rad und wird aufgeladen?
Das Rad parkt gut gesichert in der Tiefgarage der Marie-Curie- Straße. Geladen wird der Akku unter Aufsicht in meinem Büro.
Und ein erstes Fazit lautet?
Mittlerweise bin ich schon 750 Kilometer gefahren und immer noch begeistert wie am ersten Tag. Ich finde, das Lastenrad passt gut zu uns als Umweltunternehmen, eigentlich könnte es noch mehr davon geben!
https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/journal-1/detail/ich-fahre-mit-strom-aus-klaergas/
Bergisch-Rheinischer Wasserverband: Der BRW feiert sein 50-jähriges Bestehen mit Aktionstagen für Jedermann
Am 3. Oktober 1973 wurde der BRW gegründet. Auch zum 50-jährigen Bestehen bleibt sich der gemeinwohlorientierte Wasserverband treu und bietet Aktionen an, zu denen interessierte Bürger:innen herzlich eingeladen sind.
Unter dem Motto: „Wir leben für Wasser. Und das schon seit 5 Jahrzehnten.“ sind drei Aktionstage geplant, an denen jedermann Einblicke in die vielfältige Arbeit des Wasserverbands bekommen kann. Ausflüge in die Welt der Abwasserreinigung und Gewässerunterhaltung in Form von Führungen über Klärwerke und Exkursionen an Gewässerabschnitte stehen im Mittelpunkt der Aktionstage am 19. August in Ratingen und am 9. September in Monheim.
Am 30. September veranstaltet der BRW zudem einen Tag der offenen Tür auf seinem Betriebshof in Hilden.
Ganz kurz vor dem 50. Gründungsgeburtstag lädt der BRW zu einem Tag der offenen Tür ein, wo es neben Spaß und Spiel viel Wissenswertes über den BRW, seine Aufgabenerfüllung und seinen Werdegang im Laufe der letzten 5 Jahrzehnte zu erfahren gibt.
Weitere Informationen und Anmeldungen zu Führungen und Exkursionen unter
http://brw-haan.de/aktuell/termine
http://www.brw-haan.de/aktuell/presse/50-jahre-bergisch-rheinischer-wasserverband-der-brw-feiert-sein-50-jaehriges-bestehen-mit-aktionstagen-fuer-jedermann
Mit SEMA in die Zukunft schauen
Preisgekröntes Kanalalterungsmodell wurde vervollkommnet und besteht in der Praxis
Angenommen, wir würden unseren Apparat stur darauf ausrichten, in jedem Jahr rund ein Prozent des Kanalnetzes anzufassen und dabei gut 21 Kilometer auszuwechseln, 55 Kilometer zu renovieren – was meistens Berlinern bedeutet – und weitere 18 Kilometer zu reparieren, dann wäre das bis 2060 eine feine Sache. Der Zustand unseres Gesamtnetzes würde bis dahin immer besser, obwohl es unter diesen Annahmen stetig weiter altern würde. Aber danach würde unser rüstiger Rentner, so könnte man das Netz dann umschreiben, schnell immer klappriger.
Bis 2120, also in hundert Jahren, hätte sich die Verbesserung der ersten Jahrzehnte aber regelrecht umgekehrt und die Zahl der Kanäle, denen es richtig schlecht geht, wäre wahrscheinlich mehr als doppelt so groß wie heute. Das will natürlich niemand.
Solche Zahlen – zumeist mit so klaren wie kunterbunten Flächengrafiken eingängig visualisiert – spuckt die inzwischen gut trainierte und mit neuen Daten weiter lernende SEMA-Maschine aus, das Kanalalterungsmodell für Sanierungsstrategien, wir zusammen mit dem Kompetenzzentrum Wasser Berlin entwickelt haben.
2019 gab es für den Prototyp den Innovationspreis des VKU und branchenweit viel Aufmerksamkeit. Zwei Jahre weiter wird SEMA, das mit Nachnamen Berlin heißt, bei uns bis zur einzelnen Haltungsebene implementiert und soll damit künftig als Basis der Investitionsplanung dienen, also betrieblich genutzt werden. Und erweist sich dabei offenbar im Vergleich zwischen Simulations- und echten Inspektionsergebnissen zumindest bisher als 99-prozentig genau und übertrifft damit Wetter- und Lottoprognosen weit.
Gemauert sind Hundertjährige noch fast jugendlich
Weil SEMA inzwischen eine Menge Dinge verinnerlicht hat. Also welches Material aus welchem Jahr wo liegt und wann es wahrscheinlich altersschwach wird. SEMA prognostiziert den Netzzustand und zeigt Sanierungsschwerpunkte im Netz. „Der Netzsimulator gibt das Soll vor, über den Haltungssimulator wird das Ist verbessert. Beide Simulatoren ergänzen sich. Denn nur was man findet, kann man auch sanieren“, sagt SEMA-Mitentwickler Alexander Ringe. Wobei Alter abhängig vom Material relativ ist. Gemauert sind Hundertjährige noch fast jugendlich, während 30-jährige Plastik-Greise der Erlösung harren.
Und SEMA Berlin weiß auch, dass grabenlos im Vortrieb montierte Kanalrohre gegenüber offen im Graben verlegten Röhren zwar fast doppelt so teuer in den Boden kommen, dafür aber vermutlich auch ewig halten, weil dafür dickere Rohre verwandt werden und eben auch kein Baugraben verfüllt werden muss, was die Rohre ja auch ordentlich unter Druck setzt.
Und auch der Fakt, dass wir heute ja vorwiegend linern und weniger neu bauen, bringt Ringe auch angesichts der absehbaren Halbwertzeit der Kunststoffimplantate nicht um den Schlaf. „Wenn die Teile dann nach 50 plus x Jahren erschöpft sind, dann müssen wir sie halt rausfräsen und neu linern.“ Was die Stadt weniger stört und finanziell allemal günstiger ist.
Die Erkenntnisse aus der Anwendung des Strategie-Simulators haben uns schon klüger gemacht. So wissen wir jetzt dank SEMA, dass wir unsere heutige Sanierungsstrategie nachbessern oder weiterentwickeln müssen, um unsere Kanäle generationenübergreifend nachhaltig zu bewirtschaften. Was wir heute tun, reicht ab 2060 dafür nicht aus. Die Stellschrauben für diese Nachbesserung sind identifiziert, beispielsweise der Verbau dickerer Rohre oder die Verlängerung der Nutzungsdauer von Linern.
Mehr:
https://www.bwb.de/de/25726.php
Neubau der Kläranlage Ober-Eschbach
Bad Homburg bekommt eine neue Kläranlage! Die aktuelle Kläranlage ist den künftigen Aufgaben und Einwohnerwerten nicht mehr gewachsen und wird durch eine moderne und fortschrittliche ersetzt. Die Dauer dieses Mammutprojekts ist auf etwa sechs Jahre angelegt.
Hier halten wir Sie über den Baufortschritt auf dem Laufenden.
https://www.bad-homburg.de/de/stadt/planen-und-bauen/klaeranlage
Stuttgart: Lea Spraul im Stuttgarter Untergrund
Die Tiktokerin Lea Spraul – auch als Redakteurin beim SWR tätig – hat unseren Kollegen Stipe Jurkovic im Regenüberlaufbecken Schwanenplatz besucht. Inzwischen sind die dort entstandenen Videos in Lea Sprauls Tiktok-Account „Leas Lifehacks“ verfügbar und Stipe Jurkovic erklärt, warum wir so ein Becken überhaupt brauchen, wozu die Spülkippen im Regenüberlaufbecken da sind und wie sie funktionieren. Im dritten Video erzählt Stipe Jurkovic, welche kuriosen Funde im Regenüberlaufbecken so ankommen.
Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen.
https://www.stuttgart-stadtentwaesserung.de/lea-spraul-im-stuttgarter-untergrund/
Ruhrverband mit dem DWA-Klimapreis ausgezeichnet
Klimaschutz, Klimaanpassung und Klimaresilienz stehen im Fokus des Projektes „Klimafreundlicher Ruhrverband“
Der Ruhrverband hat den 3. Platz beim erstmals ausgeschriebenen Klimapreis 2023 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) gewonnen.
Das Projekt des Ruhrverbands dient dem Klimaschutz und der Klimaanpassung. Es hat den offiziellen Titel: „Klimafreundlicher Ruhrverband – Klimaanpassung und Klimaschutz zum Wohle von Mensch und Natur“. Dabei stehen eine ausgeglichenen Klimabilanz bis 2030, die Erhöhung der Klimaresilienz des Talsperrensystems zur Sicherung der Trinkwasserversorgung und das nachhaltige Wirtschaften des Ruhrverbands im Fokus.
Schon ab dem Jahr 2024 wird der Ruhrverband seine Anlagen in der Jahresbilanz nahezu vollständig mit eigenproduziertem, umweltfreundlichen Strom versorgen. Dazu nutzt der Verband den Strom aus sechs eigenen Wasserkraftanlagen an Ruhr und Lenne, aus 13 eigenen Photovoltaikanlagen sowie aus dem Betrieb von etwa 50 Blockheizkraftwerken auf den Kläranlagen. In den Blockheizkraftwerken wird das bei der Klärschlammbehandlung entstehenden Biogas zu Strom- und Wärmeerzeugung genutzt. Auf sechs Kläranlagen wird die Biogasausbeute durch die gemeinsame Behandlung organikreicher Abfälle wie beispielsweise Fetten oder Rückständen aus Fettabscheidern unterstützt.
Zusätzlich hat der Ruhrverband bereits vor einigen Jahren damit begonnen, seine Kläranlagen einer gründlichen energetischen Optimierung zu unterziehen. Als Ergebnis wird beispielsweise die zweitgrößte Kläranlage des Ruhrverbands in Bochum-Ölbachtal bereits energieneutral betrieben. Hier stand im Jahr 2021 einer Eigenerzeugung von 5,3 Millionen Kilowattstunden ein Verbrauch von nur 4,8 Millionen Kilowattstunden gegenüber. Zudem konnte durch die verfahrenstechnischen Umstellungen und den Einsatz energieeffizienter Belüftung und Durchmischung der Belebungsbecken auch die Qualität des gereinigten Abwassers nochmals gesteigert werden. Auch die größte Kläranlage in Duisburg soll energetisch optimiert und energieneutral betrieben werden.
Für diesen herausragenden Beitrag zum Klimaschutz gab es Ende September 2022 die Auszeichnung als „Climate Smart Utility“ auf dem Weltwasserkongress der International Water Association (IWA) in Kopenhagen, dem weltweit größten Branchentreffen für den öffentlichen und privaten Wassersektor – als einzige deutsche Organisation neben Wasserver- und Abwasserentsorgern aus verschiedenen Teilen der Welt.
Insgesamt haben sich gut 40 Projekte aus den verschiedensten Bereichen der Wasserwirtschaft um den ersten DWA-Klimapreis beworben. Das Spektrum innovativer, kreativer und zudem höchst erfolgreicher Projekte reichte von der Abwasserwärmenutzung bei der Kanalsanierung über energieeffiziente und multifunktionale Retentionsbodenfilter zur weitergehenden Abwasser- und Mischwasserbehandlung bis zum intelligenten Regenwassermanagement und den Asphaltknacker*innen zur Bodenentsiegelung. Die Ehrung der Gewinner erfolgt im Rahmen des DWA-Dialogs Berlin am 19. September im Umweltforum Berlin.
Sieger des DWA-Klimapreises 2023 wurde die hanseWasser Bremen GmbH für ihr Energieeffizienzprogramm „kliEN“ und Zweitplatzierter wurde HAMBURG WASSER für das Projekt „Multifunktionaler Überflutungsschutz für einen Stadtteil – ein Sportplatz macht auf Blau. Das Hein-Klink-Stadion Hamburg Billstedt“.
OOWV: erneuert Abwasserkanäle in Elsflether Fußgängerzone
Innenstadtsanierung geht weiter
Elsfleth. In Elsfleth schreitet die Innenstadtsanierung voran, den nächsten Bauabschnitt läutet der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) Mitte August ein: Dann beginnen an der Steinstraße zwischen Apotheke und Rathaus die Vorarbeiten für einen neuen Schmutz- und Regenwasserkanal. Der ganze Bereich wird freigeräumt, unter anderem werden die Blumenbeete abgebaut. Dann beginnen die eigentlichen Kanalarbeiten, zunächst von der Apotheke bis einschließlich Parkplatz Mitte.
Kandern: Stadt will ihren Energieverbrauch durch Monitoring senken
Kandern will den städtischen Energieverbrauch stärker überwachen. Dass sich das finanziell lohnt, hat Stadtkämmerer Benedikt Merkel im Gemeinderat erläutert. Mehr:
https://www.badische-zeitung.de/stadt-kandern-will-ihren-energieverbrauch-durch-monitoring-senken–277735815.html
hanseWasser: Menschen und Technik verbinden für ausgezeichneten Klimaschutz
hanseWasser gewinnt den DWA-Klimapreis
Anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens hat die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) einen Klimapreis ausgelobt. Ausgezeichnet werden bereits realisierte Projekte mit Leuchtturmcharakter, die sich der Klimaanpassung und dem Klimaschutz widmen. Nun steht fest: Der Preis geht nach Bremen! hanseWasser konnte die Jury mit dem Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekt „kliEN“ und den daraus folgenden Nachhaltigkeitsaktivitäten überzeugen. Seit vielen Jahren befasst sich hanseWasser mit den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung und hat sich frühzeitig anspruchsvolle Klimaschutzziele gesteckt. Allen voran die CO2-neutrale Abwasserreinigung bis zum Jahr 2015. Hiermit sollte nicht zuletzt ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutzprogramm der Freien Hansestadt Bremen geleistet werden. Ausgangspunkt der umfangreichen Maßnahmen war 2011 das Klimaschutz- und Energieeffizienzprogramm kliEN.
Über die erfolgreiche Verbindung von technischen Optimierungs- und Effizienzmaßnahmen sowie die aktive Einbindung eines Großteils der Belegschaft wurden die selbstgesteckten Klimaziele erreicht. Mit der CO2-Neutralität des Gesamtunternehmens endete das Projekt – die Klimaschutzaktivitäten jedoch nicht. Die entwickelte Klimaschutzkultur zog weiteres Engagement in den Bereichen Klima- und Umweltschutz nach sich und gipfelte schließlich in der Entwicklung eines umfangreichen Nachhaltigkeitsmanagements. Ein Vorgehen, das die Jury des DWA-Klimapreises überzeugte.
Auszug aus der Jurybegründung:
Was Bremen auszeichnet, ist zunächst klassisch den Hebel an der Technik anzusetzen, um klimaneutral zu werden, aber auch die Belegschaft intensiv zu integrieren und diese zum Mitmachen zu animieren, sowie die Aktivitäten der Belegschaft in Punkto Klimaschutz auch zu honorieren. Von den Klimaaktivitäten kam die hanseWasser Bremen dann zur Nachhaltigkeit und damit zu einer klaren Integration von sozialen und ökonomischen Aspekten. Dadurch wurde und ist das Unternehmen ein absolut attraktiver Arbeitgeber insbesondere auch für den Nachwuchs. „Der hanseWasser ist eine gelungene Verbindung gelungen, von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, die Nutzung innovativer Technik und besonders die Mitnahme und Motivation der Belegschaft bei den Zielen Klimaneutralität und Nachhaltigkeitskultur“, betont Dr.-Ing. habil. Uwe Müller, DWA-Vizepräsident und Juryvorsitzender.
Kontakt:
hanseWasser Bremen GmbH | Jana Küffner | Pressesprecherin | Telefon 0421 988 1233 | Mobil 0162 24 91 425
E-Mail: kueffner@hanseWasser.de | www.hansewasser.de