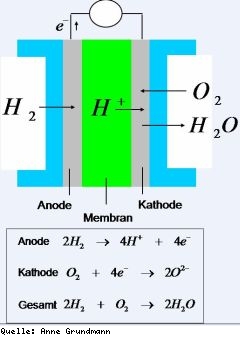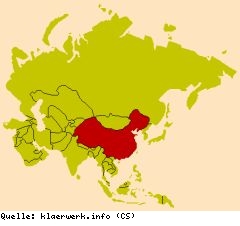| Dezember 2011 |
| Zeulenroda |
Hohe Verluste bei Abwasser |
| Westerkappeln |
Entlastung beim Abwasser |
| Tannhausen |
Abwasser und Klärschlamm |
| Oderaue |
Bakterien helfen beim Stromsparen |
| Neu-Isenburg |
Gebühren für Abwasser werden erhöht |
| Moos |
Feuchttücher legen Kläranlage lahm |
| Herbolzheim |
Veränderung bei Gebühren |
| Flammersfeld |
Abwasserbeseitigung: 15 Cent mehr pro Kubikmeter |
| Erfurt |
CDU will Abwasser-Beiträge verringern |
| Eisenberg |
Zweckverband 2012 noch ohne Kredit |
| Burkhardtsdorf |
Abwasser aus Burkhardtsdorf fließt jetzt in neue Kläranlage |
| Wollersleben |
Wollersleben ist angeschlossen
|
| Warstein |
Wasser und Abwasser sollen teurer werden |
| AZV Südholstein |
Preisträger des Malwettbewerbs zu Gast |
| Schwandorf |
Machbarkeitsstudie zur Klärschlammverwertung |
| Pustertal |
Bericht Kanalinspektion Betriebsjahr 2010 |
| Ortenau |
Klärschlamm: Ausgeglichene Bilanz |
| Ortenau |
Von Trocknung spricht keiner mehr |
| Öhningen |
Abwasser- Gemeinderat beschließt neue Gebühren |
| Offenburg |
AbwasserPilotanlage zur Phosphorrückgewinnung geht in Betrieb |
| Neunburg |
Stadtwerke investieren in eine neue Kläranlage |
| Neuburg |
Im Klärschlamm steckt wertvoller Phosphor |
| Odenbachtal |
Sanierung der Regenentlastungsanlagen im Odenbachtal und Anschluss des Odenbachtals an die Gruppenkläranlage Lauterecken |
| Neuburg |
Klärwerk soll mehr auffangen |
| Obere-Lutter |
Kohle gegen Schadstoffe |
| Lohe |
Lohe will Abwasser-Zweckverband mit Heide |
| Leverkusen |
Mit neuen, kombinerten Verfahren Klärschlamm verringern |
| Illertissen |
Das Abwasser wird billiger |
| Holzheim |
Zu viel Schmutz im Bach |
| Hildburghausen |
Jetzt wird alles geklärt |
| zv-untere-zschopau |
In der KA Hartha ist der Neubau der stationären Schlammentwässerung am 14.10.2011 feierlich eingeweiht worden |
| Hamburg |
RISA – das Gemeinschaftsprojekt zur Umsetzung einer zukunftsfähigen Regenwasserbewirtschaftung in Hamburg |
| Braunschweig |
Re-Water Braunschweig |
| November 2011 |
| Friedrichshafen |
Auftragsvergabe: Klärschlamm wird vom selben Anbieter entsorgt |
| Dresden |
Fauleier“ mit blau-grauem Anstrich – Ab Ende November soll die Gasproduktion starten |
| Bad Herrenalb |
Bildung eines Eigenbetriebs Abwasser |
| Ahrensburg |
Biogas durch Ultraschall |
| Aggerverband |
Aggerverband verleiht Förderpreis |
| Erftverband |
Fehleinleitung wird sehr teuer |
| Heinzenberg |
6,6 Millionen Euro für „sauberes“ Abwasser |
| Wupperverband |
Mit Volldampf erneuerbare Energien nutzen |
| Braunlage |
Abwasser: Stadt zahlt Geld an Kläger |
| Seelow |
Seelower Wasserverband: kämpft mit Ausfall seines Großkunden |
| Liebenburg |
Ratsbeschluss: Wasserpreis steigt, Abwasserpreis sinkt |
| Ingolstadt |
Kanalnetzkalibrierung (Kernstadt) im Rahmen des Generalentwässerungsplans |
| Rodgau |
Cannabis-Plantage hinter der Kläranlage |
| Klosterneuburg |
Auch die Stadt Klosterneuburg setzt auf den WABAG-Hybrid Prozess |
| Duisburg |
Minister Remmel will Anlage in Duisburg-Vierlinden zur Eröffnung besuchen |
| Kaster |
Gruppenklärwerk- Ertüchtigung der Belebung und Bau einer Prozesswasserbehandlungsanlage |
| Pfattertal |
Gebühr für Abwasser steigt deutlich |
| Duisburg |
dynaklim entwickelt Anpassungsstrategien mit den Duisburger Wirtschaftsbetrieben |
| Oktober 2011 |
| Ulm/Neu-Ulm |
Regierungspräsidium Tübingen gibt Fördermittel für den weiteren Ausbau der Aktivkohlestufe des Klärwerks Steinhäule in Höhe von 2,6 Millionen Euro frei |
| St. Georgen |
Regierungspräsidium fördert privates Abwasserprojekt in St. Georgen mit rd. 167 000 Euro |
| Parchim |
Stinkender Klärschlamm auf 20 Kilometern: Straße dicht |
| Kandern |
Regierungspräsidium Freiburg bezuschusst Bau eines neuen Regenüberlaufbeckens für die Kläranlage der Stadt Kandern mit fast 900.000 EUR |
| Bad Abbach |
Umweltminister startet Pilotprojekt für Kläranlagen |
| Wollersleben |
WOLLERSLEBEN IST ANGESCHLOSSEN |
| Wittenberge |
Knappe Million fließt in Kläranlage |
| Wißgoldingen |
Wißgoldingen will an die Verbandskläranlage |
| Velden |
Abwasser fließt nach Velden |
| Unterwössen |
Kanalgebühren steigen um bis zu 70 Prozent |
| Thalfang |
Thalfang investiert in Abwasserbeseitigung |
| Reichelsheim |
Parlament beschließt höhere Gebühren |
| Ochsenfurt |
Millionen gegen den Gestank |
| Nedlitz |
Weniger Abwasser in die Havel |
| Mittelberg |
Gebühren für Trinkwasser und Kanal in steigen |
| Havelländisches Luch |
Zweckverband zahlt nun Beiträge zurück – für Anschlüsse ab 1993 |
| Liebenburg |
Ratsbeschluss: Wasserpreis steigt, Abwasserpreis sinkt |
| Kühbach |
20 Cent mehr für das Abwasser |
| Harsewinkel |
Elimination von Mikroschadstoffen im Abwasser |
| Zschopau/Gornau |
Verband hebt ab 2012 Gebühren für Abwasser an |
| Geiselwind |
Abwasser wird teurer |
| Eriskirch |
Erhöhung beim Abwasser |
| Bad Emstal |
Bereit für das Abwasser |
| Büdingen |
Neues Becken für Büdinger Kläranlage |
| Beverstedt |
Abwassergebühren steigen |
| Bargfeld-Stegen/Bargteheide |
Aus drei Klärwerken mach eins |
| Titisee-Neustadt |
Umsetzung des Mischwasserbehandlungskonzeptes im Kanalnetz der Stadt Titisee-Neustadt wird vom Land mit über 900.000 Euro bezuschusst |
| AV Saale-Lauer |
Die Kläranlagen müssen Energie sparen |
| Obere Spree |
Rettung des Abwasserverbandes im Oberland droht zu scheitern |
| Neuenburg |
Sickerwasserreinigungsanlage der Deponie Neuenburg in Betrieb |
| Männedorf |
Neues Wirbelbett und Filtration für die Kläranlage Männedorf |
| Klosterneuburg |
Auch die Stadt Klosterneuburg setzt auf den WABAG-Hybrid Prozess |
| Kleines Wiesental |
Kleines Wiesental erhält über 2 Mio. Euro Landeszuschuss für Verbesserung der Abwasserentsorgung |
| Baltmannsweiler |
Hund aus Kläranlage gerettet |
| Balingen |
Kommunen verwerten ihren Klärschlamm |
| Andermatt |
WABAG Schweiz realisiert den Ausbau der ARA Andermatt in den Schweizer Alpen |
| September 2011 |
| Wörth |
Die Sanierung wird durch Gebühren bezahlt |
| WAGENITZ |
Abwasser besser dosiert |
| Suhl-Dietzhausen |
Neues BHKW nutzt Faulgase der modernsten Kläranlage Südthüringens |
| Schwerin |
Biofilter gegen üble Gerüche |
| MÜHLACKER-LOMERSHEIM |
Millionenschwerer Ausbau der Kläranlage |
| Hinterzarten und Breitnau |
Hinterzarten und Breitnau arbeiten künftig in der Kläranlage zusammen |
| Hilden |
Klärwerk wird modernisiert |
| Eisenach-Erbstromtal |
Der Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal will künftig mit den Stadtwerken Erfurt und den Eichsfeldwerken zusammenarbeiten |
| Dörsbachtal |
Kläranlage wird ausgebaut |
| Aurich |
Aurich heizt mit kalter Wärme |
| Sasbachwalden |
Schnelles Internet durch Glasfaser im Abwasser |
| Lippstadt |
Pilotprojekt Klärschlamm dient dem Klimaschutz |
| August 2011 |
| Zeltweg |
W+F liefert Kompaktanlage WS200 incl. Sandwäsche |
| Wien |
Abwasserprofis bei der KinderuniTechnik |
| Wangen |
Energiegewinn aus anaerober Klärschlamm-Faulung |
| Innsbruck |
Moderne Verfahren der Kanalnetzberechnung, -bewirschaftung und -optimierung |
| Fulda/Gläserzell |
Ein Tag als Klärwärter: Zwischen Pumpen und Schlammtürmen |
| Frankfurt |
Cargo City Süd: Nicht nur neue Landebahn für Flughafen Frankfurt … |
| Dörentrup |
Zukunftsfähige Ver- und Entsorgung in einer Kommune mit sinkender Einwohnerzahl Preisverleihung durch „menschen und erfolge“ |
| Obere Werntalgemeinden |
Gegen Gebührenerhöhung gestimmt |
| Wehr |
Betriebskosten 2007 erstmals unter einer Million Euro |
| Uplengen |
Uplengen senkt die Gebühren |
| Traunstein |
Zuwendungsbescheid für den Ausbau der Kanalisation in Traunstein |
| Stöckey |
Geld für Kläranlage |
| Rüthnick |
Amtsblatt macht es offiziell |
| Pfungstadt |
Neues Regenüberlaufbecken auf der Kläranlage fertig gestellt |
| Ludwigsburg |
Klärschlamm soll als Geldquelle dienen |
| Kupferzell/Künzelsau |
Kläranlage für zwei Gemeinden geplant |
| Kornwestheim |
Klärschlamm soll in der Region bleiben |
| Ingolstadt-Süd |
Gebühren vor Reform |
| Heringsdorf |
Heringsdorf leitet Abwasser nun in polnisches Klärwerk |
| Gütersloh |
Alarmierende Wasserproben: Ehec-Keime im Klärwerk entdeckt |
| Gemünden |
Probelauf für neue Kläranlage steht bevor |
| Fichtenau |
Abwasser nach Unterdeufstetten |
| Faulenbachtal |
Förderbescheide in Höhe von rund 800.000 Euro zur Erweiterung der Kläranlage des Faulenbachtals |
| EVS |
Neuer Zufluss für Nikolausweiher nötig |
| Erftstadt-Köttingen |
Schaden im sechsstelligen Bereich |
| Bissendorf |
Faultürme im Klärwerk bekennen Farbe |
| Erkelenz |
Inbetriebnahme Klärwerk Erkelenz bei Düsseldorf |
| Groß-Gerau |
Baugrubenherstellung mit Tauchereinsatz |
| Rheinhausen |
TurboDrain Green – Einsparungen garantiert! |
| Tübingen |
Zu viel Dünger für den Neckar aus dem Klärwerk |
| Warmsdorf |
Warmsdorf und Westeregeln kommen ans Abwassernetz |
| Westerburg/Gemünden |
Probelauf für neue Kläranlage steht bevor |
| Juli 2011 |
| Braunsbach |
Rund 380.000 Euro Fördermittel für die Abwasserbeseitigung in Braunsbach |
| Düsseldorf |
Überflutungsprüfung im Rahmen des GEP Düsseldorf, Einzugsgebiet Klärwerk Süd |
| Espenhain |
Abwasserentsorgung für zukünftige Generationen |
| LINEG |
Lamellenabscheider in der Regenwasserbehandlung im Mischsystem |
| Neuss |
Schmutzwasserpumpwerk „Am Reckberg“ in Betrieb genommen |
| Schwarze Pumpe |
Grundsteinlegung für Abwasserbehandlungsanlage |
| WVER |
Optimierung der Nachklärung Kläranlage Schleiden |
| Zeitz |
Zeitzer zahlen zu hohe Abwassergebühren |
| Wildegg |
Sauberes Wasser ist sein ganzer Stolz |
| Weißenfels |
Klärwerk am Limit |
| Weichering |
Abwasser wird teurer |
| Untermeitingen |
Das Abwasser wird teurer |
| Trulben |
Genehmigung zum Bau der neuen Gruppenkläranlage Trulben erteilt |
| Seengen |
Nachschauen, was mit den 6 Millionen gebaut wurde |
| Rottenburg-Kiebingen |
Regierungspräsidium Tübingen gibt grünes Licht für den Ausbau der Kläranlage |
| Retzbach |
Auch die Retzbacher Kläranlage bekommt ein Blockheizkraftwerk |
| Rees/Kalkar |
Ein Klärwerk für zwei Städte |
| Oberreichenbach |
Förderprogramm Wasserwirtschaft |
| Mudau |
Gemeinde erhält Zuschüsse für Abwasservorhaben |
| Ingolstadt |
Moderne Abluftfilter in der Kläranlage: Mailing kann aufatmen |
| Holzkirchen |
Abwasser wird teurer |
| Herbrechtingen |
Förderbescheid: Bissinger Abwasser fließt künftig nach Herbrechtingen |
| Greifswald |
Desinfektionsmittel im Abwasser |
| Gerstetten |
Gerstettens Anschluss an Mergelstetten wird teurer |
| Fürstenwalde |
335 000 Euro mehr für Klärwerks-Erweiterung |
| Fuldatal |
Gebühren für Abwasser werden erhöht |
| Dümmer See |
WASSERPROJEKT DER UNI WITTEN/HERDECKE ALS „SUCCESS STORY“ VOR DEM EUROPÄISCHEN PARLAMENT |
| Dietmannsried |
Wasser wird ab Juli teurer |
| Bern |
Biogas aus der Kloake |
| Althengstett |
Zuschuss genehmigt |
| Abtsgmünd |
Abwasser: Zwei Kommunen gehen einen Weg |
| Juni 2011 |
| Kappe |
Der Clou ist die Einfachheit |
| Winterberg |
„Die Produkte und Systemlösungen von HST haben uns überzeugt.“ |
| Weißenfels |
Unsauberkeiten im Abwasser |
| Schopfloch |
„Eine gute Lösung gefunden“ |
| Schöntal |
Grünes Licht für Landesförderung von Kanalsanierungsarbeiten in der Gemeinde Schöntal (Hohenlohekreis) |
| Schieder-Schwalenberg |
Durchgängiger Ablauf in Klärwerk und Außenstation |
| Salach |
Salach zahlt die Gebühren zurück |
| Porta Westfalica |
Modernisierung der Kläranlage |
| München |
Stadtentwässerung München Einsatz eines neuen Prozessleitsystems |
| Möhringen |
Die Pumpen werden aus dem Keller geholt |
| Lauenburg |
Kläranlage erzeugt Teil ihres Stroms und eigene Wärme |
| Holzminden |
Grüne gegen Subvention für Ziegenfabrik |
| Wittstock |
URTEIL – Moderater Beitrag für Altanschluss |
| Weichering |
Abwasser wird teurer |
| Traunreut |
Investitionen im Klärwerk |
| Straubing |
Klimafreundliche Energie aus Abwasser / Bayerisches Vorzeigeprojekt |
| Schopfloch |
„Eine gute Lösung gefunden“ |
| Rüthnick |
Rüthnick will zum TAV Fehrbellin |
| Mespelbrunn |
Kanalsanierung in Mespelbrunn |
| Marbach |
Der Klärschlamm soll künftig verbrannt werden |
| Hainrode |
260.000 Euro für Ausbau der Abwasserentsorgung in der Gemeinde |
| Eisenach-Erbstromta |
Pollmeier fordert weitere Rücktritte im TAV |
| Bode-Wipper |
260.000 Euro für Ausbau der Abwasserentsorgung in der Gemeinde Hainrode |
| Altensteig |
Eine spezielle Pumpe macht’s möglich |
| Kelleramt |
Großes Interesse bei Besichtigung der ARA |
| Hannover |
Bürger beschweren sich über Geruchsbelästigung |
| Gruiten |
Klärwerk schließt |
| Augustdorf |
Mehr Sicherheit für die Mitarbeiter der GWA |
| Affalterbach |
Der Klärschlamm hat ein anrüchiges Geschmäckle |
| Mai 2011 |
| Walldürn |
Neues Regenüberlaufbecken in Walldürn, Förderprogramm Wasserwirtschaft |
| Regnitzlosau |
Preis für Wasser und Abwasser stabil |
| Oberreichenbach |
Zuschuss für Projekte |
| Neubulach |
Kläranlage wird aufgegeben |
| Mudau |
Mudau erhält Zuschüsse für Abwasservorhaben |
| Immenstaad |
Inbetriebnahme BHKW |
| Emschergenossenschaft |
Emschergenossenschaft vergibt Wasserzeichen |
| Neuburg/Donau |
Phosphorgewinnung auf der Kläranlage startet am 12.5.2011 |
| April 2011 |
| Gütersloh |
Schluss mit Klärschlammexport? |
| Landau |
Schlau(ch)lining in Landau |
| Ohm-Seenbach |
Technik-Aufrüstung sparte 123000 Euro Stromkosten |
| Selmsdorf |
Widerstand gegen Pläne der Deponie |
| Stegaurach |
Jetzt wird mit Abwasser geheizt |
| Hamburg |
Energie aus Hamburgs Kanalisation |
| Wien |
Hauptkläranlage Wien- Simmering: 220 Mrd. Liter Abwasser gereinigt |
| Zossen-Wünsdorf |
ZWECKVERBAND: Die Kläranlage wird erweitert |
| Thierbaum |
Vollbiologie: Thierbaumer müssen eigene Investitionspläne begraben |
| Thalheim |
Klärwerk braucht neue Steuerung |
| Sasol |
Lineg klärt die Abwässer von Sasol |
| Parum |
Kläranlage bleibt vorerst eigenständig |
| Münster |
Abwasser rauscht nach Coerde |
| Zweckverband Kötachtal |
VTA-Systemprodukt überzeugt mit nachhaltiger Wirkung |
| Hamm |
EU nimmt Klage gegen Übernahme des Hammer Kanalnetzes durch Lippeverband zurück |
| Kaisheim |
Baustart wohl im Herbst |
| Rees-Haffen |
Lange Leitung fürs Abwasser |
| Feldberg |
Klärwerk wird zu einer Pumpstation |
| Belgern |
Alles noch offen |
| Allendorf |
Mit neuer Kläranlage wird Allendorf/Lda. Geld sparen |
| Zermatt |
Abwasserrezyklierung |
| Jennersdorf |
Vision wird Wirklichkeit |
| Bochum |
Die Feuerwehr und ein Reptilienfachmann mussten am Sonntagmorgen eine Schlange aus einem Bochumer Klärwerk retten |
| März 2011 |
| Willmering |
Die Gemeinde ist zu 100 Prozent am Kanal |
| Wertingen |
Eigene Stadtwerke für Wertingen? |
| WAV Panke/Finow |
Zweckverband bittet zur Kasse |
| Schmalenberg |
Tage der alten Kläranlage Schmalenberg sind gezählt |
| Ohm-Seenbach |
Abwasserverband investiert weiter in Modernisierungs-MaßnahmenTechnik-Aufrüstung sparte 123000 Euro Stromkosten, Gießener Anzeiger |
| Lauterecken |
Wasserrechtliche Abnahme der solaren Klärschlammtrocknungsanlage auf der Gruppenkläranlage Lauterecken |
| Gumpenweiler |
Abwasser durch zwei |
| Obere Dietzhölze |
Klärschlammvererdung |
| Cuxhaven |
Optimierte Kläranlage Cuxhaven spart Strom in der Schlammentwässerung – CONTINUFLOC Aufbereitungsanlagen helfen dabei |
| Kaisheim |
Abwasser kostet über die Hälfte mehr |
| Hude |
Kläranlage wird erweitert – OOWV investiert 2,4 Millionen Euro |
| Hergatz |
Zustand hat sich ganz leicht gebessert |
| Hasel-Schönau |
Letzte Ausbaustufe |
| Haffen |
Pipeline soll Klärwerk ersetzen |
| Friesenheim |
Wie kam das Gilft in die Friesenheimer Kläranlage? |
| Besigheim |
Kläranlage wird ausgebaut |
| Bad Zwestener |
Bad Zwestener bekommen Geld zurück – Abwasser war falsch berechnet |
| Allendorf |
„Mit neuer Kläranlage wird Allendorf/Lda. Geld sparen“ |
| Konstanz |
Sauber und wirtschaftlich: Abwasser heizt Konstanzer Neubaugebiet |
| Maroldsweisach |
Millionenschwere Erneuerung der Kläranlage |
| Northeim |
Das Abwasser wird um 2,5 Prozent teurer |
| Obere Leiblach |
Schwere Störung im Klärwerk |
| AZV Umlachtal |
Zeller Klärsystem besteht Abwasser-TÜV |
| Schmedehausen |
Bakterien mit Atemnot |
| Scher-Lauchert |
Abwasser fließt nach Veringendorf |
| Rottleberode |
Abwasserpreis sinkt weiter |
| Rees |
Den Weg freigespült |
| Obere Leiblach |
Klärwerk: „Wollten nichts verheimlichen“ |
| Februar 2011 |
| Weißenfels |
Überschreitungen |
| Wesel |
Spurensuche in der Kläranlage |
| Weißenfels |
Fortgesetzte schwere Einleitwertüberschreitungen durch Weißenfelser Kläranlage in die Saale |
| Prag |
Großtender zur Kläranlage wird neu aufgerollt |
| Moosburg |
Wie „Äpfel und Birnen“ |
| Mönchweiler |
Behörde droht mit Verschluss |
| Mönchweiler |
Alternativen der Abwasserentsorgung |
| AZV Unteres Leinetal |
Delitzsch muss raus |
| Hamburg |
Energieeinsatz auf den Hamburger Kläranlagen |
| WVS |
WVS: „Die Leute können rechnen“ |
| Aßlar |
„Erhöhung ist rechtmäßig“ |
| Himmelkron |
Geistesblitz spart 300 000 Euro |
| Weissenfels |
Umweltschützer zeigen Abwasserverband an |
| Zweckverband Ostharz |
entsorgt zukünftig selbst Kleinkläranlagen und abflusslose Abwassersammelgruben |
| Innsbruck |
Sanieren wo andere Urlaub machen – Kanalsanierung in Innsbruck |
| Januar 2011 |
| Zehdenick |
Entwässerungsbetrieb und Technische Uni Cottbus testen Pflanzen für die Klärschlammreinigung |
| Wittstock |
Wasser- und Abwasserverband erledigte alle für 2010 geplanten Investitionen |
| Schmedehausen |
Bakterien mit Atemnot |
| Pfullingen |
Ausschreibung: Abholung, Transport und thermische Verwertung von entwässertem Klärschlamm in Kläranlage Pfullingen |
| Parchim-Lübz |
Drehort für „Hammer der Woche“ |
| Northeim |
Klärwerk wird aufgerüstet |
| Meppen |
Stadtwerke modernisieren Kläranlage |
| AZV Mariatal |
Bank zur Zahlung von Schadensersatz an Abwasserzweckverband verurteilt |
| Löhne |
Auftrag der Wirtschaftsbetriebe |
| OOWV |
Huder Kläranlage wird erweitert |
| Heidenfeld |
Röthleiner Rat befürwortet Erweiterung der Kläranlage |
| Bovenden |
Abwasser wird in Nörten gereinigt |
| Belgern |
Betreibermodell oder Wiedereingliederung |
| Unteres Glantal |
Neubau des Verbindungssammlers „Odenbach-Medard“ |
| Breisgauer Bucht |
Großkläranlage 30 Jahre Erfolgsgeschichte |
| Kleines Wiesental |
Vier Millionen für Wasser/Abwasser |
| Mannheim |
Klärschlammvergasung eingeweiht |
| Holzkirchhausen |
Wärmegewinnung auf der Kläranlage |
| Biberach |
Gisela Ringwald beerbt Rainer Gutmann |
| azv Südholstein |
Baubeginn für neue Biofilter |
Zeulenroda: Hohe Verluste bei Abwasser
Verbandsausschuss des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Zeulenroda versagt der Werksleitung und dem Verbandsvorsitzenden die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010
Zeulenroda. Die Werksleitung des Eigenbetriebes Zweckverband Wasser/Abwasser Zeulenroda (ZV WAZ) sowie der Verbandsvorsitzende Frank Steinwachs erhielten zur Sitzung des Verbandsausschusses am gestrigen Vormittag von den Mitgliedern keine Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2010.
Grund dafür ist, dass der Betriebszweig Abwasser 2010 einen Verlust von 789 000 Euro eingefahren hat. Mehr:
http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Hohe-Verluste-bei-Abwasser-in-Zeulenroda-275757509
(nach oben)
Westerkappeln: Entlastung beim Abwasser
Ab 2013 will die Bundesregierung die Steuerzahler ein bisschen entlasten. Die Haushalte in Westerkappeln können sich schon früher auf geringere Abgaben freuen. Denn die Abwassergebühren sollen nächstes Jahr deutlich gesenkt werden.
Der Betriebsausschuss hat am Dienstagabend die entsprechende Kalkulation der Gemeindewerke genehmigt. Dabei wird die Schmutzwassergebühr um knapp neun Prozent, die für das Regenwasser sogar um rund zwölf Prozent preiswerter…mehr:
http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_steinfurt/westerkappeln/1818805_Entlastung_beim_Abwasser.html
(nach oben)
Tannhausen: Abwasser und Klärschlamm
Gemeinderat diskutiert die künftige Klärschlammentsorgung der Sammelkläranlage
Der Tannhäuser Gemeinderat hat zum Jahresende die Klärschlammentsorgung diskutiert. Diese wird künftig anstelle der GOA ein Privatanbieter übernehmen. Weiteres Thema war die Abwasserentsorgung in zwei Teilorten.
Tannhausen. Der einst mit der GOA geschlossene Zehnjahresvertrag zur Entsorgung des Klärschlamms läuft aus. Die GOA bietet erneut einen Vertrag mit derselben Laufzeit an. Eine weitere zehnjährige Laufzeit aber kommt …mehr:
http://www.schwaebische-post.de/590211/
(nach oben)
Oderaue: Bakterien helfen beim Stromsparen
Der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue will in den kommenden Jahren eine energieautarke Kläranlage entwickeln. Mit dieser Idee überzeugte der Verband die Jury eines bundesweiten Umweltinnovationsprogrammes und erhält dafür ab 2012 Fördermittel.
In einer Kläranlage befinden sich Bakterien. Die fressen den Dreck des Abwassers und vermehren sich dadurch. Damit die Mikroorganismen ihre Arbeit als Reinigungskräfte aber überhaupt ausführen können, müssen sie mit Sauerstoff versorgt werden.Der wird durch Belüfter in die Becken geblasen. „Diese Belüfter sind echte Energiefresser“, …mehr:
http://www.die-mark-online.de/artikel-ansicht/dg/0/1/997580/
(nach oben)
Neu-Isenburg: Gebühren für Abwasser werden erhöht
Zum 1. Januar 2012 müssen die Isenburger für ihre Nebenkosten tiefer in die Tasche greifen. Zu diesem Termin werden die Abwassergebühren erhöht. Schmutzwasserkanalgebühren sollen von 1,68 Euro pro Kubikmeter auf zwei Euro angehoben werden, die Regenwasserkanalgebühren von…mehr:
http://www.op-online.de/nachrichten/neu-isenburg/gebuehren-abwasser-werden-erhoeht-neu-isenburg-nebenkosten-1503712.html
(nach oben)
Moos: Feuchttücher legen Kläranlage lahm
Hegau – Sie sind klein, praktisch und reißfest, und das macht sie zu einem großen Problem: Feuchttücher. Gerade in Haushalten mit Kindern werden sie gerne benutzt, und nach ihrem Gebrauch landen sie oft da, wo sie nicht hingehören – nämlich in der Toilette.
Vom Verbraucher bequem entsorgt, sorgen die Feuchttücher an anderer Stelle für unangenehme Folgen. Sie verstopfen regelmäßig die Pumpen im Klärwerk Moos. Das wird vom Abwasserverband „Untere Radolfzeller Aach“ betrieben. Hier werden jährlich knapp 700 000 Kubikliter Schmutzwasser aus dem Singener Ortsteil Bohlingen, aus Worblingen, Böhringen und der Gemeinde Moos mit ihren Ortsteilen gereinigt…mehr:
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/singen/Feuchttuecher-legen-Klaeranlage-lahm;art372458,5091326
(nach oben)
HERBOLZHEIM: Veränderung bei Gebühren
Aus dem Gemeinderat.
Der Herbolzheimer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag den Preis für Frischwasser und die Gebühren für Abwasser neu festgesetzt. Während der Wasserpreis für das kommende Jahr um 10 Cent auf 1,20 Euro pro Kubikmeter gesenkt wird, steigen die Gebühren für Abwasser um 15 Cent auf 1,80 Euro pro Kubikmeter an. „Unterm Strich ist das eine vertretbare Veränderung“,mehr:
http://www.badische-zeitung.de/herbolzheim/veraenderung-bei-gebuehren–52102072.html
(nach oben)
Flammersfeld: Abwasserbeseitigung: 15 Cent mehr pro Kubikmeter
15 Cent mehr pro Kubikmeter müssen die Bürger der Verbandsgemeinde wohl zukünftig für die Abwasserbeseitigung berappen. Darauf einigten sich die Mitglieder des VG-Rates Flammersfeld bei der letzten Sitzung in diesem Jahr, bei der es unter anderem um die Themen Wasser und Abwasser ging.
Während für das Jahr 2012 beim Betriebszweig „Wasserversorgung“ mit einem knappen Gewinn zu rechnen ist – auch durch die neue Pumpleitung von Bürdenbach bis Willroth, durch die die Zahl der Rohrbrüche im Bereich Horhausen zurückging – ist eine leichte Erhöhung der Schmutzwassergebühr von 2,35 Euro auf 2,50 Euro notwendig.
Diese Erhöhung hänge auch mit Problemen an der Vererdungsanlage Peterslahr zusammen. Diese hat seit 2010 zusätzliche Kosten verursacht, zum Beispiel durch eine defekte Drainage. Sie soll in den kommenden acht Jahren entleert …mehr:
http://www.kanalinspekteure.de/content.php?209-Abwasserbeseitigung-15-Cent-mehr-pro-Kubikmete
(nach oben)
Erfurt: CDU will Abwasser-Beiträge verringern
Die CDU-Landtagsfraktion hat einen Katalog von Vorschlägen vorgelegt, um mit niedrigeren Standards Abwasserkosten zu senken. Unter anderem solle künftig vorrangig dort investiert werden, wo «Siedlungsbereiche langfristig erhalten» blieben, hieß es am Mittwoch.
Die immer noch erforderlichen Investitionen müssten auf das unbedingt Nötige beschränkt und zeitlich gestreckt werden. Dazu will die Fraktion unter anderem die Verlängerungsfristen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie ausschöpfen. In Thüringen erfüllt ein großer Teil der Gewässer die EU-Standards nicht, wofür außer der Landwirtschaft der geringe Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation verantwortlich ist.
Seit 1990 seien 4,8 Milliarden Euro für die Abwasserentsorgung ausgegeben worden. Die Zweckverbände und Stadtwerke rechneten aber …mehr:
http://www.kanalinspekteure.de/content.php?204-CDU-will-Abwasser-Beiträge-verringern
(nach oben)
Eisenberg: Zweckverband 2012 noch ohne Kredit
Ab 2013 wahrscheinlich Krediteaufnahme für geplante Investitionen. Finanzplan in der jüngsten Verbandsversammlung beschlossen.
Eisenberg. „2012 werden wir noch ohne Kredit auskommen, aber ab 2013 werden wir wieder Kredite aufnehmen müssen, um unsere geplanten Investitionen finanzieren zu können.“ Das erklärte Ute Böhm, Geschäftsleiterin des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE), in der jüngsten Verbandsversammlung beim Beschluss des Finanzplans. Der sieht in den nächsten Jahren im Bereich Abwasser jeweils um die zwei Millionen Euro für Investitionen vor. Nächstes Jahr kann der Verband das noch mit eigenen Mitteln stemmen, danach nicht mehr. Im Bereich Trinkwasser ist bis 2014 die Rekonstruktion des Hochbehälters Wetterkreuz bei Eisenberg die alles dominierende …mehr:
http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Zweckverband-Eisenberg-2012-noch-ohne-Kredit-669634117
(nach oben)
Burkhardtsdorf: Abwasser aus Burkhardtsdorf fließt jetzt in neue Kläranlage
Für sechs Millionen Euro wurden das Bauwerk und ein neues Abwassersystem errichtet. Fast 2000 Bürger sollen davon profitieren. In der neuen Kläranlage für Burkhardtsdorf, die an der Eibenberger Straße in Kemtau errichtet worden ist, hat der Probebetrieb begonnen.
„Die Bauphase war auch eine Herausforderung …mehr:
http://www.freiepresse.de/LOKALES/ERZGEBIRGE/STOLLBERG/Abwasser-aus-Burkhardtsdorf-flieszt-jetzt-in-neue-Klaeranlage-artikel7832501.php
(nach oben)
WOLLERSLEBEN: IST ANGESCHLOSSEN
In Wollersleben ist eine neue Abwasserbehandlungsanlage am Vormittag in Betrieb genommen worden. Gleichzeitig sind die erforderlichen Leitungen vom Hünstein und von Wollersleben in die Erde gebracht worden…
Auch wenn die jetzige Kläranlage, knapp 1,5 Jahre nach dem ersten Spatenstich dem entspricht, was geplant wurde, konnte das Ergebnis nur erzielt werden durch eine konsequente Bauüberwachung und stetiges eingreifen durch den Auftraggeber. Der Bau der Anlage wurde auf 1,8 Millionen geschätzt. Auch wenn …mehr:
http://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=101978
(nach oben)
WARSTEIN: Wasser und Abwasser sollen teurer werden
Wenn in den nächsten Wochen der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für 2012 aufgestellt wird, dann kann Klaus Kellerhoff mit seinen Mitarbeitern zusätzliche Einnahmen aus dem Wasser- und dem Abwasserbereich einkalkulieren…mehr:
http://www.localxxl.com/de/lokal_nachrichten/warstein/wasser-und-abwasser-sollen-teurer-werden-1319093887-ftz/
(nach oben)
AZV Südholstein: Preisträger des Malwettbewerbs zu Gast
Links steht ein Kind vor einer kleinen Hütte und winkt ei-nem anderen Kind zu, das rechts aus dem Fenster eines gro-ßen, gelben Hauses zurückwinkt. Alle Kinder auf der Welt,egal ob arm oder reich, sollten sich so gut verstehen wie diese beiden, meint Mira Lichte, die das Bild gemalt hat(Abbildung 1). Die Neunjährige besucht die vierte Klasse der Grundschule Suchsdorf in Kiel. Mit ihrer Vision einer
geeinten Welt hat Mira prompt beim landesweiten Schüler-Malwettbewerb 2009 des Bündnisses Eine Welt Schleswig-Holstein e. V. (BEI) einen Preis gewonnen: Mit ihrer gesam-ten Klasse war sie am 19. November 2009 beim azv Süd-holstein in Hetlingen zu Gast und erkundete das größte Klär-werk Schleswig-Holsteins.„Mal die Welt in deinen Farben“, so das Motto des Mal…
Den ganzen Artikel lesen Sie in:
Betriebsinfo Informationen für das Betriebspersonal von Abwasseranlagen Heft 3-2011
Autorin Dagmar Schomakera zv Südholstein Hetlingen
(nach oben)
Landratsamt Schwandorf: Machbarkeitsstudie zur Klärschlammverwertung
(fp / lra) Machbarkeitsstudie belegt: umweltgerechte Klärschlammverwertung nicht teurer als herkömmliche Entsorgung Vor 31 kommunalen Vertretern aus dem Landkreis Schwandorf wurden vor kurzem die Ergebnisse der interkommunalen Machbarkeitsstudie zur Klärschlammentsorgung durch das Ingenieurbüro U.T.E. aus Regensburg vorgestellt. Die Bürgermeister und Fachkräfte der Kläranlagen im Landkreis Schwandorf waren von manchem Ergebnis – meist positiv – überrascht. Sie wollen dieses Thema weiter befördern und nach den Sommerferien konkrete Schritte dazu einleiten.
Landrat Volker Liedtke machte in seinen einleitenden Worten darauf aufmerksam, die Ergebnisse der Studie nicht als Endstadium zu betrachten. Das Regionalmanagement habe sich mit den „grünen Themen“ einen besonderen Schwerpunkt gegeben und dabei auch die Klärschlammproblematik im Landkreis zum Thema gemacht, so der Landrat. Er freue sich, dass dieses Thema aufgegriffen wurde und war von dem Ergebnis sehr überrascht, dass im Landkreis Schwandorf selbst lediglich 10% des Klärschlammaufkommens in der Landwirtschaft verwertet wird. Er halte auch den aktuell praktizierten Klärschlammtourismus für keinen zukunftsweisenden Weg. Vielmehr begrüße er eine für alle beteiligten Kommunen sowohl ökonomisch als auch ökologisch nachhaltige Lösung vor Ort.
Claudia Scharnagl vom Büro U.T.E. war über das Regionalmanagement im August 2010 mit der Erarbeitung der komplexen Studie beauftragt worden. Als Berechnungsgrundlage ist Scharnagl in der Studie von einem Jahresaufkommen von 10 000 to ausgegangen. Auffallend sei der hohe Anteil des Klärschlamms, der in den Tagebauen Sachsens und Sachsen-Anhalts Verwendung eingelagert wird. Die schlechte CO²-Bilanz durch kostspielige Transporte durch halb Deutschland und die ethisch problematische Verarbeitung des Klärschlamms im Landschaftsbau sei sicher nicht zukunftsfähig.
Gleiches gelte für die Verwertung des Klärschlamms in der Landwirtschaft, ganz gleich ob im Heimatlandkreis oder anderswo. Aufgrund der sich weiter verschärfenden Grenzwerte in der Klärschlammverordnung sind hier in naher Zukunft Grenzen gesetzt. Da stimmten ihr die kommunalen Vertreter einhellig zu. Manche kleine Kläranlage habe bereits jetzt Probleme, gewisse Grenzwerte einzuhalten. Deshalb soll man für die anstehenden Verschärfungen der Grenzwerte gewappnet sein.
Als Verwertungswege kämen die stoffliche Verwertung – etwa in der Zementindustrie – oder die energetische Verwertung des Klärschlamms in Frage. Die neue und noch nicht ganz ausgereifte Methode der so genannten Hochlastfaulung wäre bei nur einem Standort im Landkreis effektiv. Sie sei die teuerste Variante, hätte allerdings den Vorteil, Energie zu gewinnen.
Kleinere Kläranlagen könnten ihren Klärschlamm mit mobilen Entwässerungsanlagen entwässern lassen, um ihm dann für die weitere thermische Nutzung den entsprechenden Wasseranteil zu entziehen.
Das Ingenieurbüro untersuchte vier Varianten einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Klärschlammverwertung. Variante 1 geht von einer zentralen Trocknungsanlage im Landkreis aus. Als Standort wäre die Kläranlage in Schwandorf oder Schwarzenfeld günstig, da sich hier auch Biogasanlagen mit entsprechender Abwärme befänden. 10 000 to mit einer Trockensubstanz von 25% müssten dort aufgenommen werden.
Variante 2 geht von 2 Standorten aus. Zwei Drittel sollte der größere Standort im Norden – etwa in Schwarzenfeld oder Altendorf – aufnehmen. Das übrige Drittel sollte im Städtedreieck, etwa in Teublitz getrocknet werden.
Variante 3 geht von drei Standorten aus. Im Nordwesten des Landkreises könnte knapp die Hälfte des Klärschlammes getrocknet werden, im Osten etwa ein Fünftel und im Süden etwa ein Drittel. Dabei wurden konkrete Angaben zur thermisch erforderlichen Leistung zu diesen drei Varianten gemacht.
Variante 4 geht von einer thermischen Verwertung im nächstgelegenen Kohlekraftwerk Zolling aus, wobei die Trocknung im Kohlekraftwerk erfolgen würde und sich entsprechend teure Annahmegebühren ergeben würden.
Bei 5% Trockensubstanz sei von den untersuchten Varianten die Variante 1 die günstigste und wäre mit knapp 16 € pro m³ für die meisten Kommunen sogar günstiger als in der jetzigen Entsorgungssituation. Auch die Varianten 2 und 3 seien mit 17 bis maximal knapp 20 € nur etwas teuerer. Mit 26 € deutlich teuerer schneidet aufgrund der hohen Annahmegebühren die thermische Verwertung im Kohlekraftwerk Zolling ab.
Abschließend ging die Ingenieurin noch auf die Phosphorrückgewinnung ein. Phosphor sei eine endliche Ressource, die vielleicht schon in hundert Jahren nicht mehr verfügbar sei. Verschiedene Verfahren stünden bereits jetzt dafür zur Verfügung. Bei der Verwendung des getrockneten Klärschlamms im Zementwerk oder etwa bei der Mitverbrennung sei allerdings eine Phosphorgewinnung ausgeschlossen.
Die Teilnehmer interessierten genauere Angaben zur Entwässerung des Klärschlammes, etwa ab welcher Größenordnung eine stationäre Entwässerung sinnvoll sein könnte. Bezüglich der fraglichen Investitionskosten, entgegnete Claudia Scharnagl, dass ihr in ihrer bisherigen Arbeit noch keine so kostengünstige Lösung wie für Schwandorf unter gekommen ist. Die Investitionskosten für Klärschlammtrocknungsanlagen seien in den genannten Entsorgungskosten enthalten. Allerdings müssten die Beträge für die Investition in die Trocknungsanlage vorgestreckt werden. Dies könne ein Zweckverband oder ein kommunales Unternehmen leisten. Eine Refinanzierung über die Gebühren sei dann sinnvoll.
Der 1.Bürgermeister des Marktes Schwarzenfeld, Manfred Rodde, ergänzte, dass ein Weg weg von der landwirtschaftlichen Verwertung das Gebot der Stunde sei. Der Markt Schwarzenfeld würde sich hier gerne engagieren und auch die Kläranlage in Schwarzenfeld zur Verfügung stellen. Denkbar wäre etwa an diesem Standort auch eine Entwässerung für den Klärschlamm aus den unmittelbar umliegenden Gemeinden. Auch der 1.Bürgermeister des Marktes Wernberg-Köblitz Butz signalisierte großes Interesse. In einer Steuerungsgruppe mit mindestens 5 Kommunalvertretern sollen die Ergebnisse der Studie diskutiert und weiter verwendet werden. Als zentrale Ansprechstelle soll das Regionalmanagement dienen.
Landratsamt Schwandorf
http://landkreis-schwandorf.de/index.phtml?object=tx%7C1901.100.1&ModID=7&FID=1901.428.1&sNavID=1901.65&mNavID=1901.2&La=1
(nach oben)
Pustertal: Bericht Kanalinspektion Betriebsjahr 2010
Allgemeines
Ich möchte mich in diesem Jahr im Namen des Personals der Ara Pustertal AG zuallererst
bei sämtlichen Gemeinden, Grundstückbesitzern und Institutionen für die
Zusammenarbeit, sei es für Auskünfte, die Erstellung von Genehmigungen und
Fahrerlaubnisse, auch in privaten Grundstücken, bedanken. Das letzte Jahr haben wir bei
der Begehung unser Augenmerk auf die einheitliche Bezeichnung und Zustandserfassung
der neuen Einzugsgebiete gelegt und so standen für heuer sehr viele kleinere
Reparaturen an, welche im heurigen Jahr großteils mit eigenem Personal erledigt wurden.
Bei der Begehung wurden auch verschiedene Schäden an Schächten im Bereich des
Gerinnes und der Umwandung fest gestellt, welche von externen Firmen behoben…den ganzen Bericht lesen Sie unter:
http://www.arapustertal.it/de/Berichte/Jahresberichte/Alle.html
(nach oben)
Ortenau: Klärschlamm: Ausgeglichene Bilanz
Zweckverband nimmt im November Versuchsanlage für Phosphor-Rückgewinnung in Betrieb
Der »Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau« verbrannte im vergangenen Jahr rund 21 000 Tonnen Klärschlamm und 535 Tonnen Rechengut, hieß es bei der Verbandsversammlung vergangene Woche. Als neues Projekt gibt es ab November Versuche mit einer Phosphor-Rückgewinnungsanlage
Als ausgeglichen bezeichnete der Biberacher Bürgermeister und Vorsitzende des »Zweckverbands Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau«, Hans Peter Heitzmann, den Abschluss 2010. Die Vertreter des Verbandes hatten sich vergangene Woche im Verbandsklärwerk in Offenburg-Griesheim getroffen.
Im September 2001 als Zweckverband Klärschlammtrocknung »Nördlicher Ortenaukreis« gegründet, heißt die Vereinigung seit Anfang Januar 2010 »Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau«. Mitglieder sind die Abwasserverbände Achertal, Neuried-Schuttertal, Sasbachtal, Vorderes Renchtal, die Abwasserzweckverbände »Raum Offenburg« sowie »Kinzigtal- und Harmersbachtal«. Ebenfalls im Verband: die Städte Gengenbach, Kehl, Oberkirch, Rheinau und Achern sowie die Gemeinden Appenweier und Willstätt.
Waren im Jahre 2009 noch 23 177 Tonnen Klärschlamm …mehr:wertung gekostet. Unterm Strich…
http://www.baden-online.de/news/artikel.phtml?page_id=&db=news_lokales&table=artikel_ortenau&id=17163
(nach oben)
ORTENAU: Von Trocknung spricht keiner mehr
Der „Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau“ ließ im Vorjahr 21 100 Tonnen Klärschlamm verbrennen.
21 100 Tonnen Klärschlamm ließ der „Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau“ – er deckt das mittlere und nördliche Kreisgebiet sowie Teile des Kinzigtals ab – 2010 im Kraftwerk der Firma Koehler in Oberkirch verbrennen. Weitere Interessenten können aus Kapazitätsgründen derzeit nicht aufgenommen werden. Der Vertrag …mehr:
http://www.badische-zeitung.de/ortenaukreis/von-trocknung-spricht-keiner-mehr–50302410.html
(nach oben)
Öhningen: Abwasser- Gemeinderat beschließt neue Gebühren
Öhningen (pes) Der Öhninger Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung die neue Abwassersatzung und die neuen Gebühren der gesplitteten Abwassergebühr. Künftig setzt sich die Abwassergebühr aus einer Grundgebühr, einer Schmutzwassergebühr sowie einer Niederschlagswassergebühr zusammen.
Die Grundgebühr für Wohnungen beträgt …mehr:
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/oehningen/Abwasser-Gemeinderat-beschliesst-neue-Gebuehren;art372453,5171065
(nach oben)
Offenburg: AbwasserPilotanlage zur Phosphorrückgewinnung geht in Betrieb
Baden-Württemberg übernehme bei der Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlämmen eine bundesweite Vorreiterrolle, sagte Umweltminister Franz Untersteller heute in Offenburg, wo er die erste großtechnische Anlage zur Phosphorrückgewinnung auf der Kläranlage in Griesheim offiziell in Betrieb nahm. Er freue sich, dass es an der Universität Stuttgart gelungen sei, ein Verfahren zu entwickeln, das es erlaube 70 Prozent des Phosphors aus dem behandelten Klärschlamm zurück zu gewinnen und er hoffe, dass von der Anlage eine Art Initialzündung ausgehe, so dass auch andere Bundesländern sich künftig stärker um die Phosphorrückgewinnung kümmern.
Franz Untersteller: „Phosphor ist nicht durch andere Elemente zu ersetzen und ohne Phosphor kein Leben. Dass wir aus dem früheren Abfallprodukt Klärschlamm jetzt auch in Bezug auf Phosphor eine wertvolle Sekundärrohstoffquelle machen können, ist ein Schritt in die Unabhängigkeit von teuren Phosphorimporten.“
Fachleute schätzten, dass die mit vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand abbaubaren natürlichen Phosphor-Lagerstätten in der Erde schon in weniger als einhundert Jahren erschöpft seien. Darüber hinaus sei die Gewinnung der Rohphosphate und ihre Verarbeitung zu Mineraldüngern mit erheblichen und immer weiter zunehmenden Umweltbelastungen verbunden, erklärte Untersteller.
„In einer Zeit, in der die Rohstoffe knapper und teurer würden, ist die Anlage in Offenburg also von großer ökonomischer und ökologischer Bedeutung. Umfassende Kreislaufwirtschaft ist die Voraussetzung für die Sicherung unseres Wohlstandes und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen“, so Untersteller.
Auch Offenburgs Oberbürgermeisterin und Vorsitzende des Abwasserzweckverbandes „RaumOffenburg“, Edith Schreiner betonte bei der Inbetriebnahme die Funktion der Anlage im Sinne einer effizienten Nutzung knapper Ressourcen: „Die Aufgabe einer nachhaltigen Abwasserreinigung ist es, Wertstoffe zurückzugewinnen. Deshalb sind wir froh, eine Anlage in Betrieb nehmen zu können, die genau diesen Anspruch erfüllt. Wir gewinnen die Düngeeigenschaften des Klärschlamms zurück und führen nur noch seine Schadstoffe der thermischen Verwertung zu“, sagte Schreiner.
Schon heute, so Umweltminister Franz Untersteller, würden bereits mehr als 60 Prozent der Siedlungsabfälle in Baden-Württemberg stofflich verwertet, sogar 70 Prozent unter Einbeziehung der energetischen Verwertung. Die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft und damit der Rohstoffgewinnung aus Abfällen sei eines der ganz wichtigen Themenfelder der grün-roten Landesregierung.
Auch die Rückgewinnungsquote von Phosphor solle langfristig gesteigert werden, sagte Untersteller: „Für die nächsten Jahre haben wir als Teilziel festgelegt, mindestens 15 Prozent an benötigtem Phosphor für die Landwirtschaft mit Hilfe von Anlagen wie der in Offenburg zurückzugewinnen. Das bedeutet, dass wir in Zukunft auch andere Kläranlagen entsprechend ‚aufrüsten‘ müssen.“
Die Phosphatnutzung auf der Basis von Rückgewinnungstechnologien werde sich langfristig durchsetzen, zeigte sich Untersteller überzeugt. Er sei sicher, dass in Deutschland dann auch niemand mehr an der unsinnigen traditionellen landwirtschaftlichen Klärschlammausbringung festhalten werde, bei der immer auch die Schadstoffe zurück in die Umwelt kämen. Baden-Württemberg sei bereits vor langer Zeit aus der bodenbezogenen Klärschlammverwertung ausgestiegen.
Ergänzende Informationen:
Die Kosten für die Modellanlage hat zu 100 Prozent das Land übernommen.
Die Investitionskosten in Höhe von 645.000 Euro wurden aus dem Kommunalen Investitionsfond (KIF) entnommen. Die für das Forschungsprojekt erforderliche wissenschaftliche Begleitung (179.000 Euro) wurde aus Mitteln der Abwasserabgabe finanziert.
Die künftig anfallenden Betriebskosten für die Phosphorrückgewinnungsanlage (Energie, Personal, Chemikalien) übernimmt der Abwasserzweckverband „Raum Offenburg“.
Das Verfahren zur Rückgewinnung des Phosphors wurde am Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft (ISWA) der Universität Stuttgart in Zusammenarbeit mit der iat-Ingenieurberatung entwickelt. Beim sogenannten Stuttgarter Verfahren zur Phosphorrückgewinnung aus anaerob stabilisierten Klärschlämmen entsteht nach einem chemischen Prozess unter Zugabe von Schwefelsäure, Natronlauge, Zitronensäure und Magnesiumchlorid das Produkt Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP).
Das MAP kann direkt als Mehrnährstoffdünger in der Landwirtschaft verwendet werden.
Gebaut wurde eine Anlage mit einem Reaktorvolumen von 12 Kubikmetern. Damit kann der Klärschlamm von circa 5.000 bis 10.000 Einwohnerwerten behandelt werden. Die Ausbeute wird dabei auf circa 50 Kilogramm MAP pro Tag geschätzt.
Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
(nach oben)
NEUNBURG: Stadtwerke investieren in eine neue Kläranlage
Die alte Kammerfilterpresse hat ausgedient. Sie wird durch ein System ersetzt, das kostengünstiger betrieben werden kann
.Mit dem Klärschlammkonzept des Landkreises und dem Kauf einer neuen Klärschlammbehandlungsanlage befasste sich der Werkausschuss in seiner letzten Sitzung. Der Landkreis hat Mitte 2010 eine Machbarkeitsstudie zur landkreisweiten Koordination der Klärschlammverwertung in Auftrag gegeben, erinnerte Werkleiter Willi Meier. Die beauftragte Firma U.T.E hat ihr Gutachten in der letzten…mehr:
http://www.mittelbayerische.de/region/schwandorf/artikel/stadtwerke_investieren_in_eine/722124/stadtwerke_investieren_in_eine.html
(nach oben)
Neuburg: Im Klärschlamm steckt wertvoller Phosphor
(ND) In einem Pilotprojekts wollen die Stadt Neuburg und Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft herausfinden, ob es großtechnisch möglich ist, Phosphor aus Klärschlamm zu gewinnen. Bisher wird das wertvolle Mineral bei der Zementherstellung verbrannt. Und es ist ein Rohstoff, der nicht nachwächst“, erklärte…mehr:
http://www.donaukurier.de/lokales/kurzmeldungen/neuburg/Neuburg-Im-Klaerschlamm-steckt-wertvoller-Phosphor;art74370,2416251
(nach oben)
Sanierung der Regenentlastungsanlagen im Odenbachtal und Anschluss des Odenbachtals an die Gruppenkläranlage Lauterecken
Neustadt an der Weinstraße/Odenbachtal – Wie Willi Tatge, Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, mitteilt, wurde dem Zweckverband Abwasserbeseitigung „Unteres Glantal“ die Genehmigung zum Anschluss der Ortsgemeinden Odenbach, Adenbach, Ginsweiler, Nußbach und Reipoltskirchen an die Gruppenkläranlage (GKA) Lauterecken inklusive der Sanierung der zugehörigen Regenentlastungsanlagen erteilt. Weiterhin wurden die zugehörigen Erlaubnisse der Regenentlastungsanlagen in den Ortsgemeinden Medard, Odenbach, Ginsweiler, Reipoltskirchen und Nußbach neu gefasst und der Rückbau der derzeit noch betriebenen Kläranlagen Odenbach und Nußbach genehmigt. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen belaufen sich auf circa 3,6 Mio. Euro und werden prozentual auf die dem Zweckverband Abwasserbeseitigung „Unteres Glantal“ angehörenden Verbandsgemeinden Lauterecken, Altenglan und Wolfstein aufgeteilt. Die Maßnahmen werden vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (MULEWF) mittels zinslosem Darlehen gefördert.
Zur Zeit werden die Abwässer der Ortsgemeinden Odenbach, Adenbach, Ginsweiler und Reipoltskirchen in der Tropfkörper-Kläranlage Odenbach, welche 1977 in Betrieb ging, gereinigt. Das Abwasser der Ortsgemeinde Nußbach wird in der ortseigenen Kläranlage Nußbach seit über 40 Jahren geklärt. Die beiden Kläranlagen entsprechen nicht mehr den heutigen wasserwirtschaftlichen Anforderungen und sollen daher zukünftig still gelegt, rückgebaut und die zugehörigen Abwässer in der GKA Lauterecken mitbehandelt werden. Mit einer Ausbaugröße von 32.000 Einwohnerwerten (EW) wurde diese bereits in den 1990-er Jahren für den Anschluss des Odenbachtales (circa 3.000 EW) ausgelegt. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hatte ergeben, das der Abwasseranschluss der Odenbachtal-Gemeinden an die Gruppenkläranlage Lauterecken im Vergleich zur Sanierung der bestehenden Kläranlagen Odenbach und Nußbach die eindeutig wirtschaftlichste Variante darstellt.
Weiterhin werden im Zuge des Abwasseranschlusses des Odenbachtales an die GKA Lauterecken mehrere netzabschließende Regenentlastungsanlagen und Pumpstationen zur Anpassung an den gesetzlich geforderten Stand der Technik neu gebaut, ertüchtigt oder saniert. Dies sind im Einzelnen:
• Pumpstation Medard
• Regenentlastung Odenbach rechts des Glans inkl. Pumpstation
• Regenentlastung Ginsweiler
• Regenentlastung Reipoltskirchen inkl. Pumpstation
• Regenentlastung Nußbach
Weiterhin wird zwischen Nußbach und Reipoltskirchen ein Verbindungssammler gebaut.
Die aufgeführten Maßnahmen tragen erheblich zur Verbesserung des ökologischen und chemischen Zustands des Nußbachs und des Odenbachs bei und sind Bestandteil des Maßnahmenprogramms gemäß Wasserrahmenrichtlinie zur Reduzierung der Stickstoff- und Phosphoreinträge.
http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/broker.jsp?uMen=f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266&uCon=d412f06f-6333-31f0-4a11-8272e13d6336&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042
(nach oben)
Neuburg: Klärwerk soll mehr auffangen
Weil für das Audigelände ein neues Konzept erforderlich ist, werden Maxweiler, Rohrenfeld und Bruck ans Neuburger Klärwerk angeschlossen. Neue Pumpstation geplant
Den Bau des Fahr- und Präsentationsgeländes von Audi nutzt die Stadt, um die Abwasserbeseitigung in den östlichen Stadtteilen Maxweiler, Rohrenfeld (beide werden an das Klärwerk Neuburg angeschlossen) und Bruck gleich mit zu optimieren. Weil es sich dabei um normale Sanierungs- und keine neuen Erschließungsmaßnahmen handelt, gehen die Verbesserungen …mehr:
http://www.augsburger-allgemeine.de/neuburg/Klaerwerk-soll-mehr-auffangen-id17371916.html
(nach oben)
Obere-Lutter: Kohle gegen Schadstoffe
Klärwerk Obere-Lutter schließt Versuche zur Abwasserreinigung erfolgreich ab
Gütersloh. Sie ist offenporig, feinkörnig und vollbringt wahre Wunder: die Aktivkohle. Ihre Aufgabe: Schadstoffe im Abwasser reduzieren oder eliminieren. Das Klärwerk Obere-Lutter hat nun Versuche zur Abwasserreinigung erfolgreich abgeschlossen und plant eine dauerhafte Filtration durch Aktivkohle.
„In der Vergangenheit wurden dem Klärwerk vom Entsorgungsunternehmen Zimmermann immer wieder Abwässer zugeleitet, die in einem kommunalen Klärwerk nicht behandelt werden können“, erklärt Detlef Helling, Verbandsvorsteher des Abwasserverbandes „Obere-Lutter“ (AOL), den Anlass für die Versuchsreihe. Die Überwachungswerte …mehr:
http://www.nw-news.de/lokale_news/guetersloh/guetersloh/5245965_Kohle_gegen_Schadstoffe.html
(nach oben)
Lohe: will Abwasser-Zweckverband mit Heide
Noch ist er zwar nicht gegründet, dennoch stehen die möglichen Mitglieder eines Abwasser-Zweckverbandes bereits fest. Neben Heide hat auch Lohe-Rickelshof ernsthaftes Interesse angemeldet. Perspektivisch sollen alle Heider Umlandgemeinden beitreten.
Die Gemeinde hat schon …mehr:
http://zeitungen.boyens-medien.de/aktuelle-nachrichten/zeitung/artikel/lohe-will-abwasser-zweckverband-mit-heide.html
(nach oben)
Leverkusen: Mit neuen, kombinerten Verfahren Klärschlamm verringern
Einleitung
Das Gemeinschaftsklärwerk Leverkusen behandelt Abwasser mit einer Fracht von ca. 40000 t/a CSB (chemischer Sauerstoffbedarf); größtenteils aus der chemischen Industrie. Gegenwärtig fallen 20000 t entwässerter Überschussschlamm pro Jahr an.
Wegen seiner Toxizität kann Klärschlamm aus der chemischen Industrie nicht landwirtschaftlich verwertet werden. Er kann auch nicht immer für die Biogaserzeugung genutzt werden, da er Inhaltsstoffe enthält die die Schlammfaulung stark hemmen können. Da in Deutschland auch eine Deponierung dieser Schlämme nicht zulässig ist, werden die Schlämme aus Kläranlagen der chemischen Industrie verbrannt.
Die bei der Verbrennung anfallenden Aschen werden auf Deponien abgelagert. Nachteilig bei dieser Vorgehensweise sind die damit verbundenen CO2-Emmissionen. Neben diesem Umweltaspekt spielen auch die begrenzten eigenen Verbrennungskapazitäten in der chemischen Industrie eine wichtige Rolle; auch deshalb ist man bestrebt die Schlammmengen zu reduzieren.
Den vollständigen Bericht finden unter:
http://www.currenta.de/index.php?page_id=162
(nach oben)
Illertissen: Das Abwasser wird billiger
Gebühren sinken deutlich
Das war eine klare Sache für den Stadtrat: Er hat in seiner jüngsten Sitzung die Abwassergebühren für das Stadtgebiet deutlich gesenkt. Bisher mussten die Bürgerinnen und Bürger für reines Schmutzwasser 2,30 Euro pro Kubikmeter bezahlen, in den Jahren 2012 bis 2014 brauchen sie für die gleiche Menge nur noch 2,05 Euro an die Stadtkasse zu überweisen
http://www.augsburger-allgemeine.de/illertissen/Das-Abwasser-wird-billiger-id17316161.html
(nach oben)
Holzheim: Zu viel Schmutz im Bach
Kläranlage in Steinheim soll für 125000 Euro ausgebaut werden
Der Zweckverband der Kläranlage Steinheim/Holzheim hat eine hohe Rechnung bekommen: Das Landratsamt Neu-Ulm verlangt 60000 Euro an Abgaben fürs Abwasser. Wie berichtet hatte das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth bereits 2009 gemessen, dass nach starken Regenfällen dreckiges Wasser aus der Anlage in Steinheim in die Leibi …mehr:
http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Zu-viel-Schmutz-im-Bach-id17391341.html
(nach oben)
Hildburghausen: Jetzt wird alles geklärt
Per Knopfdruck ist gestern die neueste Kläranlage des Wasser- und Abwasser- Verbands Hildburghausen (WAVH) in Betrieb gegangen. Sie steht in Heldburg und klärt bis zum 30. März 2012 die Abwässer erst einmal auf Probe.
Heldburg – „Es ist ein historischer Tag – für die Stadt Bad Colberg-Heldburg und für Straufhain“, sagt Henry Feigenspan, Werkleiter des WAVH. Mehr:
http://www.insuedthueringen.de/lokal/hildburghausen/hildburghausen/art83436,1796636
(nach oben)
azv-untere-zschopau: In der KA Hartha ist der Neubau der stationären Schlammentwässerung am 14.10.2011 feierlich eingeweiht worden.
http://www.azv-untere-zschopau.de/12.0.html
(nach oben)
Hamburg: RISA – das Gemeinschaftsprojekt zur Umsetzung einer zukunftsfähigen Regenwasserbewirtschaftung in Hamburg
Die Hamburger Wasserwirtschaft steht vor großen Herausforderungen, um den Schutz vor Überflutung auch in Zeiten des Klimawandels sicher zu stellen. Prognostiziert ist eine Zunahme der Niederschlagsmenge im Winterhalbjahr, auch treten Niederschläge öfter als Starkregen in Verbindung mit Stürmen und Gewittern auf. Gleichzeitig hält der Trend zur Versiegelung von Flächen in Hamburg weiter an. Insbesondere Starkregenereignisse können dann zu Überlastungen der Kanalisation und der Gewässer und damit zu Überflutungen von Straßen und Kellern führen
Mit dem Ziel, nachhaltige Ideen und Konzepte für den Umgang mit Regenwasser zu entwickeln, haben die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) und HAMBURG WASSER (HW) gemeinsam das Projekt RISA – RegenInfraStrukturAnpassung – ins Leben gerufen. Das Projekt setzt sich für einen neuen Umgang mit Regenwasser in Hamburg ein: vom Leben am Wasser zum Leben mit Wasser! Ziel des Projektes ist die Etablierung einer zukunftsfähigen Regenwasserbewirtschaftung in Hamburg, die in einem „Strukturplan Regenwasser“ festgeschrieben wird.
Hamburg braucht innovative Maßnahmen, die zugleich den Hochwasserschutz für die Stadt als auch den Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer gewährleisten. Ein dezentrales Konzept, das Regenwasser dort, wo es anfällt, erfasst und – soweit möglich – an Ort und Stelle durch geeignete Anlagen wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zuführt.
Die übergeordneten Ziele des Projektes „naturnaher Wasserhaushalt, Gewässerschutz und Überflutungsschutz“ setzen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit voraus, die sich in der Projektstruktur von RISA widerspiegelt: Wasserwirtschaftler, Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplaner erarbeiten gemeinsam mit wissenschaftlicher Unterstützung durch Universitäten und Ingenieurbüros zukunftsfähige Lösungen für das Leben mit Regenwasser in Hamburg!
http://www.risa-hamburg.de/index.php/hintergrund-ziele.html
(nach oben)
Braunschweig: Re-Water Braunschweig
3. Internationales Symposium
Vom 21. bis 22. November 2011 findet in Braunschweig das 3. Internationale Symposium Re-Water Braunschweig statt. Veranstalterin ist die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH in Zusammenarbeit mit dem Institut für Siedluungswasserwirtschaft der TU Braunschweig, dem Kompetenzzentrum Wasser Berlin und dem Abwasserverband Braunschweig. Die Symposiumsreihe befasst sich mit der Wiederverwertung von Wasser und Abwasser, der Rückgewinnung von Nährstoffen sowie dem Schließen von Energie- und Stoffkreisläufen. Das Symposium 2011 steht unter dem Motto Implementierung und Realisierung.
Weitere Informationen: https://www.tu-braunschweig.de/isww/aktuell
(nach oben)
Friedrichshafen: Auftragsvergabe: Klärschlamm wird vom selben Anbieter entsorgt
(wex) Nach einer interkommunalen, europaweiten Ausschreibung geht die thermische Beseitigung des Klärschlammes wieder an die Firma Hans Schmid aus Tettnang-Rattenweiler, beschloss der Friedrichshafener Gemeinderat. Die Kosten werden netto bei 57 Euro/Tonne liegen.
Mit 4500 Tonnen jährlich wird gerechnet. Der Preis ist billiger als derzeit mit netto 62,70 Euro/Tonne beim selben Anbieter. So werden rund 30 523 Euro gespart. Die Entsorgung kostet ab 2012 wohl 305 235 Euro jährlich. Der Vertrag läuft …mehr:
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/friedrichshafen/Auftragsvergabe-Klaerschlamm-wird-vom-selben-Anbieter-entsorgt;art372474,5148557
(nach oben)
Dresden: Fauleier“ mit blau-grauem Anstrich – Ab Ende November soll die Gasproduktion starten
Das erste „Riesen-Ei“ der neuen Klärschlamm-Behandlungsanlage in Dresden-Kaditz steht kurz vor der Vollendung und hat einen blau-grauen Anstrich erhalten. Der zweite Faulturm ist derzeit noch eingerüstet.
Dresden. Als zukunftsweisende Technologie und markantes Wahrzeichen bezeichneten die Verantwortlichen der Stadtentwässerung Dresden GmbH (SEDD) die beiden eiförmigen Faultürme in Kaditz beim Baustart im Dezember 2008. Die Arbeiten an der neuen Klärschlamm-Behandlungsanlage gehen bald ihrem Ende entgegen. Bereits Ende November solle die Gasproduktion im ersten Turm starten, Anfang 2012 gehe das zweite „Faulei“ ans Netz, erklärt SEDD-Pressesprecher Torsten Fiedler.
Die SEDD investiert rund 43 Millionen Euro…mehr:
http://www.dnn-online.de/dresden/web/dresden-nachrichten/detail/-/specific/Fauleier-mit-blau-grauem-Anstrich-Ab-Ende-November-soll-die-Gasproduktion-starten-150837183
(nach oben)
Bad Herrenalb: Bildung eines Eigenbetriebs Abwasser
Die Stadt Bad Herrenalb wird für die Abwasserbeseitigung einen Eigenbetrieb gründen. Stadtkämmerin Sabine Zenker sagte, auf diese Weise könnten die Investitionen in das Kanalnetz direkt im Abwasserbereich und unabhängig von der Finanzlage der Stadt finanziert werden, auch werde die Gebührenkalkulation transparenter.
Auf entsprechende Nachfragen aus dem Gremium bekräftigte Zenker, der Eigenbetrieb unterstehe zu 100 Prozent dem Gemeinderat. Dies werde auch in der Satzung …mehr:
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.bad-herrenalb-bildung-eines-eigenbetriebs-abwasser.7a3d8d57-714b-4847-93d0-7164ced6f829.html
(nach oben)
Ahrensburg: Biogas durch Ultraschall
Das Klärwerk in Ahrensburg verfügt über eine der modernsten Techniken zur Behandlung von Klärschlamm. Die Methode Ultrawave kommt von der Technischen Universität Harburg und macht die Kläranlage wirtschaftlicher und umweltschonender. Die von Dr. Klaus Nickel entwickelte Ultraschall-Technologie wird mittlerweile von 55 Klär- und fünf Biogasanlagen verwendet.Mehr:
http://www.ökogas.info/oekogasnachrichten/173-biogas-durch-ultraschall-1-11-2011
(nach oben)
Aggerverband: verleiht Förderpreis
Bei der zehnten Verleihung des Aggerverband-Förderpreises wurden im Kienbaumsaal des Campus Gummersbach drei herausragende Abschlussarbeiten aus dem Bereich Wasserwirtschaft – darunter auch eine Masterarbeit – prämiert. Zwei der Arbeiten stammten aus dem Forschungsbereich Geco-C von Prof. Dr. Michael Bongards, die dritte wurde im Kölner Studienbereich Bauingenieurwesen geschrieben. Verbandsvorstand Michael Richter gratulierte den Preisträgern und machte deutlich, dass auch der Aggerverband von den Arbeiten profitiere, die in der Praxis immer wieder zu deutlichen Kosteneinsparungen geführt hätten.
Den ersten Preis und die ansehnliche Summe von 900 Euro erhielt Barbara Bock vom Studienbereich Bauingenieurwesen für ihre Arbeit „Behandlung von Vergärungsabwasser mit Ultrafiltration und Umkehrosmose zur CSB- und Stickstoff-Eliminierung“. Wegen der hohen Belastung der Prozessabwässer des Aggerverbands und der Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) können diese zurzeit nur zur Hälfte auf der Kläranlage Engelskirchen-Bickenbach behandelt werden. Die restlichen Prozessabwässer werden auf andere Kläranlagen des Verbandes verteilt. Barbara Bock hat in ihrer Diplomarbeit erfolgreiche Versuche mit einer Pilotanlage durchgeführt, bei der durch eine zweistufige Filtration die gesamte Abwassermenge an einem Ort behandelt werden könnte. Darüber hinaus hat sie die Kosten ermittelt, die für eine Großanlage entstehen würden. Betreut wurde die Arbeit von Prof. Dr. Rainer Feldhaus und Dipl.-Ing. Achim Därr, Aggerverband.
Auf den zweiten Platz kam Oliver Trauer aus Köln, er erhielt 600 Euro. Das Thema seiner Masterarbeit hieß: „Entwicklung und simulationsbasierte Optimierung eines flexiblen Agentensystems zur Betriebsoptimierung von Kanalnetzen mit integrierten Speicherbauwerken“. Die Konfigurationvon Regelungen für Kanalnetze ist sehr aufwändig. Um die Auslegung von Kanälen und Regenüberlaufbecken zu vereinfachen, nutzte Oliver Trauer einen marktwirtschaftlichen Ansatz: Auf Basis eines Softwareagenten tritt jedes Regenüberlaufbecken im Netz als Konkurrent auf einemvirtuellen Wassermarkt auf. Das System kann bis zu 13 Prozent Kosten sparen, es wird bereits in der Praxis eingesetzt. Oliver Trauer arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Geco-C des Campus Gummersbach. Die Betreuung der Arbeit hatten Prof. Dr. Michael Bongards (Campus Gummersbach) und Prof. Dr. Rainer Bartz (Fakultät Informations-, Medien- und Elektrotechnik).
Den dritten Preis, dotiert mit 300 Euro, erhielt Silvan Schlichting aus Gummersbach. Sein Thema: „Entwicklung und Erprobung einer multivariaten statistischen Analyse von Prozessdaten zur Zustandsanalyse einer kommunalen Kläranlage“. Für die automatisierte Regelung von Kläranlage und Kanalnetz benötigt man eine Vielzahl von Eingangsgrößen. Einige dieser Größen können einfach gemessen werden, andere sind schwieriger zu ermitteln. Herr Schlichtung hat in seiner Arbeit Korrelationen zwischen diesen Gruppen von Daten für das Netz der Kläranlage Homburg-Bröl ermittelt. Dabei ermittelte er Zusammenhänge, die für die weitere Optimierung der Regelungen genutzt werden können. Silvan Schlichting studiert inzwischen für seinen Masterabschluss an der Universität Hamburg. Betreut wurde die Arbeit von Prof. Dr. Michael Bongards und Dr. Tanja Haag vom Campus Gummersbach der FH Köln.
Quelle:
http://www.verwaltung.fh-koeln.de/aktuelles/2011/03/verw_msg_03832.html
(nach oben)
Erftverband: Fehleinleitung wird sehr teuer
Das war ein teures Wochenende Anfang Juli, als in Kierdorf die Kläranlage ausfiel. Zuckerhaltige Einleitungen hatten damals dazu geführt, dass die für die Reinigung notwendigen Bakterien abstarben und die Anlage ausfiel.
Das war ein teures Wochenende Anfang Juli, als in Kierdorf die Kläranlage ausfiel. Zuckerhaltige Einleitungen hatten damals dazu geführt, dass die für die Reinigung notwendigen Bakterien abstarben und die Anlage ausfiel. Schmutzwasser musste in die Erft geleitet werden. Nun hat der Erftverband als Betreiber der Anlage ausgerechnet, wie viel Abwasserabgabe dafür fällig wird: 1,5 Millionen Euro. Sollte der Verursacher für die zuckerhaltige Einleitung …mehr:
http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1316703129607.shtml
(nach oben)
Heinzenberg: 6,6 Millionen Euro für „sauberes“ Abwasser
Kläranlage Heinzenberg wird saniert und ausgebaut – Gebühren werden langfristig steigen
Der Abwasserverband Oberes Weiltal muss viel Geld in die Hand nehmen. Die Kläranlage Heinzenberg ist veraltet und muss in den nächsten Jahren saniert und erweitert werden, um wasserrechtlichen Anforderungen standzuhalten.
Axel Bangert nahm kein Blatt vor den Mund: Die Sanierung der Kläranlage Heinzenberg ist teuer, und das wird auf die Bürger Auswirkungen haben. Sie werden sich …mehr:
http://www.fnp.de/hk/region/lokales/usinger-land/66-millionen-euro-fuer-sauberes-abwasser_rmn01.c.9263331.de.html
(nach oben)
Wupperverband: Mit Volldampf erneuerbare Energien nutzen
Neue Dampfturbine in der Klärschlammverbrennungsanlage Buchenhofen erzeugt jährlich 8 Mio. Kilowattstunden Strom
Schon seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1977 wird in der Klärschlammverbrennungsanlage (SVA) Buchenhofen des Wupperverbandes der Prozessdampf zur Stromerzeugung genutzt. Doch mit der neuen Dampfturbine beginnt nun eine neue Ära der Stromerzeugung in der SVA.
Udo Paschedag, Staatssekretär im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, und Bernd Wille, Vorstand des Wupperverband, nahmen heute die neue Dampfturbine gemeinsam offiziell in Betrieb.
Pro Jahr kann die neue Dampfturbine bis zu 8,2 Mio. Kilowattstunden Strom erzeugen. Das ist so viel Strom, wie 1.800 Vier-Personen-Haushalte im Jahr verbrauchen.
Die alte Dampfturbine erzeugte durchschnittlich rund 2,2 Mio. Kilowattstunden Strom pro Jahr. Zum Betrieb seiner SVA benötigt der Wupperverband jährlich etwa 10 Mio. Kilowattstunden Strom. Durch die Steigerung der Eigenerzeugung von 2 Mio. auf 8 Mio. Kilowattstunden kann der Stromzukauf um 6 Mio. Kilowattstunden pro Jahr reduziert werden. Dadurch spart der Verband rund 850.000 Euro pro Jahr.
Die Kosten für die neue Dampfturbine betrugen 3,3 Mio. Euro.
Wenn die SVA im Regelbetrieb läuft, sind durch die eigene Strom-erzeugung aus Dampf kein Stromzukauf und auch kein zusätzliches Heizöl notwendig. Die Anlage läuft dann energieautark. Lediglich beim An- und Abfahren der Anlage sowie im Teillastbetrieb ist die Energiebilanz nicht ausgeglichen, und Strom und Heizöl müssen zugekauft werden.
Energiemanagement des Wupperverbandes: bis 2020 mehr Strom erzeugen als verbrauchen
Die neue Dampfturbine ist ein weiterer wichtiger Baustein im
Energiemanagement des Wupperverbandes. Bei einem jährlichen Stromverbrauch von 41 Mio. Kilowattstunden zum Betrieb seiner Anlagen erzeugt der Wupperverband derzeit etwa 31 Mio. Kilowattstunden aus Klärgas, Dampf- und Wasserkraft sowie Sonnenenergie. Mit seinen 7 Blockheizkraftwerken, 6 Wasserkraftanlagen, der Dampfturbine und 5 Fotovoltaikanlagen produziert der Verband rechnerisch rund drei Viertel seines Strombedarfs auf den eigenen Anlagen. Der Strom wird überwiegend direkt vor Ort zum Betrieb der Anlagen genutzt, ein Teil (rund 16 Prozent) wird ins öffentliche Netz eingespeist.
Bis 2020 will der Wupperverband seinen Stromverbrauch von 41 Mio. auf rund 37 Mio. Kilowattstunden pro Jahr senken und gleichzeitig die Eigenerzeugung auf 45 Mio. Kilowattstunden steigern. Neben der Nutzung von erneuerbaren Energien gehören zu seinem Energiekonzept auch die Steigerung der Energieeffizienz und der marktorientierte Stromeinkauf und -verkauf.
Am Standort Buchenhofen nutzt der Wupperverband bereits seit vielen Jahrzehnten die bei der Abwasserreinigung und Schlammverbrennung anfallenden erneuerbaren Energien.
In den 1940er bis 1960er Jahren wurde aufbereitetes Klärgas im Klärwerk Buchenhofen als Kfz-Treibstoff abgegeben. Ab 1957 wurde das Klärgas dort mit Gasmotoren verstromt und die Abwärme zum Heizen genutzt. 1998 wurde die „Gaskraftanlage“ im Klärwerk Buchenhofen durch ein modernes Blockheizkraftwerk (BHKW) ersetzt, in dem aus Klärgas Strom und Wärme erzeugt werden. Bis 2013 soll das vorhandene BHKW durch ein neues BHKW mit einem höheren elektrischen Wirkungsgrad ersetzt werden.
In der SVA wird seit 1977 der Prozessdampf zur Stromerzeugung genutzt. Die Wasserkraftanlage am Klärwerk Buchenhofen ist seit 1966 in Betrieb. Seit 2008 gibt es eine Fotovoltaikanlage.
Pro Jahr erzeugt der Wupperverband allein im Klärwerk Buchenhofen und in der SVA rund 20 Mio. Kilowattstunden „grünen Strom“. Das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 4.400 Vier-Personen-Haushalten.
Wupperverband
Der Wupperverband wurde 1930 gegründet mit der Zielsetzung, die wasserwirtschaftlichen Aufgaben im 813 km² großen Einzugsgebiet der Wupper über kommunale Grenzen hinweg zu erfüllen. Für den Verband stehen als öffentlich-rechtliches Unternehmen nicht Gewinnorientierung, sondern der Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource Wasser im Mittelpunkt sowie vertretbare Kosten und maximale Leistung für Mitglieder und BürgerInnen.
Der Wupperverband betreibt 12 Talsperren, 11 Klärwerke, eine Schlammverbrennungsanlage und weitere Anlagen, z. B. Hochwasserrückhaltebecken und Regenbecken. Er unterhält insgesamt rund 2.300 Kilometer Flüsse und Bäche. Verbandsmitglieder sind Städte und Gemeinden, Kreise, Wasserversorgungsunternehmen, Industrie sowie Gewerbe im Wuppergebiet.
www.wupperverband.de, www.fluggs.de
(nach oben)
BRAUNLAGE: Abwasser: Stadt zahlt Geld an Kläger
Es ging um 194 Euro. Diesen Betrag bekommt Marian Bittner aus Zorge nun von der Stadt Braunlage zurück. Der 80-Jährige hatte 2010 gegen die Kommune geklagt, weil seiner Ansicht nach die Mindestgebühr bei der Abwassergebühr ungerecht ist. Die Stadt gab seinem Widerspruch nach.
Bereits seit vier Jahren steht das Haus Bittners in der Langen…mehr:
http://www.goslarsche.de/Home/harz/braunlage_arid,218185.html
(nach oben)
Seelower Wasserverband: kämpft mit Ausfall seines Großkunden
Seelow (MOZ) Der Seelower Wasser- und Abwasser-Zweckverband hat mit den Auswirkungen des Wegfalls seines Großkunden, der Manschnower Frostung, zu kämpfen. Das wurde auch zur Verbandsversammlung am Mittwoch im Seelower Rathaus deutlich. Ramona Gardosch vom Wirtschaftsprüfbüro Wibera erläuterte den Vertretern der Mitgliedsgemeinden, dass der Trinkwasserverbrauch in dem 17 500 Einwohner zählenden Verbandsgebiet um 27 Prozent und der Schmutzwasseranfall um rund 40 Prozent zurückgegangen …mehr:
http://www.moz.de/heimat/lokalredaktionen/seelow/artikel7/dg/0/1/981366/
(nach oben)
LIEBENBURG: Ratsbeschluss: Wasserpreis steigt, Abwasserpreis sinkt
Der Gemeinderat beschloss einstimmig eine Änderung der Gebührenstruktur im Wasser- und Abwasserbereich. Frischwasser verteuert sich pro Kubikmeter um 15 Cent. Der Preis pro Kubikmeter Abwasser sinkt um 50 Cent. Im Saldo ergibt sich für die Bürger eine Entlastung vom 3 Cent pro Kubikmeter. Ab 1. Januar 2012 kostet damit ein Kubikmeter Frischwasser 1,55 Euro und ein Kubikmeter Abwasser 3,44 Euro. Die Grundpreise bleiben unverändert. Die Erhöhung des Wasserpreises bildet …mehr:
http://www.goslarsche.de/Home/harz/liebenburg_arid,224749.html
(nach oben)
Ingolstadt: Kanalnetzkalibrierung (Kernstadt) im Rahmen des Generalentwässerungsplans
Für das Einzugsgebiet der Ingolstädter Kernstadt wird ein neuer Generalentwässerungsplan aufgestellt. Um die Berechnungsergebnisse aus dem Modell mit der Realität abzugleichen, wurde eine Kanalnetzkalibrierung durchgeführt.
Es lagen 25 Messstellen mit Wasserstands- und Durchflussmessungen für die Zeiträume Herbst 2006 und Sommer 2007 vor. Desweiteren wurden 7 im Stadtgebiet verteilte Niederschlagsschreiber verwendet. Eine ungleichmäßige Überregnung …mehr:
http://www.hydro-ingenieure.de/news_pro_kalibrierung_Ingolstadt.html
(nach oben)
Rodgau: Cannabis-Plantage hinter der Kläranlage
Enttäuschung wird sich wohl bei demjenigen breit machen, der sich in den letzten Monaten im freien Feld westlich der verlängerten Hauptstraße eine kleine Cannabis-Plantage angelegt hatte
http://www.familien-blickpunkt.de/aktuelles/cannabis-plantage-hinter-der-klranlage.html
(nach oben)
Klosterneuburg: Auch die Stadt Klosterneuburg setzt auf den WABAG-Hybrid Prozess
Die Stadt Klosterneuburg erweiterte ihre Kläranlage mit dem innovativen Verfahren für eine moderne vollbiologische Abwasserbehandlung
Die um- und ausgebaute Kläranlage in Klosterneuburg wurde am 14.9.2011 feierlich eröffnet. Die Anlage mit einer Kapazität von 55.000 EW erhielt eine vollbiologische Reinigungsstufe nach dem patentierten zweistufigen Hybrid-Verfahren, das von VA TECH WABAG gemeinsam mit Herrn Univ. Prof. DI Dr. N. Matsché entwickelt worden ist. Dieser innovative Prozess zeichnet sich vor allem durch
• einen geringen Bedarf an Beckenvolumen und damit Platzbedarf,
• verminderten Energiebedarf für die Belüftung,
• erhöhten Gasanfall bei der anaeroben Schlammfaulung,
• niedrigem Schlammindex auch bei ungünstiger Abwasserzusammensetzung,
• eine hohe Stickstoffelimination und große Flexibilität
aus und eignet sich besonders für den Ausbau hinsichtlich Kapazität und Reinigungsleistung bestehender Kläranlagen, indem bestehende Anlagenteile kostengünstig integriert werden können. Die zweistufige Verfahrensweise ergibt auch bei Stoßbelastungen durch gewerbliche und industrielle Abwässer eine hohe Qualität des gereinigten Abwassers. In Klosterneuburg werden die gereinigten Abwässer in beinahe Badewasserqualität in die Donau eingeleitet.
Die Kläranlage Klosterneuburg ist bereits die 11. Anlage in Österreich, die sich die Vorteile des Hybrid-Verfahrens gesichert hat. Der größte Anwendungsfall ist dabei sicherlich die Hauptkläranlage in Wien. Mit dem Einsatz des zweistufigen Hybridverfahrens können Stoßbelastungen optimal ausgeglichen und ein stabiler Betrieb gewährleistet werden. VA TECH WABAG hat für die ausgebaute Großkläranlage, die 2005 den Betrieb aufgenommen hat, die Planung für die Erweiterung auf 4 Millionen EW nach dem Hybrid-Prozess ausgearbeitet und die in ihren Dimensionen beeindruckenden 15 Stk. Nachklärbecken geliefert.
Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:
DI Reinhard Nowotny
VA TECH WABAG GmbH
Dresdner Straße 87-91
1200 Wien
Tel: +43 1 25105-4222
contact@wabag.com
www.wabag.com
(nach oben)
Duisburg: Minister Remmel will Anlage in Duisburg-Vierlinden zur Eröffnung besuchen
Spurenstoffe und Arzneimittelrückstände verursachen bei einem
Eintrag in Oberflächengewässer und Grundwasser Gesundheitsri-
siken für Mensch und Tier. Die Ozonanlage der Kläranlage Duis-
burg-Vierlinden wird für eine Vielzahl von Versuchen und Untersu-
chungen hinsichtlich der Effektivität der Ozonierung eingesetzt.
Ziel dieser wissenschaftlichen Untersuchungen ist es, für weitere
Anlagen in NRW einen optimalen Ozoneintrag bei hoher Eliminati-
on der Spurenstoffe unter großtechnischen Betriebsbedingungen
zu finden. Die Anlage in Duisburg Vierlinden bieten die Möglichkeit
verschiedene Ozoneintragssysteme und Ozoneintragsstrategien
miteinander zu vergleichen
http://www.umweltcluster-nrw.de/de/News/Newsletter/NL_2011_03.html#6
(nach oben)
Kaster: Gruppenklärwerk- Ertüchtigung der Belebung und Bau einer Prozesswasserbehandlungsanlage
Das Gruppenklärwerk Kaster ist weitgehend ausgelastet. Die Erweiterung der Leistungsfähigkeit hinsichtlich der biologischen Reinigungsstufe erfolgt durch den Neubau einer Prozesswasserbehandlung als SBR-Anlage mittels Deammonifikation sowie die Umrüstung des Belebungsbeckens zur intermittierenden Denitrifikation/Nitrifikation. Derzeit erfolgt die Ausführungsplanung. Der Baubeginn ist im Herbst 2011…mehr:
http://www.hydro-ingenieure.de/news_pro_kaster.html
(nach oben)
Pfattertal: Gebühr für Abwasser steigt deutlich
Die Bürger zahlen ab Oktober 4,40 Euro für den Kubikmeter. Die BI Pfattertal will gegen den neuen Tarif klagen.
Mintraching. Die Anschließer im Bereich des Abwasserzweckverbands Pfattertal zahlen derzeit 3,89 Euro pro Kubikmeter Abwasser. Damit gehört das Verbandsgebiet zu den teuersten Abwasser-Regionen im Landkreis. Ab Oktober wird der Zweckverband noch deutlich teurer: 4,40 Euro sind dann für den Kubikmeter Abwasser fällig. Die Niederschlagswassergebühr steigt zugleich um neun Cent auf 0,94 Euro pro Quadratmeter.
Auslöser für die Erhöhung ist die neue Globalberechnung
http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/nachrichten-aus-dem-landkreis-regensburg/artikel/pfattertal_gebuehr_fuer_abwass/704415/pfattertal_gebuehr_fuer_abwass.html
(nach oben)
Duisburg: dynaklim entwickelt Anpassungsstrategien mit den Duisburger Wirtschaftsbetrieben
Im Allgemeinen wird die Bausubstanz urbaner Kanalnetze für sehr lange Nutzungsdauern von bis zu 100 Jahren ausgelegt. Aus monetärer Sicht gilt es diese Wasserinfrastrukturen langfristig und somit kostengünstig abzuschreiben. Eine vorzeitige Erneuerung- vor Ablauf der Abschreibung des Anlagenvermögens- ist vergleichsweise unwirtschaftlich.
Im Zuge der dynaklim-Aktivitäten im Arbeitsprogramm E4.2 wird u.a. das Pilotgebiet der Duisburger Kläranlageneinzugsgebiete Hochfeld & Duissern hinsichtlich des klimawandelbedingten Anpassungsbedarfs und geeigneten Anpassungsmöglichkeiten untersucht.
Für die Gewährleistung einer der wesentlichen Funktionalanforderungen – dem Schutz vor Überflutungen – kommt der Niederschlagscharakteristik bei der Dimensionierung der Entwässerungssysteme eine besondere Bedeutung zu. Für die Identifizierung überflutungsgefährdeter Bereiche in einem Kanalsystem sind neben einer Quantifizierung der Eingangsbedingungen und der Reaktion des Entwässerungssystems auch mögliche Konsequenzen bei Überflutungsereignissen durch Vulnerabilitäsbetrachtungen der oberflächigen Bebauungsstruktur zu eruieren.
Gemeinsame Ortsbegehung des Duisburger Entwässerungsnetzes am 19.10.2011
Am 19.10.2011 wurden durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR und Vertretern des dynaklim-Verbunds sensitive Punkte des Entwässerungsnetzes besichtigt, um eine erste Einschätzung der lokalen Betroffenheit bei einem veränderten Niederschlagsregime zu bewerten. Es zeigte sich dabei, dass beispielsweise durch die in Duisburg per Satzung verankerte gegenüber dem Regelfall erhöhte Rückstauebene (20 cm über GOK) und dementsprechende lokale Objektschutzmaßnahmen der Grundstückseigentümer, die aktuell in der Fachwelt vielfach propagierte „wassersensible Stadtentwicklung“ in Duisburg bereits praktisch umgesetzt wird.
Im weiteren Verlauf des Forschungsvorhabens wird auf Basis zeitlich und räumlich hochaufgelöster Niederschlagsprojektionen mit Hilfe zweidimensionaler Überflutungsberechnungen eine Quantifizierung der Mehrbelastungen infolge des Klimawandels ermittelt. Daraus sollen mögliche „No-Regret-Maßnahmen“ für die Systeme identifiziert werden. Aber wie können solche No-Regret-Maßnahmen aussehen? Was sind die Ziele regionaler Adaptationsstrategien?
Präsentation der Arbeitsgebnisse auf dem dynaklim-Symposium am 09.11.2011
Auf dem dynaklim-Symposium 2011 am 09.November 2011 in Recklinghausen werden in der Session „Resiliente Siedlungswasserwirtschaft – Möglichkeiten und Grenzen“ Teilergebnisse des Arbeitsbereichs vorgestellt sowie die aufgeworfenen Fragen mit dem Auditorium diskutiert.
Das Gesamtprogramm zum download finden Sie am Ende dieser Seite
http://www.dynaklim.de/dynaklim/index/news/10_2011-Duisburg-Ortsbegehung.html
(nach oben)
Ulm/Neu-Ulm: Regierungspräsidium Tübingen gibt Fördermittel für den weiteren Ausbau der Aktivkohlestufe des Klärwerks Steinhäule in Höhe von 2,6 Millionen Euro frei
Das Regierungspräsidium Tübingen hat dem Zweckverband Klärwerk Steinhäule einen Förderbescheid in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro für den Bau von zwei Sandfiltern zukommen lassen. Sie sind Teil der Aktivkohlestufe zur Entfernung von Spurenschadstoffen. Dies sind unter anderem Arzneimittelreste, hormonwirksame Substanzen, krebserzeugende, erbgutschädigende, schwer abbaubare oder sich in Organismen akkumulierende Stoffe aus Industrie, Gewerbe und Haushalten. Sie werden in einer konventionellen Kläranlage nur unzureichend oder gar nicht abgebaut und gelangen so in die Gewässer.
Die Gesamtmaßnahme ist in mehrere Bauabschnitte gegliedert. Im Jahr 2010 hat der Zweckverband vom Regierungspräsidium Tübingen Fördermittel für einen ersten Bauabschnitt in Höhe von 3,9 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhalten. 2015 wird ein erster funktionsfähiger Abschnitt in Betrieb gehen. Die Baumaßnahme kostet circa 40 Millionen Euro und soll insgesamt bis zum Jahr 2021 realisiert sein.
Die Aktivkohlestufe mit Sandfiltration kommt der Wasserqualität der Donau und der Trinkwasserversorgung zugute. Der Zweckverband Landeswasserversorgung entnimmt der Donau in Leipheim Oberflächenwasser und bereitet es auf.
Hintergrundinformation:
Das Verbandsklärwerk Steinhäule reinigt die Abwässer aus Ulm, Neu-Ulm und weiteren Städten und Gemeinden aus Bayern und Baden-Württemberg und ist auf 440.000 Einwohnerwerte ausgelegt. Die Anlage steht auf Neu-Ulmer Gemarkung
(nach oben)
St. Georgen: Regierungspräsidium fördert privates Abwasserprojekt in St. Georgen mit rd. 167 000 Euro
Für die Finanzierung eines außergewöhnliches Abwasserprojekt hat Regierungsvizepräsident Klemens Ficht heute dem St. Georgener Bürgermeister Michael Rieger zwei Zuschussbescheide über insgesamt 167 000 Euro überreicht. Mit dieser ersten Fördertranche unterstützt das Regierungspräsidium den Bau der neuen Hauptdruckleitung von der Stockburger Mühle bis zur zentralen Kläranlage Peterzell inklusive Pumpwerk sowie Hausanschlussleitungen im Bereich Stockburg.
Außergewöhnliche Kooperation Stadt – Abwassergemeinschaft
Außergewöhnlich ist das Projekt aber nicht wegen dieser technischen Maßnahmen, sondern wegen der dahinter steckenden Kooperation zwischen der Stadt St. Georgen und – im Endausbau – insgesamt rd. 146 Grundstückseigentümern in den Außenbereichen Stockburg und Stockwald auf St. Georgener und Unterkirnacher Gemarkung sowie im Groppertal. Einen „Zusammenschluss für den Anschluss“ könnte man dieses Vorhaben bezeichnen, denn bislang haben diese Grundstückseigentümer ihre häuslichen Abwässer über Kleinkläranlagen gereinigt, die dem heutigen Stand der Technik schon lange nicht mehr entsprechen und bei weitem auch nicht die Reinigungsleistung einer modernen Kläranlage erbringen. Noch gehören diese zu einer schwindenden Minderheit von rd. 83.000 Anlagen, deren mangelhaft geklärte Hausabwässer die Flüsse und Bäche in Baden-Württemberg etwa im gleichen Maße belasten wie die rd. 10,7 Mio. Einwohner, deren Abwasser nach dem Einsatz moderner Technik wieder zurück in die Natur geht. Da diese Kleinkläranlagen auch häufig an Bächen und Wassergräben mit geringer Wasserführung und auch in Quellgebieten liegen, ist die von ihnen ausgehende Belastung der Gewässer enorm. Dies wird sich nun ändern.
Die Stadt übernimmt bei dem Projekt die Kosten für Material von Haupt- und Nebensammlern, der Pumpstation inklusive Zufahrt etc., die Abwassergemeinschaft kümmert sich in Eigenleistung um die Grab- und Verlegearbeiten für die Kanäle sowie das Material für die Hausanschlüsse.
Regierungspräsidium will nach Möglichkeit in den nächsten Jahren weiter fördern
Die Gesamtkosten für diesen ersten Bauabschnitt belaufen sich auf über eine halbe Million Euro. Grundsätzlich können nur einzelne Abschnitte hintereinander bezuschusst werden. „Diese Sondermittel stammen aus einem Topf, den das Land den jeweiligen Regierungspräsidien aus der Abwasserabgabe zeitlich unregelmäßig und in wechselnder Höhe bereitstellt. Das Regierungspräsidium möchte allerdings, wenn die finanzielle Lage es erlaubt, Fördermittel für die weiteren Bauabschnitte bereitstellen. Die Projektplanung sieht einen Abschluss der Gesamtmaßnahme Ende 2015 vor, so dass wir, wenn Geld zur Verfügung steht, auch noch in den nächsten vier Jahren bezuschussen wollen“, stellte Regierungsvizepräsident Klemens Ficht in Aussicht und machte Bürgermeister Michael Rieger ein Kompliment: „Wenn eine Kommune und viele betroffene Bürger bei einem solchen Projekt im wahrsten Sinne des Wortes Hand in Hand arbeiten, ist das ein Indiz für außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement und eine tatkräftige Kommunalverwaltung. So findet man das nicht überall im Land. Herzlichen Glückwunsch und gutes Gelingen weiterhin bei der Umsetzung des Projektes!“
(nach oben)
Parchim: Stinkender Klärschlamm auf 20 Kilometern: Straße dicht
Eine ganze Ladung übelriechender Klärschlamm hat am Freitag eine vielbefahrene Straße in Westmecklenburg fast sechs Stunden lang blockiert. Wie ein Polizeisprecher in Parchim am Sonnabned erklärte, hatte ein Lkw-Fahrer die Ladung von 30 Tonnen Schlamm auf der Landesstraße 16 bei Wozinkel (Kreis Parchim) auf fast 20 Kilometern „verteilt“. Der Schlamm habe bis zu 30 Zentimeter dick auf der Straße gelegen.
Ursache soll ein technischer Defekt an einer Ladeklappe gewesen sein, der Lkw-Fahrer…mehr:
http://www.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article2014155/Stinkender-Klaerschlamm-auf-20-Kilometern-Strasse-dicht.html
(nach oben)
Kandern: Regierungspräsidium Freiburg bezuschusst Bau eines neuen Regenüberlaufbeckens für die Kläranlage der Stadt Kandern mit fast 900.000 EUR
Das Regierungspräsidium bezuschusst den Bau eines Regenüberlaufbeckens zur Behandlung des gesammelten Mischabwassers der Stadt Kandern mit 894.500,- EUR. Das entspricht bei Gesamtkosten von rd. 2,0 Mio. EUR einem Fördersatz von rd. 47 %. Der Förderbescheid ging der Stadt bereits zu.
Mit dem Bau eines neuen Regenüberlaufbeckens wird das Kanderner Kanalnetz künftig nach einem Starkregen deutlich mehr Mischabwasser (Niederschlagswasser und häusliches Schmutzwasser) zur Kläranlage ableiten können. Die Gefahr, dass etwa nach einem Starkregen unbehandeltes Abwasser in die Kander eingeleitet werden muss, weil sonst die Kanalisation überlaufen würde bzw. die Kläranlage nicht mehr ihren Betrieb aufrecht erhalten kann, kann damit erheblich reduziert werden.
Seit ihrer Stilllegung 1980 dient die alte Kläranlage als provisorisches Regenüberlaufbecken. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist abgelaufen. Das Regenüberlaufbecken (ca. 500 m³) entspricht weder bezüglich des erforderlichen Volumens noch hinsichtlich der Ausstattung dem Stand der Technik. Der Bau eines neuen Regenüberlaufbeckens im Bereich des Bauhofes soll dieses langjährige Provisorium ablösen. Dann entfallen auch die erheblichen Betriebsprobleme mit dem alten Regenüberlaufbecken, das nur schwer zu reinigen war.
Umweltminister Franz Untersteller begrüßt diese Förderung ausdrücklich: „Ich halte es für richtig, dass die Stadt diesen Landeszuschuss erhält. Eine Ertüchtigung der Kläranlage bedeutet letztendlich auch verbesserten Gewässerschutz in den Vorflutern. Das ist auch im Sinne der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie“.
(nach oben)
Bad Abbach – Umweltminister startet Pilotprojekt für Kläranlagen
Bad Abbach (Landkreis Kelheim) ist künftig vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt. Dr. Markus Söder, Umweltminister, eröffnet das neue Schutzsystem für den Kurort am
„Zudem startet der Minister in Bad Abbach ein weiteres Pilotvorhaben aus dem Projekt „Kläranlage der Zukunft“. Ziel ist, Energie aus Klärschlamm zu gewinnen“
http://www.stmug.bayern.de/aktuell/presse/detailansicht.htm?tid=22357
(nach oben)
WOLLERSLEBEN: IST ANGESCHLOSSEN
In Wollersleben ist eine neue Abwasserbehandlungsanlage am Vormittag in Betrieb genommen worden. Gleichzeitig sind die erforderlichen Leitungen vom Hünstein und von Wollersleben in die Erde gebracht worden…
Auch wenn die jetzige Kläranlage, knapp 1,5 Jahre nach dem ersten Spatenstich dem entspricht, was geplant wurde, konnte das Ergebnis nur erzielt werden durch eine konsequente Bauüberwachung und stetiges eingreifen durch den Auftraggeber. Der Bau der Anlage wurde auf 1,8 Millionen geschätzt. Auch wenn die Schlussrechnungen noch nicht vollständig geprüft vorliegen, so kann man davon ausgehen, dass diese Summe nicht überschritten wird.
Im Jahr 2011 wurden die Verbindungssammler vom Hünstein und vom Ortsteil Wollersleben zur Kläranlage Wollersleben öffentlich ausgeschrieben. Den Zuschlag hat die Firma KEMNA …mehr:
http://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=101978
(nach oben)
WITTENBERGE: Knappe Million fließt in Kläranlage
In Wittenberge wächst die Menge des gewerblichen Abwassers / Modernisierung geplant
Mehr Klärkapazität in einer schrumpfenden Stadt? Das klingt zunächst nach einem Widerspruch, doch der lässt sich schnell aufklären: „In Wittenberge wächst seit Jahren die Schmutzfracht im Abwasser von gewerblichen Einleitern“, sagt Susanne Geissler, technische Leiterin im Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wittenberge. Das hat zur Folge, dass die Kläranlage an der Bentwischer Chaussee mit der Reinigung des Abwassers an ihre Grenzen kommt. „Früher lag das Verhältnis zwischen Haushaltsfäkalien und gewerblichem …mehr:
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12173403/61469/In-Wittenberge-waechst-die-Menge-des-gewerblichen-Abwassers.html
(nach oben)
Wißgoldingen: will an die Verbandskläranlage
An einer Sanierung der 36 Jahre alten Wißgoldinger Kläranlage führt kein Weg vorbei. Das Mutlanger Planungsbüro LK&P stellte dem Gemeinderat am Dienstagabend ein entsprechendes Strukturgutachten vor. Die Planer untersuchten mehrere Varianten und empfahlen den Anschluss an die Verbandskläranlage Salach. Zu den Kosten von rund 1,5 Millionen Euro kommen noch die Aufwendungen für Grunderwerb und Grunddienstbarkeiten sowie die laufenden Kosten und Reinvestitionen. Mehr:
http://remszeitung.de/2011/5/12/wissgoldingen-will-an-die-verbandsklaeranlage/
(nach oben)
VELDEN: Abwasser fließt nach Velden
In fairen und konstruktiven Verhandlungen wurde zwischen der Stadt Velden und dem Markt Neuhaus eine Zweckvereinbarung erarbeitet, die die Einleitung des gesamten Mischwassers der zum Markt Neuhaus gehörenden Ortschaft Höfen in die Entwässerungseinrichtung der Stadt Velden vorsieht. In bestem Einvernehmen und freudestrahlend unterzeichneten die beiden Gemeindechefs im Veldener Rathaus den Vertrag.
Bei dieser Gelegenheit erläuterte Bürgermeister Josef Springer von der Marktgemeinde die Gründe, die zum Zustandekommen dieser Vereinbarung geführt haben: Für die Ortschaft Höfen mit ihren rund 135 Einwohnern sei die abwasserrechtliche Genehmigung für die eigene Kleinkläranlage abgelaufen. Deshalb habe man nach Alternativen gesucht. Neben der Möglichkeit, eine etwa drei Kilometer lange Leitung mit Anschluss an die Abwasseranlage nach Neuhaus zu verlegen, habe man die Idee prüfen lassen, mit einer nur rund 700 Meter langen Druckleitung …mehr:
http://n-land.de/hersbrucker-zeitung/lok-detail/datum/2011/09/15/abwasser-fliesst-nach-velden.html
(nach oben)
Unterwössen: Kanalgebühren steigen um bis zu 70 Prozent
Schlechte Nachrichten für die Bürger in Unterwössen: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine drastische Erhöhung der Kanalgebühren ab 1. Januar beschlossen.
Die Grundgebühren steigen danach um rund zehn Prozent, die Abwasserentsorgung wird bis zu 70 Prozent teurer. Die Erhöhungen sind erforderlich, weil Sanierungsmaßnahmen …mehr:
http://www.chiemgau24.de/chiemgau/unterwoessen/kanalgebuehren-steigen-prozent-unterwoessen-chiemgau24-1425554.html
(nach oben)
Thalfang: investiert in Abwasserbeseitigung
In Gräfendhron baut die Verbandsgemeinde (VG) Thalfang für 920 000 Euro eine neue Pflanzenkläranlage. Sie ist eine von drei Anlagen dieser Art in der Gemeinde. Insgesamt investiert die VG rund 3,2 Millionen Euro in Abwasser- und Klärsysteme. Mehr:
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/hunsrueck/aktuell/Heute-in-der-Hunsrueck-Zeitung-Thalfang-investiert-in-Abwasserbeseitigung;art779,2897307
(nach oben)
REICHELSHEIM: Parlament beschließt höhere Gebühren
Bürger müssen künftig mehr für Abwasser zahlen – Müllgebühren steigen nicht
Die Stadtverordneten beschlossen während der jüngsten Parlamentssitzung einstimmig auf Vorschlag des Magistrats, die Abwassergebühren um 20 Cent je Kubikmeter anzuheben.
„Die Gebührensätze sollten so sein, dass sie die Kosten decken können“, erklärte Bürgermeister
http://www.kreis-anzeiger.de/lokales/wetteraukreis/reichelsheim/11226522.htm
(nach oben)
OCHSENFURT: Millionen gegen den Gestank
Starker Gestank aus den Schlammteichen zwischen Ochsenfurt und Marktbreit brachte die Ochsenfurter Zuckerfabrik im Frühjahr bei Anrainern in Verruf. Erst mit einer Reihe kostspieliger Maßnahmen gelang es, die unvorhergesehene Problem im Mai unter Kontrolle zu bekommen. Vor der neuen Kampagne ist man besser vorbereitet.
Die Veränderungen stellte die Werkleitung nun den Bürgermeistern von Frickenhausen, Ochsenfurt, Marktbreit und Segnitz vor. Ab Herbst 2012 sollen Geruchsprobleme durch den Bau einer neuen, wesentlich größeren Klärstufe endgültig …mehr:
http://mobil.mainpost.de/regional/art773,6326504
(nach oben)
Nedlitz: Weniger Abwasser in die Havel
Kläranlage Nedlitz erweitert: 4,2 Millionen Euro in Abwasserspeicher investiert
Nedlitz – Potsdamer Abwasser soll künftig bei Starkregen nicht mehr ungeklärt in die Neustädter Havelbucht abfließen: 4,2 Millionen Euro hat das Wasserunternehmen EWP in den letzten vier Jahren in die Erweiterung des Klärwerkes Nord investiert, um den Anstieg der Abwassermassen nördlich der Havel …mehr:
http://www.pnn.de/potsdam/573097/
(nach oben)
Mittelberg: Gebühren für Trinkwasser und Kanal in steigen
Gemeinde Mittelberg verlangt Walsern mehr Geld ab, um Einnahmen und Ausgaben auszugleichen
Auf höhere Gebühren für Trinkwasser und Abwasser müssen sich die Bewohner des Kleinwalsertals einstellen. Einstimmig hat die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung den Preisaufschlag gebilligt, der ab 1. Dezember gilt. Für den Kubikmeter Trinkwasser sind statt 1,30 Euro wie bisher künftig 1,40 Euro zu zahlen. Von bislang 2,20 auf 2,40 Euro pro Kubikmeter steigt die Gebühr fürs Abwasser…mehr:
http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/immenstadt/Immenstadt-geld-gebuehren-wasser-klaerwerk-sanierung-Gebuehren-fuer-Trinkwasser-und-Kanal-in-Mittelberg-steigen;art2763,1016409
(nach oben)
Havelländisches Luch: Zweckverband zahlt nun Beiträge zurück – für Anschlüsse ab 1993
ABWASSER: Altanschließer bleiben unbehelligt
FRIESACK – Gute Nachrichten für Grundstückseigentümer im Bereich des Abwasserzweckverbandes Havelländisches Luch: Wer nach 1993 an das zentrale Schmutzwassernetz angeschlossen wurde, bekommt nun die Anschlussbeiträge zurückerstattet. Allerdings muss er dazu einen schriftlichen Antrag an den Zweckverband beziehungsweise …mehr:
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12186087/61759/Zweckverband-Havellaendisches-Luch-zahlt-nun-Beitraege-zurueck-fuer.html
(nach oben)
Liebenburg: Ratsbeschluss: Wasserpreis steigt, Abwasserpreis sinkt
LIEBENBURG. Der Gemeinderat beschloss einstimmig eine Änderung der Gebührenstruktur im Wasser- und Abwasserbereich. Frischwasser verteuert sich pro Kubikmeter um 15 Cent. Der Preis pro Kubikmeter Abwasser sinkt um 50 Cent. Im Saldo ergibt sich für die Bürger eine Entlastung vom 3 Cent pro Kubikmeter.
Ab 1. Januar 2012 kostet damit ein Kubikmeter Frischwasser 1,55 Euro und ein Kubikmeter Abwasser 3,44 Euro. Die Grundpreise…mehr:
http://www.goslarsche.de/Home/harz/liebenburg_arid,224749.html
(nach oben)
Kühbach: 20 Cent mehr für das Abwasser
Erhöhung zum Jahreswechsel von 1,90 auf 2,10 Uhr je Kubikmeter geplant. Etwa 20 Euro mehr pro Haushalt jährlich
Die Bürger in der Marktgemeinde Kühbach müssen sich auf höhere Abwassergebühren einstellen. Voraussichtlich zum 1. Januar 2012 wird der Preis von derzeit 1,90 auf dann 2,10 Euro je Kubikmeter angehoben. Weil die Gemeinde ein Defizit bei der Abwasserentsorgung einfährt, soll die Verwaltung …mehr:
http://www.augsburger-allgemeine.de/aichach/20-Cent-mehr-fuer-das-Abwasser-id16826996.html
(nach oben)
Harsewinkel: Elimination von Mikroschadstoffen im Abwasser
Sitzung des Betriebsauschuss am 28.09.2011
Zur Sitzung des Betriebsauschuss am 28.09.2011 hatte die Betriebsleitung des Klärwerks eingeladen. Schwerpunkt der Sitzung war der Einstieg in die Thematik;
„Weitergehende Abwasserreinigung im Sinne der Elimination von Mikroschadstoffen“
Mikroschadstoffe – Definition aus der Verwaltungsvorlage:
Unter Mikroschadstoffe versteht man Rückstände von Arzneimitteln, Industriechemikalien, Desinfektionsmitteln, Röntgenkontrastmittel, Zusatzstoffe in Lebensmitteln usw. die bei der herkömmlichen Abwasserreinigung nicht aus dem Abwasser eliminiert werden können. Diese Stoffe belasten zunehmend die Gewässer und das Grundwasser. Einwandfreies Grundwasser ist die wichtigste Ressource für die öffentliche Trinkwasserversorgung. Eine wesentliche Rolle zum Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung stellt die Vermeidung der Einleitung von Mikroschadstoffen in die Gewässer dar.
Beschlussvorschlag der Betriebsleitung:
1. Der Betriebsausschuss beschließt, einen Förderantrag für einen großtechnischen Versuch zur Elimination von Spurenstoffen an der Kläranlage Harsewinkel beim Land NRW zu stellen.
2. Der Betriebsausschuss behält sich vor, eine Entscheidung über die Durchführung des großtechnischen Versuchs erst nach dem Vorliegen des Zuwendungsbescheids zu treffen.
Kurzfristig ist dazu eine Investition in der Höhe von ca. 200.000 Euro nötig.
Es besteht eine gute Chance diesen Betrag zu 80% durch das Land fördern zu lassen.
Bei einem erfolgreichen „Großversuch“ kommen dann Investitionen in Millionenhöhe auf die Stadt zu. Förderung könnte dann bei 60% liegen.
Warum ist die „Elimination von Mikroschadstoffen“ für Harsewinkel ein Thema?
Im immer stärkeren Umfang finden sich Mikroschadstoffe in unseren Gewässern wieder. Der steigende Verbrauch der Medikamente führt zu mehr Ausscheidungen und damit zu größeren Volumen im Abwasser.
Beispielsweise der Verbrauch einiger Medikamente in Deutschland:
Schmerzmittel Ibuprofen 344.887 kg/Jahr
Stimmungsaufheller Carbamazepin 87.605 kg/Jahr
Rheumamittel Diclofenac 85.800 kg/Jahr
Betablocker Metroprolol 93.000 kg/Jahr
Tendenz steigend.
Diese Mikroschadstoffe können mit der heutigen Technik nicht aus dem Abwasser herausgefiltert werden. Sie werden also in die Fließgewässer eingeleitet.
Diese Mikroschadstoffe werden auch nicht abgebaut. Sie gelangen über das Wasser wieder zurück in unsere Nahrungskette. Die Konzentration steigt zwangsläufig mit allen damit verbundenen gesundheitlichen Problemen.
In den sehr informativen Vorträgen Herrn Schumacher und Herrn Dipl.-Ing. Alt wurden die Ausschussmitglieder mit dem Thema vertraut gemacht. (Die Präsentationen stehen im Ratsinformationssystem der Stadt Harsewinkel bereit zur Ansicht.)
Das Klärwerk Harsewinkel befindet sich in einem guten technischen und wirtschaftlichen Zustand. Die eingeleitete Wasserqualität ist überdurchschnittlich gut.
Sich auf hohem Niveau frühzeitig neuen Herausforderungen zu stellen macht auch wirtschaftlich Sinn.
Die heutige Konfiguration des Abwasserbetriebs bietet sich für eine erweiterte Reinigung mit granulierter Aktivkohle (GAK) an.
Außerdem könnten unter Umständen noch Fördermittel generiert werden. Also kommt eine frühe Investition womöglich günstiger wie eine späte Pflichtumstellung.
Denn die Problematik mit den Mikroschadstoffen wird an Bedeutung gewinnen.
Der Verantwortung können wir uns nicht entziehen und die Gesetze werden in einigen Jahren strenger werden.
Zunächst stimmt der Ausschuss dem Verwaltungsvorschlag zu.
Eine Machbarkeitsstudie ist unumgänglich.
Denn dieses Thema ist auch für die Wissenschaft, Ingenieurbüros und Behörden Neuland.
http://www.cdu-harsewinkel.de/lokal_1_1_500_Elimination-von-Mikroschadstoffen-im-Abwasser.html
(nach oben)
Zschopau/Gornau: Verband hebt ab 2012 Gebühren für Abwasser an
Hauptgrund für Teuerung liegt im anhaltenden Bevölkerungsrückgang
Die Abwasserentsorgung in Zschopau und Gornau wird ab 2012 teurer. Nach einer zuletzt im Jahr 2008 erfolgten Anpassung müssen sich die Einwohner im neuen Jahr bei der Gebühr für Schmutzwasser auf eine zehnprozentige…mehr:
http://www.freiepresse.de/LOKALES/ERZGEBIRGE/ZSCHOPAU/Verband-hebt-ab-2012-Gebuehren-fuer-Abwasser-an-artikel7766936.php
(nach oben)
Geiselwind: Abwasser wird teurer
Für die Einleitung von Abwasser in die Kläranlage der Gemeinde Geiselwind muss ab 1. Oktober mehr bezahlt werden. Die Grundgebühren pro Abwasserzähler erhöhen sich um 50 Prozent, die Verbrauchsgebühren steigen von 1,70 Euro pro Kubikmeter auf 1,85 Euro. Darauf einigten …mehr:
http://www.main.de/kitzingen/geiselwind/geiselwind./art610,923007
(nach oben)
Eriskirch: Erhöhung beim Abwasser
Eriskirch (rac) Der Gemeinderat Eriskirch beschloss am Mittwochabend einstimmig die Erhöhung der Abwassergebühren für den Zeitraum 2012 bis 2014.
Am 1. Januar 2010 hat die Gemeinde auf den gesplitteten Gebührenmaßstab umgestellt, wobei die Abwassergebühr von 1,50 Euro je Kubikmeter Frischwasser in eine Schmutzwassergebühr von 1,25 Euro je Kubikmeter Frischwasser und 20 Cent je Quadratmeter abflussrelevanter Fläche und Jahr aufgesplittet wurde. Ab 2012 bezahlen die Eriskircher Bürger 1,52 Euro Abwassergebühr und 29 Cent Niederschlagsgebühr. „Der Grund für die Erhöhung liegt an den notwendigen Sanierungskosten des 30 Kilometer langen Leitungsnetzes …mehr:
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/eriskirch/Erhoehung-beim-Abwasser;art372472,5113179
(nach oben)
Bad Emstal: Bereit für das Abwasser
Neue Kläranlage eingeweiht
Riede. Die neue Kläranlage des Bad Emstaler Ortsteils Riede ist Freitagmittag offiziell eingeweiht worden. Nachdem verschiedene Optionen wie der Anschluss Riedes an das Bad Emstaler Zentralklärwerk verworfen worden waren, war die neue Kläranlage für den Ortsteil direkt an der Stelle der alten erbaut worden.
800 000 Euro habe der Neubau gekostet, von denen die Hälfte in den kommenden Wochen auf die angeschlossenen Bürger umgelegt würden, sagte Bürgermeister Ralf Pfeiffer in seiner Eröffnungsrede. Er betonte, dass die neue Anlage die Grenzwerte für Schadstoffe weit unterschreite und auch die für den Lärmschutz einhalte. In die Anlage fließen nur Haushaltsabwässer und Regenwasser.
Im Vorfeld hatte es bereits Beschwerden von Anwohnern wegen des Geräuschs der Sauerstoffpumpen gegeben. Sie haben sich inzwischen damit beholfen, dass sie Strohballen …mehr:
http://www.hna.de/nachrichten/kreis-kassel/wolfhagen/bereit-abwasser-1427761.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hna%2Fwolfhagen+%28HNA.de+-+News+aus+Wolfhagen%29
(nach oben)
Büdingen: Neues Becken für Büdinger Kläranlage
(red). In der Nacht wurde an der Kläranlage Büdingen die Bodenplatte für ein neues Klärbecken betoniert. Die Erweiterung der Kläranlage von einem auf zwei Klärbecken war nötig geworden, um die strenger gewordenen Grenzwerte für gereinigtes Abwasser auch zukünftig einhalten zu können.
„Eine so große Baustelle wird es in Büdingen so schnell nicht wieder geben“, hieß es bei den Stadtwerken. Das neue Becken aus Stahlbeton hat einen Durchmesser von 42 Meter und fasst etwa 4600 Kubikmeter Abwasser.
Die jetzt hergestellte Bodenplatte ist 75 Zentimeter dick. Zwischen …mehr:
http://www.kreis-anzeiger.de/lokales/wetteraukreis/buedingen/11160691.htm
(nach oben)
BEVERSTEDT: Abwassergebühren steigen
Um mehr als 100 Prozent sollten die Gebühren für das Abwasser von abflusslosen Sammelgruben in der Samtgemeinde Beverstedt erhöht werden. Bisher kostete der Kubikmeter 20,94 Euro. Nach der Kalkulation eines Fachbüros müssten die Gebühren auf 42,30 Euro angehoben werden. Damit zeigten …mehr:
http://www.nordsee-zeitung.de/region/cuxland/Beverstedt_artikel,-Abwassergebuehren-steigen-_arid,638343.html
(nach oben)
Bargfeld-Stegen/Bargteheide: Aus drei Klärwerken mach eins
Sie rücken enger zusammen, die Stadt Bargteheide und das Amt Bargteheide-Land. Eine Fusion ist es zwar nicht, was die Verwaltungschefs vorhaben. Aber eine Kooperation in drei wichtigen Bereichen: Kinderbetreuung, Verkehrsüberwachung und Abwasserentsorgung. Gemeinsam werden 40 Krippenplätze in Bargteheide geschaffen. Gemeinsam werden Falschparker ausgemacht, um die Sicherheit an kritischen Stellen wie Schulbuskehren zu erhöhen. Und gemeinsam wird das Abwasser mit der modernsten Anlage der Region geklärt. In diesem Fall ist der Schritt besonders groß.
Die beiden Klärwerke in Bargfeld-Stegen werden abgerissen. Die Gemeinde wird an die kürzlich ausgebaute und auf den neuesten Stand gebrachte Bargteheider Anlage angeschlossen – genauso wie das …mehr:
http://www.abendblatt.de/region/stormarn/article2030317/Aus-drei-Klaerwerken-mach-eins.html
(nach oben)
Titisee-Neustadt:Umsetzung des Mischwasserbehandlungskonzeptes im Kanalnetz der Stadt Titisee-Neustadt wird vom Land mit über 900.000 Euro bezuschusst
Das Regierungspräsidium bezuschusst die Umsetzung des Mischwasserbehandlungskonzeptes der Stadt Titisee-Neustadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit 940.300,00,- EUR. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 3,6 Mio. EUR. Der Fördersatz beträgt 30,3 %. Ein entsprechender Förderbescheid ging der Stadt jetzt zu. Die Stadt kann das Kanalnetz jetzt so ertüchtigen, dass deutlich weniger Mischwasser, etwa nach einem Starkregen, zur Entlastung in die Gutach eingeleitet werden muss.
Mit der Umsetzung des Mischwasserbehandlungskonzeptes sind neben dem Neubau des Regenüberlaufbeckens (RÜB) „Untere Höll“ (550 m3) einschl. Zu- und Abflussleitungen zahlreiche weitere Einzelmaßnahmen verbunden:
• Neubau eines Dükerbauwerks
• Neubau (Aufdimensionierung) des Zuleitungshauptsammler zum RÜB „Untere Höll“ auf einer Länge von 360 m
• Ausrüstung der RÜB „Hausmatte“ und „Kläranlage“ mit Siebanlagen
• Austausch einer Kanalhaltung beim RÜB „Bieberwies“
• Neubau Entlastungsleitung Sandfang
• Austausch der Fernwirktechnik in den Außenwerken zur dynamischen Steuerung der Regenbecken
Zeitweise ist das Kanalsystem der Stadt hydraulisch überlastet: Mischwasser, welches das Kanalsystem nicht aufnehmen kann, wird nach abwassertechnischen Gesichtspunkten unter unzulässigen Bedingungen in die Gutach eingeleitet. Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs zur Optimierung der Mischwasserbehandlung hat die Stadt daher drei Varianten untersucht und sich schließlich für ein Konzept der Netzbewirtschaftung über dynamische Drosseleinrichtungen und Aktivierung des Regenbeckenvolumens auf der Kläranlage entschieden. Das bedeutet, dass ein Großteil des Mischwassers direkt zur Kläranlage und dem dort bereits vorhandenen RÜB „Kläranlage“ zugeleitet wird. Dazu muss jetzt noch ein weiteres RÜB gebaut, sowie ein Zulaufkanal erweitert und die vorhandenen Regenbecken mit neuer Steuertechnik versehen werden. Durch dieses intelligente Konzept kann auf den Neubau von 2 Regenüberlaufbecken sowie auf die Erweiterung eines RÜB verzichtet werden. Die Stadt spart daher zukünftig Personal- und Unterhaltskosten. Die Investitionskosten konnten dem entsprechend im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 1,2 Mio. EUR gesenkt werden.
Insgesamt ergibt sich nach Verwirklichung des Konzeptes eine wesentliche Reduzierung der Entlastungsmenge – die Wahrscheinlichkeit, dass etwa nach Starkregen ungeklärtes Mischwasser in die Gutach eingeleitet werden muss, um ein Überlaufen der Kanäle zu verhindern, sinkt daher stark. Die Zulässigkeit des Konzepts wurde mit Hilfe einer Schmutzfrachtsimulation nachgewiesen.
Auch Umweltminister Franz Untersteller steht hinter dem Förderbescheid des Regierungspräsidiums Freiburg: „Mit der bezuschussten Lösung hat die Stadt Titisee-Neustadt ein sowohl wasserwirtschaftlich als auch ökonomisch sinnvolles Konzept zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ausgewählt. Ich bin dankbar, dass die Stadt durch ihre kluge Planung letztendlich auch den Zuschussbedarf senken konnte“.
(nach oben)
AV Saale-Lauer Gutachten: Die Kläranlagen müssen Energie sparen
HOHENROTH – (che) Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise und der Diskussion um den Klimawandel sind die Kläranlage als Großverbraucher angehalten, Energie zu sparen. Um dies tun zu können, braucht es zuerst eine Energieanalyse. Mit ihr beschäftigten sich der Abwasserverband Saale-Lauer.
(che) Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise und der Diskussion um den Klimawandel sind die Kläranlage als Großverbraucher angehalten, Energie zu sparen. Um dies tun zu können, braucht es zuerst eine Energieanalyse. Mit ihr beschäftigten sich der Abwasserverband Saale-Lauer.
Referent Professor Gerald Steinmann von der Firma GS-Wasser und Umwelt aus Treuchtlingen erläuterte den Verbandsräten die Funktion der Kläranlage und erläuterte anschaulich die verschiedenen Abläufe innerhalb dieser Anlage.
So war es auch verständlich, dass Verbandsvorsitzender Bernhard Müller sich nach Steinmanns Ausführungen mit dem Worten bedankte: „Vielen Dank, Professor Steinmann. Jetzt kann hier jeder seine eigene Kläranlage bauen.“
Steinmann stellte seine Energieanalyse vor, zu der er im Oktober 2010 vom Gremium beauftragt worden war. Die Energie auf einer Kläranlage zeigt sich in verschiedenen Formen, wie Schmutzstoffe (gebundene Form) und Abwasser (Wärme), Zudem fährt die Biologie ….mehr:
http://mobil.mainpost.de/regional/art765,6259950
(nach oben)
Obere Spree: Rettung des Abwasserverbandes im Oberland droht zu scheitern
Acht Bürgermeister wenden sich mit einem Offenen Brief an die Stadt- und Gemeinderäte von Wilthen und Beiersdorf (Landkreis Görlitz). Sie appellieren an die gemeinsame Verantwortung für die Region und bitten, eine Entscheidung zum Abwasserzweckverband Obere Spree zu überdenken.
Was treibt Bürgermeister zu diesem Schritt?
Das Rettungspaket für den finanziell angeschlagenen Verband (AZV) droht zu platzen, weil zwei Mitglieder ihren Beitrag zur Entschuldung verweigern. Der AZV muss ein 14-Millionen-Euro-Minus ausgleichen. Nach langen Verhandlungen steht das Sanierungskonzept: Sachsen steuert 3,5Millionen Euro als zinsloses Darlehen bei. Die Landkreise Bautzen und Görlitz geben insgesamt 500000Euro. Auch die Orte müssen ihren Beitrag leisten; zum Beispiel, indem sie der Gesellschaft Awos, die für den AZV die Abwasserentsorgung erledigt, für frühere Jahre Gewerbesteuer erlassen. Cunewalde, Crostau, Schirgiswalde, Neusalza-Spremberg, Kirschau, Großpostwitz, Oppach und Sohland haben das beschlossen – Wilthen und Beiersdorf nicht.
Welche Folgen hat es, dass zwei Orte nicht mitziehen?
Das gesamte Sanierungskonzept droht zu scheitern. Denn Freistaat …mehr:
http://www.sz-online.de/nachrichten/mobil.asp?action=ShowArticle&nar_id=2634791&kdhash=hier%20die%20Online-Ausgabe
(nach oben)
Neuenburg: Sickerwasserreinigungsanlage der Deponie Neuenburg in Betrieb:
Betreibermodell zwischen der Abfallwirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald (ALB) und HAASE Energietechnik
Das Sickerwasser aus der Deponie Neuenburg wird für die nächsten 10 Jahre im Rahmen eines Betreibermodells entsorgt. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung entschied sich die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ALB) für die HAASE Energietechnik AG & Co. KG als Partner für die Errichtung und den langfristigen Betrieb der Anlage.
Mittels einer einstufigen Nanofiltration (Durchsatz max. 50 m³ pro Tag) wird das belastete Wasser behandelt. Das Permeat fließt in die örtliche Kläranlage, das Konzentrat wird entsorgt. Die Container-Membrananlage wurde Ende Juli 2011 abgenommen und läuft seitdem einwandfrei, unter Einhaltung der Emissionsgrenzwerte für die Indirekteinleitung. Die Leistung wird abgerechnet nach Kubikmetern Rohsickerwasser im Zulauf. Auf diese Weise werden pro Jahr rund 4.000 bis 6.000 m³ Sickerwasser einer Vorreinigung zugeführt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 200.000 Euro/Jahr.
Die Vergabe der Sickerwasser-Behandlung als externe Dienstleistung ist für die ALB die wirtschaftlichste und flexibelste Lösung, da die Deponie Neuenburg bereits seit 1997 geschlossen ist und somit Betriebspersonal nur noch sehr eingeschränkt vor Ort ist. Die HAASE Energietechnik ist auf zahlreichen Deponien im ganzen Bundesgebiet engagiert und verfügt über einen Pool mobiler Membrananlagen, die bedarfsgerecht zum Einsatz kommen. Zusätzlich kann das Betriebspersonal auf diese Weise besser eingesetzt werden, da es parallel mehrere Anlagen in Süddeutschland betreut.
Nach Vertragsende besteht für die ALB sowohl die Möglichkeit, die Anlage durch HAASE Energietechnik wieder demontieren zu lassen, als auch, sie selbst zu übernehmen.
Den »Grünstrom« für den Betrieb der Membrananlage Neuenburg liefert die Clean Energy Sourcing GmbH, Leipzig – Partner von HAASE Energietechnik im Rahmen der Vermarktung von Strom aus regenerativen Energieträgern.
Rückfragen zu HAASE Sickerwasserbehandlung:
Christian Blumenthal
christian.blumenthal@haase.de
Der direkte Link zu HAASE Sickerwasserbehandlung:
http://www.haase-energietechnik.de/de/Products_and_Services/Water_Treatment/
(nach oben)
WABAG Schweiz: Neues Wirbelbett und Filtration für die Kläranlage Männedorf
Ausbau mit Einsatz der innovativen WABAG-Technologien FLUOPUR® und Zweischichtfiltration.
WABAG Wassertechnik AG hat im Sommer 2011 den Auftrag für die Erneuerung und den Ausbau der überlasteten biologischen Stufe sowie für den Ersatz der bestehenden Sandfiltration der Kläranlage Männedorf erhalten. Das Unternehmen hat mit dem Einsatz von Eigentechnologien den Kunden überzeugt: Das Wirbelbettsystem FLUOPUR® als Hybridbiologie wird künftig in 4 Linien die biologische Reinigung sicherstellen und die bestehende Abwasserfiltration wird in eine WABAG-Zweischicht-Filtration innerhalb der bestehenden Bausubstanz und mit doppelter Filteranzahl umgebaut. Damit wird nicht nur die erforderliche Kapazitätserweiterung der Anlage auf 18’000 EW sichergestellt, sondern ist auch ein wesentlich flexiblerer und sicherer Betrieb gewährleistet.
Wirbelbettverfahren FLUOPUR® als Hybrid-System
Für den Ausbau der biologischen Reinigungsstufe hat WABAG das FLUOPUR®-Verfahren in Kombination mit Belebtschlamm als so genannte Hybridbiologie gewählt. Mit dem Einsatz des speziellen FLUOPUR®-Trägermaterials wird ein kostengünstiger Ausbau der bestehenden Anlage in den bestehenden Becken erzielt. Zudem bietet das Verfahren eine einfache Phosphor-Elimination durch Simultanfällung im Rücklaufschlamm. Darüber hinaus wird die bisher 2-straßige Anlage in Bereichen mit Wirbelbettmaterial zu einer 4-straßigen Anlage umgebaut, womit hohe Flexibilität und Sicherheit bei der Betriebsführung sichergestellt werden.
Abwasserfiltration mit WABAG-Zweischichtfilter
Die bestehenden Dynasandfilter werden von WABAG in eine Zweischicht-Filtration umgebaut. Der Umbau findet innerhalb der bestehenden, wabenförmigen Bausubstanz statt und erfordert damit spezielle Lösungsansätze für eine möglichst sanfte Renovation. Mit der Erhöhung der Filteranzahl von drei auf sechs wird auch in dieser Stufe die Betriebsflexibilität und -sicherheit deutlich erhöht.
Der Ausbau der Anlage startet im Herbst dieses Jahres und wird aufgrund der erforderlichen Realisierung in Etappen und gesetzlicher Auflagen bezüglich der Bauphasen bis 2013 abgeschlossen werden.
Es ist nicht der erste Auftrag für WABAG Wassertechnik in Männedorf: Schon 2005 hat das Unternehmen für das neue Seewasserwerk modernste Prozesstechnologie implementiert: Die Membranfiltrationsanlage mit innovativem Rückspülwasserrecycling produziert Trinkwasser in bester Qualität und repräsentiert eine der modernsten Anlagen ihrer Art in der Schweiz.
(nach oben)
Auch die Stadt Klosterneuburg setzt auf den WABAG-Hybrid Prozess
Die Stadt Klosterneuburg erweiterte ihre Kläranlage mit dem innovativen Verfahren für eine moderne vollbiologische Abwasserbehandlung
Die um- und ausgebaute Kläranlage in Klosterneuburg wurde am 14.9.2011 feierlich eröffnet. Die Anlage mit einer Kapazität von 55.000 EW erhielt eine vollbiologische Reinigungsstufe nach dem patentierten zweistufigen Hybrid-Verfahren, das von VA TECH WABAG gemeinsam mit Herrn Univ. Prof. DI Dr. N. Matsché entwickelt worden ist. Dieser innovative Prozess zeichnet sich vor allem durch
einen geringen Bedarf an Beckenvolumen und damit Platzbedarf,
verminderten Energiebedarf für die Belüftung,
erhöhten Gasanfall bei der anaeroben Schlammfaulung,
niedrigem Schlammindex auch bei ungünstiger Abwasserzusammensetzung,
eine hohe Stickstoffelimination und große Flexibilität
aus und eignet sich besonders für den Ausbau hinsichtlich Kapazität und Reinigungsleistung bestehender Kläranlagen, indem bestehende Anlagenteile kostengünstig integriert werden können. Die zweistufige Verfahrensweise ergibt auch bei Stoßbelastungen durch gewerbliche und industrielle Abwässer eine hohe Qualität des gereinigten Abwassers. In Klosterneuburg werden die gereinigten Abwässer in beinahe Badewasserqualität in die Donau eingeleitet.
Die Kläranlage Klosterneuburg ist bereits die 11. Anlage in Österreich, die sich die Vorteile des Hybrid-Verfahrens gesichert hat. Der größte Anwendungsfall ist dabei sicherlich die Hauptkläranlage in Wien. Mit dem Einsatz des zweistufigen Hybridverfahrens können Stoßbelastungen optimal ausgeglichen und ein stabiler Betrieb gewährleistet werden. VA TECH WABAG hat für die ausgebaute Großkläranlage, die 2005 den Betrieb aufgenommen hat, die Planung für die Erweiterung auf 4 Millionen EW nach dem Hybrid-Prozess ausgearbeitet und die in ihren Dimensionen beeindruckenden 15 Stk. Nachklärbecken geliefert.
(nach oben)
Kleines Wiesental: erhält über 2 Mio. Euro Landeszuschuss für Verbesserung der Abwasserentsorgung
Regierungsvizepräsident Klemens Ficht übergibt heute Förderbescheide
Regierungsvizepräsident Klemens Ficht hat heute Bürgermeister Gerd Schönbett von der Gemeinde Kleines Wiesental zwei Förderbescheide übergeben. Sie haben zum Inhalt, dass das Land sich bereit erklärt, bedeutende abwassertechnische Vorhaben in den Ortsteilen Demberg und Wies mit insgesamt rd. 2,03 Mio. EUR zu bezuschussen.
Für den Bau der Ortskanalisation und des Ableitungskanals für den Ortsteil Demberg gewährt das Land 909.400,- EUR . Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1,2 Mio. EUR. Der Fördersatz beträgt 80 %. Der Ortsteil Demberg mit ca. 100 Einwohnern verfügt bisher über keine geordnete Abwasserbeseitigung. Das Schmutzwasser wird derzeit in Kleinkläranlagen lediglich mechanisch und damit unzureichend behandelt. Die Zuwendung ermöglicht nun den Bau der ca. 1,5 km langen Ortskanalisation und des ca. 500 m langen Ableitungskanals. Das Abwasser wird dann über einen neuen Ableitungssammler vom Ortsteil Wies zur Verbandskläranlage Steinen des AV Mittleres Wiesental abgeleitet.
Dieser neue, ca. 3,4 km lange Ableitungssammler wird rd. 1,4 Mio. EUR kosten; das Regierungspräsidium hat dafür ebenfalls 80 % Zuschuss, das entspricht rd. 1,12 Mio. EUR, bewilligt. Die Gemeinde Kleines Wiesental wird dadurch in die Lage versetzt, die Kläranlage für den Ortsteil Wies stillzulegen und statt dessen das anfallende Abwasser der zentralen Kläranlage Steinen des Abwasserzweckverbandes Mittleres Wiesental zuzuführen. Diese Lösung ist lt. einem Gutachten wirtschaftlicher als die Sanierung der Kläranlage in Wies, die sich in einem desolaten Zustand befindet und daher grundlegend ertüchtigt und erneuert werden müsste.
Regierungsvizepräsident Klemens Ficht betonte bei der Übergabe des Förderbescheides, dass die Ersterschließung von Ortsteilen und Weilern im ländlichen Raum hohe Priorität habe und daher ein landespolitischer Förderschwerpunkt ersten Ranges sei. „Nicht nur das Kleine Wiesental, sondern Kommunen im ländlichen Raum generell haben für die Abwasserentsorgung aufgrund der oft flächenhaften Ausdehnung auf mehrere Teilorte und Wohnplätze wesentlich höhere Aufwendungen als Kommunen in Ballungsgebieten. Deshalb geht ein Großteil der Fördermittel in diese Gebiete. Durch dieses große Abwasserprojekt werden abwassertechnische Missstände beseitigt und eine zukunftssichere Abwasserentsorgung ermöglicht.“ Umweltminister Franz Untersteller habe erst unlängst aus Anlass anderer Förderprojekte darauf hingewiesen, dass die verhältnismäßig wenigen verbliebenen Kleinkläranlagen im Land die Flüsse und Bäche, in die sie das unzureichend geklärte Abwasser einleiten, etwa im gleichen Maße verschmutzen als alle modernen zentralen Kläranlagen zusammen – hier seien daher auch weiterhin sowohl schrittweise Verbesserungen als auch staatliche Förderung gefragt.
(nach oben)
Baltmannsweiler: Hund aus Kläranlage gerettet
Eine Passantin ist am Sonntagnachmittag auf einen in der Kläranlage in Baltmannsweiler schwimmenden Jagdhund aufmerksam geworden. Das laut heulende Tier saß dort in einem Becken mit Klärschlamm fest.
Laut Polizei konnten die herbeigerufenen Beamten mit dem zuständigen Bauhofleiter die Anlage betreten und das Tier, das sich aus eigener Kraft an den inneren Beckenrand gerettet hatte, …mehr:
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.blaulicht-vom-5-september-hund-aus-klaeranlage-gerettet.f69b481b-bf4a-41af-ad72-26129e892855.html
(nach oben)
Balingen: Kommunen verwerten ihren Klärschlamm
Der Klärschlamm soll in Zukunft besser verwertet werden – und zwar interkommunal. Der Zweckverband Abwasserreinigung Balingen weiht am Samstag, 24. September, von 10 bis 16 Uhr im Rahmen eines Tags der offenen Tür die neu gebaute Klärschlammverwertungsanlage offiziell ein. In Zukunft soll dort der Klärschlamm der Kläranlagen Balingen, Hechingen, Bisingen, Geislingen, Rosenfeld sowie Oberes Schlichemtal in interkommunaler Zusammenarbeit gemeinsam verwertet werden.
Für das gemeinsame Projekt wurde die Kapazität der Schlammtrocknung und der Klärschlammvergasung der Balinger Kläranlage erweitert. Mit einem Investitionsaufwand von 3,3 Millionen Euro wurde eine neue Trocknungsanlage errichtet und die bestehende Klärschlamm-Vergasungsanlage, die seit 2002 als Pilotanlage in Betrieb war, erweitert. Das Projekt wurde vom Land Baden-Württemberg mit 716 000 Euro gefördert.
Insgesamt werden in der Balinger Kläranlage jährlich 6700 Tonnen Pressschlamm…mehr:
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.balingen-kommunen-verwerten-ihren-klaerschlamm.9278c6dd-1db7-4f18-b401-dbb22a636820.html
(nach oben)
WABAG Schweiz realisiert den Ausbau der ARA Andermatt in den Schweizer Alpen
Die Kläranlage wird mit drei innovativen WABAG-Technologien erweitert: eine neue WABAG-Feinsiebung, FLUOPUR® und WABAG-Filtration kommen zum Einsatz.
Der Bau des Tourismusresorts Andermatt Swiss Alps, der geplante Ausbau der Skiinfrastruktur sowie die rege Bautätigkeit im angrenzenden Urserental führen spätestens 2015 zu fehlenden Kapazitäten auf der bestehenden Abwasserreinigungsanlage in Andermatt. Abwasser Uri – die zuständige Organisation für die Abwasserreinigung im Kanton – hat daher die Erweiterung der Anlage als Komplettpaket ausgeschrieben und das Konzept der WABAG Wassertechnik AG, Winterthur als beste und wirtschaftlichste Lösung gewählt. Am 9. September wurde der Vertrag mit einer Investitionssumme von knapp 8 Millionen Euro unter-schrieben. Der unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen komplexe Ausbau wird bis Ende 2013 fertig gestellt.
Ein innovatives Konzept für ein komplexes Vorhaben
Die Rahmenbedingungen für den Ausbau der ARA Andermatt sind anspruchsvoll: beschränkte Platzverhältnisse kombiniert mit einem Anbau an das bestehende Gebäude, eine erforderliche Einhausung der Anlage aufgrund der klimatischen Bedingungen auf 1.400 m Höhe und zur Vermeidung von Lärm- und Geruchsemissionen, saisonale Belastungsschwankungen aufgrund des Tourismus und sehr strenge Einleitbedingungen. Die Anforderungen an die Verfahrenstechnik resultierten damit in einer größtmöglichen Flexibilität, kompakten Bauweise und hoher Reinigungsleistung.
WABAG entwickelte für diese Aufgabenstellung ein innovatives und äußerst kompaktes Konzept und setzte dabei auf drei Eigen-Technologien.
Als Vorreinigung kommt die neueste Entwicklung der WABAG, zum Einsatz: Ein innovativer Feinsiebungsprozess, wo Grobstoffe nahezu vollständig aus dem Abwasser entfernt werden und damit die nachfolgende biologische Reinigungsstufe entlastet und gleichzeitig das benötigte Biologievolumen reduziert wird.
Für die biologische Stufe haben die WABAG-Experten das flexible FLUOPUR®-Wirbelbettverfahren gewählt, welches den saisonalen Schwankungen am besten entgegenkommt und sich zusätzlich noch durch einen geringen Energieverbrauch und damit erheblich reduzierten Betriebskosten auszeichnet. Abschließend wird das Abwasser in einer WABAG-Raumfiltration als dritte Stufe behandelt, um die Einhaltung der gesetzlichen Einleitbedingungen für das gereinigte Abwasser in den Fluss Reuss sicher zu gewährleisten.
Eine schlüsselfertige Anlage
Der Kunde Abwasser Uri erhält von WABAG eine schlüsselfertige Anlage nach dem letzten Stand der Technik. Die Arbeiten starten im Frühjahr 2012. Die erweiterte Abwasserbehandlungsanlage mit einer zusätzlichen Kapazität von 6.000-8.000 EW wird Ende 2013 betriebsbereit sein.
Spezialist für schwierige Aufgaben
Ein weiteres aktuelles Beispiel auf dem Gebiet der Abwasserbehandlung mit besonderen Herausforderungen ist der Auftrag für den Ausbau der Kläranlage Zermatt am Fuß des Matterhorns. Auch hier konnte WABAG Winterthur den Kunden mit Einsatz anspruchsvoller Technologien unter schwierigen Bedingungen überzeugen. Eine moderne Membranbioreaktor-Anlage wird innerhalb einer Kaverne realisiert und die umweltgerechte Entsorgung sämtlicher Abwässer des beliebten Tourismusgebiets sicherstellen.
Technologieführer in der Schweiz
WABAG Wassertechnik AG hat mit dem Auftrag Andermatt erneut seine Technologieführerschaft in der Schweiz unter Beweis gestellt. Als fortschrittliches Unternehmen entwickelt WABAG kontinuierlich innovative Lösungen zum Nutzen seiner Kunden und hat auf dieser Basis eine Vielzahl maßgeschneiderter Projekte umgesetzt. Die laufenden Investitionen in neue Technologien machen sich bezahlt: für die Kunden, unsere Umwelt und für ein starkes Vertrauen in die Marke WABAG.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
WABAG Wassertechnik AG
Martin Baggenstos
Abwasserreinigung
Bürglistrasse 31
8401 Winterthur
Schweiz
Tel: +41 52 262 43 43
water@wabag.net
(nach oben)
Wörth: Die Sanierung wird durch Gebühren bezahlt
Die Wörther und Wiesenter zahlen die Kosten der Modernisierung durch einen höheren Preis für das Abwasser.
Die geplante Sanierung der Wörther Kläranlage kommt in ihre „heiße Phase“. Denn die Ausschreibung für die auf 1,28 Millionen Euro veranschlagten Maßnahmen läuft jetzt. „Bis zum 25. August wollen wir alle Angebote auf dem Tisch haben“, sagt Siegfried Stadler, Bauamtsleiter der Stadt Wörth. Auf alle Fälle soll dann heuer noch eine Schlamm-Presse angeschafft werden, ein Schlammstapelbehälter soll folgen, ehe dann in einem der Becken die Wasserhöhe nach oben verändert wird. Weil das Regenbecken frei wird, kann dieses dann für den Schlamm genutzt werden. Finanziert wird die Erneuerung durch die Gebühren, die bislang bei 1,53 Euro pro Kubikmeter lagen.
Die Modernisierung der Kläranlage ist seit langem schon ein Thema. Die Anlage, die nahe…mehr:
http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=10070&pk=692950&p=1.
(nach oben)
WAGENITZ: Abwasser besser dosiert
Zweckverband lässt Kläranlage in Wagenitz bis Ende November umfassend modernisieren
Ein seltener Anblick bietet sich derzeit im Klärwerk in Wagenitz. Das Belebungsbecken, in das sonst die Fäkalien unter anderem aus Friesack eingeleitet werden, ist völlig leer. Stattdessen kämpfen die Bakterien übergangsweise nebenan – im eigentlichen Schlammpolder – gegen das frische Abwasser.
Für rund 770 000 Euro lässt der Abwasserzweckverband „Havelländisches Luch“ momentan die Kläranlage am Rande von Wagenitz sanieren und modernisieren. Ende November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Aber schon für Ende September ist geplant, das Belebungsbecken samt einer neuen Steuerungsanlage wieder in Betrieb zu nehmen. Das sagte Olaf Müller, der als Technischer Leiter bei den Osthavelländischen Trink- und Abwasser GmbH (Owa) tätig ist. Die Owa ist Betriebsführer des Zweckverbandes.
Ein weiteres Bauwerk wird künftig hinzu kommen, nämlich ein so genannter Vorspeicher. Mit seinen 350 Kubikmeter Fassungsvermögen…mehr:
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12161537/61759/Zweckverband-laesst-Klaeranlage-in-Wagenitz-bis-Ende-November.html
(nach oben)
Suhl-Dietzhausen: Neues BHKW nutzt Faulgase der modernsten Kläranlage Südthüringens
In Suhl-Dietzhausen wurde jetzt die modernste Kläranlage Südthüringens in Betrieb genommen. Der Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ (ZWAS) nutzt eine neue Phosphorfiltrationsanlage und ein Blockheizkraftwerk, das die Faulgase der Kläranlage verbrennt und so 30 Prozent des gesamten Strombedarfs der Suhler Kläranlage deckt. An die Kläranlage sind die Stadt Suhl sowie deren Ortsteile Neuendorf, Albrechts, Goldlauter, Heidersbach, Mäbendorf, Dietzhausen, Wichtshausen und die Gewerbegebiete „Zella-Mehlis Ost und West“ angeschlossen.
Die Fertigstellung der Kläranlage in Suhl ist auch ein weiterer Baustein zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Danach soll bis 2015 mit Ausnutzung aller Verlängerungsoptionen spätestens bis 2027 ein guter Zustand aller Gewässer im Freistaat erreicht werden. Seit 1990 wurden im Freistaat Thüringen rund 4,5 Milliarden Euro in die Abwasserentsorgung investiert. Hierzu hat der Freistaat den Zweckverbänden und Kommunen Fördermittel in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
Dem Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ gehören die Städte Suhl, Oberhof, Zella-Mehlis, Schleusingen sowie 7 Gemeinden mit 19 Ortslagen und Stadtteilen an, deren Abwässer über ein Kanalnetz von rund 376 Kilometer Länge entsorgt werden. Der Zweckverband entsorgt zurzeit das Abwasser der Städte in 4 Kläranlagen von rund 50.834 Einwohnern sowie von ortsansässigen Gewerbe- und Industriebetrieben mit 34.327 Einwohnergleichwerte. Rund 95% der Einwohner Suhls sind an die öffentliche Kanalisation angeschlossen, wobei 86% einen Anschluss an die zentrale Kläranlage haben. Diese Werte liegen jeweils über dem landesweiten Durchschnitt Thüringens.
Quelle: Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz
(nach oben)
Schwerin: Biofilter gegen üble Gerüche
Den störenden Gerüchen auf der Spur: Die Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) hat gestern die Biofilter-Masse an der Kläranlage in Süd gewechselt, um künftig Geruchsbelästigungen noch besser ausschließen zu können. In den vergangenen Monaten hatten sich Wüstmarker, Krebsfördener und Neu Pampower vermehrt über üblen Geruch in ihrem Wohngebiet beschwert. Untersuchungen des zuständigen Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) hatten bis auf einen Havariefall an der Biogas-Anlage der Stadtwerke aber keinen konkreten Verursacher feststellen können (SVZ berichtete). Für die Anwohner ist indes klar: Es kann nur die Biogas-Anlage oder die Kläranlage für den Gestank …mehr:
http://www.svz.de/artikel/article//biofilter-gegen-ueble-gerueche.html
(nach oben)
MÜHLACKER-LOMERSHEIM: Millionenschwerer Ausbau der Kläranlage
Die Kläranlage im Mühlacker Stadtteil Lomersheim wird umfassend modernisiert. Das umfangreiche Projekt wird insgesamt knapp über sechs Millionen Euro verschlingen. Der Spatenstich zur ersten Erweiterungsmaßnahme findet am 23. September um 14 Uhr auf der Kläranlage statt.
Beteiligt an dieser Zukunftsinvestition sind neben Mühlacker die Gemeinden Ötisheim, Ölbronn-Dürrn, Kieselbronn und die Stadt Maulbronn. Auch das Land Baden-Württemberg unterstützt die Modernisierung und den Ausbau …mehr:
http://www.muehlacker-news.de/muehlacker_artikel,-Millionenschwerer-Ausbau-der-Lomersheimer-Klaeranlage-_arid,209761.html
(nach oben)
Hinterzarten und Breitnau: arbeiten künftig in der Kläranlage zusammen
Das Abwasser vereint die Gemeinden
HINTERZARTEN/BREITNAU. Mit der Unterzeichnung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung schufen die Nachbargemeinden Hinterzarten und Breitnau die Grundlage zur Umsetzung einer gemeinsamen Abwasserkonzeption. Breitnau wird die Klärwerke Oberhöllsteig und Ödenbach aufgeben. Hinterzarten verpflichtet sich, das Schmutz- und Fremdwasser in der Kläranlage „Rappeneck“ aufzunehmen. Dazu sind allerdings einige bauliche Maßnahmen nötig.
Die von Rechtsanwalt Dirk Schöneweiß, Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Freiburg, ausgearbeitete Vereinbarung regelt in 18 Paragraphen nahezu jedes Detail. Der Anschlusswert von Breitnau beläuft sich auf 2200 Einwohnergleichwerte. Breitnau muss ein Pumpwerk und eine Durchflussmessung betreiben. Die Kommune leitet das Abwasser in den Hauptsammler von Hinterzarten ein. Sie beteiligt sich an den Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des gemeinsam genutzten Teilstücks des Hauptsammlers sowie des Klärwerks von Hinterzarten. Breitnau trägt…mehr:
http://www.badische-zeitung.de/hinterzarten/das-abwasser-vereint-die-gemeinden–48430170.html
(nach oben)
Hilden: Klärwerk wird modernisiert
Der Bergisch-Rheinische Wasserverband investiert bis 2014 fast sechs Millionen Euro in die Technik in der 54 Jahre alten Hildener Kläranlage. Der Starkregen der vergangenen Tage beeinträchtigt nicht die Leistung.
Bis Juli 1957 war die Itter ein in allen Regenbogenfarben schillernder Abwasserbach, der auch dementsprechend roch. Dann ging die erste Ausbaustufe des Klärwerks Hilden in Betrieb. Die Anlage wurde Anfang der 60er-Jahre erweitert und von 1981 bis 1984 für 35 Millionen Mark zur ersten vollbiologischen Kläranlage des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes ausgebaut.
Die mittlerweile 54 Jahre alte Konstruktion funktioniert bis heute, erläutert Markus Koch, Leiter des Abwasser-Fachbereichs beim…mehr:
http://www.rp-online.de/region-duesseldorf/hilden/nachrichten/klaerwerk-wird-modernisiert-1.1355529
(nach oben)
Eisenach-Erbstromtal: Der Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal will künftig mit den Stadtwerken Erfurt und den Eichsfeldwerken zusammenarbeiten
Beide Geschäftsführer, die gestern ihre zu 100 Prozent kommunalen Unternehmen im Verbandsausschuss vorstellten, erklärten, bei der Erarbeitung eines Konsolidierungskonzepts zur Verfügung zu stehen. Auch Mitarbeiter ihrer jeweiligen Fachabteilungen könnten zu Rate gezogen werden.
Eisenach. „Wir bieten außerdem an, einen unserer Manager vor Ort einzusetzen“, so Peter Zaiß, Geschäftsführer der Stadtwerke Erfurt. Es ist Diplom-Ingenieur Peter Kahlenberg (48), der bereits für den Verband „Mittleres Nessetal“ tätig ist. Hörselberg- Hainichs Bürgermeister Bernhard Bischof (pl) kennt Peter Kahlenberg aus dieser Zusammenarbeit einige Ortsteile seiner Gemeinde gehören zu dem Verbund. Bischof verwies darauf, dass es dort gelungen ist, die Verschuldung zu stoppen. Auch sei die Kläranlage in Friedrichswerth kostengünstiger gebaut worden als die in Behringen. „Wir können keine Wunder erwarten, die Schulden sind da, aber was uns helfen wird, ist die Kompetenz“, …mehr:
http://eisenach.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/politik/detail/-/specific/Oberbuergermeister-Matthias-Doht-SPD-mit-weiteren-Gespraechen-beauftragt-509633532
(nach oben)
Dörsbachtal: Kläranlage wird ausgebaut
Die Kläranlage Dörsbachtal erreicht ihre Belastungsgrenze. Die Anlage wurde 1995 gebaut und war ursprünglich für 7000 „Einwohnerwerte“ – das Mittel aus Einwohnern und Betrieben – geplant. Mittlerweile verarbeitet sie Abwasser von 9000 Einwohnerwerten, deshalb soll sie ausgebaut werden.
Über das Vorhaben, das rund 900 000 Euro kosten wird, berichteten nun Norbert Schumacher, Geschäftsführer der Ingenieurgesellschaft, die mit der Planung befasst war, der Landtagsabgeordnete Frank Puchtler, der Abwassermeister der Kläranlage, Mark Christ, Rainer Heuser von den Verbandsgemeindewerken und Bürgermeister Harald Gemmer. Die Kläranlage soll für die Zukunft gerüstet werden, damit die steigenden Anforderungen bei der Beseitigung des Klärschlamms erfüllt werden. Die Zahl der Anschlüsse ist unter anderem dadurch gestiegen, dass die Gemeinden Kördorf und Berndroth sowie ein Galvanikbetrieb angeschlossen wurden. Norbert Schumacher erläuterte die bisherige Arbeitsweise der Kläranlage im Jammertal bei Ergeshausen. Vom Regenüberlaufbecken über die biologische Stufe und ein Nachklärbecken gelangt das geklärte Wasser in den Dörsbach. Bis zu diesem Punkt ist viel Klärschlamm aus dem Abwasser herausgefiltert worden, der entsorgt werden muss.
Es gibt eine Klärschlammvererdungsanlage bei der Kläranlage. Ihre Fläche ist durch die Tallage begrenzt,…mehr:
http://www.rhein-zeitung.de/regionales/diez_artikel,-Klaeranlage-im-Doersbachtal-wird-ausgebaut-_arid,297563.html
(nach oben)
Aurich: heizt mit kalter Wärme
Preis für Projekt
Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und die Deutsche Bank zeichnen das Projekt „Kalte Fernwärme“ der ostfriesischen Stadt Aurich und der Molkerei Rücker aus. Dabei werde 30 Grad warmes Abwasser der Molkerei zum Heizen einer großen Veranstaltungshalle genutzt, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Täglich würden bis zu eine Million Liter Abwasser über einen Wärmetauscher zur umweltschonenden Erzeugung von Heizenergie eingesetzt. Das Pilotprojekt wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. Es ist einer der Preisträger …mehr:
http://213.71.18.104/wissen/nachrichten/wissenaurichkaltewaerme100.html
(nach oben)
Sasbachwalden: Schnelles Internet durch Glasfaser im Abwasser
Das Internet sucht sich im Schwarzwald-Kurort Sasbachwalden (Ortenaukreis) seinen Weg durchs Abwasser. Erstmals in Baden-Württemberg wurden dort Glasfaserkabel im Abwasserkanal verlegt. Damit werde ein schnelles Internet ermöglicht, sagte Agrarminister Alexander Bonde (Grüne) am Mittwoch.
Die neue Variante sei kostengünstiger und effektiver als andere Lösungen. Nun werde überprüft, ob die Schwarzwald-Gemeinde Vorbild für andere Kommunen im Land sein könne.
„Eine leistungsfähige, flächendeckende Anbindung an schnelles Internet ist für Baden-Württemberg als Wohn- und Wirtschaftsstandort unverzichtbar“, sagte Bonde. Das gelte auch für den ländlichen Raum. Nötig sei ein Ausbau der Netze, Sasbachwalden nehme dabei eine Vorreiterrolle ein. „Hier werden neuartige technische Verfahren in der Praxis erprobt.“ Bislang waren Abwasserkanäle im Land nicht für Internetleitungen genutzt worden. Es waren hierfür vor allem rechtliche Gründe genannt worden.
„Starke Internetverbindungen sind ein klarer Standortvorteil. Auch …mehr:
http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=8414160/qbs4up/index.html
(nach oben)
Lippstadt: Pilotprojekt Klärschlamm dient dem Klimaschutz
Die Stadtentwässerung Lippstadt hat grünes Licht für den Bau einer energetischen Klärschlamm-Verwertungsanlage erhalten. Sie ist in Nordrhein-Westfalen bisher einzigartig und auch bundesweit gibt es bisher nur wenige derartige Anlagen. NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Bündnis 90/Die Grünen) überbrachte persönlich den Bewilligungsbescheid für das 5,6 Millionen Euro-Leuchtturmprojekt. Das Land wird demnach 30 Prozent der Kosten übernehmen.
In Lippstadt soll künftig mittels eines patentierten thermischen Verfahrens aus dem Klärschlamm der Zentralkläranlage im Nahtfeld Energie gewonnen werden (siehe ). Willkommener Nebeneffekt: Da der Klärschlamm nun in Gänze thermisch verwertet wird, können künftig rund 200 Entsorgungsfahrten mit dem Lkw eingespart werden. Dies bedeutet pro Jahr etwa 40 000 gefahrene Kilometer weniger. Der CO2-Ausstoß sinkt folglich in erheblichem Maße. Gleiches gilt für die Lärmbelastung.
Remmel dazu: „Lippstadt setzt auf ein innovatives Energiegewinnungskonzept, das wir als Land voll und ganz unterstützen. Im Hinblick auf die beschleunigte Energiewende…
Quelle:, Der Westen, Lippstadt
(nach oben)
Zeltweg: W+F liefert Kompaktanlage WS200 incl. Sandwäsche
Für moderne Wassergütesicherung und nachhaltigen Umweltschutz
Der Abwasserverband Zeltweg (Österreich) errichtet eine neue Kläranlage mit 30 000 EW. Variantenuntersuchungen hatten ergeben, dass der Neubau in Bezug auf die Betriebs- und Baukosten die eindeutig günstigste Variante ist.
Ziel des Bauvorhabens ist neben einer modernen Wassergütesicherung der nachhaltige Umweltschutz. Ende 2011 soll die neue Kläranlage in Betrieb gehen.
Modernste Technik von W+F
Zur Beseitigung der mechanischen Störstoffe, der Grob- und Fettstoffe sowie der mineralischen Sandbestandteile lieferte W+F über seinen österreichischen Vertriebspartner ACAT eine Kompaktanlage WS270/200 mit integrierter Notumlaufleitung. Sie hat im Normalbetrieb eine Durchsatzleistung von 200 l/s, im Hydraulikbetrieb sind bis zu 270 l/s möglich.
Eingesetzt werden zwei Flach-Feinsiebrechen (je 140 l/s), die mit 3mm Spaltweite ausgestattet sind. Beide Rechen beschicken eine gemeinsame Rechengutwaschpresse. Die Rechen können einzeln mittels eines Dammbalkens abgekoppelt werden. Der Zulauf erfolgt dann über den zweiten Rechen.
Zusätzlich wurden folgende Komponenten eingebaut:
• Automatischer Fettabzug
• Nachgeschaltete Sandwaschanlage (SWA-TE) zum Auswaschen der organischen Anteile auf < 3% Glühverlust
Trotz einer Maschinenlänge von gut 12 Metern, konnte der Transport der gesamten Vorklärstation mit nur 3 LKW bestens bewältigt werden.
Die Stadtgemeinde Zeltweg liegt im österreichischen Murtal…mehr:
http://www.werkstoff-und-funktion.de/index.php?site=1246635837&itemID=1311588305&lang=de
(nach oben)
Wien: Abwasserprofis bei der KinderuniTechnik
Vom 11. bis 15. Juli stellen ganz junge Studentinnen und Studenten die ehrwürdige TU Wien auf den Kopf: Bei der heurigen KinderuniTechnik im Rahmen der KinderuniWien können die Kids auch die Wiener Abwasserprofis (Wien Kanal und ebswien hauptkläranlage) mit ihren Fragen „löchern“. Im Hof des TU-Hauptgebäudes lädt ein 100 m2 großer „Abwasserspielplatz“ zum „Begreifen“ ein: Kinder können an Kanal- und Kläranlagenmodell selbst Hand anlegen und so spielerisch Neues über die Wichtigkeit der Abwasserreinigung lernen. Zusätzlich beantworten Expertinnen und Experten der TU Wien bei zwei Workshops für 7- bis 9-jährige Studentinnen und Studenten die Fragen, was mit dem Wasser passiert, das wir täglich verbrauchen und wie schmutziges Wasser wieder sauber wird. Passend zum heurigen Schwerpunktthema Energie und Umwelt geht es auch darum, wie aus Abwasser Energie gewonnen werden kann.
KinderuniTechnik und KinderuniWien
An der KinderuniWien ist beinahe alles so wie an einer richtigen Universität, nur die Studierenden sind ein wenig jünger, nämlich zwischen 7 und 12 Jahre alt. Wie an einer richtigen Uni müssen sich die kleinen Studentinnen und Studenten für die KinderuniTechnik anmelden, es gibt Stempel, Studienbücher und Ausweise. Am Ende eines Studiums bekommt man dann einen Titel. Prüfungen müssen dafür nicht abgelegt werden, denn das Wichtigste bei der KinderuniWien ist: Spaß haben, Fragen stellen und ganz besonders neugierig sein!
Die Wiener Abwasserprofis
Das Kanalnetz der Stadt Wien ist mehr als 2.400 Kilometer lang. Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Wien Kanal im Einsatz und arbeiten daran, das Kanalnetz funktionsfähig und sauber zu halten. Eine halbe Milliarde Liter Abwasser fließt täglich sicher und umweltgerecht zur ebswien hauptkläranlage in Wien-Simmering. Dort heißt es dann 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr: „Wir klären alles.“ Nach der mechanischen Reinigung nehmen sich die 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ebswien hauptkläranlage in den beiden biologischen Reinigungsstufen die Natur zum Vorbild. Mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann: Die Donau verlässt Wien in der derselben guten Qualität, in der sie in die Stadt gekommen ist.
Veranstaltungshinweis:
• KinderuniTechnik
Zeit: 11. bis 15. Juli 2011, Montag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr
Ort: Hauptgebäude der TU Wien, 4., Karlsplatz 13
Weitere Informationen unter http://kinderuni.at
http://www.wien.gv.at/rk/msg/2011/07/07010.html
(nach oben)
Wangen: Energiegewinn aus anaerober Klärschlamm-Faulung
In Zeiten steigender Strompreise und immer knapper werdender Rohstoffe suchen Kommunen verstärkt nach zukunftsfähigen Alternativen, um das Abwasser der Einwohner möglichst energiesparend und damit kostengünstig zu reinigen.
In ländlichen Gebieten entstehen sehr oft Biogasanlagen, in denen Gülle aus der Region oder auch Nutzpflanzen zur Energiegewinnung verwertet werden. In Wangen im Allgäu haben sich die Verantwortlichen des Städtischen Abwasserwerks für eine Weiterentwicklung dieser Lösung entschieden: Kürzlich wurde ein so genannter KomBio-Reaktor der Tannhausener Firma Lipp GmbH im Klärwerk Pflegelberg errichtet, um den bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlamm zu verarbeiten und das erzeugte Klärgas in elektrische Energie umzuwandeln.
Auf diese Weise reduziert die Kommune erheblich den Bezug teurer Fremdenergie und versucht, in ihrer Energieversorgung weitgehend unabhängig zu werden.
Für 80.000 Einwohner ist das Klärwerk Pflegelberg in Wangen angelegt. Bisher stammte ein Großteil des anfallenden Abwassers aus der ortsansässigen Textilindustrie. Der bei der biologischen Reinigung entstehende Überschussschlamm musste daher mittels einer so genannten simultanen aeroben Stabilisierung von Geruchsstoffen befreit werden, was besonders viel Energie benötigte.
Nach dem drastischen Rückgang dieser Branche stellte man im Klärwerk fest, dass sich die Beschaffenheit des anfallenden Schlamms veränderte – die Voraussetzungen für eine anaerobe Ausfaulung des Klärschlamms waren jetzt gegeben. „Unser Ziel bestand nun darin, die noch vorhandenen Energiepotenziale im Schlamm für uns gewinnbringend zu nutzen, dadurch das Klärwerk energetisch zu optimieren und so den Fremdenergiebezug für die Abwasserreinigung erheblich zu mindern“, so Wolfgang Friedrich, Technischer Werkleiter des Städtischen Abwasserwerks Wangen.
Anstatt, wie zuvor, Strom für die Klärschlammstabilisierung zu kaufen, wird die im Schlamm enthaltene Energie genutzt. Die im Blockheizkraftwerk entstehende Wärme wird ebenfalls für die Faulung und die Heizung verwendet. „Dadurch reduzieren wir unseren Verbrauch an elektrischer Energie um ein Drittel“, hat Friedrich errechnet.
Fermenter und Gasspeicher am selben Ort
Installiert wurde dazu eine Anlage, die Faulbehälter und Gasspeicher miteinander kombiniert. 1.100 m3 fasst der von der Lipp GmbH entwickelte KomBio-Reaktor. Im Fermenter wird zunächst der aus der biologischen Abwasserreinigung anfallende Klärschlamm ausgefault.
„Um angesichts der engen Platzverhältnisse sehr große Behälter zu vermeiden, kam es darauf an, dass die Ausfaulung nur wenig Zeit benötigt“, erklärt Manfred Thalmann, Anlagenplaner der Lipp GmbH. „Aus diesem Grund mussten die Durchmischung des Materials und die Temperaturverteilung optimal abgestimmt sein.“
Daher wurde an der Außenwand ein spezielles Wandheizsystem integriert, das für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Behälter sorgt. Aufgrund der im Vergleich zu klassischen Faulbehältern kürzeren Betriebszeit wird die Anlage zudem weniger beansprucht, was ihre Lebensdauer verlängert und Kosten einspart.
„Durch die Klärschlammfaulung können wir zudem den Feststoffgehalt erhöhen“, so Friedrich. Das sorge beim Input in die anschließende Trocknungsanlage für einen besseren und stabileren Betrieb.
Das bei der Fermentation entstandene Faulgas wird im integrierten Gasspeicher gesammelt und anschließend zu einem Blockheizkraftwerk im Klärwerk geleitet. Die dort bei der Verstromung gewonnene Abwärme wird genutzt, um sowohl den Fermenter als auch das Betriebsgebäude zu beheizen.
„Die Kompaktlösung hat für uns den Vorteil, dass wir auf einen separaten und in der Regel teuren Gasspeicher – auch mangels Platzangebot – verzichten konnten“, so Friedrich.
Exakt auf die Platzverhältnisse abgestimmte Behältergröße
Jedoch war im Klärwerk Pflegelberg nur wenig Platz für einen zusätzlichen Behälter vorhanden. Ein Fermenter aus Beton, der in der Regel in …mehr:
http://www.energie.de/news/energie/regenerativ/energiegewinn-aus-anaerober-klaerschlamm-faulung_4515.html
(nach oben)
Innsbruck: Moderne Verfahren der Kanalnetzberechnung, -bewirschaftung und -optimierung
Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit den Innsbrucker Kommunalbetrieben führt der
Arbeitsbereich Umwelttechnik eine Reihe von Projekten im Rahmen der modernen
Kanalnetzberechnung, -bewirtschaftung und -optimierung durch. Insbesondere
erfolgt dies unter Beachtung der für den alpinen Raum besonderen Gegebenheiten:
• Schneefall und -schmelze
• Stoffeintrag durch Salz- und Splitstreuung
• Räumliche Niederschlagsverteilung durch Wetterbeeinflussung durch Gebirge
• Kombination von sehr steilen Kanalsträngen mit Flachstrecken
• Hochwassergefahr durch alpine Abflüsse
Mehr unter:
http://www.uibk.ac.at/umwelttechnik/research/iut/ibk.pdf
(nach oben)
Fulda/Gläserzell: Ein Tag als Klärwärter: Zwischen Pumpen und Schlammtürmen
„Guten Morgen, Fuldaer Zeitung! Ich arbeite heute bei Ihnen für einen Tag als Klärwärter“, spreche ich früh morgens um kurz vor 7 Uhr in die Gegensprechanlage am Betriebstor des Verbandsklärwerks Fulda/Gläserzell und frage mich im gleichen Moment, auf was ich mich da eingelassen habe.
Das Tor öffnet sich und ich fahre die lange Straße hinab zu den noch im Morgennebel liegenden Gebäuden der größten Kläranlage Fuldas.
Ich bekomme zunächst eine Einweisung in die Weiß- und Schwarzzone des Umkleideraumes. In der Weißzone ziehe ich meine saubere Straßenkleidung aus, um dann in der Schwarzzone, die dreckige Arbeitskleidung anzuziehen. „Wir müssen diese beiden Bereiche führen! Man kommt den ganzen Tag mit vielen Erregern und Bakterien in Kontakt. Die beiden Zonen sorgen dafür, dass diese nicht auf der privaten Straßen- und Freizeitkleidung landen“, erklärt mir Erhard Brähler, stellvertretender Betriebsleiter des Verbandklärwerkes.
Mit blauer Arbeitshose und in Sicherheitsschuhen beginnt mein Tag als Klärwärter mit der Schichtübergabe. Der Nachtdienst berichtet routiniert von Pumpstationen und Bodenfilteranlagen, die durch den nächtlichen Stark- regen Fehlermeldungen angezeigt hatten. Als Laie verstehe ich noch gar nichts von dem, was der Nachtdienst an seine Kollegen weitergibt.
Abwässer aus Fulda, Künzell und Petersberg
Für mich geht es nach der Übergabe zum sogenannten Mischwasserkanal, der am Anfang des Prozesses einer Kläranlage steht. Hier schießen die Wassermassen mit bis zu 800 Litern pro Sekunde durch ein Rohr mit einem Durchmesser von zwei Metern in die Anlage. „Das Wasser, das hier hinein rauscht, ist das Abwasser aus Fulda, Künzell und Petersberg“, erklärt mir Brähler mit lauter Stimme, um das Tosen aus Richtung des Kanals zu übertönen. Mit einer langen Stange mit befestigtem Behälter ziehe ich eine Probe des ankommenden Abwassers für das Labor. Durch das Metallgitter unter mir kann ich den ein oder anderen Fetzen Toilettenpapier in der braun-grauen Brühe erkennen, der dann in das sogenannte Rechenhaus weitergeleitet wird.
Hier werden die vom Abwasser mitgeführten groben Inhaltsstoffe von zwei Rechen zurückgehalten. Jetzt bin ich richtig in der Kläranlage angekommen, denn der beißende Geruch des Abwassers hat sich in meiner Nase festgesetzt. Auf den noch leeren Magen am Morgen ist dies für einen „Klärwärter auf Zeit“ nicht wirklich angenehm.
„Fast alles, was die Fuldaer in den Abfluss werfen, wird hier ausgesiebt“, sagt Brähler. Auch ein großes braunes Nagetier mit langem Schwanz hat den nächtlichen Regenguss scheinbar nicht überlebt und hängt steif vor dem Rechen. „Die großen Probleme bereiten uns weniger die Ratten; vielmehr sind es die Ohrstäbchen, die von den Haushalten in die Toilette geworfen werden.“ Der Sieb könne die Stäbchen aus Plastik nicht vom Abwasser trennen, da sie einfach zu klein und zu dünn seien. So könne es passieren, dass das Plastik am Ende des Prozesses in die Fulda geleitet wird, erläutert Brähler.
Prozesse in der Anlage laufen weitestgehend automatisiert ab
Das, was der Rechen aus dem Abwasser filtert, wird gewaschen, entwässert…mehr:
http://www.fuldaerzeitung.de/nachrichten/fulda_und_region/Fulda-Region-Ein-Tag-als-Klaerwaerter-Zwischen-Pumpen-und-Schlammtuermen;art25,429598
(nach oben)
Cargo City Süd: Nicht nur neue Landebahn für Flughafen Frankfurt …
Modernisierung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Cargo City Süd
Im Zuge der Flughafenerweiterung entstehen auf dem Bereich der ehemaligen US-Air Base neue Kapazitäten für den Frachtverkehr: die Cargo City Süd.
Hierfür wird u.a. auch eine neue Abwasserreinigungsanlage (ARA), mit einer Ausbaugröße von max. 100.000 EW und einer Zulaufmenge von derzeit 70 I/s, errichtet. Dies garantiert die Einhaltung der Abwasser-Satzungswerte auch bei weiterem Wachstum.
Im Rahmen des ersten Bauabschnitts wird u.a. eine neue Rechenhalle gebaut.
Zukunftsorientierte Lösung von W+F
W+F erhielt von der Hochtief Solutions AG den Auftrag, die Anlage zur mechanischen Vorreinigung zu liefern (Liefertermin: Mitte Juni 2012).
W+F realisiert dies mit einer Doppelkompaktanlage, bestehend aus zwei WalzenSandfang-Kompaktanlagen WS-60. Diese von W+F entwickelte Doppelanlage beinhaltet
• die bewährten W+F Rundfeinsiebrechen mit integrierter Rechengutpresse
• den kompakten W+F Walzensandfang inklusive automatischem Fettabzug
• die mittig angeordnete Notumlaufleitung
Die Lösung als Doppelanlage mit mittig angeordneter Notumlaufleitung ist platzsparend und effizient. Sie ist derzeit zu 100% redundant ausgelegt und bietet damit auch ausreichend Puffer für mögliche künftige Erhöhungen der Durchsatzmenge.
Neubau bei laufendem Betrieb
Der Neubau der ARA muss bei laufendem Betrieb der bestehenden Kläranlage Air-Base erfolgen. Dabei wird die bestehende Kläranlage abschnittsweise außer Betrieb …mehr:
http://www.werkstoff-und-funktion.de/index.php?site=1246635837&itemID=1311589143&lang=de
(nach oben)
Dörentrup: Zukunftsfähige Ver- und Entsorgung in einer Kommune mit sinkender Einwohnerzahl Preisverleihung durch „menschen und erfolge“
Ort: Dörentrup (Nordrhein-Westfalen)
Kurzbeschreibung: Aufgrund des prognostizierten Bevölkerungsrückgangs in der Gemeinde müssen die Kosten für den Unterhalt der Wasser- und Abwasser-Infrastruktur künftig von immer weniger Menschen mit der Konsequenz der Preissteigerung getragen werden. Um dem entgegenzuwirken war und ist das Ziel den finanziellen Unterhaltungsaufwand durch die Optimierung von Betriebsabläufen, Ressourcenschonung und mehr Bürgerfreundlichkeit zu senken
http://www.menschenunderfolge.de/pages/wettbewerb/projekt137.php?searchresult=1&sstring=137
(nach oben)
Obere Werntalgemeinden: Gegen Gebührenerhöhung gestimmt
EUERBACH – (sia) Gegen die Gebührenerhöhung im Abwasserzweckverband Obere Werntalgemeinden ab 2012 habe auch er in der Verbandsversammlung gestimmt, sagte Gemeinderat Günther Hutter im Gemeinderat, nicht nur Ratskollege Manfred Peter. Die finanzielle Entwicklung des AZV sei schlechter, als er gedacht habe, monierte er. Wenn bis 2014 die Schulden auf 29,4 Millionen Euro stiegen, müssten allein 1,1 Millionen Euro Zinsen gezahlt werden. Bürgermeister Arthur Arnold entgegnete, auch weil der AZV in Euerbach und Obbach Regenrückhaltebecken bauen müsse, stiegen die Kosten, die die Gemeinde allein belastet hätten. Jetzt müssten keine Beiträge vom Bürger erhoben werden, die Kosten würden eben über Gebührenerhöhung gedeckt. Über mangelnde Information zur AZV-Sitzung beschwerte sich SPD-Rat Bernd Schraut, Fraktionskollege Roland Strauß wies darauf hin, die Euerbacher Vertreter sollten laut Absprache mit dem Gemeinderat handeln.
Gegen die Gebührenerhöhung im Abwasserzweckverband Obere Werntalgemeinden ab 2012 habe auch er in der Verbandsversammlung gestimmt, sagte …mehr:
http://mobil.mainpost.de/regional/art763,6261945
(nach oben)
WEHR: Betriebskosten 2007 erstmals unter einer Million Euro
Zufriedene Gesichter bei der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kläranlage / Klärschlammtrocknung macht Probleme
Schnell und problemlos ging die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kläranlage Wehr gestern im Bürgersaal über die Bühne. Diskussionsbedarf gab es kaum, was auch daran gelegen haben mag, dass die Betriebskosten erstmals seit Bestehen der Kläranlage unter eine Million Euro gedrückt werden konnten. Möglich wurde dies auch durch Klärung von Positionen im Bereich der Klärschlammtrocknung, die allerdings immer noch teurer kommt, als sie müsste. Ab 2011 sieht Verbandschef Bürgermeister Michael Thater aber auch hier Land in Sicht.
Das Thema Klärschlammtrocknung und die dadurch verursachten Kosten zog sich denn auch wie ein roter Faden durch die Versammlung. Zwar konnten durch die Klärung des Streites mit der Stadt Bad Säckingen…mehr:
http://www.badische-zeitung.de/wehr/betriebskosten-2007-erstmals-unter-einer-million-euro–3390124.html
(nach oben)
Uplengen: senkt die Gebühren
Der Kubikmeter kostet ab 2012 zehn Cent weniger , weil die Gemeinden einen Überschuss erwirtschaftet hat. Der Preis für 1000 Liter liegt im kommenden Jahr bei 2,40 Euro.
Remels – In der Regel hört man aus den Verwaltungen der Kommunen folgende Sätze: „Die Kosten laufen uns davon. Wir müssen die Gebühren leider anheben.“ In Uplengen zeigte sich jetzt ein anderes Bild. „Wir können die Gebühren bei der Abwasserbeseitigung senken“, sagte Enno Ennen, Bürgermeister der Gemeinde Uplengen, bei der vergangenen Sitzung des Gemeinderates.
Der Grund: Die Betriebsabrechnung hat bei der Abwasserbeseitigung einen Überschuss ergeben. Der sei zustande gekommen, da in der
http://www.oz-online.de/index.php?id=97&tx_ttnews%5Btt_news%5D=46886&cHash=aea41ee41b&ftu=aea2f2c06c
(nach oben)
Traunstein: Zuwendungsbescheid für den Ausbau der Kanalisation in Traunstein
Die Stadt Traunstein kommt in Sachen Kanalisation voran. Das nahm der bayerische Umweltminister Dr. Markus Söder zum Anlass, um persönlich den Förderbescheid für die Ortsteile Einham und Neuling in Höhe von bis zu rd. 890.000 € an Traunsteins Oberbürgermeister zu übergeben. Ziel ist, bis in zwei Jahren 96,7 Prozent aller Anwesen in und um Traunstein an das Kanalnetz anzuschließen. Der Freistaat Bayern, fördert das Abwasserprojekt und übernimmt 70 Prozent der Kosten. Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein betreut das Vorhaben baufachlich
Quelle: http://www.wwa-ts.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/archiv/2011/14.02.2011/index.htm
(nach oben)
Stöckey: Geld für Kläranlage
Heute wird Thüringens Landwirtschaftsminister Jürgen Reinholz an den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ den Zuwendungsbescheid zum Neubau derzentralen Kläranlage für Stöckey an Ort und Stelle an den Verbandsvorsitzenden Heinrich Barthel übergeben. Die Kläranlage soll noch in diesem Jahr für einen großen Teil der Haushalte der Gemeindedas häusliche Schmutzwasser reinigen. Die Besonderheit ist, dass seit 2010 an einem komplett neuen Schmutzwassernetz für die gesamte Gemeinde gebaut wird. Dieses soll Ende 2013 für den ganzen Ort fertig gestellt sein. Dann wird der Verband ca. 5.000 m Abwasserkanal gebaut haben. Möglich ist dies technisch nur, weil sich der Verband auch auf Grund der Flächenausdehnung des Netzes für eine Vakuumentwässerung…mehr:
http://eic-zeitung.de/nachricht/items/geld-fuer-klaeranlage-stoeckey.html
(nach oben)
Rüthnick: Amtsblatt macht es offiziell
Die Rüthnicker erwartet bald Post. Der Trink- und Abwasser-Zweckverband Fehrbellin/Temnitz wird die Briefe verschicken. Darin werden die Einwohner darüber informiert, dass sie künftig über den Verband ihr Wasser beziehen beziehungsweise es entsorgen und welche Änderungen damit …mehr:
http://www.die-mark-online.de/nachrichten/landkreis-ostprignitz-ruppin/lindow/amtsblatt-macht-offiziell-1250589.html
(nach oben)
Pfungstadt: Neues Regenüberlaufbecken auf der Kläranlage fertig gestellt
Das neue Regenüberlaufbecken auf der Kläranlage Pfungstadt ist fertig gestellt worden und nun in Betrieb. Die komplett erneuerte Anlage verfügt über ein Mischwasserhebewerk mit 3 Förderschnecken à 1.000 l/s sowie über ein Überlaufbecken mit einem Volumen von rund 1.000 m³. Die Anlage wird aufgrund der flachen Kanalisation in Pfungstadt teilweise mit sehr viel Sediment beaufschlagt. Zur Beckenreinigung werden 4 Rührwerke und 2 Spülkippen eingesetzt, die programmgesteuert aktiviert werden können. Die Entleerung erfolgt in freiem Gefälle. Der Bodenschlamm kann optional auch über ein Pumpwerk in die Kanalisation zurück …mehr:
http://www.a2i.de/de/meldungen/meldungen/2011-04-Rueb_in_Pfungstadt.php?navanchor=1110019
(nach oben)
Ludwigsburg: Klärschlamm soll als Geldquelle dienen
Der Kreis will die Reste nicht mehr in den Osten karren, sondern verbrennen und lukrativ aufbereiten. Bei dem, was hinten rauskommt, sind sich Schwarz und Grün mitunter ziemlich einig. Die im Kreis Ludwigsburg geplante, …
http://www.chat-ludwigsburg.de/?p=1960
(nach oben)
Kupferzell/Künzelsau: Kläranlage für zwei Gemeinden geplant
Die beiden Gemeinden Kupferzell und Künzelsau schicken sich an, bei der Beseitigung von Abwasser zusammenzuarbeiten. Im Auftrag der Kommunen soll ein Aaalener Ingenieurbüro untersuchen, ob die Kläranlagen in Gaisbach und Kupferzell-Süd aufgegeben werden. Stattdessen sollen die Abwässer zentral in der Kupferzeller Hauptkläranlage …mehr:
http://www.stimme.de/regioticker/art16233,2178675
(nach oben)
Kornwestheim: Klärschlamm soll in der Region bleiben
Derzeit wird der Klärschlamm aus der Anlage in der Talstraße im sächsischen Landbau verwendet. Die Stadt Kornwestheim sucht nach einer anderen Verwertung. Von Werner Waldner
Der Landkreis Ludwigsburg schneidet in vielen Statistiken gut ab. Was die Verbrennung des Klärschlamms und die damit verbundene Gewinnung von Phosphor angeht, da bildet der Kreis allerdings das Schlusslicht. 70 Prozent des Klärschlamms wird in der Landwirtschaft und im Landbau zur Gestaltung von Halden und Rekultivierungsflächen oder bei Abdeckung von Straßenrändern genutzt. Im Landesdurchschnitt liegt dieser Wert bei gerade einmal 20 Prozent.
Auch Kornwestheim trägt zu diesem unerfreulichen Ergebnis bei: Der Schlamm aus dem Klärwerk – rund 2000 Tonnen Filterkuchen fallen jährlich…mehr:
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.klaerschlamm-soll-in-der-region-bleiben.3787e4c9-6b5d-4d8f-b743-c494a0e6610c.html
(nach oben)
Ingolstadt-Süd: Gebühren vor Reform
Der Abwasserbeseitigungsverband führt 2012 die getrennt kalkulierte Abwassergebühr ein…mehr:
http://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Abwasser-Gebuehren-vor-Reform;art599,2439584
(nach oben)
Heringsdorf: leitet Abwasser nun in polnisches Klärwerk
Die zweite Druckleitung von Bansin nach Swinemünde ist fertig. Durch die Rohre fließen nun 500 Kubikmeter Abwasser in der Stunde. Investiert wurden zehn Millionen Euro.
Swinemünde (OZ) – Imbiss am Klärwerk – klingt gar nicht appetitlich. Die Vertreter der deutschen und polnischen Seite wählten gestern diesen Ort allerdings symbolisch für den Abschluss der bislang größten Baumaßnahme des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom aus.
Für rund zehn Millionen Euro wurde die Schmutzwasserüberleitung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ins Swinemünder Klärwerk fertiggestellt. „Seit 2009 haben wir in verschiedenen Bauabschnitten den …mehr:
http://media.ostsee-zeitung.de/ozdigital/lokales/greifswald/index_artikel_komplett.phtml?SID=6f11a4b4c825433b7828ba062daafa20¶m=news&id=3171264
(nach oben)
Gütersloh: Alarmierende Wasserproben: Ehec-Keime im Klärwerk entdeckt
Essen. Nach einer Routine-Probe in einem Klärwerk bei Gütersloh ging das Ergebnis der Analyse Freitag in Düsseldorf ein. Das Labor hat aggressive Ehec-Keime entdeckt. Sofort wurden weiter Proben gezogen, die übers Wochenende in Berlin überprüft werden.
Die Probe aus der Kläranlage vom 30. Juni war eine von vielen, die landesweit routinemäßig gezogen wurde. Freitag meldete das Labor dem Düsseldorfer Umweltministerium: Im Wasser einer Kläranlage im Kreis Gütersloh fand ein privates Analyse-Labor Ehec-Erreger vom Typ Sero O 104:H4.
Dies ist der besonders aggressive Typ, der in den letzten Wochen rund 50 Menschen in …mehr:
http://www.derwesten.de/nachrichten/politik/Kreis-Guetersloh-Ehec-Keime-im-Klaerwerk-entdeckt-id4850761.html
(nach oben)
Gemünden: Probelauf für neue Kläranlage steht bevor
Westerburg/Gemünden – Die neue Gruppenkläranlage Westerburg/Gemünden wird voraussichtlich zum 1. August diesen Jahres den Probebetrieb aufnehmen. Aufgrund der Witterung mussten die Bauarbeiten im November 2010 für einige Monate eingestellt werden. Die Ausfallzeiten der Winter 2008/2009 und 2009/2010 konnten nicht kompensiert werden. Das Gesamtvolumen des Großprojektes liegt bei 12,5 Millionen Euro. Mit den Baumaßnahmen war im Frühsommer 2008 begonnen worden.
Voraussichtlich zum 1. August soll der Probebetrieb für die neue Gruppenkläranlage aufgenommen werden.
Neben den Abwässern der Gruppe Gemünden soll möglichst schnell auch die Abwassergruppe Westerburg über einen bereits verlegten Verbindungssammler angeschlossen werden. Nach Inbetriebnahme der Gruppenkläranlage die alte …mehr:
http://www.rhein-zeitung.de/regionales/westerwald_artikel,-Probelauf-fuer-neue-Klaeranlage-steht-bevor-_arid,273095.html
(nach oben)
Fichtenau: Abwasser nach Unterdeufstetten
Drei Varianten standen dem Fichtenauer Gemeinderat zur Verfügung, als es jüngst um die Zukunft der Kläranlage in Krettenbach ging. Favorisiert wird nun der Anschluss an die Kläranlage in Unterdeufstetten.
Das Wichtigste, weil Finanzielle vorab: Mit rund 220 000 Euro würde diese Lösung die Gemeindekasse belasten. Die Mittel stünden indes bereit, hieß es in der Sitzung. Nötig wird die Sanierung, weil die Abwasserreinigung in Gunzach und Krettenbach zwar derzeit noch befriedigend arbeitet, in den nächsten Jahren aber Instandsetzungsarbeiten zu erwarten …mehr:
http://www.swp.de/crailsheim/lokales/land/Abwasser-nach-Unterdeufstetten;art5509,1019930
(nach oben)
Faulenbachtal: Förderbescheide in Höhe von rund 800.000 Euro zur Erweiterung der Kläranlage des Faulenbachtals
Umweltminister Franz Untersteller: „Mit dem Zuschuss nimmt das Land seine Verantwortung für Mensch und Umwelt wahr und sorgt für eine gleichbleibend hohe Wasserqualität.“
Zwei Förderbescheide mit einer Zuschusshöhe von insgesamt 793.400 Euro für die Erweiterung der Kläranlage des Faulenbachtals übergab Regierungsvizepräsident Klemens Ficht im Rathaus Rietheim an Bürgermeister Jochen Arno und seinen Dürbheimer Kollegen Alfred Pradel. Von dieser Summe entfallen auf die Gemeinde Rietheim-Weilheim 661.900 Euro und auf die Gemeinde Dürbheim 131.500 Euro. Insgesamt übernimmt das Land somit rund die Hälfte der Gesamtkosten in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR für die Erweiterung der Kläranlage.
„Mit diesem Zuschuss können die Gemeinden nun die Kläranlage Faulenbachtal hinsichtlich Betrieb und Reinigungsleistung auf den aktuellen Stand der Technik bringen“, so Regierungsvizepräsident Klemens Ficht.
Für Umweltminister Franz Untersteller ist die Erweiterung der Anlage die Garantie dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Rietheim-Weilheim und Dürbheim sich weiter auf die hohe Qualität ihres Wassers verlassen können.
Beide Gemeinden betreiben seit 1974 eine gemeinsame Kläranlage. Zum Ende des Jahres 2010 lief die alte Einleitungserlaubnis aus. Das ökologisch empfindliche Gewässer im Einzugsgebiet der oberen Donau sowie die Lage in einem Wasserschutzgebiet erfordern im Zuge der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis erhöhte Anforderungen an die Abwasserbeseitigung bzw.-aufbereitung. So wurden z. B. vom Landratsamt Tuttlingen die Grenzwerte deutlich verschärft: Für abfiltrierbare Stoffe wurde die Höchstgrenze von 50 mg/l auf 5 mg/l, die für Ammoniumstickstoff von 5 mg/l auf 2 mg/l und die für Phosphor von 1,5 mg/l auf 1 mg/l gesenkt.
Das gesamte Vorhaben ist in Funktionsabschnitte unterteilt. In den ersten beiden Funktionsabschnitten (2009 und 2010) wurden der mechanische Anlagenteil, der Filtratwasserspeicher und der Schlammspeicher realisiert. Mit dem aktuellen Funktionsabschnitt sollen die Schlammentwässerung und die Mess- und Regeltechnik ersetzt, das Regenbecken saniert, eine Schlammstabilisierung errichtet und das Volumen des Belebungsbeckens und des Nachklärbeckens erhöht werden. Im Endausbau 2012/2013 soll zukünftig das Abwasser über eine Sandfiltrationsanlage weitergehend behandelt werden. Für das Abwasser aus der Regenwasserbehandlung sind eine Siebanlage und ein Retentionsbodenfilter geplant. Diese Maßnahmen sollen in einem weiteren Funktionsabschnitt realisiert werden.
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1329878/index.html
(nach oben)
EVS: Neuer Zufluss für Nikolausweiher nötig
Der Entsorgungsverband Saar will Abwasser per Pumpleitung von Karlsbrunn nach Dorf im Warndt befördern und die veraltete Karlsbrunner Kläranlage schließen. Die Planung läuft. Sie hat Folgen für den Nikolausweiher.
Für den Nikolausweiher gibt es Gestaltungsideen, die das beliebte Ausflugsziel künftig noch reizvoller machen könnten als bisher (wir haben berichtet). Die Sache hat nur einen Haken: Die natürlichen Quellen, die den Weiher einst gespeist haben – früher trieb das Wasser sogar ein Mühlrad an -, tröpfeln heute nur noch, eine Folge des Bergbaus in der Region. Wäre da nicht der Zulauf aus der nahen Kläranlage Karlsbrunn, läge der Weiherspiegel viel tiefer als heute; und er wäre unangenehm starken Schwankungen unterworfen, so wie früher – vor dem Umbau – der Warndtweiher.
Gereinigtes Wasser aus der Kläranlage wird aber nicht mehr lange den Nikolausweiher füllen. Denn die vom Entsorgungsverband Saar (EVS) betriebene …mehr:
http://www.saarbruecker-zeitung.de/aufmacher/lokalnews/St-Nikolaus-Entsorgungsverband-Saar-EVS-Abwasser-Pumpleitung-Karlsbrunn-Dorf-Warndt-Karlsbrunner-Klaeranlage-Nikolausweiher;art27857,3853820
(nach oben)
ERFTSTADT-KÖTTINGEN: Schaden im sechsstelligen Bereich
Kosten im sechsstelligen Bereich dürfte die Störung in der Köttinger Kläranlage in der vergangenen Woche verursacht haben. Das schätzt Norbert Engelhard, Bereichsleiter Abwassertechnik beim Erftverband.
In der Köttinger Kläranlage war es zu einer außergewöhnlichen Verunreinigung gekommen.
Er geht davon aus, dass der Erftverband, um nicht auf den Kosten sitzenzubleiben, Anzeige gegen den mutmaßlichen Verursacher erstatten wird. Wer das ist, dazu machte er keine Angaben. Zwei Erftstädter Firmen bestritten gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, mit dem Vorfall etwas zu tun zu haben. Am Dienstag vergangener Woche hatten stark zuckerhaltige Abwässer aus einer Firma eine schwere Betriebsstörung in der Köttinger Kläranlage verursacht. Der Erftverband hatte daraufhin erst einmal alle Abflüsse der Anlage gesperrt.
„Fünf Tage rund um die Uhr“ seien Mitarbeiter im Einsatz gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Abwasser musste in Tankwagen…mehr:
http://www.rhein-sieg-anzeiger.ksta.de/html/artikel/1309767262174.shtml
(nach oben)
Bissendorf: Faultürme im Klärwerk bekennen Farbe
19 Hauptschüler legten eine Woche lang fleißig Hand mit Pinsel und Rolle an
Lange musste Hastra-KED-Geschäftsführer Günter Fehr herumtelefonieren, bis er mit der Konrad-Adenauer-Schule eine Schule fand, die auf sein Angebot einging, die Faultürme im Bissendorfer Klärwerk zum 25-jährigen Geburtstag der Übernahme durch den Entsorger zu verschönern.
Doch das Ergebnis hat die Mühe gelohnt, zeigte sich Fehr gestern bei der endgültigen Abnahme des Werkes begeistert. Gemeinsam mit Schulleiter Wilfried Osing, Konrektorin Heike Hartung und Lehrerin Nadine Cornelius hatte Fehr das Werk der 19 Achtklässler bereits am Donnerstag in Augenschein genommen und sich ehrlich über das farbenfrohe Outfit der Faultürme gefreut. Den einen verschönt jetzt eine Stadt frei nach Hundertwasser, den anderen …mehr:
http://www.extra-verlag.de/wedemark/lokales/faultuerme-im-klaerwerk-bekennen-farbe-d14148.html
(nach oben)
Erkelenz: Inbetriebnahme Klärwerk Erkelenz bei Düsseldorf
Im Januar 2011 wurde eine Mikroturbine T100 auf dem Klärwerk Erkelenz (Düsseldorf) in Betrieb genommen.
Nun kann das Klärgas vollumfänglich verstromt und wird nicht mehr abgefackelt…mehr:
http://www.ensola.com/cms/index.php/de/aktuell
(nach oben)
Groß-Gerau :Baugrubenherstellung mit Tauchereinsatz
Eine Herausforderung beim Neubau des Zulaufpumpwerks vor der Kläranlage Groß-Gerau stellte die Herstellung einer ausreichend wasserdichten Baugrube bei annähernd geländegleichem Grundwasserstand dar.
Hierzu wurden 11 m lange Spundwandprofile erschütterungsarm in den vorhandenen Baugrund eingebracht, bevor unter dem Einsatz von Berufstauchern der Aushub und das Betonieren der auftriebssicheren Unterwasserbetonsohle stattfinden konnten.
Nach Fertigstellung des Zulaufpumpwerks wird hierüber das gesamte Abwasser aus der Kernstadt …mehr:
http://www.a2i.de/de/meldungen/meldungen/2011-03-Baugrube-mit-Tauchereinsatz.php?navanchor
(nach oben)
Lahnstein: Blockheizkraftwerk auf der Kläranlage in Betrieb genommen
Energieoptimierung ist ein wichtiges Thema in Lahnstein. Und so arbeitet die Stadt Schritt für Schritt an einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Energieversorgung. Mitte Mai wurde nun das Blockheizkraftwerk (BHKW) auf der Kläranlage Lahnstein eingeweiht. Mit dem neuen Blockheizkraftwerk kann das bisher ungenutzte Faulgas der Kläranlage einerseits als Eigenantrieb und andererseits zur Strom- und Wärmegewinnung genutzt werden. Die Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner mbH war mit der Ausführung des BHKW’s betraut. Die Bauzeit dauerte von September 2010 bis Mai 2011.
Quelle: http://www.siekmann-ingenieure.de/index.php?id=news&language=de&item=61
(nach oben)
Rheinhausen: TurboDrain Green – Einsparungen garantiert!
Die erste TurboDrain Green Anlage wurde vor fast einem Jahr auf der Kläranlage Rheinhausen installiert. Zeit, einmal zurückzublicken und ein Resümee zu ziehen. Die sich zuvor dort befindlichen Zentrifugen mussten ausgetauscht werden.
Die Wahl des neuen Eindickaggregates wollte gut überlegt sein. Deshalb wurden Vergleiche zwischen den unterschiedlichen Eindicksystemen durchgeführt. Nach Auswertung des großtechnischen Betriebsversuches, der mit der mobilen Anlage vor Ort durchgeführt worden war, nach Erstellung eines fachtechnischen Gutachtens und einer Ausschreibung gemäß VOB, fiel die Wahl in Rheinhausen auf die Technologie aus dem Hause Bellmer. Genau zu diesem Zeitpunkt war die Entwicklung der neuen TurboDrain Generation Green abgeschlossen.
Ein positiver Aspekt für die Neuanschaffung in Rheinhausen. Konnte man sich doch sowohl über die innovativen Neuerungen beim TD Green im Vergleich zum Vorgängermodell TDC freuen, als auch mit einem noch größeren Sparpotential durch die neue Technik rechnen.
Durch seine Neuerungen ist der TD Green in der Lage, 10 % an Energie, 20 % Polymer und gut 30 % Wasser einzusparen. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Bedienerfreundlichkeit gelegt. Der TD Green 3C ist in Rheinhausen für die Eindickung des Überschussschlammes zuständig. Die Mannschaft ist auch ein Jahr nach seiner Installation immer noch sehr zufrieden mit ihrer Wahl. Mehr:
http://www.bellmer.de/n140561/n.html#TuDr
(nach oben)
Tübingen: Zu viel Dünger für den Neckar aus dem Klärwerk
Zehn Jahre nach der großen Modernisierung der Tübinger Kläranlage verlangt das Regierungspräsidium jetzt erste Nachbesserungen: Um den Output von Stickstoff und Phosphor weiter zu reduzieren, werden laut Tiefbau-Chef Albert Füger Investitionen von sieben Millionen Euro fällig.
SEPP WAIS
Die Tübinger Abwasserfabrik in der Lustnauer Neckaraue: Über 35 Millionen Euro hat die Stadt Ende der 1990er Jahre in das Klärwerk investiert, um die Schadstoff-Fracht für den Neckar auf ein Zehntel des früheren Niveaus zu reduzieren. Jetzt werden weitere sieben Millionen Euro für Nachbesserungen fällig.Archivbild: Grohe
Tübingen. Die gute Nachricht zuerst: Die Kläranlage im Lustnauer Neckartal leistet zuverlässig das, was sich die Wasserwirtschafter beim 35 Millionen Euro teuren Ausbau vor zehn Jahren von ihr versprochen haben. Das geht aus den Vorarbeiten für die neue „Einleitungserlaubnis“ hervor, die das Regierungspräsidium jetzt für die nächsten 15 Jahre erteilt hat. Ob beim Sauerstoff-Bedarf, bei den Schwermetallen oder bei den Phosphor- und Stickstoff-Verbindungen – die Anlage hält die Grenzwerte ein.
Trotzdem ist Hans-Joachim Vogel, der im Regierungspräsidium das Abwasser-Referat leitet, mit der Qualität des Auslaufs nicht ganz zufrieden. Das gereinigte Abwasser, das in den Neckar abgeleitet wird, enthält seiner Ansicht nach noch immer zu viel Stickstoff und Phosphor. Nicht genug, um die bundesweiten Grenzwerte zu reißen, aber mehr als der Flora und Fauna im Neckar bekommt.
Den Anstoß zur weiteren Aufrüstung der Kläranlagen …mehr:
http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/tuebingen_artikel,-Zu-viel-Duenger-fuer-den-Neckar-aus-dem-Klaerwerk-_arid,137204.html
(nach oben)
Warmsdorf: und Westeregeln kommen ans Abwassernetz
In der Stadt Güsten, Ortsteil Warmsdorf (Salzlandkreis) kann demnächst ein neuer Schmutzwasserkanal gebaut werden. Mit Realisierung der Maßnahme erfolgt die abwassertechnische Erschließung des Ortsnetzes Warmsdorf mit Überleitung nach Güsten. Damit kann der Anschluss von 75 Einwohnern an die zentrale Abwasserentsorgung zur Kläranlage in Staßfurt erfolgen. Die Gesamtkosten für das Vorhaben betragen 639.000 Euro. Ein großer Teil davon – 337.500 – kann mit Fördergeldern beglichen werden. Einen entsprechenden Förderbescheid überreichte heute der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Herr Thomas Pleye an den Geschäftsführer des WAZV Bode-Wipper, Herrn Dr. Rosenthal. Die Mittel kommen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Gleichzeitig wird ein weiteres Vorhaben des WAZV Bode-Wipper vom Landesverwaltungsamt gefördert. Auch dafür überreichte Präsident Pleye den Förderbescheid …mehr:
http://www.kreis-slk.de/salzland/aktuelles/news/2008/2011-07-01_Abwasser.htm
(nach oben)
Westerburg/Gemünden: Probelauf für neue Kläranlage steht bevor
Die neue Gruppenkläranlage Westerburg/Gemünden wird voraussichtlich zum 1. August diesen Jahres den Probebetrieb aufnehmen. Aufgrund der Witterung mussten die Bauarbeiten im November 2010 für einige Monate eingestellt werden. Die Ausfallzeiten der Winter 2008/2009 und 2009/2010 konnten nicht kompensiert werden. Das Gesamtvolumen des Großprojektes liegt bei 12,5 Millionen Euro. Mit den Baumaßnahmen war im Frühsommer 2008 begonnen worden.
Voraussichtlich zum 1. August soll der Probebetrieb für die neue Gruppenkläranlage aufgenommen werden.
Neben den Abwässern der Gruppe Gemünden soll möglichst schnell auch die Abwassergruppe Westerburg über einen bereits verlegten Verbindungssammler angeschlossen werden. Nach Inbetriebnahme der Gruppenkläranlage die alte Anlage, die in unmittelbarer Nähe zum Westerwaldbad in Westerburg liegt, außer Betrieb genommen werden. Zu diesem Zweck sind im ersten Bauabschnitt die Verlegung eines circa 100 Meter langen Kanals sowie verschiedene Umbauarbeiten am alten Standort notwendig. In einem zweiten Bauabschnitt, der für das kommende Jahr vorgesehen ist, folgt dann die Einrichtung der notwendigen Regenrückhaltung, wobei nach Darstellung der Eigenwerke große Teile der bestehenden Bausubstanz genutzt werden können. Im Investitionsplan der Abwasseranlagen stehen für die Arbeiten am Altstandort Westerburg insgesamt 1,05 Millionen Euro zur Verfügung.
In der neuen Anlage sollen künftig die Abwässer aus dem Einzugsbereich der bisherigen Abwassergruppen Westerburg, …mehr:
http://www.rhein-zeitung.de/regionales/westerwald_artikel,-Probelauf-fuer-neue-Klaeranlage-steht-bevor-_arid,273095.html
(nach oben)
Braunsbach: Rund 380.000 Euro Fördermittel für die Abwasserbeseitigung in Braunsbach
Regierungspräsident Johannes Schmalzl: Wesentlicher Beitrag zum Gewässerschutz
Regierungspräsident Johannes Schmalzl hat heute dem Bürgermeister der Gemeinde Braunsbach (Landkreis Schwäbisch Hall), Frank Harsch, einen Zuwendungsbescheid zur weiteren Umsetzung der Abwasserbeseitigungskonzeption in Höhe von 383.200 Euro übergeben. Schmalzl: „Ich freue mich sehr, diesen Bescheid übergeben zu können, damit das Gesamtprojekt mit Unterstützung des Landes im Sinne eines nachhaltigen Umweltschutzes weiter vorangetrieben werden kann.“
Die im Jahr 2001 erstellte Abwasserbeseitigungskonzeption der Gemeinde Braunsbach ist nahezu umgesetzt. Neben dem Anschluss von mehreren Ortsteilen an die Sammelkläranlage (SKA) in Döttingen wurde von 2008 bis 2010 die SKA ausgebaut. Diese Maßnahme wurde vom Land mit einem Zuschuss in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro gefördert.
Die derzeitige Abwasserbeseitigung des Teilortes Weilersbach besteht aus dezentralen Anlagen (Hauskläranlagen oder Gruben). Da der Unterlauf des Weilerbaches sowie der Kocher als Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Gebiet ausgewiesen sind, gelten entsprechend hohe Anforderungen an das Einleiten von Abwasser. Nachdem die Sammelkläranlage Döttingen erst vor kurzem erweitert wurde, somit klärtechnisch auf dem neuestem Stand ist und die Einleitungsanforderungen eingehalten werden können, ist der Anschluss von Weilersbach nach Döttingen die sinnvollste Lösung.
Mit dem jetzigen Bau eines Pumpwerks und Verbindungskanals von Steinkirchen (Braunsbach) zur Sammelkläranlage Döttingen werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Ortsteil Weilersbach baldmöglichst an die SKA Döttingen angeschlossen werden kann. Nach Fertigstellung aller Maßnahmen wird das Abwasser von Weilersbach mittels einer ca. 1,3 Kilometer langen Druckleitung zur Ortskanalisation von Steinkirchen gepumpt und gelangt von dort zur Reinigung in die SKA Döttingen.
„Für die Flächengemeinden im ländlichen Raum ist es nicht einfach, die hohen Investitionen in die Infrastruktur ohne Zuschüsse zu tätigen,“ so der Regierungspräsident. „Mit den Landesmitteln aus dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft können wir dazu beitragen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger von unzumutbar hohen Gebühren- und Beitragsbelastungen verschont bleiben.“
Quelle: http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1328813/index.htm
(nach oben)
Düsseldorf: Überflutungsprüfung im Rahmen des GEP Düsseldorf, Einzugsgebiet Klärwerk Süd
Für die Einzugsgebiete Mitte, Süd und Süd-West des Klärwerks Düsseldorf Süd wird ein neuer Generalentwässerungsplan aufgestellt. Das gesamte Einzugsgebiet hat eine Größe von ca. 6.200 ha mit einer Kanalnetzlänge von rund 940 km.
Basierend auf den Ergebnissen der Seriensimulationen für den Ist-, Prognose- und Sanierungszustand wurde eine Überflutungsprüfung durchgeführt. Diese wurde in Anlehnung an die DWA-A 118 und DIN EN 752 in Form statistischer Auswertungen für Schächte mit erhöhten Überstauhäufigkeiten und Überstauvolumina erstellt.
Die insgesamt 600 ausgewerteten Schächte wurden in der Örtlichkeit begangen, die Erkenntnisse in einem Risikobewertungsbogen dokumentiert und daraus ein Gefährdungspotential abgeleitet, welches die Wahrscheinlichkeit bewertet, mit der durch die austretenden Wassermengen am betrachteten Schacht eine potentielle Gefahr und Schadensquelle für die angrenzende Bebauung bestehen könnte. Abgeleitet aus den Erkenntnissen der Risikobewertung wurden Maßnahmen in der Örtlichkeit ausgewiesen oder wenn dies nicht möglich war, weitergehende Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetz erarbeitet.
Haben Sie Interesse an weiteren Informationen zu diesem Projekt, so stehen Ihnen telefonisch unsere Frau Traut unter 0211 / 44 99 1-79 und unser Herr Okrzynski unter 0211 / 44 99 1-44 gerne zur Verfügung. Oder schicken Sie einfach eine E-mail an tt@hydro-ingenieure.de oder ao@hydro-ingenieure.de.
(nach oben)
ESPENHAIN: Abwasserentsorgung für zukünftige Generationen
GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG DES ABWASSERZWECKVERBANDES „ESPENHAIN“, DER HTWK LEIPZIG UND DER UNIVERSITÄT LEIPZIG VOM 21. JUNI 2011
HTWK LEIPZIG, UNIVERSITÄT LEIPZIG UND ABWASSERZWECKVERBAND KOOPERIEREN
Der Demografische Wandel wirkt sich auch auf Abwassersysteme aus. Bevölkerungsrückgang sowie geringerer Wasserverbrauch führen bei konventionellen Systemen zu betrieblichen Problemen. Zugleich steigt die Kostenbelastung für die Bürger. Neue Lösungskonzepte sind gefragt. Ein gemeinsames Forschungsprojekt des Institutes für Wasserbau und Siedungswasserwirtschaft (IWS) an der HTWK Leipzig, des Institutes für Infrastruktur und Ressourcenmanagement (IIRM) an der Universität Leipzig sowie des Abwasserzweckverbandes „Espenhain“ widmet sich neuartigen Sanitärsystemen. Unter dem Titel „Untersuchung des Beitrages neuartiger Sanitärkonzepte zur Gewährleistung einer kostengünstigeren, verursachergerechten und bürgerfreundlichen Abwasserentsorgung bei demografischem Wandel“ forschen sie gemeinsam in dem von der Sächsischen Aufbaubank geförderten Projekt.
Die negativen Folgen des sich seit den 1990er Jahren stark beschleunigenden demografischen Wandels machen sich bei der Wasserver- und Abwasserentsorgung deutlich bemerkbar. Die Bevölkerung in ländlichen Gebieten nimmt ab. Inzwischen leben in diesen Regionen im Durchschnitt 80 Prozent, in einigen peripheren Gegenden noch weniger Menschen im Vergleich zu 1990. Benachbarte Ortsteile können sich hierbei sehr unterschiedlich entwickeln. Neben dem Bevölkerungsrückgang tragen auch das zunehmende Umweltbewusstsein der Bevölkerung sowie technische Fortschritte zu geringerem Wasserverbrauch und somit zur drastischen Reduzierung der Abflussmengen in den Abwasserkanälen bei. Das hat nicht nur starke Ablagerungen in den bestehenden Infrastrukturnetzen, sondern auch Veränderungen der Abwasserzusammensetzung zu Folge. Auch die zunehmenden Betriebskosten der Anlagen entsprechen nun nicht mehr den Anforderungen an eine ökologisch und ökonomisch orientierte Abwasserentsorgung. Schließlich erhöht sich die Finanzierungslast für die Bürger. Die quantitativen und qualitativen Veränderungen erfordern daher neue Lösungen für die Abwasserfortleitung und -behandlung, denn die Möglichkeiten der derzeitigen konventionellen Verfahren sind begrenzt.
Wissenschaftliche Erkenntnisse sofort im Abwasserzweckverband umgesetzt
Im Forschungsprojekt untersuchen Wissenschaftler seitens des IWS an der HTWK Leipzig neue Lösungsansätze auf der ingenieurwissenschaftlichen Ebene und seitens des IIRM an der Universität Leipzig aus wirtschaftlicher Sicht. Zeitgleich erproben sie diese an den Anlagen des Abwasserzweckverbandes „Espenhain“. Dabei legen die Forscher und Praktiker den Schwerpunkt auf die neuartigen Sanitärsysteme (NASS). Sie überprüfen, ob und in welchen Teilräumen des Untersuchungsgebietes die möglichen Lösungsansätze gegenüber konventionellen Systemen im Vorteil sind, um langfristig eine kostengünstige und vor allem verursachergerechte Abwasserentsorgung in vom demografischen Wandel besonders betroffenen Gebieten sicherzustellen.
Hohe Anwendbarkeit weit über regionale Grenzen hinaus
Das Forschungsprojekt konzentriert sich somit nicht nur auf eine bestimmte, räumlich begrenzte Fragestellung. Es umfasst das gesamte Spektrum von der Entstehungsursache bis hin zu konkreten Lösungsansätzen und bildet somit eine Grundlage für weitere nationale und internationale Anwendungen.
Das Projekt ist ein weiterer Baustein im Rahmen der Kooperationstätigkeit zwischen der HTWK Leipzig und der Universität Leipzig sowie der regionalen Wirtschaft. Die Leitung haben Professor Dr.-Ing. Hubertus Milke von der HTWK Leipzig und Professor Dr.-Ing. Robert Holländer von der Universität Leipzig inne. Die Fördersumme, die von der SAB aus Haushaltsmitteln des Freistaates Sachsen bereitgestellt wurde, beträgt 72.000 Euro. Das Projekt startet am 1. Juli 2011 und endet am 30. September 2012.
Vertreter der Presse können gern ein Foto von der heutigen Auftaktveranstaltung in der Pressestelle der HTWK Leipzig (pressestelle@htwk-leipzig.de) anfordern. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.iws.htwk-leipzig.de und www.wifa.uni-leipzig.de/iirm/professur-umwelttechnik-in-der-wasserwirtschaft-umweltmanagement.html.
Weitere fachliche Informationen:
Professor Dr.-Ing. Hubertus Milke, Fakultät Bauwesen, HTWK Leipzig
Telefon: 0341/3076 6230
E-Mail: hubertus.milke@fb.htwk-leipzig.de
Professor Dr.-Ing. Robert Holländer, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Universität Leipzig
Telefon: 0341/9733870
E-Mail: hollaender@wifa.uni-leipzig.de
Sven Lindstedt, Geschäftsführer Abwasserzweckverband „Espenhain“
Zentralgebäude Blumrodapark 1
04552 Borna
http://www.htwk-leipzig.de/de/forschung-und-kooperation/aktuelles/nachrichten-details/detail/abwasserentsorgung-fuer-zukuenftige-generationen/
(nach oben)
LINEG:Lamellenabscheider in der Regenwasserbehandlung im Mischsystem
Die LINEG plant derzeit die Erweiterung der Mischwasserbehandlungsanlage Duisburg Homberg-Hakenfeld. Neben dem Umbau des Zulaufrechens und der Herstellung eines vorgeschalteten Beckenüberlaufes sowie der Installation einer Abluftbehandlung für die offenen Gerinne ist die Ausrüstung eines rd. 1.200 m3 fassenden Regenüberlaufbeckens mit Lamellenabscheidern vorgesehen.
Um die gleiche Reinigungsleistung wie bei einem konventionellen Regenüberlaufbecken zu erzielen, werden in Zusammenarbeit mit dem ISA der RWTH Aachen und der Hydrograv GmbH Dresden die hydraulischen Auslegungsgrundlagen erarbeitet, um für die Bieter im Wettbewerb eine fundierte Datengrundlage zur Verfügung zu stellen.
Haben Sie Interesse an weiteren Informationen zu diesem Projekt, so steht Ihnen telefonisch unser Herr Kreifelts unter 0211 / 44 99 1-19 gerne zur Verfügung. Oder schicken Sie einfach eine E-mail an sk@hydro-ingenieure.de.
(nach oben)
Neuss: Schmutzwasserpumpwerk „Am Reckberg“ in Betrieb genommen
Im März 2011 wurde nach einjähriger Bauzeit das ertüchtigte Schmutzwasserpumpwerk „Am Reckberg“ der InfraStruktur Neuss AöR in Neuss Uedesheim in Betrieb genommen. Das vorhandene Schmutzwasserpumpwerk wurde um einen gleich großen Pumpwerksanbau erweitert sowie die maschinelle und elektrotechnische Installation entsprechend des Standes der Technik komplett erneuert.
Das Pumpwerk ist mit zwei Grundlastpumpen und einer Hochlastpumpe ausgerüstet. Die Gesamtfördermenge beträgt 130 l/s. Das Schmutzwasser wird über zwei neu hergestellte 180 m lange Druckrohrleitungen und über eine geodätische Förderhöhe von 11 m zu einem Freispiegelkanal DN 400 und damit in Richtung Kläranlage gepumpt.
(nach oben)
Schwarze Pumpe: Grundsteinlegung für Abwasserbehandlungsanlage
Sachsen und Brandenburg stärken Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes
Der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg errichten in einer länderübergreifenden Erschließungsmaßnahme eine Abwasserbehandlungsanlage im Industriepark Schwarze Pumpe.
Schwarze Pumpe bildet einen zentralen industriellen Kern in der Lausitz-Region. Der Industriestandort Schwarze Pumpe / Altstandort Industriegebiet Spreewitz verfügt über 700 Hektar Industrieflächen und 120 Hektar Entwicklungsflächen, es sind dort mehr als 80 Unternehmen mit über 4.200 Beschäftigten ansässig. Um neue Unternehmen für den Standort zu gewinnen und die …mehr:
http://www.lausitz-branchen.de/branchenbuch/2011/06/15/grundsteinlegung-fuer-abwasserbehandlungsanlage-in-schwarze-pumpe/
(nach oben)
WVER – Optimierung der Nachklärung Kläranlage Schleiden
Die 2-straßige Nachklärung der Kläranlage Schleiden wird in Zusammenhang mit dem Betrieb des nachgeschalteten Filters optimiert, um eine Stabilisierung der Feststoff-Ablaufwerte zu gewährleisten. Gemeinsam mit der Firma Hydrograv, Dresden, wird neben einer Simulation der Strömungsverhältnisse für verschiedene Lastfälle eine klärtechnische Überprüfung der gegebenen Randbedingungen durchgeführt.
Haben Sie Interesse an weiteren Informationen zu diesem Projekt, so stehen Ihnen telefonisch unsere Frau Barnscheidt unter 0211 / 44 99 1-48 und unsere Frau Gans unter 0211 / 44 99 1-17 gerne zur Verfügung. Oder schicken Sie einfach eine E-mail an ba@hydro-ingenieure.de oder ng@hydro-ingenieure.de
(nach oben)
Zeitz: Zeitzer zahlen zu hohe Abwassergebühren
Nach Auffassung des Landesrechnungshofes werden die Gebührenzahler bei den Abwasserkosten in Zeitz und im Umland zu hoch belastet. Eine Prüfung der Dessauer Behörde ergab, dass die für die Kalkulation der Gebühren zu Grunde gelegten Betriebsführungsentgelte überhöht sind. Präsident Ralf Seibicke sieht sowohl für die Stadt als auch für die umliegenden Abwasserzweckverbände schwerwiegende Probleme rechtlicher und finanzieller Art.
Magdeburg. Es begann 1992, als die Stadt Zeitz (Burgenlandkreis) mit 30 umliegenden Gemeinden in Göbitz den Bau eines Klärwerkes beschloss. Die Gemeinden sollten sich über Einleitungsverträge an den 20 Millionen Euro Baukosten beteiligen. Als die Stadt die Kosten nach Fertigstellung des Klärwerkes im Oktober 1997 den Gemeinden in Rechnung stellte, erkannten die Abwasserzweckverbände und Gemeinden die Rechnungen nicht an – wegen fehlender Vertragsgrundlagen und der nicht nachvollziehbaren Höhe, heißt es im Prüfbericht.
Die Kredite wurden allein von der Stadt bzw. dem Abwasserbetrieb bedient – sowohl Zinsen als auch Tilgung. Der Abwasserzweckverband Hasselbach/ Thierbach zahlte elf Jahre nicht. Erst im Jahr 2008 schlossen die Stadt Zeitz und der Verband einenVertrag. Insgesamt erhielt die Stadt 2,4 Millionen Euro. Nach Auffassung des Rechnungshofes hätten aber nur 10,9 Millionen Euro als Berechnungsgrundlage dienen dürfen (Baukosten ohne Fördermittel), der Abwasserverband somit nur 1,6 Millionen Euro zahlen müssen. Laut Rechnungshof sind für die Gebührenermittlung somit zu hohe Kapitalkosten berücksichtigt worden.
100 000 Euro zu viel
In dem Prüfbericht heißt es weiter, dass wichtige Vertragsbedingungen (zum Beispiel Laufzeiten, Einleitmengen, Zinsen) nicht einheitlich geregelt wurden. Nach Auffassung der Rechnungsprüfer die „wesentliche Ursache“ für die bis heute andauernden Streitigkeiten über die Beteiligung an den Klärwerksbaukosten.
Weiter gibt bis heute keine „ordnungsgemäße Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Gebühren und Beiträge für die Abwasserbeseitigung“. So ist das Betriebsführungsentgelt, das die Stadt Zeitz an die Stadtwerke Zeitz GmbH, die die kaufmännische und technische Betriebsführung für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Zeitz durchführt, zahlt, um rund 100 000 Euro jährlich überhöht. Im Jahresbericht wird dabei auf eine Prüfung des Landesverwaltungsamtes verwiesen, die diesen Fakt bereits im Jahr 2009 ermittelt hat. Statt danach im Interesse der Gebührenzahler eine Lösung zu suchen, einigt sich der Zeitzer Oberbürgermeister mit den Stadtwerken, die das Prüfergebnis zurückweisen, auf eine „einvernehmliche Lösung“.
Rechnungshof-Chef Ralf Seibicke findet in seiner sonst eher zurückhaltenden Art deutliche Worte: „Das Verhalten …mehr:
http://vsdigital.volksstimme.de/Olive/ODE/sbk/LandingPage/LandingPage.aspx?href=U0JLLzIwMTEvMDYvMTg.&pageno=Mg..&entity=QXIwMDIwMA..&view=ZW50aXR5
(nach oben)
Wildegg: Sauberes Wasser ist sein ganzer Stolz
Marcel Joos ist Leiter der Kläranlage Langmatt und zeigt übermorgen seinen Betrieb
Täglich fallen in der Schweiz 4 Millionen
Kubikmeter Abwasser an. Über
tausend Personen kümmern sich in
der Schweiz in den verschiedensten
Kläranlagen darum. Einer davon ist
der ausgebildete Klärwerkfachmann
Marcel Joos der Abwasserreinigungsanlage
(ARA) Langmatt in Wildegg.
Sein Arbeitsplatz liegt direkt an
der Aare, inmitten von Wiesen, Bäumen
und Biotopen. Er hört Wasserrauschen,
hört die Frösche quaken.
Nein, Marcel Joos ist nicht Ranger eines
Wildparks – er ist Betriebsleiter
auf der Kläranlage Langmatt. Er arbeitet
seit zehn Jahren als Betriebsleiter
auf dieser Anlage.
Abwasser von 50 000 Einwohnern
Der gelernte Maschinenschlosser
und Instandhaltungs-Fachmann war
zuvor auf der Trinkwasser-Anlage in
Lenzburg tätig. «Ich kenne den Wasserkreislauf
somit von der Wasserfassung
bis zur Reinigung», erklärt der
heute 55-Jährige. Seit zehn Jahren ist
er Betriebsleiter der …mehr:
http://www.neu.vsa.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Veranstaltungen/20110519_AargauerZeitung.pdf
(nach oben)
Weißenfels: Klärwerk am Limit
In Weißenfels läuft das Klärwerk über. Bereits seit fünf Jahren arbeitet die Wasserentsorgung in Weißenfels am Limit. Der Grund: Mehrere Industriebetriebe haben mit großen Abwassermengen im wahrsten Sinne des Wortes das Klärwerk geflutet.
Inzwischen ist die Situation so dramatisch, dass kaum behandelte Abwässer direkt in die Saale gelangen, Umweltverbände schlagen Alarm. Als Verursacher des Problems wird ein ortsansässiger Fleisch- und Wurstwarenproduzent vermutet, der über Jahre …mehr:
http://www.mdr.de/exakt/8669843.html
(nach oben)
Weichering: Abwasser wird teurer
Einleitungsgebühr wird sukzessive auf 2,50 Euro erhöht
Erhitzt haben sich die Gemüter in der Weicheringer Gemeinderatssitzung am Montag an der Erhöhung der Einleitungsgebühr für das Abwasser, die vom Landratsamt gefordert wurde. „Das ist unsozial und geht mir gegen den Strich“, bewertete Gemeinderat Georg Niedermeier die stufenweise Anhebung der Gebühr von derzeit 1,89 auf 2,50 Euro pro Kubikmeter bis zum Jahr 2013. Man sollte zunächst nur den Beschluss einer Erhöhung auf 2,30 Euro für ein Jahr tätigen und abwarten, wie sich die Kostensituation 2012 entwickelt.
Nachdem das Landratsamt aus Kostendeckungsgründen eine sofortige Erhöhung auf 2,50 Euro zur Auflage gemacht hatte, stand das Thema bereits in der Sitzung vor vier Wochen auf der Tagesordnung. Damals kam das Gremium überein, der Aufsichtsbehörde den Vorschlag einer stufenweisen Erhöhung zu unterbreiten. „Als Entgegenkommen und als goldene Brücke zum Regelfall“ kam diese dem Ansinnen des Gemeinderats nach.
Doch mit der Kulanz des Landratsamts hatte so mancher Gemeinderat sein Problem, denn letztlich obliegt es nicht der Kreisbehörde, sondern der Gemeinde, die Preise für die Einleitungsgebühr …mehr:
http://www.augsburger-allgemeine.de/neuburg/Abwasser-wird-teurer-id15125731.html
(nach oben)
Untermeitingen: Das Abwasser wird teurer
Untermeitingen hebt die Einleitungsgebühr um 24 Cent pro Kubikmeter Wasser. Grundgebühr wird auf 60 Euro erhöht
Untermeitingen Für die Abwasserbeseitigung werden die Bürger in Untermeitingen künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat jetzt die Eckdaten einer neuen Entwässerungssatzung festgelegt, die eine deutliche Gebührenerhöhung vorsieht.
Grundlage ist eine Globalberechnung, die sämtliche, innerhalb der vergangenen vier Jahre erbrachten und auch die zu erwartenden Kosten und Einnahmen der Abwasserbeseitigung erfasst. Laut Gesetz müssen kommunale Entwässerungsanlagen kostendeckend geführt und die anfallenden Kosten nach dem tatsächlichen Aufwand umgesetzt werden.
Dies war bisher in Untermeitingen nicht der Fall, wie die Rechnungsprüfung bemängelte. Der Gemeinde gehe es zwar „verhältnismäßig gut“, sagte Bürgermeister Georg Klaußner. Da aber Einnahmen etwa aus der Einkommens- oder Gewerbesteuer nicht zur Finanzierung der Abwasserbeseitigung eingesetzt werden dürfen, „müssen wir an der Gebührenschraube etwas drehen“.
Die neue Satzung ist der aktuellen Rechtslage angepasst und regelt …mehr:
http://www.augsburger-allgemeine.de/schwabmuenchen/Das-Abwasser-wird-teurer-id15423951.html
(nach oben)
Trulben: Genehmigung zum Bau der neuen Gruppenkläranlage Trulben erteilt
Neustadt an der Weinstraße/Trulben/Eppenbrunn – Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd hat der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land die Genehmigung für den Bau und Betrieb der neuen Gruppenkläranlage (GKA) Trulben und den Anschluss der Ortsgemeinde Eppenbrunn (Bau und Betrieb einer Pumpstation und eines Verbindungssammlers) erteilt. Die Gesamtkosten des Projekts, mit dem noch im Sommer dieses Jahres begonnen werden soll, belaufen sich auf circa 6,4 Millionen Euro. Die Maßnahme ist im Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2011 und 2012 gemeldet.
Die neue GKA wird im Trualbtal direkt neben dem Standort der alten Kläranlage Trulben gebaut. Sie wird auf 4 000 Einwohnerwerte ausgelegt und reinigt zukünftig die Abwässer der Ortsgemeinden Trulben (mit Felsbrunnerhof, Imsbacherhof, Trulbermühle und Hochstellerhof), dem Ortsteil Kettrichhof der Gemeinde Lemberg und den Ortsgemeinden Eppenbrunn und Hilst. Durch den hohen Stand der eingesetzten Klärtechnik mit Stickstoff- und Phospatelimination kann zukünftig ein höherer Reinigungsgrad erreicht werden als bisher. Der Eintrag von belastenden und sauerstoffzehrenden Schmutzstoffen wird nach Inbetriebnahme der neuen Abwasseranlagen erheblich verringert, wodurch eine Verbesserung der Wasserqualität und des ökologischen Zustandes des Eppenbrunner Baches und der Trualbe erreicht wird.
Die über 40 Jahre alten Kläranlagen Eppenbrunn und Trulben entsprechen nicht mehr den heutigen wasserwirtschaftlichen Anforderungen und müssten saniert bzw. erweitert werden. Ursprünglich war geplant, die oben genannten Ortsgemeinden an die Kläranlage Felsalbe der Stadt Pirmasens anzuschließen. Aufgrund einer erneuten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Jahr 2007 hat sich die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land jedoch für den Neubau einer Gruppenkläranlage im Trualbtal entschieden. Die Ortsgemeinden Trulben, Hilst und der Ortsteil Kettrichhof sind bereits an die alte Kläranlage Trulben angeschlossen. Zeitgleich mit dem Bau der Gruppenkläranlage wird auch eine 1,7 Kilometer lange Druckleitung entlang der L 478 für den Anschluss der Ortsgemeinde Eppenbrunn gebaut.
Die alten Kläranlagen Trulben und Eppenbrunn werden später rückgebaut und die Grundstücke renaturiert. Am Standort der alten Kläranlage Eppenbrunn verbleibt lediglich das zu sanierende Pumpengebäude und das Überlaufbauwerk des bereits in 2008 gebauten Stauraumkanals
Quelle: http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/broker.jsp?uMen=f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266&uCon=4bc30eca-3b6e-3031-117b-1ae072e13d63&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042
(nach oben)
Seengen: Nachschauen, was mit den 6 Millionen gebaut wurde
Tag des Abwassers kann sich
die Öffentlichkeit bei der ARA
Hallwilersee in Seengen ein
Bild machen, wofür in den letzten
Jahren 6 Millionen
Rund 6 Millionen Franken haben Sanierung,
Erweiterung und Umbau
der Abwasserreinigungsanlage (ARA)
Region Hallwilersee gekostet. Die realisierten
Projekte umfassen insbesondere
Massnahmen zur Werterhaltung,
die Steigerung der Reinigungsleistung
und die Erweiterung der
Schlammbehandlung.
Das Einzugsgebiet der ARA Region
Hallwilersee umfasst die Gemeinden
…mehr:
http://www.neu.vsa.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Veranstaltungen/20110519_AargauerZeitung.pdf
(nach oben)
Rottenburg-Kiebingen: Regierungspräsidium Tübingen gibt grünes Licht für den Ausbau der Kläranlage
Anlage produziert jetzt über ein Drittel ihres Stromverbrauches aus der Nutzung von Faulgas selbst
Das Regierungspräsidium Tübingen hat der Stadt Rottenburg einen Förderbescheid zum Umbau der Kläranlage Rottenburg-Kiebingen in Höhe von rund 1,1 Millonen Euro zukommen lassen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 4,5 Millionen Euro.
Kernstück der Maßnahme ist die Errichtung einer Schlammfaulungsanlage, die es ermöglicht, mit dem gewonnenen Klärgas in dem ebenfalls neu zu installierenden Blockheizkraftwerk (BHKW) über 500.000 kWh /a Eigenstrom zu erzeugen und die Abwärme des BHKW zusätzlich zur Beheizung von Gebäuden und zur Schlammfaulung zu nutzen. Die erzeugte Strommenge entspricht gut einem Drittel des bisherigen Strombezuges aus dem Netz. Mit dem so produzierten Strom könnten zum Vergleich rund 200 Haushalte versorgt werden.
Der spezifische Energieverbrauch einer Kläranlage liegt im Mittel mit 33 kWh pro Einwohner und Jahr zwar nur im Prozentbereich des privaten Stromverbrauches, dennoch ist die Kläranlage häufig der größte Energieverbraucher einer Stadt. Sie hat damit auch eine strategische Bedeutung bei den allgemeinen Anstrengungen zur Energieeinsparung. Oberste Priorität bei allen Bemühungen muss allerdings stets die Reinigungsleistung der Kläranlage haben. Durch Optimierungen lassen sich aber durchaus alle drei Ziele, Ökologie, Ökonomie und Energiesparen, sinnvoll vereinbaren.
Aufgrund der verfahrenstechnischen Veränderungen kann zudem die biologische Stufe der Kiebinger Anlage verkleinert werden. Bislang wurde der Klärschlamm in diesen Becken simultan im Reinigungsprozess mit höherem Energieaufwand stabilisiert, das heißt, die unangenehm riechenden organischen Anteile wurden durch den Luftsauerstoff oxidiert. Dieser Vorgang findet nun ohne Sauerstoff, unter Bildung von Methangas im Faulbehälter statt. Die dadurch freiwerdenden Becken können für anderweitige Aufgaben innerhalb der Kläranlage genutzt werden, unter anderem für ein Vorklärbecken, ein Becken zur biologischen Phosphorelimination und ein 1000 m³ fassendes Havariebecken, das bei Ölunfällen und Brandfällen zur Speicherung herangezogen werden kann.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt des Ausbaus der Kläranlage ist die Möglichkeit, das BHKW bei einem längeren Stromausfall als Notstromaggregat zu nutzen, um vorübergehend eine Grundreinigung des Abwassers zu gewährleisten.
Quelle:
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1327591/index.htm
(nach oben)
RETZBACH: Auch die Retzbacher Kläranlage bekommt ein Blockheizkraftwerk
(ka) Insgesamt 2,6 Millionen Euro wird der Abwasserzweckverband Zellinger Becken in die verbesserte Klärschlammbehandlung der Kläranlage in Retzbach investieren. Geplanter Baubeginn für die Anlage mit Faulturm und Blockheizkraftwerk ist das Frühjahr 2012.
(ka) Insgesamt 2,6 Millionen Euro wird der Abwasserzweckverband Zellinger Becken in die verbesserte Klärschlammbehandlung der Kläranlage in Retzbach investieren. Geplanter Baubeginn für die Anlage mit Faulturm und Blockheizkraftwerk ist das Frühjahr 2012.
„Die Investition trägt sich durch Einsparungen bei der Klärschlammentsorgung selbst, es wird keine zusätzliche Abgabe für die sechs Mitgliedsgemeinden geben, kein Bürger wird dafür einen Zahlbescheid bekommen“, schickte Verbandsvorsitzender Harald Führer der Vorstellung des Konzepts in der Verbandsversammlung voraus. Sein Stellvertreter Philipp Kromczynski war in einem Zeitungsbericht zum Ortsgespräch der CSU unglücklich zitiert worden, die im Abwasserzweckverband anstehenden großen Investitionen würden die Bürger langfristig viel Geld kosten.
Wie Holger Scheer und Ingo Urban von der Emscher Gesellschaft für Wassertechnik aus Essen erklärten, muss die Schlammbehandlung auf eine Jahresmenge von 15 000 Kubikmeter Klärschlamm ausgelegt werden. Das habe die Auswertung des Schlammanfalls der letzten vier Jahre ergeben, die beim Ingenieurwettbewerb angesetzten 9000 Kubikmeter erwiesen sich als viel zu wenig. Deshalb wird die Anlage auch teurer, bisher war von zwei Millionen Euro die Rede.
Damit die Kosten nicht explodieren, einigten sich die Bürgermeister der sechs Mitgliedsgemeinden auf einige Kompromisse. So fällt der ausgefaulte und gepresste Schlamm einfach in Container, entwässert wird er nicht mit einer Bandpresse, sondern einer kompakten Zentrifuge. Im Vorfeld besichtigten die Bürgermeister Kläranlagen im Kahlgrund, Schneidach und Bad Staffelstein.
Dass die Schlammmenge um 66 Prozent zulegt, auch durch Umstellung der Betriebsführung mit Einbau einer Vorklärung, ist deshalb nicht so schlimm, weil aus den Faulgasen Strom und Wärme erzeugt wird. Unterm Strich sinkt die Klärschlammmenge durch die Behandlung gegenüber bisher sogar um zwölf Prozent.
Das Prinzip ist bewährt: Der Klärschlamm aus der Anlage kommt in einen Faulturm, das Faulgas wird in einem Blockheizkraftwerk mit 50 Kilowatt elektrischer Leistung …mehr:
http://mobil.mainpost.de/regional/art772,6178021
(nach oben)
Rees/Kalkar: Ein Klärwerk für zwei Städte
Nach Inbetriebnahme der Druckrohrleitung wurde die Kläranlage in Haffen gestern außer Betrieb gesetzt. Kalkar und Rees sind nunmehr komplett an die Kläranlage in Kalkar-Hönnepel angeschlossen.
Da soll noch jemand sagen, der Rhein sei eine natürliche Grenze. Gestern wurde sie per Druck auf den roten Signalknopf aufgehoben. Auf jeden Fall in Sachen Abwasser. Denn seit gestern sind die beiden Städte Kalkar und Rees komplett an die Kläranlage in Kalkar-Hönnepel angeschlossen – rheinunterschreitend.
„Wenn überall die Zusammenarbeit so gut klappen würde wie hier im Abwasserbehandlungsverband!“, lobten die beiden Bürgermeister Christoph Gerwers, Rees, und Gerhard Fonck, Kalkar, die unkomplizierte Bauphase. Wie berichtet hatten die Gremien des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees im Jahr 2010 beschlossen, eine Druckrohrleitung von der Kläranlage Rees-Haffen bis zum Anschlusspunkt an der Rauhen Straße einzurichten. Diese Leitung ist nun fertiggestellt und ging gestern ans Netz.
Verbindung erfolgt „rheinunterschreitend“
Knapp sieben Kilometer lang ist die Leitung und wird ab sofort das Abwasser von Haffen und Mehr über …mehr:
http://www.derwesten.de/staedte/emmerich/Ein-Klaerwerk-fuer-zwei-Staedte-id4791893.html
(nach oben)
Oberreichenbach: Förderprogramm Wasserwirtschaft
Zuschuss für Projekte in Oberreichenbach;
Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner: Unterstützung für wichtige Vorhaben im Bereich Abwasserbeseitigung
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat jetzt Landesmittel in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro für wasserwirtschaftliche Projekte in Oberreichenbach (Landkreis Calw) freigegeben.
„Die geförderten Maßnahmen dienen der Strukturverbesserung der Abwasserbeseitigung. Mit dem gut angelegten Geld kann die Qualität der Abwasserversorgung und -reinigung für die Zukunft gesichert und weiter verbessert werden“, so Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner heute (3. Mai) in Karlsruhe.
Für die Stilllegung der Kläranlage Würzbach und den Abwasseranschluss an die Kläranlage Calmbach erhält die Gemeinde Oberreichenbach einen Zuschuss in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro.
Aufgrund des schwachen Vorfluters (Würzbach) werden an die Reinigungsleistung der Kläranlage erhöhte Anforderungen gestellt. Im Rahmen eines Strukturgutachtens wurde ermittelt, dass ein Anschluss an die Kläranlage Calmbach (Bad Wildbad) die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Das Abwasser wird künftig über eine 4,4 Kilometer lange Freispielleitung ins Ortsnetz von Calmbach geleitet und in der dortigen Kläranlage gereinigt. Ergänzend werden die beiden bestehenden Regenüberlaufbecken in Würzbach modernisiert und fernwirktechnisch an die Kläranlage in Calmbach angeschlossen.
Die Kanalisierung der Eberspieler Straße wird mit rund einer Million Euro gefördert.
Die Eberspieler Straße liegt im südlichen Teil des Ortsteiles Oberkollbach. Die bestehende Kanalisation weist dort starke Schäden und auch Überlastungen auf. Dies führt zu Fremdwassereintritt und lässt eine Verschmutzung des Grundwassers befürchten.
Der alte Mischwasserkanal wird durch einen neuen Schmutzwasserkanal sowie einen zusätzlichen Regenwasserkanal ersetzt, um anfallendes Regenwasser und Fremdwasser künftig getrennt ableiten zu können.
Gleichzeitig mit der Kanalsanierung plant die Gemeinde die Erneuerung der Wasserleitung sowie den Ausbau der Straßenfläche.
„Kommunen im ländlichen Raum haben für die Abwasserentsorgung aufgrund der oft flächenhaften Ausdehnung auf mehrere Teilorte und Wohnplätze wesentlich höhere Aufwendungen als Kommunen in Ballungsgebieten. Deshalb geht ein Großteil der Fördermittel in diese Gebiete“, so Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner.
Quelle: http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1326678/index.htm
(nach oben)
Mudau: Gemeinde erhält Zuschüsse für Abwasservorhaben
Die Gemeinde Mudau erhält für zwei Abwasservorhaben einen Zuschuss in Höhe von knapp 700.000 Euro aus dem wasserwirtschaftlichen Förderprogramm des Landes. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Mittel jetzt freigegeben.
„Die geförderten Maßnahmen dienen der Strukturverbesserung der Abwasserbeseitigung. Mit dem gut angelegten Geld kann die Qualität der Abwasserversorgung und -reinigung für die Zukunft gesichert und weiter verbessert werden“, so Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner heute (4. Mai) in Karlsruhe.
Der Großteil der Fördersumme (rund 613.000 Euro) ist für Maßnahmen im Ortsteil Mörschenhardt vorgesehen. Dort wird im Zuge des Ausbaus der Ernsttaler Straße auch die Abwasserentsorgung neu geordnet. Der momentan als Mischwasserkanal genutzte ehemalige Oberflächenwasserkanal soll wieder seine Funktion zur Ableitung von Außengebietswasser übernehmen. Mit dem Bau eines neuen Mischwasserkanals wird künftig nur noch das Abwasser der Kläranlage zugeführt, welches auch einer Behandlung bedarf. Nicht behandlungsbedürftiges Regenwasser wird direkt abgeleitet. Die Trennung spart nicht nur Betriebskosten bei der Abwasserbehandlung, sie gewährleistet außerdem eine bessere Reinigungsleistung der Kläranlage.
Im Ortsteil Mudau werden im Rahmen der Straßenraumgestaltung in der Langenelzer Straße auch der schadhafte Abwasserkanal sowie die zugehörigen Hausanschlüsse erneuert. Die Arbeiten finden in offener Bauweise auf einer Länge von etwa 345 Meter statt. Hierfür erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von rund 79.000 Euro.
„Kommunen im ländlichen Raum haben für die Abwasserentsorgung aufgrund der oft flächenhaften Ausdehnung auf mehrere Teilorte und Wohnplätze wesentlich höhere Aufwendungen als Kommunen in Ballungsgebieten. Deshalb geht ein Großteil der Fördermittel in diese Gebiete“, so Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner.
Mehr:
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1326978/index.htm
(nach oben)
Ingolstadt: Moderne Abluftfilter in der Kläranlage: Mailing kann aufatmen
Rund zwei Millionen Euro hat sich der Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt die neue Abluftbehandlungsanlage kosten lassen, die am Dienstag offiziell in Betrieb genommen wurde. Besonders die Mailinger dürfen sich freuen. „Das ist ein Stück Lebensqualität“, sagte der Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Scherer.
Bisher konnte der Klärschlamm nur sehr unregelmäßig getrocknet werden. Bei Ostwind musste die Trocknung stillgelegt werden, weil sonst …mehr:
http://www.donaukurier.de/lokales/kurzmeldungen/ingolstadt/Ingolstadt-Moderne-Abluftfilter-in-der-Klaeranlage-Mailing-kann-aufatmen;art74355,2426368
(nach oben)
Holzkirchen: Abwasser wird teurer
Auf die Holzkirchner Haus- und Wohnungsbesitzer kommt eine nicht allzu erfreuliche Neuerung zu: Zum 1. Juli steigen die Abwassergebühren von 1,25 Euro je Kubikmeter Abwasser auf dann 1,48 Euro. Das ist eine Erhöhung um 18,4 Prozent.
Der Gemeinde bleibe gar keine andere Wahl, sagt Albert Götz, Geschäftsführer der Gemeindewerke. „Wir müssen die Notbremse ziehen, sonst geht immer mehr Eigenkapital drauf.“ Dieses Eigenkapital betrifft nicht unmittelbar den Haushalt der Gemeinde, sondern das „Kommunalunternehmen Abwasser“ der Marktgemeinde. Die Gebühren konnten in den vergangenen Jahren die laufenden Kosten nicht mehr decken. Um die Bilanzen auszugleichen, musste Stammkapital zugebuttert werden, das sich aus staatlichen Zuschüssen für den Bau der Anlagen gespeist hatte. „Die Zuschüsse wurden an die Bürger weitergegeben“, sagt Götz. So blieben zwar die Gebühren niedrig, doch das Eigenkapital schrumpfte.
Auf Dauer, das war klar, konnte das nicht so weitergehen. „Denn irgendwann sind die Zuschüsse aufgebraucht“, sagt Götz. Zwischen den Jahren 2005 und 2009 summierten sich die operativen Jahresverluste auf 561 000 Euro, ausgeglichen jeweils vom Stammkapital.
Betroffen von der Erhöhung sind nicht nur Holzkirchner, sondern auch Otterfinger und Warngauer, die …mehr:
http://www.merkur-online.de/lokales/holzkirchen/abwasser-wird-teurer-1286303.html
(nach oben)
Herbrechtingen: Förderbescheid: Bissinger Abwasser fließt künftig nach Herbrechtingen
Sämtliche Befürchtungen sind vom Tisch, nach dem Regierungswechsel in Stuttgart könnte der geplante Anschluss Bissingens ans Herbrechtinger Abwassernetz gestrichen werden: Regierungspräsident Johannes Schmalzl hat jetzt den offiziellen Startschuss für das Vorhaben gegeben. Dies in Gestalt eines Regenüberlaufbeckens und eines Pumpwerks nördlich des Bissinger Sportplatzes, von wo aus eine Druckleitung nach Herbrechtingen verlegt wird. Schmalzl bezeichnete das gesamte Vorhaben, das auch den Anschluss Gerstettens und und die Stilllegung sieben kleiner Kläranlagen einschließt, aus mehrerlei Gründen als vorteilhaft: Zum einen würden freie Kapazitäten in der Mergelstetter Kläranlage genutzt, die aufgrund ihrer Größe eine besonders hohe Reinigungsleistung gewährleiste. Zum anderen …Mehr:
http://www.hz-online.de/nc/nachrichten/lokales/nachrichten/detail-news/article/foerderbescheid-bissinger-abwasser-fliesst-kuenftig-nach-herbrechtingen-1.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=508
(nach oben)
Greifswald: Desinfektionsmittel im Abwasser
Viele Kliniken in Greifswald heißt auch besonders viel Desinfektionsmittel im Abwasser. In Greifswald ist der Anteil an Desinfektionsmitteln im Abwasser besonders hoch, sogar fünf mal höher als in größeren Städten. Grund sind die vielen Kliniken in der Stadt. Mikrobiologen der Greifswalder Universität haben diese Belastung jetzt im zuständigen Klärwerk in Ladebow überprüft. Sie fanden heraus: In der Stadt leben vergleichsweise wenig Bürger, deshalb werde das Abwasser nicht in dem Maße verdünnt, wie in Großstädten, so ein Mikrobiologe.
Forscher geben Entwarnung – keine Verschmutzung
Die Forscher haben untersucht, ob die Bakterien im Klärwerk auch alle Desinfektionsmittel abtöten können. Das Ergebnis: Sie bringen ihre volle Leistung, das Abwasser wird gründlich geklärt und kann unbedenklich in den Greifswalder Bodden geleitet werden, ohne beispielsweise ein vermehrtes Algenwachstum zu verursachen. Wie genau die Bakterien die schädlichen Stoffe umwandeln …mehr:
http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/abwasser105.html
(nach oben)
Gerstetten: Gerstettens Anschluss an Mergelstetten wird teurer
Etwa 14,6 Millionen Euro: So viel kostet die Gemeinde der Anschluss an das Sammelklärwerk in Mergelstetten nach derzeitigem Stand. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stelle Tiefbauamtsleiter Jörg Halbauer die Nachträge der zuständigen Baufirma Leonard Weiss vor. Größter Brocken hierbei: Drei größere Höhen- und ein zusätzlicher Schieberschacht, die sich nach einer Druckstoßberechnung als notwendig erwiesen haben. Am teuersten kommt die Verwaltung hierbei der Schieberschacht im Bereich Heldenfingen. „Dieser eine Schacht allein kostet uns rund 67.000 Euro“, so Halbauer. Zwar sei er teuer, aber unerlässlich. Er verhindere im Fall eines Rückstoßes, dass ein Vakuum entstehe und …mehr:
http://www.hz-online.de/nc/nachrichten/lokales/nachrichten/detail-news/article/abwasser-gerstettens-anschluss-an-mergelstetten-wird-teurer.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=75
(nach oben)
Fürstenwalde: 335 000 Euro mehr für Klärwerks-Erweiterung
Die geplante Erweiterung der Kläranlage in Fürstenwalde wird um rund 335 000 Euro teurer, als ursprünglich angesetzt. Grund dafür ist, dass zwei zusätzliche Ablaufspeicher gebaut werden müssen.
Seit mehreren Jahren verhandeln nun schon das Umweltministerium, das Landesumweltamt und der Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland (ZVWA) über die Erweiterung des Fürstenwalder Klärwerkes. Hauptknackpunkt ist die Frage, wohin das geklärte Abwasser entsorgt wird. Bisher wird es verrieselt. Das hätte der Zweckverband weiterhin auch gerne getan, ist es doch die kostengünstigste Variante. Da die Verrieselung aber nicht mehr erlaubt ist, hätte der ZVWA gerne eine Einzelfallprüfung gehabt. Das Landesumweltamt war dagegen.
Statt dessen soll das Abwasser, wie schon lange im Gespräch, in die Müggelspree geleitet werden. Das allerdings ist ein besonders geschütztes Gebiet, für das besondere Auflagen gilt. Im Laufe des Verfahrens forderte das Landesumweltamt deshalb eine 4. Reinigungsstufe. „Es war auch die Rede von einer Membrananlage“, so Marlies Görsdorf, technische Geschäftsführerin des ZVWA. „Das hätte die Kosten für die Klärwerkserweiterung mehr als verdoppelt.“ Auch sei der Betrieb später teuer. Momentan geht der Zweckverband von Baukosten bis zu 7 Millionen Euro aus.
Im Vergleich dazu sind die Mehrkosten, von denen der Zweckverband nach weiteren Gesprächen und Gutachten nun ausgeht, fast bescheiden. Im Zuge der Klärwerkserweiterung, die aus Sicht des Verbandes längst überfällig ist, sollen nun zusätzlich zwei sogenannte Ablauf- speicher entstehen. Dort kann das gereinigte Abwasser zwischengespeichert werden und dosiert in die Müggelspree fließen.
Wobei die Speicher nur in Extremfällen zum Einsatz kommen sollen. Als Beispiel nennt Marlies Görsdorf Niedrigwasser in der Müggelspree und Dauerregen. Dann fällt viel Abwasser in der Kläranlage an, damit aber auch viel gereinigtes Wasser, das in die Müggelspree abgeleitet wird. In solch einem Fall besteht die Gefahr, dass sich die Qualität des FFH-Gebietes (Flora-Fauna-Habitat) verschlechtert – und das darf laut Gesetz nicht sein. Es gilt ein Verschlechterungsverbot. Mehr:
http://www.moz.de/details/dg/0/1/107025/?print=1&cHash=5c408f8c8100addcb71f2b6a2d8f3514
(nach oben)
Fuldatal: Gebühren für Abwasser werden erhöht
Die Haus- und Wohnungseigentümer beziehungsweise Mieter in Fuldatal müssen sich auf höhere Abwassergebühren einstellen. Nach einem Beschluss der Gemeindevertretung während der jüngsten Sitzung wird der Betrag zum 1. Juli von 3,50 Euro pro Kubikmeter auf 3,80 Euro pro Kubikmeter angehoben. Die …mehr:
http://www.localxxl.com/de/lokal_nachrichten/fuldatal/gebuehren-fuer-abwasser-werden-erhoeht-1306958042-ftz/
(nach oben)
Dümmer See: WASSERPROJEKT DER UNI WITTEN/HERDECKE ALS „SUCCESS STORY“ VOR DEM EUROPÄISCHEN PARLAMENT
Kläranlagen am Dümmer See profitieren von Beratung durch Umweltinstitut
Aus 215 Projekten zur Vorstellung herausgehoben worden
Das Generaldirektorat „Umwelt“ der Europäischen Kommission hat am 25. und 26. Mai 2011 im Europäischen Parlament Brüssel die Ergebnisse und Perspektiven des Förderprogrammes LIFE UMWELT vorgestellt. Eines der 215 geförderten Projekte kommt aus der Universität Witten/Herdecke und es wurde im Rahmen dieser Präsentation als Erfolgsgeschichte (Success Story) vor dem Parlament aus dem Bereich Wasserwirtschaft besonders hervorgehoben: Der Wasserverband Wittlage in Bad Essen hat mit innovativer Technologie und elektronischer Fernwirktechnik zwei Kläranlagen so verknüpft, dass die Abwasserbelastung erheblich reduziert werden konnte. Außerdem senkte der Umbau die Investitions- und Betriebskosten. Das Einzugsgebiet ist der international bekannte Dümmer See, ein von der EU registriertes Naturschutzgebiet von hoher ökologischer Bedeutung.
Das von Professor Rudolph vom Umweltinstitut an der Universität Witten/Herdecke entwickelte und betreute Projekt, berichtet über die Planungs-, Bau- und Betriebsphase dieses, mit 12,5 Mio. € vergleichsweise großen, EU Life-Vorhabens: „Es war nicht einfach, zwei Städte dazu zu bewegen, ihre Klärwerke zusammenzulegen. Am Ende haben beide davon profitiert, weil mit weniger Geld mehr an Schadstoffen aus dem Abwasser entfernt werden. Dadurch konnten beide Städte ihre Entsorgungsgebühren stabilisieren und sind so wettbewerbsfähiger. Ein schönes Beispiel für die so oft gescholtene ‚Europäische Politik'“
Kommunalvertreter aus England, Irland und Spanien interessierten sich dann auch für die Ergebnisse aus diesem und anderen erfolgreichen EU-LIFE-Projekten. „Wir wollen, dass das Know-How aus den Projekten nun in ganz Europa genutzt werden kann. Auch andere europäische Kommunen könnten dem Beispiel folgen, und es gibt auch beim deutschen Forschungsministerium im Verbundprogramm IWRM gute Vergleichsprojekte dafür“, rät Rudolph deutschen Interessenten. Auch gehört ist das Wittener Umweltinstitut mit Forschungsaktivitäten in Südafrika, Vietnam und im Iran zu den erfolgreichsten Wissenschaftsvertretern international.
Weitere Informationen bei Dipl.-Ökonom Daniel Gregarek, 02302 91 40 1-0
mail@uni-wh-utm.de
(nach oben)
Dietmannsried: Wasser wird ab Juli teurer
Nur Reicholzrieder zahlen durch Anschluss ans Gruppenklärwerk künftig weniger fürs Abwasser
Tiefer in die Tasche greifen müssen die Dietmannsrieder künftig für Wasser und Abwasser. Trinkwasser kostet ab Juli 1,10 Euro (bisher 1 Euro), Abwasser steigt von 1,18 Euro pro Kubikmeter auf 1,50 Euro. «Das hat aber nichts damit zu tun, dass Reicholzried am 1. Juli an das Abwassernetz der Gesamtgemeinde angeschlossen wird,» betonte Bürgermeister Hans-Peter Koch bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.
Ein saftiges Defizit machte die Gebührensteigerungen notwendig, begründete Kämmerer Christian Götsch. 60.000 Euro kamen beispielsweise in den letzten Jahren beim Trinkwasser zusammen. Mit 1,10 Euro pro Kubikmeter, so betonte Götsch, könne innerhalb von drei Jahren dieses Minus ausgeglichen werden.
«Wir hatten doch erst vor zwei Jahren den Wasserpreis …mehr:
http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/kempten/Kempten-wasser-kosten-abwasser-wasserwirtschaft-Wasser-in-Dietmannsried-wird-ab-Juli-teurer;art2760,980029
(nach oben)
Bern: Biogas aus der Kloake
Die ARA Bern Die ARA Bern reinigt nicht nur Abwasser, sie liefert auch Energie. Zurzeit reicht diese für 32 Bernmobil-Busse, bald soll es deutlich mehr sein. Zum Tag des Abwassers öffnet die Kläranlage ihre Türen.
Es riecht übel im Rechengebäude der Abwasserreinigungsanlage Region Bern (ARA Bern). Eine schmale Öffnung im Boden gibt den Blick frei auf die braune Brühe, die an dieser Stelle die Anlage erreicht. Anlagenleiter Adrian Fasel blickt kurz auf den Monitor an der Wand und sagt: «950 Liter pro Sekunde.» Der Schein der Lampe, die im Innern des Kanals angebracht ist, spiegelt sich in den Wellen des stinkenden Bachs. Das Wasser ist trüb, aber nicht undurchsichtig. Allerhand Gegenstände schwimmen darin – neben Fäkalien und Papier auch solche, die nicht die Toilette hinuntergespült gehören. So zum Beispiel Essensreste und Hygieneartikel. «Ein massives Problem sind die neuen Hygienetücher», sagt Fasel, «weil sie elastisch und nicht zerreissbar sind.» Das führe zu Problemen in den Pumpen. Ab und zu fänden sich auch Kuriositäten im Abwasser: Portemonnaies, Barbiepuppen, iPhones. «Wir bekamen auch schon Anrufe von Leuten, die wissen wollten, ob wir die Tausendernoten gefunden hätten, die sie versehentlich ins WC fallen gelassen hatten», erzählt Fasel.
Sechs Reinigungsstufen
Der Rechen ist die zweite von sechs Reinigungsstufen. Zuvor hat das Abwasser bereits den Kiesfang durchflossen. Es folgen der Sandfang, das Vorklärbecken, die biologische Reinigung und zuletzt der Sandfilter. Dann fliesst das Wasser in die Aare. Zurück bleibt – neben Feststoffen wie Sand und Papier – der Klärschlamm. Früher wurde er als Dünger auf den Feldern verteilt, doch das wurde verboten. Die Kläranlagen mussten sich nach anderen Verwendungs- beziehungsweise Entsorgungsmöglichkeiten umsehen.
Nicht nur Kläranlage
Heute ist die ARA Bern längst nicht mehr nur Reinigungsanlage, sondern auch Energieproduzent. Der Klärschlamm, der anfangs noch sehr viel Wasser enthält, wird eingedickt und in Faultürmen vergoren. Dabei wandeln Mikroorganismen die organischen Verbindungen im Schlamm zu Biogas um. Dieses wird bereits seit 1967, als die Anlage in Betrieb ging, verwendet, um den Schlamm vor dem Vergären zu erwärmen und die Gebäude zu heizen. Seit 2002 hat die ARA Bern ein Blockheizkraftwerk in Betrieb, das neben Wärme auch Elektrizität produziert. Weil es im Sommer aber mehr Wärme produzierte, als die Anlage brauchte, betreibt die ARA Bern seit 2008 zusätzlich eine Anlage, die aus dem Biogas Biomethan in Erdgasqualität macht. Dieses speist sie ins Erdgasnetz von EWB ein – die Menge reicht aus, um 32 Bernmobil-Busse zu betreiben.
Regionales Entsorgungszentrum
Die ARA Bern verarbeitet nicht nur den eigenen Klärschlamm, sondern auch jenen aus anderen Kläranlagen rund um Bern. «Wir sind eine Art regionales Entsorgungszentrum», sagt Fasel. Zusätzlich nimmt die ARA Bern seit 2004 andere organische Abfälle an, die sie zusammen mit dem Klärschlamm vergärt – und bewegt sich damit in einem umkämpften Markt…mehr:
http://www.derbund.ch/bern/Biogas-aus-der-Kloake-/story/20783632
(nach oben)
Althengstett: Zuschuss genehmigt
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat jetzt Landesmittel in Höhe von rund 543.000 Euro für strukturverbessernde Abwassermaßnahmen in Althengstett freigegeben.
Das Wasserrecht für die Kläranlage Ottenbronn ist ausgelaufen. Aufgrund des schwachen Vorfluters (Brombach) hätten im Rahmen einer neuen wasserrechtlichen Genehmigung erhöhte Anforderungen an die Kläranlage gestellt werden müssen. In einer von der Gemeinde beauftragten Untersuchung wurde deswegen die Variante Sanierung und Weiterbetrieb mit dem Anschluss an andere Kläranlagen verglichen. Die Stilllegung der Anlage und der Anschluss an Althengstett haben sich als die wirtschaftlichste Lösung erwiesen.
Künftig wird das Abwasser über eine 2.930 Meter lange Druckleitung bis nach Neuhengstett gepumpt. Von dort aus geht es über die bestehende Ortskanalisation bis zur Kläranlage in Althengstett weiter.
Weitere Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind der Umbau des bisherigen Belebungsbeckens zu einem zusätzlichen Regenüberlaufbecken sowie der Neubau einer Pumpstation.
Die aufnehmende Kläranlage in Althengstett verfügt über genügend Reserven, um die zusätzliche Abwassermenge aufzunehmen und kann aufgrund der dann besseren Auslastung wirtschaftlicher betrieben werden. Aber auch hier werden ergänzende Maßnahmen durchgeführt, um die Reinigungsleistung der Kläranlage zu verbessern.
„Durch die Infrastrukturförderung auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung wird besonders die Entwicklung des ländlichen Raums nachhaltig unterstützt“, so Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner.Mehr:
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1327550/index.htm
(nach oben)
ABTSGMÜND: Abwasser: Zwei Kommunen gehen einen Weg
Abtsgmünd und Adelmannsfelden gehen auf eine Kläranlage – Stuttgart steht dem Projekt wohlwollend gegenüber
Ein gutes Beispiel für gelungene interkommunale Zusammenarbeit nimmt mit der Kooperation von Abtsgmünd und Adelmannsfelden in punkto Abwasserbeseitigung erste Formen an. Geht es nach den Wünschen der beiden Gemeinden, könnte schon ab 2015 die Kläranlage Abtsgmünd als zentrale Anlage die Abwässer von Abtsgmünd, Pommertsweiler und Adelmannsfelden reinigen. Auch die Anlage Fischhaus würde wegfallen. „Verbunden wird das alles durch unterirdische Druckleitungen“, erklärt Christian Krieger, Ortsbaumeister von Abtsgmünd. Hier sei die Technik schon so weit, dass auch größer Entfernungen problemlos überbrückt werden könnten.
Die Kläranlage Abtsgmünd – Baujahr 1987 – habe eh eine Erweiterung und Sanierung nötig. „Da kommen wir langsam an unsere Kapazitätsgrenzen“, so Krieger. Da lag es nah, kreativ an das Thema heranzugehen. Denn eine erweiterte Anlage im Kochertal könnte weitere Anlagen unnötig machen. Das ist die Hauptaussage eines Strukturgutachtens, dass die Gemeinde Abtsgmünd in Auftrag gegeben hat. Diese Studie wurde 2009 vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Zuwendungen in Höhe von 11 000 Euro bezuschusst. „Als Schätzzahl stehen 5,4 Millionen Euro Investitionskosten im Raum“, sagt der Ortsbaumeister. Etwa 1,6 Millionen Euro davon betreffen übrigens den Adelmannsfelder Teil. Kriegers Chef, Abtsgmünds Bürgermeister Armin Kiemel, sieht hier die Chance auf ordentliche Zuschüsse aus Stuttgart. „Interkommunale Abwasserprojekte werden gut gefördert“, sagt der Schultes. Im Fall von Abtsgmünd geht er von 56 Prozent aus.
Noch mehr erwartet Adelmannsfeldens Bürgermeister Edwin Hahn: „Es stehen 78 Prozent Zuschüsse im Raum.“ Dies hätten erste Schätzungen ergeben. Daher sei die ganze Sache auch so lukrativ und attraktiv für seine Gemeinde. „Irgendwann müsste ich die Technik unserer Kläranlage …mehr:
http://www.nachrichten.de/panorama/Abtsgmuend-Adelmannsfelden-Klaeranlage-Fischhaus-Kochertal-cid_6347532/
(nach oben)
Kappe: Der Clou ist die Einfachheit
Was sich im Labor bereits bestätigt hat, soll nun in der Praxis erprobt werden: Die Beseitigung von Phosphat aus dem Abwasser der Kläranlage Kappe.
„Das Besondere ist, dass das Verfahren so einfach ist“, fasste Zehdenicks Stadtwerke-Chef Uwe Mietrasch den Versuchsaufbau auf der Anlage in Kappe zusammen. Nur äußerlich wirke der Versuchsaufbau für den Laien kompliziert. Tatsächlich aber mussten im Rahmen des Versuch viele Daten erhoben werden, was eine auf den ersten Blick verwirrende Verkabelung notwendig mache.
Mietrasch begrüßte am Dienstagnachmittag die an dem europäischen Forschungsprojekten beteiligten Wissenschaftler und andere Experten aus Frankreich, Italien, Deutschland und Luxemburg, die sich über den laufenden Versuch informierten.
In mehreren großen Plastikbottichen, die in einem Gartenhaus untergebracht sind, lagern insgesamt rund 500 Kilogramm Schlacke aus einem Stahlwerk in Eisenhüttenstadt. Das bereits in der Pflanzenkläranlage gereinigte Abwasser wird durch diese Bottiche geleitet und der Phosphatgehalt durch eine chemische Umwandlung drastisch reduziert. Die Schlacke eliminiere den Nährstoff. Anschließend werde in zwei Neutralitätsstufen unter anderem durch …mehr:
http://www.die-mark-online.de/nachrichten/landkreis-oberhavel/zehdenick/clou-einfachheit-1238498.html
(nach oben)
Winterberg: „Die Produkte und Systemlösungen von HST haben uns überzeugt.“
Das sagen unsere Kunden: Henrik Weiß, Stadtwerke Winterberg
„Es war sicher auch die räumliche Nähe, die uns vor 2 Jahren dazu bewogen hat, die Zusammenarbeit mit HST Hydro-Systemtechnik aufzunehmen. Was uns aber noch mehr überzeugt hat, sind die Produkte und Systemlösungen von HST für die Leit- und Fernwirktechnik, die genau zu unserem Anforderungsprofil passen. Außerdem haben wir einen Partner gesucht, der in der Lage ist, mit uns gemeinsam die besten Lösungen zu finden und uns kompetent zu begleiten.“
Für die Stadtwerke Winterberg werden von HST nach und nach die rund 25 Bauwerke für die Abwasserentsorgung mit der Fernwirktechnik TeleMatic und dem Prozessleitsystem HydroDat V8 ausgestattet. Hinzu kommen Produkte aus der Maschinentechnik, mehr:
http://www.systemtechnik.net/aktuell/aktuelles/artikel/stadtwerke-winterberg/
(nach oben)
Weißenfels: Unsauberkeiten im Abwasser
Anzeigen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und von Bürgern haben die stetige Entwicklung des Weißenfelser Schlachthofes bisher nicht aufhalten können. Jetzt machen BUND und Bürgerinitiative Pro Weißenfels das Tönnies-Unternehmen für die Überschreitung von Grenzwerten für die Einleitung von Abwasser des Klärwerkes in die Saale verantwortlich und hoffen auf breite Unterstützung, soll die Stadt Weißenfels doch mehrere Millionen Euro Strafe für die Überschreitungen zahlen.
Matthias Riedl und Nicole Reppin (BUND) von der Bürgerinitiative Pro Weißenfels legen die Zahlen des Betriebsführungstagebuches des Klärwerkes vor, um die Angaben des Tönnies-Werkes zu widerlegen, dass nur zweimal und in geringem Maße die zulässigen Zulaufhöchstmengen ins Klärwerk 2010 überschritten worden seien. „Es geschah 31-mal und um bis zu elf Prozent“, so Reppin.
„Das stimmt nicht“, versichert Tönnies-Geschäftsführer Josef Tillmann. Und seine Erklärung, dass Daten falsch zugeordnet wurden – nämlich dass nicht die Mengen des vom Fleischwerk bereits über eine Flotationsanlage vorgereinigten Wassers erfasst sind, sondern jene, die in die Flotationsanlage des Fleischwerkes einlaufen – wird von Claudia Girnus, der Geschäftsführerin des Weißenfelser Abwasserzweckverbandes, bestätigt. „Das Tagebuch ….mehr:
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1299744066544
(nach oben)
Schopfloch: „Eine gute Lösung gefunden“
Der Zweckverband Abwassergruppe Haugenstein lässt seinen Klärschlamm vom Biogasanlagenbetreiber Buhl auf dem Kaltenhof bei Sulz entsorgen. Dies bezeichnete der Verbandsvorsitzende Klaas Klaassen als gute Lösung.
Das Thema Klärschlamm hatte im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt. Nachdem eine kreisweite Lösung geplatzt war, zeigte sich Klaassen in der jüngsten Sitzung des Zweckverbands froh, dass die Klärschlammentsorgung jetzt geregelt und zukunftsfähig ist. Der Klärschlamm wird direkt auf der Kläranlage in Dettingen abgeholt. „Im Vergleich zur früheren Entsorgung eine ökologisch wesentlich bessere Situation“, unterstrich Klaassen. Die Kosten für die Entsorgung durch den Biogasanlagenbetreiber liegen bei 68 Euro …mehr:
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.schopfloch-eine-gute-loesung-gefunden.1b4eaa83-ce87-4066-a60d-ba5de21f5220.html
(nach oben)
Schöntal: Grünes Licht für Landesförderung von Kanalsanierungsarbeiten in der Gemeinde Schöntal (Hohenlohekreis)
Rund 530.000 Euro für den Gewässerschutz – Regierungspräsident Johannes Schmalzl: „Daseinsvorsorge insbesondere für Kommunen im ländlichen Raum zunehmend schwieriger“
Regierungspräsident Johannes Schmalzl hat heute (21. April 2011) grünes Licht für die Auszahlung von Landesmitteln in Höhe 532.200 Euro für Kanalsanierungsarbeiten im Ortsteil Bieringen der Gemeinde Schöntal (Hohenlohekreis) gegeben. „In Zeiten knapper Kassen gestaltet sich die Daseinsvorsorge insbesondere für Kommunen im ländlichen Raum zunehmend schwieriger“, so Regierungspräsident Johannes Schmalzl. „Umso mehr freut es mich, dass wir die Gemeinde Schöntal bei der Sanierung von Abwasserkanälen unterstützen können. Durch den Zuschuss gelingt es, gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbare Abwasserpreise zu gewährleisten.“
Über eine Härtefallregelung in den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2009 können Kommunen, die ein effektives Wasser- und Abwasserentgelt von 6,90 Euro pro Kubikmeter erreichen, in Einzelfällen eine Zuwendung für Kanalsanierungs- und
erneuerungsmaßnahmen erhalten.
Im Regierungsbezirk Stuttgart sind aktuell für 2011 Fördermittel in Höhe von 10,6 Millionen Euro für kommunale Abwassermaßnahmen bereitgestellt worden. Damit konnte an vielen Stellen der Ausbau und die Modernisierung von Abwasserbeseitigungsanlagen weiter umgesetzt werden.
Quelle:
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1326318/index.htm
(nach oben)
Schieder-Schwalenberg: Durchgängiger Ablauf in Klärwerk und Außenstation
2500 m³ Abwasser von ca. 10.000 Einwohnern aus acht Orten werden bei trockenem Wetter täglich in die Kanäle zur Kläranlage in Schieder geleitet.
Die Automatisierungstechnik von Phoenix Contact sorgt im Klärwerk für einen durch-gängigen Ablauf und steuert, regelt und überwacht zuverlässig das Hauptwerk sowie vier Pumpstationen und Regenüberlauf-becken.
Die Applikation
Zwecks Herstellerneutralität sollte im Klärwerk Schieder die OS2-Fernwirkanlage durch ein Windowsbasierendes System ersetzt werden. Benachbarte Klärmeister empfahlen der Stadt Schieder-Schwalenberg GmbH das Technische Softwarebüro iPATEC und die Automatisierungstechnik von Phoenix Contact.
Offene Protokolle, die eine Ankopplung an bestehende Systeme einfach realisierbar machen, hatten iPATEC schon in vergangenen Projekten überzeugt. Weitere Vorteile des Systems: flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse dank modularer Bauweise, Übersichtlichkeit bei der Störungssuche und vereinfachte Wartung.
Eine Reduktion von Kabelbäumen ist durch die dezentrale Aufteilung der I/O-Stationen möglich. Nach einer Vergleichsrechnung fiel die Entscheidung für eine vollständige Modernisierung und Umstellung aller Komponenten auf Produkte von Phoenix Contact.
Die Lösung
Antonio Algarve von iPATEC konzipierte und programmierte für die Kläranlage Schieder eine Automatisierungslösung und schaffte zusätzlich neue Möglichkeiten, regelnd in den Prozess einzugreifen.
Im Rahmen einer ethernetbasierenden durchgängigen Automatisierung kommen im Zentralschrank zwei RFC 430 Steuerungen zum Einsatz. Neben der Steuerung und Regelung des Prozesses wurde auch das bestehende Mosaikbild in das neue Automatisierungskonzept …mehr:
http://www.phoenixcontact.de/branchen/26449_27580.htm
(nach oben)
Salach: zahlt die Gebühren zurück
Der Millionenüberschuss bei den Abwassergebühren verursachte in Salach einen hohen Wellenschlag. Nun soll er aber über neun Jahre hinweg zurückgezahlt werden. Im Haushaltsbeschluss wurde dies verankert.
Einfach ist die Sache nicht. Bis zum Jahr 2006 erzielte die Gemeinde Salach bei den Abwassergebühren noch einen Überschuss, als dann aber das Aus für die Papierfabrik kam war es damit vorbei. Zur Überdeckung beim Abwasser kam eine Unterdeckung bei den Wassergebühren hinzu. Beides, die Abrechnung der Versorgung und der Entsorgung, werden in Salach innerhalb des regulären Gemeindehaushalts gebucht. In den meisten anderen Kommunen erfolgt dafür eine separate Kostenrechnung.
Nach 23 Jahren standen am Ende des vergangenen Jahres rund 1,47 Millionen Euro Mehreinnahmen im Abwasserbereich rund 570 000 Euro Mindereinnahmen beim Frischwasser gegenüber. Dies bedeutet nach Angaben der Gemeindeverwaltung im Saldo einen Überschuss von 900 000 Euro. Ein Betrag, den Ex-Kämmerer Valentin Maichl noch im Mai 2010 hatte zurückzahlen wollen. Dann änderte sich die Interpretation der Rechtslage. Nach einem neuen Urteil des Verwaltungsgerichtshofes …mehr:
http://www.swp.de/goeppingen/lokales/mittleres_filstal/Salach-zahlt-die-Gebuehren-zurueck;art5777,949781
(nach oben)
Porta Westfalica: Modernisierung der Kläranlage
Der Abwasserbetrieb der Stadt Porta Westfalica wurde für die transparente Zugriffsmöglichkeit auf alle Daten, nach ISO 9001 und DIN EN 14001 zertifiziert.
Täglich betreiben rund 40 Mitarbeiter zwei größere Klärwerke, Möllbergen und Nammen, sowie 20 Pumpstationen, neun Rückhalte-becken und zwölf Regenüberläufe.
Die vollbiologische Kläranlage Möllbergen sammelt das Abwasser von vier südlichen Stadtteilen, ca. 12.000 Einwohnern, Porta Westfalicas.
Die Applikation
Im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen wurden die Belüftungstechnik, die Vorreinigung, die Schlammentwässerung und die Elektro- und Automatisierungstechnik im Klärwerk Möllbergen erneuert. Dazu gehören die Fernüberwachung der Unterstationen sowie eine direkte Verbindung zwischen den Automatisierungs- und SAP-Systemen als Grundlage für eine laufzeitabhängige Wartung.
Beide Kläranlagen können über das Microsoft-basierte, multitaskingfähige Prozessleitsystem (PLS) in der Leitwarte bedient und beobachtet werden. Neben dem offenen PLS Aucoprovis von Firma Aucotec war den Betreibern wichtig, ein Bussystem einzusetzen, welches auf offenen Schnittstellen basiert. Hier kam aufgrund der guten Erfahrung mit INTERBUS ST-Modulen im Schwester-Klärwerk Nammen nur das Feldbussystem INTERBUS in Frage
Mehr:
http://www.phoenixcontact.de/branchen/26449_27572.htm
(nach oben)
München: Stadtentwässerung München Einsatz eines neuen Prozessleitsystems
Ein neues Prozess-Leittechnik-Konzept im Klärwerk Gut Großlappen in München er-forderte die Erneuerung der Datenfern-übertragung.
Nach einem öffentlichen Ausschreibungs-verfahren erhielt Firma Hautz GmbH aus Lenting, Spezialist für rechnergestützte Automation, den Auftrag, die Fernwirktechnik der dezentralen Kanalnetz-Stationen der Regenmesser und Regionaleinleiter zu modernisieren.
In diesem Projekt wurden Überspannungs-schutz, Signalkonverter, Stromversorgungen sowie Automatisierungstechnik von Phoenix Contact vorgesehen.
Die Applikation
32 Stationen, welche im Stadtgebiet von München verteilt sind, sollten dezentral auto-matisiert sowie sämtliche Daten zum Klärwerk übertragen werden.
Die Messdaten von den Freiluftschränken sollten mittels Festverbindung eines Telefonanbieters zu einer Subzentrale geführt und über ein eigenes Glasfaserkabel
ca. 14 km zum Klärwerk übertragen werden.
Ebenso war die Installation einer weiteren Subzentrale direkt im Klärwerk gewünscht; welche über eigene Fernmeldeleitungen von vier weiteren Stationen Daten zur Verfügung stellt. Die Anbindung an das Prozessleitsystem sollte über einen OPC-Server erfolgen.
Die Lösung
Phönix:In den Außenstationen sorgen jetzt Steuerungen vom Typ ILC 200 IB mit I/O- Modulen sowie RS232 Scheiben aus der IP20-Produktfamilie Inline und entsprechende Modems für einen reibungslosen Betrieb.
Als Subzentrale 1 kommt eine Hochleistungs-SPS vom Typ RFC 430 mit insgesamt 27 Inline RS232 Modulen und 27 auf Standleitungsbetrieb konfigurierten Phoenix Contact-Modems zum Einsatz.
Mehr: http://www.phoenixcontact.de/branchen/26449_27565.htm
(nach oben)
Möhringen: Die Pumpen werden aus dem Keller geholt
Die Stadt investiert 2,1 Millionen Euro in die Modernisierung des Möhringer Klärwerks.
Es war eine Entscheidung, die ohne Diskussion fiel. Der Gemeinderat stimmte Ende März zu, dass für etwas mehr als zwei Millionen Euro die sogenannte Vorklärung im Möhringer Klärwerk erneuert wird. Baubeginn soll im Juli sein. Als Gesamtbauzeit sind drei Jahre veranschlagt.
An ihnen hat doch merklich der Zahn der Zeit genagt: Die beiden Vorklärbecken sind mehr als 30 Jahre alt. „Die Technik schreitet natürlich voran“, sagt Thomas Bosler, der für den Betrieb des Klärwerks verantwortlich ist. Nicht nur die Elektroinstallation ist veraltet, auch erste Betonschäden an der Oberfläche sind deutlich sichtbar. Durch die Vorklärbecken fließt das Abwasser langsam hindurch. Feste Teile setzen sich am Boden ab und werden von Räumerbrücken, eine Art großer Schieber, in eine Mulde gedrückt. Dieser sogenannte Primärschlamm wird dann durch Pumpen …mehr:
http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2864637_0_9223_-die-pumpen-werden-aus-dem-keller-geholt.html
(nach oben)
LAUENBURG: Kläranlage erzeugt Teil ihres Stroms und eigene Wärme
Die Versorgungsbetriebe Elbe GmbH beschreiten in Boizenburgs Partnerstadt Lauenburg neue Wege zur eigenen Energieversorgung. Sie nahmen auf der Kläranlage ein neues Blockheizkraftwerk in Betrieb. Mit dem symbolischen Knopfdruck vor Mitarbeitern und Besuchern der Stadtbetriebe setzte Geschäftsführer Joachim Schöttler den Antriebsmotor mit seinen sechs Zylindern und den Generator in Gang.
Die Anlage nutzt zur Erzeugung des elektrischen Stroms das Klärgas, das bei der Behandlung von Abwasser und Schlamm entsteht. Es kann jedoch auch mit Erdgas betrieben werden. Die Umschaltung erfolge automatisch. Die elektrische Leistung von 50 Kilowatt verringert die notwendige Stromabnahme für die Kläranlage aus dem öffentlichen Netz um bis zu 50 Prozent. Der Wärmebedarf kann mit der in Betrieb genommenen Anlage vollständig abgedeckt werden. Die thermische Leistung (84 kW) wird über Heizungsvor- und Rücklaufleitungen in den Herzkreislauf im Maschinen- und Betriebsgebäude eingespeist. Rund…mehr:
http://www.prignitzer.de/nachrichten/lokales/hagenow/artikeldetails/article//klaeranlage-erzeugt-teil-ihres-stroms-und-eigene-waerme.html
(nach oben)
Holzminden: Grüne gegen Subvention für Ziegenfabrik
7.500 Ziegen sollen in der geplanten Ziegenfarm gehalten werden. Der umstrittene Bau einer Ziegenfabrik im Landkreis Holzminden sorgt weiter für Ärger. Wegen der zugesagten Subventionierung einer Abwasserpipeline für das Großprojekt auf dem Gelände der Domäne Heidbrink haben die Grünen jetzt den Landesrechnungshof eingeschaltet. Die Kritik richtet sich gegen Umweltminister Hans-Heinrich Sander. Der FDP-Politiker will die Abwasserleitung für die Ziegenfarm der Firma Petri-Feinkost mit bis zu 1,125 Millionen Euro aus der Landeskasse unterstützen. Das geht aus einer Stellungnahme des niedersächsischen Umweltministeriums hervor.
Grüne wenden sich an Landesrechnungshof
„Die Richtlinie, auf die sich der Minister beruft, gilt seit 2006 nicht mehr“, sagte der Grünen-Abgeordnete Christian Meyer am Mittwoch in Hannover. Die heute gültigen Vergaberichtlinien erlaubten eine Förderung von Abwassertransportleitungen der Kommunen nicht mehr, da sie zu einer Verbesserung der Umweltsituation nicht beitragen. Meyer habe sich daher mit einem Brief an den Landesrechnungshof gewandt und die Überprüfung der beabsichtigten Vergabe gefordert.
Zuschüsse auch von Landkreis und Gemeinde
Insgesamt solle der Bau der Pipeline rund 2,6 Millionen Euro kosten, sagte Meyer. Er vermutet hinter der Förderung eine „politisch motivierte Zweckentfremdung von Umweltmitteln für einen befreundeten Unternehmer in Sanders Wahlkreis“. Unter dem Vorbehalt der Landesförderung hätten zudem der Landkreis Holzminden und die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle Zuschüsse von 200.000 Euro bzw. 100.000
http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/harz/ziegenfarm101.html
(nach oben)
WITTSTOCK: URTEIL – Moderater Beitrag für Altanschluss
Verbandsversammlung des Wittstocker Wasser- und Abwasserverbandes fasst Grundsatzbeschluss
Bei Grundstückseigentümern und Wohnungsgesellschaften gab es schon Klarheit, wer als Altanschließer gilt. Wieviel diese nun als Anschlussbeiträge erst nach Jahrzehnten der Nutzung dafür berappen müssen, darüber konnte bisher nur gerätselt werden. Befürchtungen, dass jetzt Unsummen nachzuzahlen wären, bestätigen sich nicht, das Gegenteil ist der Fall. Allerdings reicht auch diese Spanne von um 500 Euro bei Kleingrundstücken bis zu 400 000 Euro bei Großvermietern, nur für den Abwasser-Altanschluss.
Die Verbandsversammlung vom Wasser- und Abwasserverband Wittstock hat jetzt eine Entscheidung getroffen, „die sehr moderat und zugunsten der Grundstückseigentümer ausfällt und dabei dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts gerecht wird“, sagt Verbandsvorsteher Jörg Gehrmann nach der Sitzung am 16. Mai in Wittstock.
Ein vollständiger Verzicht auf die Beteiligung von Altanschließern ist juristisch nicht möglich. In der jetzt herausgegebenen Presseerklärung …mehr:
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12090759/61299/Verbandsversammlung-des-Wittstocker-Wasser-und-Abwasserverbandes-fasst-Grundsatzbeschluss.html
(nach oben)
WEICHERING: Abwasser wird teurer
Einleitungsgebühr wird sukzessive auf 2,50 Euro erhöht
Weichering Erhitzt haben sich die Gemüter in der Weicheringer Gemeinderatssitzung am Montag an der Erhöhung der Einleitungsgebühr für das Abwasser, die vom Landratsamt gefordert wurde. „Das ist unsozial und geht mir gegen den Strich“, bewertete Gemeinderat Georg Niedermeier die stufenweise Anhebung der Gebühr von derzeit 1,89 auf 2,50 Euro pro Kubikmeter bis zum Jahr 2013. Man sollte zunächst nur den Beschluss einer Erhöhung auf 2,30 Euro für ein Jahr tätigen und abwarten, wie sich die Kostensituation 2012 entwickelt.
Nachdem das Landratsamt aus Kostendeckungsgründen eine sofortige Erhöhung auf 2,50 Euro zur Auflage gemacht hatte, stand das Thema bereits in der Sitzung vor vier Wochen auf der Tagesordnung. Damals kam das Gremium überein…mehr:
http://www.augsburger-allgemeine.de/neuburg/Abwasser-wird-teurer-id15125731.html
(nach oben)
Traunreut: Investitionen im Klärwerk
677 000 Euro haben die Stadtwerke an der Kläranlage Traunreut investiert, um den Betrieb der Anlage abzusichern und sie effizienter zu betreiben. Dabei wurden die Rechenanlage und das Dach der Rechenanlage erneuert sowie der Gasbehälter saniert.
An der Rechenanlage war es nach 23 Jahren Dauerbetrieb des Rechens und der weiteren Ausstattung zum Entfernen der Feststoffe aus dem Abwasser der Stadt Traunreut und der angeschlossenen Gemeinde Nußdorf an der Zeit für eine Sanierung. Laut technischem StadtwerkeLeiter Franz Hagener bestand die Gefahr, dass der einzige Rechen völlig ausfällt und dadurch der Klärprozess gefährdet wird.
Für 448 000 Euro wurden zwei neue Rechen eingebaut. Ein Grobrechen mit einem Stababstand von sechs Millimeter filtert nun den gröbsten Schmutz heraus, ein Feinrechen mit drei Millimeter Stababstand feinere Verunreinigungen. Der gefilterte Schmutz wird an einer neuen Rechengutanlage gewaschen und gepresst, um das Volumen zu reduzieren.
An einer eigenen Sandwaschanlage werden außerdem organische Substanzen von Sand und Kies getrennt. Erneuert wurde dabei auch die Zuführung des Abwassers zur Rechenanlage. Die Anlage ist künftig auch in das…mehr:
http://www.chiemgau-online.de/portal/lokales/trostberg-traunreut_Investitionen-im-Klaerwerk-_arid,1344265.html
(nach oben)
Straubing: Klimafreundliche Energie aus Abwasser / Bayerisches Vorzeigeprojekt
In Straubing dient Abwasser der Wärmerückgewinnung. Die Anlage in Niederbayern ist ein Vorzeigeprojekt für klimafreundliche Energie, betonte Dr. Markus Söder, Umweltminister, heute bei der offiziellen Inbetriebnahme: „In Straubing kommt eine bislang ungenutzte Ressource zum Einsatz: Abwasser kann das ganze Jahr über klimafreundliche Energie liefern.“ Fossile Energie werde eingespart, zugleich die Energieeffizienz gesteigert. Mittels einer Wärmepumpe werden 102 Wohnungen mit 7.150 Quadratmetern Wohnfläche klimafreundlich beheizt. Das Bayerische Umweltministerium fördert die Anlage mit rund 220.000 Euro.
Das erstmals angewandte Verfahren wurde von einem bayerischen Unternehmen entwickelt. In Straubing wird Abwasser aus dem Kanal entnommen und über einen Wärmetauscher geführt. Die Wärme des Abwassers kann mit modernster Technologie zurück gewonnen werden. „Das reduziert den CO2-Ausstoß gegenüber einer herkömmlichen Heizung um bis zu 80 Prozent“, so Söder. Solche Projekte leisteten einen wichtigen Beitrag, den CO2-Ausstoß zu senken.
Neben Abwasser sind laut Söder auch andere Abwärmequellen zunehmend energetisch nutzbar. So könnten Abgas- oder Kühlwasserströme als Energieressourcen verwendet werden. Der Energie-Atlas Bayern zeigt unter www.energieatlas.bayern.de die vorhandenen Potenziale von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz in Bayern auf. Er enthält digitale Karten zu den Erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind oder Biomasse sowie zu Abwärme und ist kostenlos abrufbar.
Quelle: Umweltministerium
(nach oben)
Schopfloch: „Eine gute Lösung gefunden“
Der Zweckverband Abwassergruppe Haugenstein lässt seinen Klärschlamm vom Biogasanlagenbetreiber Buhl auf dem Kaltenhof bei Sulz entsorgen. Dies bezeichnete der Verbandsvorsitzende Klaas Klaassen als gute Lösung.
Das Thema Klärschlamm hatte im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt. Nachdem eine kreisweite Lösung geplatzt war, zeigte sich Klaassen in der jüngsten Sitzung des Zweckverbands froh, dass die Klärschlammentsorgung jetzt geregelt und zukunftsfähig ist. Der Klärschlamm wird direkt auf der Kläranlage in Dettingen abgeholt. „Im Vergleich zur früheren Entsorgung eine ökologisch wesentlich bessere Situation“, unterstrich Klaassen. Die Kosten für die Entsorgung durch den Biogasanlagenbetreiber liegen bei 68 Euro ohne Mehrwertsteuer pro Tonne. „Hier haben wir zusammen mit der Stadt Horb eine gute Lösung gefunden“, so der Verbandsvorsitzende. Er informierte ferner, dass als Partner auch Fluorn-Winzeln und der Zweckverband Unteres Glatttal mitmachen.
Zu Problemen mit Schmutzwasser bei Starkregen …mehr:
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.schopfloch-eine-gute-loesung-gefunden.1b4eaa83-ce87-4066-a60d-ba5de21f5220.html
(nach oben)
Rüthnick: will zum TAV Fehrbellin
Gemeinde gibt Eigenständigkeit auf
Als einzige Gemeinde des Amtes Lindow gab Rüthnick bis heute sein Wasserwerk und seine Abwasserentsorgung nicht aus der Hand. Das soll sich nun ändern: Die Gemeinde will dem Trink- und Abwasser-Zweckverband Fehrbellin beitreten – möglichst schon zum 1. Juli. Diesen Beschluss fassten die Gemeindevertreter am Mittwochabend. Lediglich Bürgermeister Roland Fröhlich und seine Frau Brigitte (beide SPD) enthielten sich.
Mit der Bewirtschaftung der Gemeindewerke Rüthnick hatte das Dorf bislang die Firma Eurawasser mit Sitz in Leuna beauftragt. Eurawasser hatte den Bürgern die Rechnungen ins Haus geschickt, das Wasserwerk und das Klärwerk gewartet. Darüber hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Ärger gegeben. Aus dem Klärwerk soll Fäkalschlamm in Gräben gelaufen sein – was die Firma bestritt. Auch die Untere Wasserbehörde stellte damals in den Gräben keine Schadstoffe fest.
Mehr:
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12051385/61299/Gemeinde-gibt-Eigenstaendigkeit-auf-Ruethnick-will-zum-TAV.html
(nach oben)
Mespelbrunn: Kanalsanierung in Mespelbrunn
Die Abwasserkanäle in Mespelbrunn sind marode und sollen in den kommenden zehn Jahre saniert werden: Auf die Gemeinde kommen Kosten in Höhe von fast zwei Millionen Euro zu. Weiter ist offen, ob die Bürger direkte Beiträge beisteuern müssen und wie hoch diese sein könnten. Bernd Mehler vom Würzburger Ingenieurbüro …mehr:
http://www.main-netz.de/nachrichten/aktuelles/art81887,1645507
(nach oben)
Marbach: Der Klärschlamm soll künftig verbrannt werden
Artikel aus der Marbacher Zeitung vom 21.05.2011
Marbach/Ludwigsburg Landkreis will mit Anlage den Mülltourismus in die östlichen Bundesländer stoppen. Von Oliver von Schaewen
Klärschlamm gehört nicht aufs Feld. Zu viele Schadstoffe, vor allem Schwermetalle, aber auch Rückstände von Medikamenten, würden in den Nahrungskreislauf gelangen. Fragt sich, wo die Reste aus den Klärwerken am besten aufgehoben sind. Derzeit karrt der Landkreis Ludwigsburg einen Großteil in die neuen Bundesländer. Der Schlamm dient dazu, riesige Flächen des Braunkohletagebaus aufzufüllen. „Das ist gesetzlich zulässig, aber wenig umweltfreundlich“, sagt Carsten Scholz, Leiter des Referats Umwelt im Landratsamt Ludwigsburg.
Besser wäre aus Sicht des Kreishauses, den Klärschlamm zu verbrennen. Der Vorteil: Schadstoffe werden aus dem Naturkreislauf genommen. Landesweit werden derzeit schon mehr als 85 Prozent des Klärschlamms auf diese Weise entsorgt. Der Landkreis Ludwigsburg hinkt dagegen hinterher. Er kommt gerade mal auf aktuell etwa 28 Prozent und belegt in der Statistik den letzten Platz. „Andere Landkreise sind wesentlich weiter“, weiß Scholz, der die rote Laterne gerne abgeben würde.
Weil die Abwasserbeseitigung in den Händen der Kommunen liegt, versucht das Landratsamt alle Betreiber von Kläranlagen unter einen Hut zu bringen. Wirtschaftlich lohne sich die Verbrennung, wenn mindestens rund 70 Prozent des gemeinsamen Schlammes thermisch …mehr:
http://content.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2893259_0_5397_-der-klaerschlamm-soll-kuenftig-verbrannt-werden.html
(nach oben)
Hainrode: 260.000 Euro für Ausbau der Abwasserentsorgung in der Gemeinde
Thüringens Umweltminister Jürgen Reinholz hat heute in Hainrode (Landkreis Nordhausen) dem Abwasserzweckverband Bode-Wipper einen Förderbescheid über rund 260.000 Euro für Bauvorhaben im Bereich der Abwasserentsorgung der Gemeinde Hainrode übergeben. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt rund 575.000 Euro.
Mit dem Geld wird in Hainrode das wasserwirtschaftliche Ortsnetz in der Dorfstraße im Trennsystem ausgebaut, um die Gewässerqualität zu verbessern. Das Abwasser der Gemeinde wird über einen vorhandenen Verbindungssammler bis nach Hünstein geleitet, von wo aus es über den noch zu errichtenden Verbindungssammler (610 Meter Schmutzwasserkanal) bis zur Kläranlage Wollersleben gelangen soll. Dadurch sollen weitere 198 Einwohner an die Kläranlage angeschlossen und das Regenwasser in den „Hainröder Bach“ (450 m Regenwasserkanal) eingeleitet werden.
Der Ausbau ist erforderlich, um die anspruchsvollen Anforderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen. Danach soll bis 2015 – mit Ausnutzung aller Verlängerungsoptionen spätestens bis 2027 – ein guter Zustand aller Gewässer erreicht werden. Die kommunalen Abwasserbeseitigungspflichtigen und der Freistaat Thüringen investieren dafür bis 2015 rund 410 Millionen Euro.
Hintergrund:
Zum Abwasserzweckverband (AWZV) Bode-Wipper gehören 15 Gemeinden und Ortsteile, deren Abwässer über ein Kanalnetz von rund 160 Kilometer Länge entsorgt werden. Der AWZV entsorgt zurzeit Abwässer von rund 13.000 Einwohnern sowie den ortsansässigen Gewerbetreibenden, die an die fünf zentralen Kläranlagen angeschlossen sind.
http://www.thueringen.de/de/tmlfun/aktuell/presse/55289/uindex.html
(nach oben)
Eisenach-Erbstromta: Pollmeier fordert weitere Rücktritte im TAV
Zur Versammlung des Trink- und Abwasserverbandes Eisenach-Erbstromtal (TAV) am Dienstag ist Geschäftsleiter Thomas Fritz nach Unregelmäßigkeiten abberufen worden. Ralf Pollmeier, Verbandsrat aus Creuzburg, fordert nun in einem öffentlichen Brief weitere Schritte.
So erwartet er nach dem Rücktritt des einstigen TAV-Vorsitzenden Christian Köckert auch die Niederlegung weiterer Ämter. Köckert (CDU) trägt als ehrenamtlicher Beigeordneter Mitverantwortung für die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Eisenach.
„Ich habe als Verbandsvorsitzender die Aufgabe, alle im Raum stehenden Vorwürfe rechtsstaatlich aufzuklären“, antwortete Oberbürgermeister Matthias Doht (SPD). „Für seine städtische Tätigkeit gibt es bislang keine Vorwürfe gegen Köckert.“ Doht lehnt eine Vorverurteilung daher ab und sieht seine Hauptaufgabe darin, den Verband jetzt arbeitsfähig zu halten. Außerdem verweist er darauf, dass …mehr:
http://www.otz.de/startseite/detail/-/specific/Pollmeier-fordert-weitere-Ruecktritte-im-TAV-Eisenach-Erbstromtal-1974714864
(nach oben)
Bode-Wipper: 260.000 EURO FÜR AUSBAU DER ABWASSERENTSORGUNG IN DER GEMEINDE HAINRODE
Der Abwasserzweckverband Bode-Wipper hat am Montag einen Förderbescheid über rund 260.000 Euro für Bauvorhaben im Bereich der Abwasserentsorgung der Gemeinde Hainrode (Landkreis Nordhausen) erhalten. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt rund 575.000 Euro. Mit dem Geld wird in Hainrode das wasserwirtschaftliche Ortsnetz in der Dorfstraße im Trennsystem ausgebaut, um die Gewässerqualität zu verbessern.
Das Abwasser der Gemeinde wird nach Angaben des Umweltministeriums über einen vorhandenen Verbindungssammler bis nach Hünstein geleitet, von wo aus es über den noch zu errichtenden Verbindungssammler …mehr:
http://www.regioweb.de/details/meldung/260000-euro-fuer-ausbau-der-abwasserentsorgung-in-der-gemeinde-hainrode/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=24&cHash=f5ac9debba4db86e4923415a31e18f1f
(nach oben)
Altensteig: Eine spezielle Pumpe macht’s möglich
Das Abwasser von Wenden wird künftig in der Kläranlage Altensteig gereinigt. Ebhausens Bürgermeister Volker Schuler und der Vorsitzende des Abwasserzweckverbands Oberes Nagoldtal, Gerhard Feeß, unterzeichneten den Vertrag.Im Klärwerk im Ebhauser Ortsteil Wenden wären größere Investitionen wie der Einbau einer Simulationstechnikanlage erforderlich gewesen, erklärte Schuler bei der Vertragsunterzeichnung im Beisein des technischen Leiters der Altensteiger Anlage, Hermann Unsöld, des kaufmännischen Leiters, Udo Hirrle, Klaus Raidt vom Ingenieurbüro Raidt und Geier und des Klärwärterteams mit Betriebsleiter Gottlieb Thoma, seinem Stellvertreter Tobias Weiß sowie Hans Roller.
„Wir haben zahlreiche Alternativen geprüft“, machte Schuler deutlich. Auch wenn das restliche Abwasser der Gemeinde Ebhausen Richtung Nagold fließe – am Ende habe sich die Ableitung aus dem Ortsteil Wenden ins Altensteiger Klärwerk wirtschaftlich und technisch als die rentabelste Lösung herauskristallisiert.
Doch noch fehlen die baulichen Voraussetzungen. Um das Abwasser ins höher gelegene Wart transportieren zu können, bedarf es neben einer 1450 Meter langen Druckleitung, die mit Hilfe eines Pflugverfahrens verlegt werden soll, auch eines speziellen Pumpwerks. Zudem muss die Anlage in Wenden umgebaut werden. Geplant ist der Bau eines 175 Kubikmeter fassenden Regenüberlaufbeckens (RÜB).
Mehr:
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.altensteig-wuertt-eine-spezielle-pumpe-macht-s-moeglich.2959f7bb-e87a-4013-842b-6e063a185630.html
(nach oben)
Kelleramt: Großes Interesse bei Besichtigung der ARA
Mitte Januar besichtigten Mitarbeiter eines Schweizer Ingenieurbüros zusammen mit Vertretern des Abwasserverbandes Region Müllheim und Vertretern des zuständigen Amtes für Umwelt die Kläranlage Kelleramt in Unterlunkhofen, Schweiz. Die Kläranlage Kelleramt wurde 2007 im Zuge einer Erweiterung mit Cleartec® Biotextil ausgerüstet. Der erfolgreiche Einsatz des Systems wurde insbesondere anhand positiver Leistungstests bei normalen und niedrigen Temperaturen deutlich. Die Betriebsergebnisse der Anlage sind hervorragend.
Hintergrund des Besuches sind die Ausbaupläne des Abwasserverbandes Region Müllheim für eine ihrer Abwasserreinigungsanlagen, bei der der Einsatz von Cleartec® Biotextil als Aufwuchsträger für Mikroorganismen in Erwägung gezogen wird. Die Besichtigung wurde mit einer Diskussionsrunde abgeschlossen, wobei die Besucher großes Interesse für das System Cleartec® Biotextil …mehr:
http://www.cleartec.de/groses-interesse-bei-besichtigung-der-ara-kelleramt/
(nach oben)
Hannover: Bürger beschweren sich über Geruchsbelästigung
Die Geruchsbelästigung in Seelze hält an: Obwohl Honeywell nach eigener Aussage Schäden an Rohrleitungen beseitigt hat, klagen viele Bürger weiterhin über unerträglichen …mehr:
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Region/An-der-Leine/Seelze/Buerger-beschweren-sich-ueber-Geruchsbelaestigung
(nach oben)
Gruiten: Klärwerk schließt
Der Bergisch-Rheinische Wasserverband will das Gruitener Abwasser ab 2013 in die Kläranlage Mettmann pumpen und reinigen. Dadurch ließen sich im Jahr rund 170 000 Euro sparen.
http://www.rp-online.de/duesseldorf/hilden/nachrichten/hilden/Klaerwerk-Gruiten-schliesst_aid_992729.html
(nach oben)
Augustdorf: Mehr Sicherheit für die Mitarbeiter der GWA
PersonenNotsignalAnlage :
Erfolgreiche Einführung eines nach BGR 139 / DIN VDE0825-11 zertifizierten PNA System auf der Kläranlage Augustdorf.
(Gemeindewerke Augustdorf).
Für die Mitarbeiter in den Bereichen der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung wurde Anfang März auf der Kläranlage ein gemeinsames PNA System in Betrieb genommen.
Die Auslegung des PNA Systems erfolgte an die speziellen Anforderungen kleiner und mittelgroßer Kläranlagen mit einem Bereitschaftdienst. Die Besonderheiten der Systemlösung liegt u.a. in der Berücksichtigung, dass die Kläranlage über keine über 24 Stunden besetzte Leitwarte verfügt, keine 24 Stunden personalbesetzte Pforte besitzt, aber eine 24 stündige Bereitschaft unterhält.
Als Fachplaner für die Elektrotechnik haben wir ein PNA System, abgestimmt auf die lokale Situation der GWA, komplett geplant und deren fachgerechte Erstellung überwacht.
Quelle:
http://www.bl-automation.de/bl_automation/aktuelles/meldungen/PNA_System_KA_Augustdorf.php?navanchor=5410000
(nach oben)
Affalterbach: Der Klärschlamm hat ein anrüchiges Geschmäckle
Nur in Wolfsölden dürfen Landwirte im Kreisgebietbelastete Rückstände nutzen.
Gut bis sehr gut, mit diesen Noten schneiden die 30 Kläranlagen im Landkreis Ludwigsburg regelmäßig bei den Leistungstests der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) ab. Ein wichtiger Punkt bei der Untersuchung ist der Klärschlamm. Er sollte wegen Schwermetallanteilen nicht mehr auf die Felder, empfiehlt die Umweltministerin Tanja Gönner. Daran halten sich im Landkreis inzwischen fast alle Kommunen. Einzige Ausnahme ist die Gemeinde Affalterbach. Sie stellt den Klärschlamm in Wolfsölden immer noch den Landwirten zur Verfügung.
Zu den Bauern, die gelegentlich Klärschlamm der Anlage nutzen, zählt Wolfgang Häußermann, langjähriger stellvertretender Bürgermeister der 4600-Einwohner-Gemeinde. „Die Schwermetall-Anteile des Schlamms liegen unter den Grenzwerten“, weiß er. Das Landratsamt Ludwigsburg untersuche zusätzlich solche Werte im Boden. Für Wolfgang Häußermann ist klar: „Nur wenn die Kontrollwerte stimmen, sollte der Klärschlamm weiter genutzt werden.“ Bereits jetzt würden viele Landwirte darauf…mehr:
http://content.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2458834_0_1972_-der-klaerschlamm-hat-ein-anruechiges-geschmaeckle.html
(nach oben)
Walldürn: Neues Regenüberlaufbecken in Walldürn, Förderprogramm Wasserwirtschaft
Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner: Ländlicher Raum wird besonders gefördert
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat jetzt Landesmittel in Höhe von rund 865.000 Euro für ein neues Regenüberlaufbecken in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) freigegeben.
Das neue Becken entwässert künftig die Bau- und Gewerbegebiete Galgen, Spitzenacker und Buschlein sowie das künftige Baugebiet „Lindig“. Damit wird die bestehende Kanalisation in diesem Bereich entlastet. Hier kam es in der Vergangenheit häufig zu Überflutungen in der Seestraße sowie den nahegelegenen Gleisanlagen der Deutschen Bahn. In der Planungsphase wurden etliche Ausführungsvarianten und Standorte für das Becken überprüft, da sowohl eine Bundesstraße als auch eine Bahnlinie zu queren sowie ein Höhenunterschied von zwölf Metern auf kurzer Strecke zu überwinden sind. Zur Ausführung kommt nun ein Kombinationsbecken, bestehend aus einem Stauraumkanal und anschließendem Rechteckbecken mit einem Gesamtvolumen von 411 m³.
„Durch die Infrastrukturförderung auf dem Gebiet der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wird besonders die Entwicklung des ländlichen Raums nachhaltig unterstützt“, so Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner.Mehr:
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1326679/index.htm
(nach oben)
Regnitzlosau: Preis für Wasser und Abwasser stabil
Die Wasserpreise und die Abwassergebühren in Regnitzlosau bleiben stabil. Möglich machen das die ausreichenden Einnahmen und die Sonderrücklagen, die Defizite aus den kommunalen Eigenbetrieben abfedern.
So konnten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung nach den von der kommissarischen Kämmerin vorgelegten Zahlen den alten und neuen Preisen zustimmen. Der Wasserpreis beträgt in den nächsten zwei Jahren pro Kubikmeter 1,78 Euro brutto und der Abwasserpreis 1,23 Euro in diesem Jahr. Das ist im Vergleich zu dem, was die Bürger in anderen Kommunen des Landkreises Hof bezahlen müssen, sehr günstig.
Möglich ist das aber nur, weil die Gemeinde über eine eigene Kläranlage verfügt, die jetzt für einen Millionenbetrag saniert werden muss. Einnahmenüberschüsse bei Wasser und Abwasser können nach Aussage …mehr:
http://www.frankenpost.de/lokal/hofrehau/rehau/art2452,1619634
(nach oben)
Oberreichenbach: Zuschuss für Projekte
Förderprogramm Wasserwirtschaft
Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner: Unterstützung für wichtige Vorhaben im Bereich Abwasserbeseitigung
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat jetzt Landesmittel in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro für wasserwirtschaftliche Projekte in Oberreichenbach (Landkreis Calw) freigegeben.
„Die geförderten Maßnahmen dienen der Strukturverbesserung der Abwasserbeseitigung. Mit dem gut angelegten Geld kann die Qualität der Abwasserversorgung und -reinigung für die Zukunft gesichert und weiter verbessert werden“, so Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner heute (3. Mai) in Karlsruhe.
Für die Stilllegung der Kläranlage Würzbach und den Abwasseranschluss an die Kläranlage Calmbach erhält die Gemeinde Oberreichenbach einen Zuschuss in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro.
Aufgrund des schwachen Vorfluters (Würzbach) werden an die Reinigungsleistung der Kläranlage erhöhte Anforderungen gestellt. Im Rahmen eines Strukturgutachtens wurde ermittelt, dass ein Anschluss an die Kläranlage Calmbach (Bad Wildbad) die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Das Abwasser wird künftig über eine 4,4 Kilometer lange Freispielleitung ins Ortsnetz von Calmbach geleitet und in der dortigen Kläranlage gereinigt. Ergänzend werden die beiden bestehenden Regenüberlaufbecken in Würzbach modernisiert und fernwirktechnisch an die Kläranlage in Calmbach angeschlossen.
Die Kanalisierung der Eberspieler Straße wird mit rund einer Million Euro gefördert.
Die Eberspieler Straße liegt im südlichen Teil des Ortsteiles Oberkollbach. Die bestehende Kanalisation weist dort starke Schäden und auch Überlastungen auf. Dies führt zu Fremdwassereintritt und lässt eine Verschmutzung des Grundwassers befürchten.
Der alte Mischwasserkanal wird durch einen neuen Schmutzwasserkanal sowie einen zusätzlichen Regenwasserkanal ersetzt, um anfallendes Regenwasser und Fremdwasser künftig getrennt ableiten zu können.
Gleichzeitig mit der Kanalsanierung plant die Gemeinde die Erneuerung der Wasserleitung sowie den Ausbau der Straßenfläche.
„Kommunen im ländlichen Raum haben für die Abwasserentsorgung aufgrund der oft flächenhaften Ausdehnung auf mehrere Teilorte und Wohnplätze wesentlich höhere Aufwendungen als Kommunen in Ballungsgebieten. Deshalb geht ein Großteil der Fördermittel in diese Gebiete“, so Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner.
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1326678/index.htm
(nach oben)
Neubulach: Kläranlage wird aufgegeben
Land fördert Abwasserbeseitigung;
Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner: Hohes Niveau der Abwasserreinigung wird gesichert
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat jetzt Landesmittel in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro für die wasserwirtschaftliche Strukturverbesserung in Neubulach (Landkreis Calw) freigegeben.
Die Kläranlage der Stadt Neubulach ist in ihrem derzeitigen Ausbaustandard sowohl hydraulisch als auch biologisch überlastet. Untersuchungen ergaben, dass die Modernisierung und Erweiterung der Anlage am Standort unwirtschaftlich ist, zumal aufgrund des schwachen Vorfluters (Ziegelbach) nach heutigen Maßstäben erhöhte Anforderungen an die Reinigungsleistung zu stellen sind. Deshalb wird die Kläranlage der Stadt Neubulach stillgelegt.
Begleitende Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung, insbesondere der Neubau eines Retentionsbodenfilters, sorgen künftig dafür, die Abwassermenge in Neubulach möglichst gering zu halten. Das verbleibende Abwasser wird in Zukunft über eine neue 1,3 Kilometer lange Druckleitung in Richtung Nagoldtal abgeleitet, wobei aufgrund der Höhendifferenz auf ein Pumpwerk verzichtet werden kann. Von dort aus geht es weiter über eine bestehende Sammelleitung zur Kläranlage in Calw-Hirsau. Dort wird das Abwasser gereinigt.
„Kommunen im ländlichen Raum haben für die Abwasserentsorgung aufgrund der oft flächenhaften Ausdehnung auf mehrere Teilorte und Wohnplätze wesentlich höhere Aufwendungen als Kommunen in Ballungsgebieten. Deshalb geht ein Großteil der Fördermittel in diese Gebiete. Die Qualität der Abwasserversorgung und Abwasserreinigung im Land hat Dank der Investitionen von Land, Städten und Gemeinden ein hohes Niveau erreicht“, so Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner.Mehr:
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1326321/index.html
(nach oben)
Mudau: erhält Zuschüsse für Abwasservorhaben
Die Gemeinde Mudau erhält für zwei Abwasservorhaben einen Zuschuss in Höhe von knapp 700.000 Euro aus dem wasserwirtschaftlichen Förderprogramm des Landes. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Mittel jetzt freigegeben.
„Die geförderten Maßnahmen dienen der Strukturverbesserung der Abwasserbeseitigung. Mit dem gut angelegten Geld kann die Qualität der Abwasserversorgung und -reinigung für die Zukunft gesichert und weiter verbessert werden“, so Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner heute (4. Mai) in Karlsruhe.
Der Großteil der Fördersumme (rund 613.000 Euro) ist für Maßnahmen im Ortsteil Mörschenhardt vorgesehen. Dort wird im Zuge des Ausbaus der Ernsttaler Straße auch die Abwasserentsorgung neu geordnet. Der momentan als Mischwasserkanal genutzte ehemalige Oberflächenwasserkanal soll wieder seine Funktion zur Ableitung von Außengebietswasser übernehmen. Mit dem Bau eines neuen Mischwasserkanals wird künftig nur noch das Abwasser der Kläranlage zugeführt, welches auch einer Behandlung bedarf. Nicht behandlungsbedürftiges Regenwasser wird direkt abgeleitet. Die Trennung spart nicht nur Betriebskosten bei der Abwasserbehandlung, sie gewährleistet außerdem eine bessere Reinigungsleistung der Kläranlage.
Im Ortsteil Mudau werden im Rahmen der Straßenraumgestaltung in der Langenelzer Straße auch der schadhafte Abwasserkanal sowie die zugehörigen Hausanschlüsse erneuert. Die Arbeiten finden in offener Bauweise auf einer Länge von etwa 345 Meter statt. Hierfür erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von rund 79.000 Euro.
„Kommunen im ländlichen Raum haben für die Abwasserentsorgung aufgrund der oft flächenhaften Ausdehnung auf mehrere Teilorte und Wohnplätze wesentlich höhere Aufwendungen als Kommunen in Ballungsgebieten. Deshalb geht ein Großteil der Fördermittel in diese Gebiete“, so Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner.
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1326978/index.htm
(nach oben)
Immenstaad: Inbetriebnahme BHKW
Die Kläranlage Immenstaad hat sich – zu unserer großen Freude – für ein Senergie BHKW entschieden. Im November 2010 wurde die Anlage in Betrieb genommen.
Quelle: http://www.senergie.de/
(nach oben)
Emschergenossenschaft: vergibt Wasserzeichen
hat das Wasserzeichen „Route des Regenwassers“ an das Universitätsklinikum Essen vergeben. Das Wasserzeichen steht als Symbol für einen natürlichen Wasserkreislauf. „Als Großunternehmen im Gesundheitswesen möchten wir neben der Gesundheit des Einzelnen auch zur Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung beitragen. Der nachhaltige Umgang mit Regenwasser auf dem Klinikareal mit seinen vielen Gebäuden ist dafür ein anschauliches Beispiel“, so der Ärztliche Direktor Prof. Eckhard Nagel, der nun das Wasserzeichen entgegennahm.
Das UK Essen hat das Wasserzeichen erhalten, weil Regenwasser von etwa 25.000 m2 Dachfläche der Klinikgebäude vom Abwassersystem abgekoppelt worden ist. Dieses saubere Regenwasser wird nun direkt in den neu gestalteten Borbecker Mühlenbach geleitet, der nun kein offener Abwasserkanal mehr ist, sondern als klarer Bach südöstlich des Klinikgeländes fließt. Die für das Projekt notwendigen Bau- und Straßenarbeiten auf dem Gelände des UK Essen erstreckten sich über ein Jahr. Da für die abgekoppelten Flächen keine Entwässerungsgebühr mehr gezahlt …mehr:
http://www.uk-essen.de/aktuelles/detailanzeige0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1103&cHash=cef59750f8ff3761576251b605ee65ce
(nach oben)
Neuburg/Donau: Phosphorgewinnung auf der Kläranlage startet am 12.5.2011
Phosphor-Recycling macht Fortschritte
Wegweisendes Umweltprojekt in Bayern: technisch-wissenschaftliche Koordination am KIT – Pilotanlage geht in Betrieb
Phosphor gehört zu den lebenswichtigen Elementen, ist endlich und nicht austauschbar. Die weltweit wirtschaftlich erschließbaren Reserven reichen noch circa 100 Jahre. Wissenschaftler am KIT haben nun ein Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphor aus Abwasser weiterentwickelt, das die Stadt Neuburg in Bayern in einem Pilotprojekt im Klärwerk einsetzt. Am Donnerstag, 12. Mai, geht die Anlage in Betrieb.
In Händen des Kompetenzzentrums für Materialfeuchte (CMM) am KIT liegt die technisch-wissenschaftliche Koordination des Projekts, das im Frühjahr vergangenen Jahres startete. Nun geht es in seine dritte und entscheidende Phase. Die Labor- und Halbtechnikversuche waren erfolgreich: „Sie lassen für den Pilotzeitraum auf der Kläranlage ebenfalls einen erfolgreichen Betrieb erwarten“, sagt der Leiter des CMM, Dr. Rainer Schuhmann.
Ziel des Projektes ist es, Phosphor teilweise aus Abwasser auszusondern und als wieder verwertbares Produkt einen Rohphosphat-Ersatzstoff zu generieren. Dazu haben die Forscher um Schuhmann das P-RoC-Verfahren (Phosphorus Recovery from waste and process water by Crystallisation) weiterentwickelt. Damit lässt sich in der Abwasserphase gelöstes Phosphat mittels Kristallisation an Calcium-Silicat-Hydrat-Phasen (CSH) als phosphathaltiges Produkt zurückgewinnen. Dieses einfache und effektive Prinzip, so erklärt Schuhmann, „liefert ein pflanzenverfügbares Produkt, das zum Beispiel ohne weitere Aufbereitung als Düngemittel einsetzbar ist.“ Kooperationspartner im Projekt sind auch die Firma Cirkel GmbH & Co. KG aus Rheine und die HeidelbergCement AG.
Läuft alles nach Plan, wird die Pilotphase in Neuburg in etwa in einem halben Jahr abgeschlossen sein. Danach erfolgt eine Evaluierung, die insbesondere auch Aufschluss geben soll über die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit des P-RoC-Verfahrens. „Dann wird man wissen, ob 20, 30 oder noch mehr Prozent der jährlich anfallenden circa 30 Tonnen Phosphor aus dem Neuburger Abwasser zurückgewonnen werden können“, sagt Rainer Schuhmann. Eines sei jedoch schon jetzt sicher: „Die Qualität des recycelten Phosphors ist hervorragend, weil er vollständig pflanzenverfügbar ist und mehrere Pflanzennährstoffe zur Verfügung stellt.“
Beurteilen wollen die Projektbeteiligten dann auch, ob sich mit der Phosphor-Rückgewinnung für Kommunen wie Neuburg eine lohnenswerte neue Einnahmequelle auftut. Immerhin stieg der Preis für die Tonne Phosphaterz an den Rohstoffbörsen von April 2007 bis August 2008 von 40 auf 430 US-Dollar pro Tonne. Aktuell liegt er bei 120 US-Dollar pro Tonne.
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den Gesetzen des Landes Baden-Württemberg. Es nimmt sowohl die Mission einer Universität als auch die Mission eines nationalen Forschungszentrums in der Helmholtz-Gemeinschaft wahr. Das KIT verfolgt seine Aufgaben im Wissensdreieck Forschung – Lehre – Innovation.
Weiterer Kontakt:
Klaus Rümmele
http://www.kit.edu/besuchen/pi_2011_6792.php
(nach oben)
GÜTERSLOH: Schluss mit Klärschlammexport?
Ratsmehrheit will Transport in ostdeutsche Bundesländer prüfen lassen
Gütersloh. 7.700 Tonnen Klärschlamm sind 2010 im Klärwerk Putzhagen angefallen; sie wurden samt und sonders auf Äcker in Ostdeutschland und Schleswig-Holstein ausgefahren. Ein Vorgehen, das CDU, Grüne und UWG nun hinterfragen.
Die drei Fraktionen fordern die Stadtverwaltung in einem gemeinsamen Antrag auf, andere Entsorgungsvarianten zu prüfen – zum einen, weil es möglicherweise einen ökologischeren Weg gibt, zum anderen, weil derzeit die gesetzliche Klärschlammverordnung überarbeitet wird. Kommenden Montag debattiert der Umweltausschuss über diesen Prüfantrag.
Um den Klärschlamm aus Putzhagen loszuwerden, hat die Stadt vor Jahren ein Partnerunternehmen aus Brandenburg …mehr:
http://www.nw-news.de/lokale_news/guetersloh/guetersloh/4317210_Schluss_mit_Klaerschlammexport.html
(nach oben)
Landau: Schlau(ch)lining in Landau
Clevere Bauplanung der KMG Pipe Technologies GmbH reduzierte bei einem Kanalsanierungsprojekt in Landau die Kosten um 138.000 Euro.
Bekanntermaßen ist die Kanalsanierung durch Schlauchlining an und für sich schon eine intelligente Alternative zum Kanalneubau. Ein aktuelles Projekt der KMG Pipe Technologies GmbH in Landau/Pfalz zeigt, dass die Art und Weise, wie man ein Schlauchlining-Projekt plant und durchführt, ein zusätzliches Nutzen-Potential frei setzen kann. Bei der Sanierung eines begehbaren Mischwasser-Transportsammlers im Stadtteil Queichheim konnte dank eines kreativen Sondervorschlages zur Bauabwicklung auf den Bau diverser Hausanschluss-Schächte verzichtet werden, was als Ersparnis von 138.000 Euro zu Buche schlug.
Die gesammelten Abwässer der Stadt Landau fließen auf dem letzten Weg zu Kläranlage in begehbaren Betonkanälen durch den dörflich strukturierten Vorort Queichheim. Der um die Jahrhundertwende gebaute Kanal hatte sich in den letzten Jahren aufgrund von Undichtigkeiten zu einem unabweisbaren Sanierungsfall entwickelt. Im Herbst 2010 sollten daher im Auftrage der Entsorgungs- und Wirtschaftbetrieb Landau AÖR und nach einem Konzept des Ingenieurbüros Rolf Walk aus Landau, 465 Meter Eiprofil 900/1350 und 105 Meter Beton-Kreisprofil DN 1400 per Schlauchlining saniert werden. In den engen Gassen Queichheims war eine offene Erneuerung keine wirklich ernst zu nehmende Option. Solch ein Projekt hätte den Anliegerverkehr für Monate zusammen brechen lassen und die unmittelbar angrenzende Wohnbebauung möglicherweise schwer beeinträchtigen können. Die konsequent grabenlose Technik des Schlauchlining war hier also praktisch alternativlos, zumal diese Lösung die hydraulische Kapazität des Sammlers weitest gehend erhielt.
Sondervorschlag führte zur Auftragsvergabe
Im Zuge der öffentlichen Ausschreibung des Projektes setzte sich die KMG Pipe Technologies GmbH mit dem Pull-Inliner (ehemals KM- Inliner) und einem Sondervorschlag gegen die Konkurrenz durch, …mehr:
http://www.bi-umweltbau.de/Artikel_UB_1_11_Schlau_ch_lining_in_Landau.AxCMS
(nach oben)
Ohm-Seenbach: Technik-Aufrüstung sparte 123000 Euro Stromkosten
Abwasserverband Ohm-Seenbach investiert weiter in Modernisierungs-Maßnahmen
Der Abwasserverband Ohm-Seenbach hat in den vergangenen acht Jahren durch technische Umrüstung allein in der Kläranlage Nieder-Ohmen den Jahres-Stromverbrauch von 460 000 auf 300 000 Kilowattstunden gesenkt und damit Stromkosten in Höhe von 123 000 Euro gespart. Darüber informierten gestern die Geschäftsführerin des Verbandes, Sabine Bork, sowie die beiden Bürgermeister aus dem Verbandsgebiet, Matthias Weitzel (Mücke) und Frank Ide (Grünberg).
Im Jahre 2003 war in der Kläranlage ein „Fuzzy-Logic-Regler“ als Steuerelement eingebaut worden. Damit können Systeme auch sinnvoll gesteuert werden, wenn es keine mathematischen Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgabegrößen gibt. Der Regler wurde aus Mitteln der Abwasserabgabe finanziert. Mehr:
http://www.passavant-intech.de/page/de/page_ID/1/action/24/call/article/site_code/pi/news_part_ID/25/news_ID/19?PHPSESSID=1eb876dae6dfc457bde51a2fc1a72cf2
(nach oben)
Selmsdorf: Widerstand gegen Pläne der Deponie
Anwohner protestieren gegen den Bau einer Klärschlammtrocknungsanlage auf dem Ihlenberg. Selmsdorfer Gemeindevertretung berät über Veränderungssperre für ein 220 Hektar großes Gebiet.
Knapp 400 Meter liegen zwischen der Selmsdorfer Straße in Schönberg und der Mülldeponie Ihlenberg. „Die Grundstücke und Häuser haben keinen Wert mehr“, sagt Anwohnerin Birgit Schreinert. Die Menschen in der Selmsdorfer Straße sahen mit an, wie in ihrer Nachbarschaft seit 1979 eine Deponie entstand und nach und nach zu einer der größten ihrer Art in Europa ausgebaut wurde. Gefragt wurden sie nicht. Doch nun melden sie sich vehement zu Wort. „Wir sitzen ja schon seit Jahrzehnten mit dem Gestank hier an und wollen nicht, dass uns noch etwas vor die Nase gesetzt wird“, sagt Kuno Witt. So wie er legen auch andere Anwohner der Selmsdorfer Straße Einspruch ein gegen das neue Vorhaben der landeseigenen Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG): den Bau einer Klärschlammtrocknungsanlage. Maximale Kapazität laut Genehmigungsverfahren beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg: 18 000 Tonnen pro Jahr.
„Wir haben nicht vor, es gleich in vollem Umfang zu realisieren“, sagt IAG-Geschäftsführer Dr. Berend Krüger. Woher der Klärschlamm komme und wie er eventuell weiterverwertet werde, das könne die IAG derzeit nicht sagen, aber: „Industrielle Schlämme wollen wir nicht trocknen. Wir denken an Schlämme aus kommunalen Kläranlagen.“ Die IAG sei …mehr:
http://www.selmsdorf-live.de/index.php?id=129&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6618&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2
(nach oben)
Stegaurach: Jetzt wird mit Abwasser geheizt
Die Kläranlage der Gemeinde Stegaurach liefert künftig den größten Teil der von ihr benötigten Energie selbst. Die neue Heizung nutzt die Wärmeenergie des Wassers im Klärbecken
Es klingt ebenso genial wie einfach: Eine Kläranlage bezieht ihre Energie aus der Wärme des Abwassers, das sie selbst reinigt. Aber in ganz Franken gab es bislang nur eine solche Anlage, in Uettingen im Landkreis Würzburg. Jetzt wird das auch in Stegaurach so gemacht. Vorher wurden das Betriebsgebäude, die Werkstatt und das Rechengebäude der Kläranlage mit Nachtspeicheröfen und Heizstrahlern beheizt. Der Stromverbrauch der gesamten Anlage lag dadurch bei rund 50 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr (kWh/a). 37 500 Kilowattstunden – das entspricht in etwa dem Verbrauch von zehn Drei-Personen-Haushalten – will die Gemeinde nun mit der neuen Anlage einsparen. Die CO2 -Emission wird dadurch um 35 Tonnen im Jahr auf etwa 8,75 Tonnen reduziert.
Im Auftrag des Betreibers Südwasser hat …mehr:
http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/bamberg/Jetzt-wird-mit-Abwasser-geheizt;art212,149310
(nach oben)
Hamburg: Energie aus Hamburgs Kanalisation
Im Klärwerk Köhlbrandhöft wird aus Abwasser Biogas hergestellt. Seit heute wird es ins Netz eingespeist
Steinwerder. Hamburg ist um einen ökologischen Rohstoff reicher: Biogas aus dem Abwasser der städtischen Kanalisation. Von dem Klärwerk Köhlbrandhöft auf Steinwerder strömt es seit heute unter der Elbe hindurch in die Hansestadt. Gestern nahmen der Hamburg-Energie-Chef Michael Beckereit und Klärwerksleiter Hartmut Schenk die Aufbereitungsanlage in Betrieb.
„18 Millionen Kilowattstunden Biomethan sollen im Jahr eingespeist werden“, sagte Beckereit. Ein kleiner Anteil im Vergleich zu den konventionellen Gasressourcen: Im Schnitt können damit nur 900 Haushalte versorgt werden. Der städtische Stromkonzern bietet es seinen Kunden in Anteilen zu einem oder zehn Prozent an.
Etwa 400 000 Kubikmeter Kanalisationsbrühe erreichen das Klärwerk täglich. Das ist mehr Wasser, als die Binnenalster fasst. Bei der Reinigung entsteht Schlamm, aus dem das Gas gewonnen wird. In drei Stufen wird dabei der grobe Dreck zunächst aus der Brühe gerecht, gesiebt und gefiltert. Danach lösen Bakterien die Kohlenstoffverbindungen auf, bevor das vorgereinigte Wasser zum Klärwerk Dradenau fließt. 3700 Kubikmeter Morast pro Tag entstehen dabei. Damit könnte man etwa neun Schwimmbäder füllen.
In den zehn silbernen, eiförmigen Faultürmen auf dem Gelände lagert der Schlamm 20 Tage lang. Bakterien zersetzen in den luftdichten Türmen etwa die Hälfte der organischen Verbindungen zu Methan, Kohlendioxid und Wasser. Den Stickstoff wandeln sie in Ammonium um, das Faulgas entsteht. In der Aufbereitungsanlage wird es tiefgekühlt und das verbleibende Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff herausgefiltert. So gereinigt kann es in das Gasnetz eingespeist werden. „Das Verfahren ist deutschlandweit einzigartig“, sagte der Hamburg-Energie-Chef. Biogas wird normalerweise aus landwirtschaftlichen Produkten wie Dung oder Pflanzen gewonnen. Beckereit: „Dies ist ein städtisches Modell.“ Das Gas unterscheide sich qualitativ nicht von anderen Biogasen.
3,3 Millionen Euro hat die Anlage gekostet. Bezahlt hat es Klärwerksbetreiber Hamburg Wasser, mehr:
http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/article1818840/Energie-aus-Hamburgs-Kanalisation.html
(nach oben)
Hauptkläranlage Wien- Simmering: 220 Mrd. Liter Abwasser gereinigt
Knapp 7.000 Liter Abwasser pro Sekunde wurden 2010 in der Wiener Hauptkläranlage gereinigt. Dabei wurden täglich fast 18.800 Kilogramm Feststoffe heraus gefischt.
In der Hauptkläranlage in Wien-Simmering sind im Vorjahr mehr als 220 Milliarden Liter Abwasser gereinigt worden. Das seien umgerechnet knapp 7.000 Liter pro Sekunde, berichtete das stadteigene Unternehmen „ebswien Hauptkläranlage“. Das Schmutzwasser verließ die Anlage dabei fast sauber: Die „mittlere Reinigungsleistung“ betrug 98 Prozent, hieß es. Der gesetzlich vorgeschriebene Wert liege bei 95 Prozent.
18.800 Kilogramm Feststoffe in der Hauptkläranlage
Das Wasser durchströmt in der Hauptkläranlage verschiedene Bereiche. Im Schotterfang wird „alles Grobe“ wie Schotter und Kies herausgebaggert, der Rechen fischt Abfall wie Klopapier oder Speisereste heraus. Im Sandfang werden feinere Feststoffe, Sand und Asche entfernt. Auf dieser sogenannten mechanischen Reinigungsstufe wurden 2010 täglich fast 18.800 Kilogramm Feststoffe aus dem…mehr:
http://www.vienna.at/hauptklaeranlage-wien-simmering-220-mrd-liter-abwasser-gereinigt/news-20110404-07295079
(nach oben)
Zossen-Wünsdorf: ZWECKVERBAND: Die Kläranlage wird erweitert
KMS rechnet am Jahresende erstmals mit einem Überschuss
Die Tandemkläranlage Zossen-Wünsdorf wird erweitert. Das steht im jetzt aktualisierten Abwasserbeseitigungskonzept des Zweckverbandes KMS. 2012 und 2013 entstehen an der Straße der Jugend in Zossen ein weiteres Belebungsbecken und ein zusätzliches Nachklärbecken für 1,9 Millionen Euro.
Die Anlage war 2003 für 33 000 Einwohner geplant worden. Derzeit reinigt sie das Schmutzwasser von
44 000 Einwohnern. Die Bevölkerung im Verbandsgebiet wuchs schneller als prognostiziert. Der Verband stand vor der Frage, das Klärwerk zu erweitern oder die Abwässer von Groß Machnow, Rangsdorf und Dahlewitz zum Klärwerk Waßmannsdorf zu leiten. Es gehört den Berliner Wasserbetrieben. Der Variantenvergleich ergab, dass die Vergrößerung der eigenen Anlage wirtschaftlicher ist.
„Bereits nach zwei Jahren amortisiert sich der Ausbau“, so die stellvertretende Verbandsvorsteherin Heike Nicolaus. Zudem sei ungewiss, …mehr:
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12035226/61939/KMS-rechnet-am-Jahresende-erstmals-mit-einem-Ueberschuss.html
(nach oben)
Thierbaum: Vollbiologie: Thierbaumer müssen eigene Investitionspläne begraben
Eine vollbiologische Abwasser-Reinigung für (fast) das gesamte Dorf, und das unabhängig vom Versorgungsverband Grimma-Geithain: Dieser Traum, den viele Thierbaumer träumten, ist seit Montagabend ausgeträumt. Angesichts der gesunkenen Zahl derer, die sich beteiligen möchten, vor allem aber wegen der Kostenentwicklung zog der Ortschaftsrat die Reißleine.
Die Sache, an der die Thierbaumer seit mindestens zwei Jahren tüfteln, war weit gediehen: Am Mittwoch hätte sich der Verwaltungsrat des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain mit dem Antrag des Bad Lausicker Ortsteiles beschäftigen sollen, den Verband zu verlassen. Die Thierbaumer wollten, wenn sie schon zur Umstellung der Abwasserreinigung auf Vollbiologie bis Ende 2012 gezwungen würden, selber handeln. Eine gemeinschaftliche Anlage für beinahe alle Grundstücke des Dorfes sollte es sein, selbst gebaut und durch ein Fachunternehmen betrieben, unabhängig von der Gebührenpolitik des Verbandes. Planungen gab es, die Stadt Bad Lausick wäre bereit gewesen, ein Grundstück für die Anlage zur Verfügung zu stellen. Doch daraus wird nun nichts.
„Wir haben aufgegeben“, sagte Ortsvorsteher …mehr:
http://nachrichten.lvz-online.de/region/geithain/vollbiologie-thierbaumer-muessen-eigene-investitionsplaene-begraben/r-geithain-a-78500.html
(nach oben)
Thalheim: Klärwerk braucht neue Steuerung
Die zwölf Jahre alte Elektronik der Thalheimer Kläranlage muss erneuert werden, die Mittel sind im Haushalt aber nicht enthalten.
Für rund 25 000 Euro muss die zwölf Jahre alte Steuerungselektronik in der Thalheimer Kläranlage ausgetauscht werden.
Wie Ingenieur Michael Schultheiss (Hirrlingen) dem Gemeinderat erläuterte, sind sowohl die Software als auch der Computer nach über 80 000 ununterbrochenen Betriebsstunden völlig veraltet. Bürgermeister Armin Reitze erinnerte an die ehemalige Anlagensteuerung im Pumpwerk Altheim, die – wie jetzt die Anlage in Thalheim – immer wieder Ärger gemacht habe. Reitze: „Die Steuerung im Pumpwerk wurde deswegen 2008 ausgetauscht und funktioniert seither störungsfrei.“
Die 25 000 Euro sind im beschlossenen, aber …mehr:
http://www.suedkurier.de/region/linzgau-zollern-alb/leibertingen/Klaerwerk-braucht-neue-Steuerung;art372564,4789993
(nach oben)
Lineg klärt die Abwässer von Sasol
Die Linksniederheinische Entwässerungs-Genossenschaft Lineg übernimmt die Abwasseraufbereitung des Moerser Chemieunternehmens Sasol Solvents Germany. Der Vertrag zwischen den beiden Partnern wurde jetzt in Kamp-Lintfort offiziell unterzeichnet.
Vorbehaltlich der beantragten und noch zu erteilenden Genehmigung durch die Be-hörden nutzt Sasol die freien Kapazitäten, die Technik und das Know-How der Lineg, um das im Werk an der Römerstraße anfallende Abwasser um-weltgerecht und energieeffizient zu entsorgen.
Der Vertragsunterzeichnung sind jahrelange, intensive Vorbereitungen vorausgegangen. Mehr:
http://www.derwesten.de/staedte/moers/Lineg-klaert-die-Abwaesser-von-Sasol-id4522910.html
(nach oben)
Parum: Kläranlage bleibt vorerst eigenständig
GÜSTROW – Der Fortbestand der Abwasser Parum GmbH ist offensichtlich gesichert. Die Stadt Güstrow reduzierte in ihrem Haushalt 2011 ihre geplante Kreditaufnahme für den Städtischen Abwasserbetrieb (SAB) deutlich: Statt sieben Millionen … mehr:
http://www.nachrichten.de/panorama/Klaeranlage-Parum-Abwasser-Kreditaufnahme-SAB-cid_5813662/
(nach oben)
Münster: Abwasser rauscht nach Coerde
Das Abwasser rauscht jetzt ungehindert von der Kläranlage Mariendorf zur Hauptkläranlage Münster nach Coerde. Dafür sorgen zwei 4000 Meter lange Druckrohrleitungen und das neue Pumpwerk an der Dyckburgstraße in Sudmühle, das gestern offiziell in Betrieb genommen wurde.
„Die Planungen für dieses Vorhaben begannen im Jahr 2008″, blickt Peter Haard vom städtischen Tiefbauamt zurück. Der Grund für die Baumaßnahme: Die Kläranlage Mariendorf ist seit mehr als 30 Jahren im Dienst und wird nun aufgrund der gewachsenen Anforderungen geschlossen. Das alte Pumpwerk wird abgerissen. So werden die Abwässer aus Handorf, Sudmühle und …mehr:
http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/muenster/ms_top_thema_2/1518100_Abwasser_rauscht_nach_Coerde.html
(nach oben)
Zweckverband Kötachtal: VTA-Systemprodukt überzeugt mit nachhaltiger Wirkung
Dieser Erfolg hat Bestand
Zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb findet man Entspannung und Wellness auf hohem Niveau, genauer gesagt auf 733 Meter Seehöhe: Bad Dürrheim ist Europas höchstgelegenes Solebad, und das Gesundheitszentrum Solemar wird als das „schönste Meer im Schwarzwald“ beworben.
Alles andere als entspannend war dagegen für Klärmeister Rudolf Moser lange Zeit der Betriebszustand der Kläranlage des Zweckverbandes Kötachtal.
In dieser Anlage, die auf 10.500 EW ausgebaut und mit 7500 EW belastet ist, wird das Abwasser aus den Bad Dürrheimer Stadtteilen Öfingen, Biesingen, Hochemmingen, Oberbaldingen, Sunthausen und Unterbaldingen und aus der Nachbargemeinde Tuningen gereinigt.
Hoher Index, Flockenabtrieb
Ständig wurden Indexwerte von mehr als 150 ml/g gemessen, die Bildung von Blähschlamm und Flockenabtrieb waren die Folge. Der Einsatz von Eisen(III)-chlorid, das dem Klärmeister von seinem früheren Lieferanten empfohlen wurde, erwies sich weitgehend als fruchtlos. Mit Vor-Ort-Service durch gut ausgebildete Verfahrenstechniker – so wie bei VTA üblich – konnte dieses Unternehmen nicht aufwarten.
Was es heißt, kompetent und umfassend betreut zu werden, erfuhr Moser erst, als VTA-Techniker Wolfgang Geiger auf die Anlage kam und zunächst einmal die Problemlage eingehend analysierte. Fadenbakterien, von den Biologen im VTA-Labor als Microthrix parvicella identifiziert, hatten sich im Belebtschlamm massiv ausgebreitet und die Bildung von Schwimmschlamm verursacht.
Markante Verbesserung
Ein VTA-Systemprodukt zur Phosphatfällung brachte die erhoffte Wende: Der Schlammindex sank rasch auf unter 100 ml/g und blieb konstant auf diesem Niveau, Absetz- und Eindickverhalten des Schlamms verbesserten sich markant, die Sinkgeschwindigkeit nahm zu. Flockenabtrieb war somit bald kein Thema mehr, und die hydraulisch eher unterbelastete Anlage lief wieder stabil.
Das ist nun zwei Jahre her – und bis heute so geblieben. Seit damals wird in der Kläranlage Kötachtal das gleiche VTA-Systemprodukt verwendet, und es wirkt so effektiv wie am ersten Tag, inzwischen sogar bei reduzierter Einsatzmenge. Auch während der mehrmonatigen Totalsanierung des Faulturms in diesem Sommer kam es zu keinerlei Abweichungen.
„Spitzenservice von VTA“
„Wir sind sehr zufrieden, sowohl mit dem Produkt als auch mit dem Spitzenservice von VTA“, sagt Reinhold Moser. Seit sechs Monaten setzt er nun auch bei der Schlammentwässerung auf VTA. Mit einem Konditionierungsmittel lässt sich die Kammerfilterpresse jetzt deutlich wirtschaftlicher betreiben. Das Fazit von Klärmeister Moser: „Bei VTA geht´s nicht nur um Fällung, sondern um die ganzheitliche und nachhaltige Optimierung einer Kläranlage.“
http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=107
(nach oben)
EU nimmt Klage gegen Übernahme des Hammer Kanalnetzes durch Lippeverband zurück
Die EU-Kommission hat Ende März 2011 ihre Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Übernahme des Kanalnetzes der Stadt Hamm durch den Lippeverband zurückgezogen. Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Harry K. Voigtsberger (SPD) begrüßte die Einstellung des Verfahrens. „Die Entscheidung der EU-Kommission schafft Klarheit. Das historisch gewachsene und bundesweit einmalige Verbandsmodell von NRW wird damit rechtlich bestätigt“, erklärte Voigtsberger. Auch die Stadt Hamm und der Lippeverband begrüßten die Entscheidung der Kommission. Der BDE bedauert die Rücknahme der Klage erwartungsgemäß.
Die EU-Kommission hatte auf Grundlage einer Beschwerde des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) die Bundesrepublik wegen Verletzung von Wettbewerbsregeln aus dem EG-Vertrag verklagt. Die EU zeigte sich überzeugt von den in der Klageerwiderung vorgebrachten Argumenten. Gemeinsam mit der Stadt Hamm und dem Lippeverband hatte das Bundeswirtschaftsministerium als Vertreter des Bundes auf die Brüsseler Klage erwidert. Zuvor hatte die EU-Kommission die Auffassung vertreten, dass die Abwasserbeseitigung und damit die Übernahme des Abwassernetzes hätten ausgeschrieben werden müssen, weil private Mitbewerber für die Abwasserbeseitigung in Hamm durch die Direktvergabe benachteiligt worden seien.
Mit der Rücknahme der Klage erkennt Brüssel jetzt an, dass es sich bei der Übertragung der Abwasserbeseitigung von der Kommune auf einen anderen öffentlich-rechtlichen Träger, nämlich von der Stadt Hamm auf den Lippeverband, um die Delegation einer hoheitlichen Aufgabe handelt. Dieser „staatsorganisatorische Akt“ richte sich nach nationalstaatlichem Recht und unterliege deshalb keiner Ausschreibungspflicht. Mit anderen Worten: Weil nach deutschem Recht eine Übertragung der Abwasserbeseitigung von einem öffentlichen Träger auf den anderen zulässig war, ist eine Ausschreibung nach Europarecht gar nicht gefordert.
Dabei spielt es auch nach Auffassung des Bundeswirtschaftsministeriums grundsätzlich keine Rolle, dass der Lippeverband neben den Städten und Gemeinden auch private Mitglieder aus Gewerbe, Industrie und Bergbau hat. Denn diese halten keine „Anteile“ am Verband, der als Non-Profit-Institution am Gemeinwohl orientiert ist und keine Gewinne erzielt.
Quelle: DWA
(nach oben)
Kaisheim: Baustart wohl im Herbst
Auch alternative Angebote möglich. Vier Kaisheimer Räte lehnen das geplante Konzept ab. Finanzierung wohl über Beiträge
Der Bau der gemeinsamen Kläranlage der Gemeinden Kaisheim und Buchdorf soll heuer im September oder Oktober starten. Gut ein Jahr später – im Herbst 2012 – soll die Anlage laufen. Diesen Zeitplan nannte ein Vertreter des mit der Planung und Ausschreibung beauftragten Ingenieurbüros Resch (Weißenburg) im Kaisheimer Marktgemeinderat. Thomas Hitz sagte, es sei mit Baukosten von rund 3,5 Millionen Euro zu rechnen. 62 Prozent der Summe wird Kaisheim tragen, 38 Prozent Buchdorf.
Die Kosten werden – wie allgemein üblich – auf die angeschlossenen Grundstückseigentümer umgelegt. Noch ist in der Marktgemeinde nicht entschieden, ob dies über höhere Gebühren …mehr:
http://www.augsburger-allgemeine.de/donauwoerth/Klaeranlage-Baustart-wohl-im-Herbst-id14429686.html
(nach oben)
Rees-Haffen: Lange Leitung fürs Abwasser
Das alte Klärwerk in Haffen wird bald stillgelegt. Das Abwasser soll später auf die andere Rheinseite nach Hönnepel gepumpt werden. Jetzt werden die Rohre dafür verlegt. Kalkarer Bürger profitieren von der Maßnahme.
Wie eine lange Schlange liegt entlang des Doelenweges bis hin zur Rauhen Straße ein etwa 250 Millimeter dicker Schlauch aus Hartkunststoff. An manchen Stellen mit Erde bedeckt, an anderen „kriecht“ er aus der Erde heraus.
Es handelt sich um eine Druckrohrleitung, die von der Kläranlage Rees-Haffen bis zum Anschlusspunkt an der Rauhen Straße verlegt wird. Insgesamt ist dieser Schlauch sechs Kilometer lang. „Nach Fertigstellung der Druckrohrleitung Mitte dieses Jahres wird die Kläranlage in Haffen stillgelegt und das gesamte Abwasser aus den Stadtgebieten Rees und Kalkar in der Zentralkläranlage Kalkar-Hönnepel …mehr:
http://www.rp-online.de/niederrheinnord/kleve/nachrichten/kleve/Lange-Leitung-fuers-Abwasser_aid_965282.html
(nach oben)
Feldberg: Klärwerk wird zu einer Pumpstation
Gemeinderat beschließt Bauantrag und Ausschreibungen für die Kläranlage / Anschluss nach Todtnau erst 2012 möglich.
Die kleine Kläranlage in Feldberg-Ort muss stillgelegt werden und künftig fließt das Abwasser zur Klärung in die Kläranlage nach Todtnau. Für das Problem, dass eine Kläranlage nicht außerbetrieb genommen werden kann und in der nächsten Sekunde die Pumpen das verschmutzte Wasser nach Todtnau befördern können, hat Planer Franz Riede jetzt eine Lösung erarbeitet und diese als Bauantrag dem Gemeinderat am Dienstagabend erläutert. Spätestens am 1. Dezember 2012 sollen alle Arbeiten erledigt sein.
Die Planung für das Millionenprojekt hat sich insofern geändert, dass auf den Bau eines großen Pumphauses verzichtet wird und stattdessen die Technik in die bestehenden Gebäude kommt. Nur so gelingt es, den Anschluss nach Todtnau voranzubringen und gleichzeitig die in Feldberg-Ort anfallenden Abwässer…mehr:
http://www.badische-zeitung.de/feldberg/klaerwerk-wird-zu-einer-pumpstation–43546119.html
(nach oben)
Klärwerk Belgern: Alles noch offen
Belgern (TZ). Noch immer wurde keine Entscheidung getroffen, wer zukünftig das Klärwerk in Belgern betreiben wird. Ursprünglich war geplant, zu Anfang des Jahres einen Betreiber festzulegen.
Doch laut Stadtoberhaupt Harald Thomas kann sich die Suche noch das ganze Jahr hinziehen. Eine europaweite Ausschreibung ist ebenfalls noch nicht erfolgt, da neben einem Betreibermodell kürzlich auch die Wiedereingliederung in den Zweckverband Torgau-Westelbien (ZV) in Betracht gezogen wurde. Kontakte diesbezüglich haben bereits Ende des vergangenen Jahres stattgefunden. Anscheinend konnte aber bisher noch kein Konsens erzielt werden.
„Die Stadt hat uns entsprechende wirtschaftliche Daten zum Klärwerk zugearbeitet, die über die Abwassersituation, den aktuellen technischen Zustand und über notwendige Instandhaltungsaufwendungen Auskunft geben. Eine Auswertung hat diesbezüglich schon stattgefunden. Jedoch besteht seitens des ZV noch reichlich Informationsbedarf, bevor eine mögliche Entscheidung zur Wiedereingliederung erfolgen kann“, so Uwe Fiukowski, Geschäftsführer des westelbischen Zweckverbands gegenüber der TZ. Demnach muss die Stadt Belgern als derzeitiger Betreiber beispielsweise noch eine Schadensklassifizierung des Kanalnetzes einreichen, einen Sanierungsplan erstellen, eine Stellungnahme der unteren Wasserbehörde (kurz UWB) zum Stand der Klärschlammentsorgung einholen und entsprechend ein genehmigtes Konzept vorlegen sowie einen Nachweis bezüglich der Qualifikation des zur Übernahme vorgesehenen Personals erbringen. Zudem muss noch ein Stadtratsbeschluss zur Eingliederung in den Zweckverband Torgau-Westelbien erfolgen. Sobald diese erforderlichen und noch ausstehenden Daten dem ZV vorliegen und eine erneute Analyse erfolgen kann, erst dann sei man in der Lage, eine endgültige Entscheidung zu treffen, so der Geschäftsführer des Zweckverbandes. Mehr:
http://www.torgauerzeitung.com/default.aspx?t=newsdetailmodus(56311)
(nach oben)
ALLENDORF: Mit neuer Kläranlage wird Allendorf/Lda. Geld sparen“
Planer erläutert Funktionsweise und Kosten – Bislang 3,3 Millionen Euro ausgegeben – Zwei Klärbecken mit je 1600 Kubikmetern Fassungsvermögen
Nur wenige Besucher interessierten sich dafür, die fast fertiggestellte neue Kläranlage in Allendorf/Lda. zu besichtigen. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde mit dem Bau begonnen. Planer Walter Grohmann und der zuständige Bauleiter Stefan Walter erläuterten die Details.
Das durch die beschlossene Finanzierungsart nicht unumstrittene Bauprojekt befindet sich in den letzten Phasen. Seit rund einem halben Jahr läuft nun das erste Oxidations-Klärbecken mit 1600 Kubikmeter Fassungsvermögen, in dem große Rotoren die Sauerstoffzufuhr für die Mikroorganismen regeln. Mittlerweile ist das zweite Klärbecken, ebenfalls mit 1600 Kubikmeter Fassungsvermögen, fertiggestellt und wird …mehr:
http://www.giessener-anzeiger.de/lokales/kreis-giessen/allendorf-lda/10221411.htm
(nach oben)
Zermatt :Abwasserrezyklierung
Membranbioreaktor in Zermatt
Auf einer Seilbahn-Bergstation im Skigebiet von Zermatt wird Toilettenwasser
in einer Kleinkläranlage mit Membranbioreaktor (MBR) vor Ort
behandelt
und wiederverwendet. Neben 100 % Stickstoff konnten in der
Saison 2005/06 auch 80 % Phosphor aus dem System eliminiert werden; so
konnte die sensible alpine Landschaft vor negativen Einflüssen bewahrt
werden. Dieser Artikel beschreibt die Betriebsresultate, das Schlamm-Management,
die Entfärbung des rezyklierten Abwassers und die langfristige
Behandlung von Belebtschlamm in den schwach belasteten Sommermonaten.
Diese Erfahrungen
und Resultate sind global gesehen von grosser Bedeutung,
werden dabei doch Grundlagen geschaffen, um den Wasserbedarf
für Toilettenabwasser durch Wiederverwendung von beinahe 100 % behandeltem
Abwasser zu reduzieren.
http://www.hunziker-betatech.ch/kfcmsdata/News/GWA_2010_01.pdf
(nach oben)
Jennersdorf: Vision wird Wirklichkeit
MicroTurbine macht´s möglich: 130.000-EW-Anlage wird energieautark betrieben
Grenzen sind da, um überwunden zu werden: Das zeigt der Abwasserverband Jennersdorf im Burgenland eindrucksvoll vor. Die Kläranlage des Verbands ist Teil des grenzüberschreitenden Businessparks Heiligenkreuz, der sich über 85 Hektar sowohl auf österreichischem als auch auf ungarischem Staatsgebiet erstreckt. Rund ein Dutzend Unternehmen haben hier ihren Standort, darunter als Leitbetrieb das weltweit modernste Lyocellfaserwerk von Lenzing Fibers mit rund 190 Mitarbeitern, das direkt an die Kläranlage angrenzt.
Die industrielle Vorreinigung des Zulaufs aus dem Lenzing-Werk beansprucht mit 40.000 EW denn auch knapp ein Drittel der derzeitigen Ausbaugröße der Kläranlage (130.000 EW). Ausgelastet ist die kommunale Anlage zu knapp 70 Prozent; das restliche Drittel dient als Reserve für den Wirtschaftspark, dessen Kapazitäten noch lange nicht erschöpft sind.
Die derzeit geringe Auslastung und die Tatsache, dass das Industrieabwasser viel Stickstoff, aber nur wenig Kohlenstoff enthält, haben Folgen für die Faulung: Die Wärme, die für die Beheizung der beiden Faultürme nötig ist, konnte bisher nicht selbst in der Anlage produziert werden. Das bestehende Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 130 kW war nicht kontinuierlich zu betreiben, sondern nur je nach Gasanfall. Wärmeenergie musste deshalb zugekauft werden, was einen wirtschaftlichen Betrieb beider Faultürme nicht zuließ.
Die Verbandsführung dachte daher bereits daran, einen Turm außer Betrieb zu nehmen. Das hätte allerdings neue Probleme bereitet, weil die für die Schlammstabilisierung nötige Ausfaulzeit dann nicht mehr einzuhalten gewesen wäre. „Schlechtere Entwässerungseigenschaften des Schlamms und womöglich auch Geruchsprobleme wären zu befürchten gewesen“, schildert Betriebsleiter Ing. Martin Spirk das Dilemma.
In dieser Situation entschied sich der AWV Jennersdorf für eine zukunftsträchtige Strategie: Das Projekt „Energieautarke Kläranlage“ wurde geboren. Dabei baute man auf erste Versuche mit Cofermentation auf, die bis ins Jahr 2002 zurückreichen. Die zusätzliche Übernahme und Verwertung energiereicher flüssiger Abfälle sollte die Gasproduktion erhöhen und dadurch eine effiziente Strom- und Wärmeversorgung gewährleisten.
Turbinen einfach integrierbar
Bei der Ausschreibung für eine geeignete Technologie überzeugte die von VTA angebotene MicroTurbine – durch ihre vielfach bewährten technischen Innovationen, aber auch durch den Vorteil, dass man sie ohne großen Aufwand in den Anlagenbestand integrieren kann. Anstelle des alten Blockheizkraftwerks arbeitet nun eine Anlage mit zwei Capstone-Turbinen – jede mit einer Leistung von 200 kW – samt Wärmenutzung. Die Turbinen wurden in den bestehenden Räumlichkeiten installiert, die dafür nur geringfügig adaptiert werden mussten.
Damit lässt sich der Strombedarf der Kläranlage von rund 2 Millionen kWh jährlich nun zur Gänze aus eigener Produktion decken, ebenso der gesamte Wärmebedarf. Die Vorteile liegen auf der Hand: bessere Ausnutzung der bestehenden Ressourcen in der Schlamm- und Gaslinie, CO2-Einsparung und nicht zuletzt eine Minimierung der Betriebskosten.
Wärmeüberschuss für Fußboden
Weil die Turbinen im Sommer sogar mehr Wärme liefern als benötigt wird, geht man in Heiligenkreuz nun noch einen innovativen Schritt weiter: Die überschüssige Wärme wird künftig genutzt, um den Lagerbunker für den abgepressten Klärschlamm nach Art einer „Fußbodenheizung“ zu beheizen. Das steigert nochmals den Trocknungseffekt – und senkt die Entsorgungskosten zusätzlich.
Quelle:
http://www.vta.cc/de/laubfrosch_archiv.html?newsid=86
(nach oben)
Bochum: Die Feuerwehr und ein Reptilienfachmann mussten am Sonntagmorgen eine Schlange aus einem Bochumer Klärwerk retten
Feuerwehr rät Bürgern, in derartigen Fällen niemals selbst zur Tat zu schreiten.
In einem Klärwerk im Querenburger Ölbachtal, in der Straße Vor den Teichen, musste am Sonntag ein Reptilienfachmann eine Kornnatter retten. Laut Feuerwehr hatte ein Werksmitarbeiter das knapp ein Meter lange Tier um 7.45 Uhr in der Hebeanlage entdeckt. Der von der Feuerwehr alarmierte Reptilienexperte konnte aber schnell Entwarnung geben: Das Tier war ungiftig. Es habe sich …mehr:
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/Feuerwehr-Bochum-rettete-Schlange-aus-Querenburger-Klaerwerk-id4414230.html
(nach oben)
Willmering: Die Gemeinde ist zu 100 Prozent am Kanal
ABSCHLUSS: Zweckverband feiert Beendigung des letzten Bauabschnittes der Abwasserbeseitigung
Für die Gemeinde Willmering
ist es ein Meilenstein in der
Entwicklung, als erste Gemeinde im
Landkreis Cham einen Anschlussgrad
von 100 Prozent bei der Abwasseranlage
erreicht zu haben. Nach dem Abschluss
des letzten Bauabschnittes
„Pfannen/Geigen“ haben sich die Vertreter
des Abwasserzweckverbandes
(AZV) Willmering-Waffenbrunn zu einer
kleinen Feier …mehr:
http://www.wwa-r.bayern.de/aktuelles/doc/pdf_zeitung/be_25_2_2011_die_gemeinde_willmering_ist_zu_100_prozent_am_kanal.pdf
(nach oben)
Wertingen: Eigene Stadtwerke für Wertingen?
Die Stadt Wertingen will eigene Stadtwerke gründen. Das Thema „Eigene Stadtwerke für Wertingen“ kam bei der jüngsten Sitzung des Wertinger Stadtrats zum Debatte.
Am Montag fand eine Sitzung des Wertinger Stadtrats in der Stadthalle statt. Dort überraschte der Kämmerer Matthias Freier seine Zuhörer mit dem Vorschlag Wertinger Stadtwerke zu gründen.
Laut Freier ist diese Idee zur Gründung einer Stadtwerke Wertingen eine Initiative der Verwaltung. Über die verwaltungs-rechtlichen Hintergründe habe man sich auch bereits mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband beraten.
Vorteile einer eigenen Stadtwerke
Durch eine …mehr:
http://www.b4bschwaben.de/Mittelstand/Regionale-Wirtschaftsnachrichten/Dillingen/arid,59825_puid,1_pageid,14.html
(nach oben)
WAV Panke/Finow: Zweckverband bittet zur Kasse
Bernau (MOZ) Bernau (MOZ) Mindestens 3,65 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche sollen sogenannte Altanschließer als Anschlussbeitrag für Wasser und Abwasser bezahlen. Das sieht die Satzung des Wasser- und Abwasserverbandes „Panke/Finow“ vor. Beschlossen wurde dies mit dem Wirtschaftsplan für 2011. Abgedeckt werden sollen damit Investitionen des Verbandes, die nach Oktober 1990 getätigt worden sind. Im Gegenzug sieht der Wirtschaftsplan Senkungen der Gebühren für die dezentrale Abwasserentsorgung von 20 Prozent und für die zentrale Abwasserentsorgung von 15 Prozent vor.
Wer schon vor dem 3. Oktober 1990 an ein zentrales Trinkwasser- und/oder Abwassernetz angeschlossen war, sah sich lange Zeit von finanziellen Forderungen der Wasser- und Abwasserverbände verschont. Das ist nun anders geworden. Nach der neuerlichen Rechtssprechung können nun auch die sogenannten Altanschließer für Investitionen, die die Zweckverbände nach 1990 tätigten, zur Kasse gebeten werden.
Der Wasser- und Abwasserverband „Panke/Finow“ (WAV) will von der Möglichkeit…mehr:
http://www.moz.de/lokales/artikel-ansicht/dg/0/1/282749/?print=1&cHash=f8361d1c20286cb777af4548e5e55de4
(nach oben)
Schmalenberg: Tage der alten Kläranlage Schmalenberg sind gezählt
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd hat der Inbetriebnahme des Verbindungssammlers von der Ortsgemeinde Schmalenberg bis zum Anschlussschacht der Ortskanalisation in Heltersberg einschließlich der Pumpstation zugestimmt. Wie Ralf Neumann, Vizepräsident der SGD Süd, mitteilt, können damit die Anlagen ab sofort betrieben werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Maßnahme ist im Förderprogramm des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz (MUFV) enthalten.
Nach einjähriger Bauzeit wird das Abwasser der Ortsgemeinde Schmalenberg zukünftig in der Gruppenkläranlage Waldfischbach-Burgalben nach dem neuesten Stand der Technik gereinigt. Hierzu wird das Abwasser zunächst von der neuen Pumpstation auf dem Gelände der alten Kläranlage Schmalenberg über eine Druckleitung bis zu einem circa 800 Meter entfernten Hochpunkt gepumpt, von dort läuft es in einer circa 1 Kilometer langen Freispiegelleitung bis zu einer zweiten Pumpstation nahe der Hirschalber Mühle. Hier fördern zwei große Verdrängerpumpen das Abwasser von Schmalenberg über eine weitere rund 1,1 Kilometer lange Druckleitung bis in einen Schacht der Ortskanalisation Heltersberg. Zusammen mit dem Abwasser der Ortsgemeinden Heltersberg und Geiselberg fließt es nun über den bereits in 2004 gebauten Verbindungssammler vorbei am Golfplatzgelände über die Kanalisation von Waldfischbach-Burgalben in die Gruppenkläranlage Waldfischbach-Burgalben.
Die über 40 Jahre alte …mehr:
http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/broker.jsp?uMen=f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266&uCon=ff650442-b517-9e21-4471-d7b1072e13d6&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042
(nach oben)
Ohm-Seenbach: Abwasserverband investiert weiter in Modernisierungs-MaßnahmenTechnik-Aufrüstung sparte 123000 Euro Stromkosten, Gießener Anzeiger
(kr). Der Abwasserverband Ohm-Seenbach hat in den vergangenen acht Jahren durch technische Umrüstung allein in der Kläranlage Nieder-Ohmen den Jahres-Stromverbrauch von 460 000 auf 300 000 Kilowattstunden gesenkt und damit Stromkosten in Höhe von 123 000 Euro gespart. Darüber informierten gestern die Geschäftsführerin des Verbandes, Sabine Bork, sowie die beiden Bürgermeister aus dem Verbandsgebiet, Matthias Weitzel (Mücke) und Frank Ide (Grünberg).
Im Jahre 2003 war in der Kläranlage ein „Fuzzy-Logic-Regler“ als Steuerelement eingebaut worden. Damit können Systeme auch sinnvoll gesteuert werden, wenn es keine mathematischen Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgabegrößen gibt. Der Regler wurde aus Mitteln der Abwasserabgabe finanziert. Sabine Bork berichtete, dass 2010 dieses bewährte Steuerelement noch einmal mit Enerlogic-Technik aufgerüstet worden sei. Der Fachbegriff steht für ein Maximum an Energieeinsparung bei gleichbleibend hoher Prozessqualität. Der Abwasserverband arbeitet in diesem Bereich mit der fränkischen Firma Passavant Intech zusammen. Die Modernisierung habe den „Energiefresser“ der Kläranlage, die Lufteinspeisung, nochmals optimiert.
Quelle: http://www.passavant-intech.de/page/de/page_ID/1/action/24/call/article/site_code/pi/news_part_ID/25/news_ID/19?PHPSESSID=cc5992b9649b4706fd35d020ea8965bd
(nach oben)
Lauterecken: Wasserrechtliche Abnahme der solaren Klärschlammtrocknungsanlage auf der Gruppenkläranlage Lauterecken
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd hat die solare Klärschlammtrocknungsanlage auf der Gruppenkläranlage Lauterecken wasserrechtlich abgenommen. Damit sind die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme erfüllt. Dies teilt Ralf Neumann, Vizepräsident der SGD Süd, mit. Durch die Fertigstellung der solaren Klärschlammtrocknungsanlage sind die umfangreichen Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten auf der Gruppenkläranlage in Lauterecken, welche bereits im Jahr 1999 begonnen wurden, abgeschlossen.
Zukünftig wird der aus dem Klärprozess entnommene Rohschlamm zunächst dem Faulturm zugeführt. Unter ständiger Umwälzung und Beheizung entsteht durch den Faulprozess das begehrte Faulgas, welches im Blockheizkraftwerk (BHKW) zu Strom umgewandelt wird. Nach erfolgter Ausfaulung des Klärschlammes erfolgt eine kurzfristige Nacheindickung mit anschließender Entwässerung mittels einer Zentrifuge, die den Trockensubstanzgehalt auf 33 Prozent steigert. Um den Wassergehalt des Schlammes weiter zu senken und so Entsorgungskosten zu sparen, wird der vorentwässerte Schlamm zur weiteren Trocknung in die solare Klärschlammtrocknungshalle verbracht. Durch den Treibhauseffekt wird die Verdunstungsrate erhöht und durch die Be- und Entlüftungssteuerung der Halle eine effektive Trocknung des Schlammes gewährleistet.
Mit der Erweiterung des Einzuggebiets durch den geplanten Anschluss der Kläranlagen in Nußbach und Odenbach wird in Zukunft mehr Klärschlamm auf der Anlage mehr:
http://www.sgdsued.rlp.de/icc/Internet/nav/f3c/broker.jsp?uMen=f3c705e6-8f8d-a811-6d16-9bb102700266&uCon=f427e160-93f4-e215-8064-9b2072e13d63&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042
(nach oben)
Gumpenweiler: Abwasser durch zwei
Eine grenzübergreifende Zusammenarbeit in Sachen Abwasser besiegelten dieser Tage die Gemeinden Schnelldorf und Kreßberg.
Mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat die Gemeinde Schnelldorf den Anschluss des Schmutzwasserkanals von Gumpenweiler an die Abwasseranlage der Gemeinde Kreßberg auf eine rechtliche Grundlage gestellt. Die bayerische Grenzgemeinde verpflichtete sich im Gegenzug dazu, für den Teilort Gumpenweiler eine Kanalisation im Trennsystem einzurichten. Damit wird das Schmutzwasser aus …mehr:
http://www.swp.de/crailsheim/lokales/land/Abwasser-durch-zwei;art5509,849027
(nach oben)
„Obere Dietzhölze“: KLÄRSCHLAMMVERERDUNG
Der Abwasserverband „Obere Dietzhölze“ als Betreiber der Kläranlage Eibelshausen war auf der Suche nach einer optimierten Schlammbehandlung. Das Ziel einer Optimierung war insbesondere eine deutliche Senkung der Betriebs- und Verwertungskosten.
Ein gründlicher Vergleich der am Markt verfügbaren Techniken zeigte, dass Klärschlammvererdung in schilfbepflanzten Beeten Vorteile bietet, die technische Systeme nicht leisten können.
So erzielt dieses naturnahe Verfahren zur Schlammbehandlung bei vergleichbarer Entwässerungsleistung seinen größten Nutzen durch den Abbau organischer Anteile (auch von Schadstoffen) im Schlamm und durch eine hohe Volumenreduktion, so dass nur noch geringe Restmengen zur Verwertung anfallen. Eine Vererdungsanlage kommt außerdem mit sehr wenig Primärenergie aus und reduziert den Betriebsaufwand der Kläranlage für die Schlammentwässerung deutlich.
Weitere Faktoren, die die Entscheidung für die Vererdung leicht machten, sind in erster Linie Betriebsstabilität und Verwertungssicherheit. Hinzu kommen Merkmale wie Umweltverträglichkeit durch Nutzung natürlicher Ressourcen sowie Komfortsteigerung für das Kläranlagenpersonal im Betriebsalltag.
Der passende Lösungsanbieter wurde mit der EKO-PLANT GmbH aus Neu-Eichenberg (Hessen) gefunden, die noch zusätzliche Leistungen wie betriebsbegleitende Betreuung und Beratungsleistungen für die spätere Klärschlammverwertung anbietet.
Das auf die naturnahe Schlammbehandlung spezialisierte Unternehmen hat darüber hinaus eine technisch optimierte Lösung für die Behandlung des Schlammes der Kläranlage Eibelshausen entwickelt, das für den Einsatz auf unserer Anlage und die standörtlichen Bedingungen individuell angepasst wurde.
Das von EKO-PLANT auf der Kläranlage Eibelshausen realisierte innovative Pilotprojekt „Hochleistungsvererdung“ ist eine speziell konzipierte Anaerob-Lösung, die sich insbesondere in der Beschickungstechnik von der konventionellen Klärschlammvererdung unterscheidet.
Statt einer sonst üblichen großflächigen Schlammverteilung durch seitliche Zulaufbauwerke bietet dieses System eine punktgenaue Aufbringungsmöglichkeit des stark eingedickten Schlammes über ein computergesteuertes Beschickungssystem. Dadurch kann im Ergebnis die für die Vererdung benötigte Fläche verringert und zusätzlich die Effizienz des Gesamtsystems gesteigert werden. Erwartet werden dadurch längere Laufzeiten der Anlage bis zur ersten Beräumung, kürzere Trockenphasen und geringere Restmengen gut vererdeten Klärschlamms.
Der Vererdungsvorgang bleibt gleich: Schilf und Mikroorganismen nutzen weiterhin natürliche Ressourcen wie Sonneneinstrahlung und Luftsauerstoff und verändern den Schlamm, der hier als Nahrungsquelle dient.
Entwässerungsleistung und Kompostierungswirkung führen in der Summe zu einer enorm reduzierten Materialmenge. Erwartet wird eine zusätzliche Verringerung der Gesamtrestmenge von mehr als 35 Prozent im Vergleich zu technischen Pressensystemen!
Dieser Vorteil wird sich im Ergebnis sehr günstig auf die Transport- und Entsorgungskosten für die spätere Verwertung des Restmaterials auswirken.. Doch bis zur ersten Verwertung ist noch viel Zeit.
Für uns ist wichtig: Ab sofort wird Geld gespart!
http://www.abwasserverband-obere-dietzhoelze.de/klaerschlammvererdung.php
(nach oben)
Cuxhaven: Optimierte Kläranlage Cuxhaven spart Strom in der Schlammentwässerung – CONTINUFLOC Aufbereitungsanlagen helfen dabei.
Auf einer Kläranlage wie der in Cuxhaven entfallen rund 60% des Strombedarfs auf die biologische Reinigung und Schlammentwässerung. Hier setzte die EWE WASSER GmbH im vergangenen Jahr an und erneuerte unter anderem die Schlammentwässerung, um die Stromkosten zu senken. Den Zuschlag für die FHM-Anlagen im Rahmen der Modernisierung der Schlammentwässerung erhielt Alltech.
Seit Dezember 2010 sind zwei 12000er CONTINUFLOC-Anlagen auf der Kläranlage Cuxhaven in Betrieb.
Die beiden Löse- und Dosierstationen CONTINUFLOC 12000 V7 – 1 VG arbeiten nach dem Zweikammer-Pendelprinzip und entsprechen den CE-Richtlinien, den Vorschriften des VDE und den DIN.
Die Lieferung der Flockungshilfsmittel-Anlagen erfolgte betriebsfertig verkabelt, verrohrt und elektrisch und hydraulisch werksseitig geprüft.
Die Bedienung der Anlagen erfolgt an einem übersichtlichen Fließbild im Touchbetrieb und unterstützt so die Mitarbeiter der Kläranlage bei der Inbetriebnahme und im laufenden Betrieb.
Die Anlagen wurden ausgerüstet für die Auflösung von pulverförmigen Produkten mit automatischer pneumatischer Förderung AIRLIFT sowie für die Verwendung von flüssigen Polymeren. Zum Lieferumfang gehörten auch die Nachverdünnungen und die Möglichkeit der Kommunikation mit dem Leitsystem über Profibus DP.
(nach oben)
Kaisheim: Abwasser kostet über die Hälfte mehr
Nun ist es doch amtlich: Die Bürger in Kaisheim (Kernort) müssen beim Trinkwasser und beim Abwasser ab sofort ein ganzes Stück tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat erhöhte für die Kaisheimer und Bergstettener den Tarif für einen Kubikmeter Trinkwasser von 2 auf 2,50 Euro (plus 25 Prozent). Diese Entscheidung fiel einstimmig. Bei der Abwassergebühr sind neben den Kaisheimern auch die Hafenreuter betroffen. Hier werden gleich über 50 Prozent mehr fällig: 2,38 statt bislang 1,52 Euro pro Kubikmeter. Neun Räte waren dafür, drei dagegen.
Vor wenigen Wochen noch hatten die beiden Punkte im Gemeinderat für heftige Debatten …mehr:
http://www.augsburger-allgemeine.de/donauwoerth/Abwasser-kostet-ueber-die-Haelfte-mehr-id9445966.html
(nach oben)
Hude: Kläranlage wird erweitert – OOWV investiert 2,4 Millionen Euro
Die Kläranlage in Hude wird erweitert. Im Juni soll mit dem Bau eines neuen Beckens mit integrierter Vorklärung begonnen werden. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) investiert laut Pressesprecher Lutz Timmermann rund 2,4 Millionen Euro in der Gemeinde Hude. Der größte Teil der Summe – rund 1,9 Millionen Euro – ist für den Ausbau des Klärwerks vorgesehen. Außerdem seien Maßnahmen im Bereich des Kanalnetzes und der Pumpwerke geplant.
„Die Kläranlage Hude ist inzwischen vollständig ausgelastet“, teilte OOWV-Sprecher Timmermann mit. Zur Stabilisierung des Betriebs und auch zur Sicherstellung der weiteren Entwicklung in der Gemeinde sei eine Erweiterung erforderlich.
„Die Kläranlage ist mit ihrer Leistung am Ende“, sagte auch …mehr:
http://www.weser-kurier.de/Druckansicht/Region/Landkreis+Oldenburg/302775/Huder+Klaeranlage+wird+erweitert.html
(nach oben)
Hergatz: „Zustand hat sich ganz leicht gebessert»
Biologie der Kläranlage in Hergatz kommt langsam in Gang – Protest aus Vorarlberg
«Der Zustand des Patienten hat sich ganz leicht gebessert. Wann sein Zustand stabil ist, können wir aber noch nicht sagen.» So beschreibt Norbert Hillenbrand, Betriebsleiter der Kläranlage in Hergatz, die Situation am gestrigen Montag. Wie berichtet, war in der vergangenen Woche die biologische Stufe des Klärwerks beinahe zum Erliegen gekommen, so dass …mehr:
http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/weiler/Weiler-lokales-klaeranlage-zustand-gebessert-biologie-hergatz-gang-protest-vorarlberg-stoerung–Zustand-hat-sich-ganz-leicht-gebessert-;art2792,933258
(nach oben)
Hasel-Schönau: Letzte Ausbaustufe
Trotz einer Investition in Höhe von 2,5 Millionen Euro wird sich der Ausbau der zentralen Kläranlage bei Viernau nicht negativ auf Gebühren und Beiträge auswirken, sagt der Betreiber.
– Wie vorgesehen, wird die zentrale Kläranlage des Abwasserzweckverbandes (AZV) „Hasel-Schönau“ in diesem Jahr ausgebaut. Die bestehenden Reinigungsbecken verfügen über eine Kapazität von 7000 Einwohnerwerten. „Dieses Leistungsvermögen ist bereits jetzt zu 100 Prozent ausgelastet“, erklärte Andreas Buda. Deshalb, so der Geschäftsstellenleiter des AZV, wird die Anlage nun auf fast das doppelte Fassungsvermögen erweitert.
Ursprünglich war ein Volumen von 14 000 Einwohnerwerten vorgesehen. Doch die Planung …mehr:
http://www.stz-online.de/nachrichten/regional/schmalkalden/fwstzsmlokal/art2450,1292167
(nach oben)
Haffen: Pipeline soll Klärwerk ersetzen
Die Zukunft des Ferienparks spielt auch eine Rolle beim Abwasser-Management. Über eine neue Rohrleitung von Haffen nach Rees könnte nämlich auch der Park am Reeser Meer angeschlossen werden.
Auch wenn Haffen und Mehr längst zum Stadtgebiet Rees gehören, beim Abwasser sind die beiden Orten bisher noch selbstständig. Denn in Haffen steht noch ein kleines Klärwerk, in dem das Abwasser von rund 3 500 Einwohnern gereinigt wird. Allerdings stehen bei dem Klärwerk erhebliche Investitionen an, um es für die Zukunft fit zu machen. Die so genannte Einleitgenehmigung ist nämlich wegen der Deichsanierung in diesem Bereich bis zum 31. Mai 2009 befristet. Die Bezirksregierung hat bereits mitgeteilt, dass sie die Genehmigung nur unter erheblichen Auflagen verlängern wird. Zudem liegen die Kosten der Kläranlage in Haffen um 20 Prozent über denen der Kläranlage…mehr:
http://www.rp-online.de/niederrheinnord/emmerich/nachrichten/emmerich/Pipeline-soll-Klaerwerk-ersetzen_aid_625609.html
(nach oben)
Friesenheim: Wie kam das Gilft in die Friesenheimer Kläranlage?
Viel hat nicht gefehlt, und in der Schutter hätte es ein katastrophales Fischsterben gegeben. Denn: Giftige Abwässer haben die Friesenheimer Kläranlage beinahe lahm gelegt. Nun ermitteln Ämter und Polizei, wie es dazu kommen konnte.
Nachdem am vergangenen Donnerstag ein noch unbekannter Stoff in die Kläranlage in Schuttern eingeleitet worden ist und die zum Nitritabbau nötigen Bakterienstämme stark geschädigt hat, läuft die Suche nach dem Schuldigen. Wie jetzt klar wurde, lag der Nitritgehalt des in die Schutter ausgeleiteten Wassers am Freitag nur sehr knapp unter …mehr:
http://www.badische-zeitung.de/friesenheim/wie-kam-das-gilft-in-die-friesenheimer-klaeranlage–40995364.html
(nach oben)
Besigheim: Kläranlage wird ausgebaut
Neues Belebungsbecken in Besigheim kostet rund 2,2 Millionen Euro
Seit Mitte Januar wird bei der Kläranlage in Besigheim mit einem Bagger gearbeitet. Er schafft die Voraussetzungen für ein zweites Belebungsbecken, das bis zum Dezember dort entstehen soll.
Eigentlich sollten die Bauarbeiten für das neue Belebungsbecken in Besigheim bereits im Oktober des vergangenen Jahres beginnen. Im Juli 2010 hatte der Gemeinderat die örtliche Firma Karl Köhler mit den Rohbauarbeiten beauftragt. „Es gab Probleme wegen des beantragten Bausystems“, berichtete indes der stellvertretende Stadtbaumeister Stefan Maier gestern. Das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) habe erst einmal Bedenken gegen das beabsichtigte Vorhaben geäußert, da das neue Bauwerk relativ nah am Neckarfluss liege.
„Die Schifffahrtsbehörde befürchtete negative Einflüsse auf den Hochwasserschutzdamm“, erläuterte …mehr:
http://www.bietigheimerzeitung.de/bz1/news/stadt_kreis_artikel.php?artikel=5498705
(nach oben)
Bad Zwestener: bekommen Geld zurück – Abwasser war falsch berechnet
Zu viel bezahlt haben die Bad Zwestener für Wasser und Abwasser im vergangenen und in diesem Jahr. Nun können sie sich über eine Rückzahlung freuen. Denn künftig sollen sie nicht mehr 4,85 Euro für das Abwasser bezahlen.
Wie hoch die neuen Gebühren sein werden, wollte Bürgermeister Michael Köhler auf Anfrage der HNA noch nicht sagen. Die Gebührenwelle in Bewegung gesetzt hatte die SPD-Fraktion während der Gemeindevertretersitzung. Der Blick auf die Gebühren habe ergeben, dass neben den Betriebskosten, der Abwasserabgabe, den kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen für das vergangene und dieses Jahr auch noch Zinsen der Darlehen für die Abwasserbeseitigung eingeflossen seien. Das könne nicht sein, vermutete Fraktionssprecher Robert Koch. Deshalb wollte er geklärt wissen, ob diese Kalkulation auf rechtlich sicheren Füßen stehe.
Es sei richtig, dass bei der Kalkulation der Gebühren ein Fehler gemacht worden sei, erklärte Bürgermeister Köhler auf Anfrage. Das hätten Nachfragen beim Rechnungsprüfungsamt ergeben. Sein Vorschlag lautet deshalb: Die 2100 Haushalte der Kurgemeinde erhalten das zu viel gezahlt Geld für das erste Quartal dieses Jahres und das gesamte vergangene Jahr zurück. Über die Höhe …mehr:
http://m.hna.de/nachrichten/schwalm-eder-kreis/fritzlar/zwesten-zahlt-gemeinde-geld-abwasser-falsch-berechnet-1133075.html
(nach oben)
Allendorf: „Mit neuer Kläranlage wird Allendorf/Lda. Geld sparen“
Planer erläutert Funktionsweise und Kosten – Bislang 3,3 Millionen Euro ausgegeben – Zwei Klärbecken mit je 1600 Kubikmetern Fassungsvermögen
Nur wenige Besucher interessierten sich dafür, die fast fertiggestellte neue Kläranlage in Allendorf/Lda. zu besichtigen. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde mit dem Bau begonnen. Planer Walter Grohmann und der zuständige Bauleiter Stefan Walter erläuterten die Details.
Das durch die beschlossene Finanzierungsart nicht unumstrittene Bauprojekt befindet sich in den letzten Phasen. Seit rund einem halben Jahr läuft nun das erste Oxidations-Klärbecken mit 1600 Kubikmeter Fassungsvermögen, in dem große Rotoren die Sauerstoffzufuhr für die Mikroorganismen regeln. Mittlerweile ist das zweite Klärbecken, ebenfalls mit 1600 Kubikmeter Fassungsvermögen, fertiggestellt und wird nach einer Dichtigkeitsprüfung …mehr:
http://www.giessener-anzeiger.de/lokales/kreis-giessen/allendorf-lda/10221411.htm
(nach oben)
Konstanz: Sauber und wirtschaftlich: Abwasser heizt Konstanzer Neubaugebiet
Wenn das Badewasser abgelassen oder die Waschmaschine leer gepumpt ist, dann hat das Wasser normalerweise ausgedient. Doch im Abwasser steckt noch jede Menge Energie. Es kann als Wärmequelle genutzt werden. Diese bisher brach liegende Energie machen sich die Stadtwerke Konstanz zu Nutze: In einem Neubaugebiet in Konstanz werden sie in ein bis zwei Jahren zahlreiche Wohnungen und Gewerberäume heizen. Damit sind sie eines der ersten Unternehmen in der Region, das die Abwasserwärme in diesem Ausmaß einsetzt. In der Gesamtanlage können im Vergleich zu einer konventionellen Energieversorgung pro Jahr etwa 196 Tonnen CO2 vermieden werden. Aufgrund seiner besonderen Energieeffizienz und seines Beitrags zum Klimaschutz fördert das baden-württembergische Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr dieses Projekt. mehr:
http://www.bodensee-woche.de/sauber-und-wirtschaftlich-abwasser-heizt-konstanzer-neubaugebiet-35082/
(nach oben)
Maroldsweisach: Millionenschwere Erneuerung der Kläranlage
Gemeinde geht Planungen an und hofft auf Sparpotenzial durch ein zwischengeschaltetes Planungsbüro
Es macht sich durch den Abfluss davon, und weg ist es. Kaum jemand verschwendet einen Gedanken an den Aufwand, der hinter dem Entsorgen von Abwasser steckt. Es sei denn, er oder sie besitzt ein Grundstück und muss Beiträge zahlen. Oder gehört zu den kommunalen Verantwortungsträgern, für die das Thema immer wieder auf den Tisch, respektive auf die Tagesordnung kommt.
Ein leidiges Thema, vor allem wegen der meist hohen Kosten für etwas, von dem Otto Normalbürger so wenig mitbekommt. Der Gemeinderat des Marktes Maroldsweisach wird sich in seiner Sitzung am Montag mit dem Thema Abwasser befassen. Hinter dem Punkt „Abwicklung und Finanzierung öffentlicher Bauvorhaben“ verbirgt sich die anstehende Erneuerung der Kläranlage im Kernort.
Mit ihren 35 Jahren ist die Kläranlage in Maroldsweisach „nicht mehr so leistungsfähig“, wie es Geschäftsleiter Werner Thein formuliert.
Ein Großprojekt
Und aufgrund der behördlichen Vorgaben besteht innerhalb der nächsten zwei Jahre Handlungsbedarf, und es muss eine Planung erstellt werden. Zusätzlich zur Erneuerung der Anlage steht eine Mischwasserbehandlung an.
Auch wenn die Kosten derzeit noch nicht feststehen – ein Großprojekt wird es allemal. Bürgermeister Wilhelm Schneider schätzt die Investition ganz grob auf etwa 2,2 Millionen. Dabei kann …mehr:
http://www.mainpost.de/regional/hassberge/Millionenschwere-Erneuerung-der-Klaeranlage;art1726,5949778
(nach oben)
Northeim: Das Abwasser wird um 2,5 Prozent teurer
Die Abwassergebühren in Northeim steigen leicht. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen, die Gebühren für Schmutzwasser um sechs Cent auf 2,46 Euro anzuheben.
Das entspricht einer Steigerung von 2,5 Prozent. Die Regenwassergebühr bleibt unverändert. Sie beträgt 0,33 Euro pro Quadratmeter versiegelte Fläche. Gleichzeitig stimmte der Stadtrat dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser (EBA) zu.
Er umfasst unter anderem Investitionen in Höhe von 2,6 Millionen Euro, mehr:
http://www.hna.de/nachrichten/landkreis-northeim/northeim/abwasser-wird-prozent-teurer-1048229.html
(nach oben)
Obere Leiblach: Schwere Störung im Klärwerk
Biologische Stufe in Hergatz kaputt
In der Kläranlage des Abwasserverbands Obere Leiblach (AOL) in Hergatz ist es zu einer schweren Störung gekommen. Bereits am Wochenende ist die biologische Klärstufe fast zum Erliegen gekommen. Das heißt, die für die Abwasserreinigung notwendigen Bakterien sind beinahe restlos abgestorben.
Verschiedene Versuche, die Biologie wiederzubeleben, brachten bislang nicht den gewünschten Erfolg. Die Aufzeichnungen des Klärwerks belegen schon seit Mitte vergangener Woche deutlich erhöhte PH-Werte in den eingeleiteten Abwässern. Laut AOL ist die Biologie am Samstag gekippt. Seither kann das Abwasser des AOL, in dem die Westallgäuer Gemeinden Heimenkirch, Hergatz und Opfenbach Mitglieder sind, nur noch mechanisch gereinigt werden. Es fließt vom Klärwerk Hergatz in die Leiblach, welche in den Bodensee …mehr:
http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/rundschau/Rundschau-facebook-rundschau-klaeranlage-schwere-stoerung-klaerwerk-biologische-stufe-hergatz-kaputt-abwasser-Schwere-Stoerung-im-Klaerwerk;art2757,932149
(nach oben)
AZV Umlachtal: Zeller Klärsystem besteht Abwasser-TÜV
Gutachten bescheinigt Abwasserzweckverband C fast optimale Auslastung
Das Entwässerungssystem der Gemeinde Eberhardzell ist für die Zukunft gerüstet: Das ist das Ergebnis einer aufwendigen Untersuchung, die das Biberacher Ingenieurbüro Wasser-Müller im Auftrag des Abwasserzweckverbands Umlachtal vorgenommen hat.
„Das ist doch mal ein rentierliches Gutachten“, freute sich der Eberhardzeller Bürgermeister Hans-Georg Maier in der Sitzung des Abwasserzweckverbands Umlachtal über das Ergebnis der Untersuchung. Für die nächsten 20 Jahren müssen am Entwässerungssystem der Verbandskläralage Eberhardzell, an das auch die Bad Wurzacher Teilorte Eckmannsried und Unterschwarzach angeschlossen sind, keine größeren baulichen Veränderungen vorgenommen werden. So bleiben …mehr:
http://www.schwaebische.de/region/biberach-ulm/bad-schussenried/rund-um-bad-schussenried_artikel,-Zeller-Klaersystem-besteht-Abwasser-TUeV-_arid,5014816.html
(nach oben)
Schmedehausen: Bakterien mit Atemnot
Die Teichkläranlage in Schmedehausen hat ein Problem – und das vor allem im Winter. Wenn bei Frost eine Eisschicht das Wasser bedeckt, wird der Sauerstoffaustausch über die Wasseroberfläche empfindlich gestört. Den Sauerstoff brauchen aber die Bakterien, die biologisch die Schadstoffe im Abwasser abbauen sollen. „Kommt weniger Sauerstoff bei ihnen an, können die Mikroorganismen ihre Arbeit nur noch unvollkommen verrichten, und die sonst übliche Wasserqualität am Ablauf wird nicht mehr erreicht,“ sagt Dietmar Beinker, beim Bau- und Entsorgungsbetrieb zuständig für die Entwässerungs- und Kanalplanung.
Und Abwassermeister Josef Averbeck ergänzt: „Die Teichkläranlage in Schmedehausen, die 1985 als Pilotprojekt des Landes in Betrieb ging, ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. So werden Stickstoff und Phosphat nur zum Teil aus dem Abwasser entfernt, mehr:
http://www.bbv-net.de/lokales/kreis_steinfurt/greven/1476510_Bakterien_mit_Atemnot.html
(nach oben)
Scher-Lauchert: Abwasser fließt nach Veringendorf
Gemeinderat Hettingen entscheidet sich für den Abwasserzweckverband Scher-Lauchert
Die Würfel sind gefallen: Das Hettinger Abwasser wird talabwärts in die Kläranlage nach Veringendorf fließen. Bisher gab es nur eine Absichtserklärung, weil die Variante, an der Gammertinger Kläranlage anzuschließen, noch durchgerechnet werden musste. Das Regierungspräsidium bezuschusst grundsätzlich nur die wirtschaftlichste Variante, erklärte Bürgermeister Uwe Bühler. Das Sigmaringer Ingenieurbüro Kovacic hatte den Auftrag bekommen, drei Varianten zu untersuchen und zu vergleichen.
Die teuerste Variante führt über das Fehlatal nach Neufra und dann runter nach Gammertingen. Sie ist technisch gesehen die Schwierigste, weil eine große Höhendifferenz überwunden werden muss. Dies treibt die Baukosten immens…
(nach oben)
Rottleberode: Abwasserpreis sinkt weiter
Das dürfte die Rottleberöder gewaltig freuen: Sie bezahlen jetzt nur noch 1,40 statt 1,60 Euro je Kubikmeter Abwasser, hinzu kommt die monatliche Grundgebühr von 7,06 Euro je Haushalt. Das bedeutet für eine dreiköpfige Familie mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 33 Kubikmetern 233 Euro fürs Abwasser und eine Ersparnis von 20 Euro im Jahr. Das ist im Kreis mit Abstand der niedrigste und landesweit einer der günstigsten Abwasserpreise.
Im Gegensatz zu den meisten Orten im Landkreis gehört Rottleberode keinem Abwasserzweckverband an. Stattdessen wurde ein Eigenbetrieb gegründet, der sich um die Abwasserentsorgung kümmert – und das offensichtlich mit Erfolg. Mehr:
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1294645913751
(nach oben)
Rees: Den Weg freigespült
Die Abwässer von Haffen und Mehr werden ab Jahresmitte in Kalkar-Hönnepel geklärt, das betrifft 2000 Haushalte.
Das Klärwerk in Haffen, das derzeit noch die Abwässer der 3500 Einwohner von Haffen und Mehr reinigt, ist in die Jahre gekommen. „Eine Sanierung wäre sehr teuer gekommen“, weiß Heinz Arntz, Betriebsleiter des Abwasserbehandlungsverbands Kalkar-Rees. Preiswerter ist es, die 220 000 Kubikmeter Abwasser aus den beiden Reeser Ortsteilen zentral in Kalkar-Hönnepel aufbereiten zu lassen.
Um dies möglich zu machen, wird derzeit eine sechs Kilometer lange Druckleitung zwischen der Kläranlage in Haffen und der Rauhen Straße in Rees eingebaut.
Ein Drittel der Leitung
ist schon verlegt…mehr:
http://www.derwesten.de/staedte/rees/Den-Weg-freigespuelt-id4282755.html
(nach oben)
Obere Leiblach: Klärwerk: „Wollten nichts verheimlichen“
Nach dem Störfall im Klärwerk Hergatz (D) dauern die Untersuchungen des Gewässerzustandes der Leiblach an, die Lage entspannt sich aber. Markus Reichart vom Abwasserverband Obere Leiblach sagt, man habe Vorarlberg nichts verheimlichen versuchtKein Fischsterben und normaler pH-Wert
Die Lage an und in der Leiblach entspannt sich. Das bestätigen sowohl das Vorarlberger Umweltinstitut als auch der für das Klärwerk zuständige Abwasserverband Obere Leiblach.
So sei etwa der pH-Wert der Leiblach …mehr:
http://vorarlberg.orf.at/stories/498872/
(nach oben)
Weißenfels: Überschreitungen
BUND stellt Aussagen der Firma Tönnies bezüglich deren überhöhter Einleitungen in die Kläranlage richtig – Statt 2 zugegebener sind allein 31 Überschreitungen in 2010 registriert – Keine Genehmigungen für Außenanlagen der Zerlegehalle sowie weitere belegte Auflagenverstöße des Konzerns – BUND sieht Zuverlässigkeit von Tönnies weiterhin in Frage gestellt!
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND, LSA) erachtet es als notwendig, die vom Schlachtkonzern als Reaktion auf die hiesige Pressemitteilung vom 18.01.2010 gemachten öffentlichen Aussagen richtig zu stellen. Tönnies gibt lediglich zu, dass in 2010 an nur 2 Schlachttagen die zulässige Einleitmenge in die Weißenfelser Kläranlage um 0,8 bzw. 1,9 % überschritten wurde. Gemäß dem Tagebuch des Betriebsführers, die Stadtwerke Weißenfels, überschritt die Firma Tönnies aber allein in 2010 mindestens 31-mal die täglich zulässige Zulaufhöchstmenge, wobei dieses nach hiesiger Kenntnis besonders häufig in den Monaten Juni, Juli und September erfolgte. Im Einzelfall wurden mehr als 200 Kubikmeter über den Höchstwert eingeleitet. Das sind Überschreitungen um bis ca. 11% am Tag. Der BUND bietet interessierten Pressevertretern an, diese Unterlagen bei Bedarf einzusehen. Es ist ebenfalls Fakt, dass Anfang November auch der Verschmutzungsgrad nachweislich zu hoch war und vertraglich festgelegte Einleitwerte, insbesondere für den Chemischen und Biochemischen Sauerstoffbedarf…mehr:
http://www.pro-weissenfels.de/index.php?entry_id=73
(nach oben)
Wesel: Spurensuche in der Kläranlage
Der Klärschlammreport ließ bei den Stadtwerken aufhorchen. Schadstoffbelastungen drohten Entsorgungskosten und damit auch Abwassergebühren in die Höhe zu treiben. Verursachersuche hat Erfolg und ist tägliches Geschäft.
Wer in seinem Betrieb mit bestimmten Schadstoffen hantiert, muss sie noch auf dem Firmengelände vom normalen Abwasser abtrennen. So weit die Theorie. Wie der Klärschlammreport im Aufsichtsrat der Stadtwerke Wesel jetzt deutlich machte, gelingt dies in der Praxis nicht immer so sauber, wie es sein sollte (RP berichtete). Schwermetalle und AOX (adsorbierbare organisch gebundene Halogene) im Klärschlamm erreichten in diesem Jahr bedenkliche Werte. Das macht die Entsorgung teuer und eine aufwendige Spurensuche nötig. Wie der …mehr:
http://www.rp-online.de/niederrheinnord/wesel/nachrichten/wesel/Spurensuche-in-der-Klaeranlage_aid_941807.html
(nach oben)
Weißenfels: Fortgesetzte schwere Einleitwertüberschreitungen durch Weißenfelser Kläranlage in die Saale
– Kontrollwerte bis zu 24-fach höher als erlaubt – Der Bund für Umwelt und Naturschutz Sachsen-Anhalt (BUND) erstattet Strafanzeige – Weitere Millionenstrafe für Weißenfels
Bei behördlichen Kontrollen in den Monaten November und Dezember 2010 wurden erneut erhebliche Überschreitungen der Überwachungswerte durch die Kläranlage Weißenfels festgestellt. Diese bestätigen, dass weit über den zulässigen Grenzwerten verschmutztes Abwasser in das empfindliche Ökosystem der Saale fortgesetzt eingeleitet wird. Dabei wurden die Werte für Stickstoff, Phosphor sowie für den Chemischen- und Biochemischen Sauerstoffbedarf (CSB und BSB) erheblich überschritten. Der Chemische Sauerstoffbedarf, welcher als Summenparameter zur Quantifizierung der Belastung von Abwasser mit organischen Stoffen dient, erreichte dabei das 24-fache des zulässigen Grenzwertes!
Somit wird auch für 2010 ein weiterer Abwasserabgabestrafbescheid von hier geschätzten 4 bis 5 Millionen Euro auf die Stadt Weißenfels zukommen, wenn nicht endlich der oder die Verursacher …mehr:
http://www.pro-weissenfels.de/index.php?entry_id=72
(nach oben)
Prag: Großtender zur Kläranlage wird neu aufgerollt
Stadt will Ausschreibung aufheben oder überarbeiten
Prag – Seit mehreren Jahren wird das millionenschwere Projekt zu Umbau und Erweiterung der zentralen Abwasserkläranlage Prags zwischen der EU-Kommission und Tschechien verhandelt. Eine erste Phase (geschätzter Wert etwa 252 Mio. Euro) ist im September 2010 vom Magistrat ausgeschrieben worden trotz ungewisser Finanzierung.
Unter Berufung auf ein Rechtsgutachten hat der neue Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda den laufenden Tender aber Anfang Januar 2011 als fehlerhaft bezeichnet.
Mit 2010 ist für die Tschechische Republik die Frist zur Erfüllung der EU-Richtlinie zur Behandlung des kommunalen Abwassers (91/271/EWG) abgelaufen. Diese zusätzliche Zeit hatte sich das Land bei seinem EU-Beitritt ausgehandelt, um Städte und Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern an die Kanalisation anzuschließen und Kläranlagen mit einer bestimmten Reinigungsleistung einzusetzen. Der größte Teil der 630 betroffenen Kommunen hat es geschafft, das Ziel zu erreichen oder wenigstens mit dem Bau von Kanalisationsprojekten und Kläranlagen bis Ende 2010 zu beginnen. Doch bleiben nach Angaben des Umweltministeriums etwa ein Dutzend ungelöster Fälle. Das Schwergewicht darunter ist die zentrale Kläranlage Prags auf der Kaiserinsel in der Moldau gelegen. Die bestehende Anlage ist für die Metropole mit ihren 1,2 Mio. Einwohnern nicht ausgelegt, was zu einer erhöhten Stickstoffkonzentration ihrer Abwässer führt. Eine Ausnahmegenehmigung für die ungenügende Abwasserqualität hat die Stadt noch einmal bis 2016 verlängert. Bis dahin soll die Anlage derart umgebaut und erweitert worden sein, dass sie die EU-Auflagen erfüllt.
Die wegen ihrer Dimension sowohl im Tschechischen Informationssystem über öffentliche Beschaffungen (www.isvzus.cz) als auch in der Ted-Datenbank der EU (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do) bekannt gegebene Ausschreibung gibt den geschätzten Wert mit 6.227,96 Mio. Tschechischen Kronen an (Kc; rund 252,0 Mio. Euro; Wechselkurs am 6.1.11: 1 Euro = 24,710 Kc). Es geht um die erste Phase, den Bau einer Wasseraufbereitungslinie, ausgeschrieben als Bauarbeiten für Abwasserbeseitigungsanlagen. Explizit erwähnt wird, dass das Projekt mit Unterstützung von EU-Fördermitteln aus dem Operationellen Programm Umwelt umgesetzt werden soll. Die Verhandlungen mit der EU Kommission laufen schon seit der ersten Förderperiode (2004 bis 2006). Grünes Licht hat es bisher für dieses Großvorhaben aber noch nicht gegeben.
Brüssel stößt sich vor allem an den langfristigen Verträgen zwischen der Stadt Prag und dem Betreiber, der zum Veolia-Konzern gehörenden Gesellschaft Prager Wasserwerke und Kanalisation (PVK). Diese laufen bis 2028, was den Wettbewerbsregeln der EU zuwiderläuft. Erst kurz vor Weihnachten 2010 erklärte sich Veolia einverstanden, die zentrale Prager Kläranlage aus dem Vertrag zwischen Betreiber und Stadt herauszunehmen. Ihr Betrieb müsste dann neu ausgeschrieben werden. Pressemeldungen zufolge gilt das gesamte Abwasserreinigungs-Projekt als überdimensioniert. Zusammen mit Umbau- und Erweiterung der Kläranlage sowie einer Klärschlammaufbereitungsanlage wird es auf 19,8 Mrd. Kc (800 Mio. Euro) geschätzt.
Anfang Januar 2011 hat der neue Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda den Tender als fehlerhaft bezeichnet. Er war kurz vor den Kommunalwahlen im Oktober 2010 noch von der früheren Stadtverwaltung ausgeschrieben worden. Bis zum 22.1.2011 soll die Entscheidung fallen, wie weiter verfahren werden soll, ob die Ausschreibung gänzlich storniert oder überarbeitet wird. Die ursprünglich am 9.12.10 ablaufende Abgabefrist für die Angebote war bereits unerwartet auf den 28.1.11 verlängert worden. In die Schlagzeilen gekommen war das Kläranlagen-Projekt im Dezember zudem durch eine Affäre, bei der es um mutmaßliche Korruption im Umweltministerium ging. In ihrem Verlauf trat Umweltminister Pavel Drobil zurück, durchlebte die regierende Dreiparteienkoalition vor Weihnachten ihre erste große Krise.
Da es der Hauptstadt nicht gelungen ist, ihre Abwasserentsorgung fristgerecht wenigstens in Angriff zu nehmen, könnte ihr von Brüssel eine Geldstrafe auferlegt werden. Weitere Projekte der Abwasserwirtschaft sind landesweit in der Umsetzung oder stehen kurz vor dem Start. Noch im Laufe 2010 hat das Umweltministerium mehreren Dutzend Vorhaben Förderungen im Rahmen des Operationellen Programms Umwelt zugesprochen. Bei einigen größeren Projekten wurde Anfang Januar 2011 noch an der Ausschreibungsdokumentation gearbeitet.
Mit baldiger Ausschreibung war im Fall der Stadt Usti nad Orlici zu rechnen, die eine Kläranlage modernisieren und neue Kanalisation legen will. Das städtische Versorgungsunternehmen Tepvos wird rund 890 Mio. Kc (36,0 Mio. Euro) investieren. Davon sind etwa 670 Mio. Kc (23,5 Mio. Euro) Subventionen der EU. Der Zeitplan geht davon aus, dass die Bauarbeiten im Mai 2011 beginnen und das Projekt Ende 2013 abgeschlossen sein wird. Bauarbeiten zu Kanalisation und Wasserwirtschaft sind auch im Gebiet um die Stadt Krivoklat geplant. Die Ausschreibung soll Anfang Juli 2011 erfolgen. Der Gesamtwert des Vorhabens wird in einer Liste des Umweltministeriums mit fast 940,0 Mio. Kc (38 Mio. Euro) angegeben. Die Bauarbeiten könnten …mehr:
http://www.tschechien-online.org/news/17752-grosstender-prager-klaranlage-wird-neu-aufgerolltgrosstender-prager-klaranlage-wird-neu-aufgerollt/
(nach oben)
Moosburg: Wie Äpfel und Birnen“
Abwassergebühren: Meinelt ärgern Vergleiche mit anderen Kommunen
Die Abwassergebühren in Moosburg sind zu hoch, bis zu dreimal höher als in den Nachbarkommunen – das führen die Befürworter des Bürgerbegehrens „Mehr Gerechtigkeit bei den Abwasser-Hausanschlüssen“ an, wenn sie für Zustimmung beim Entscheid am 23. Januar werben. Die Zahlen, die genannt werden, will Bürgermeisterin Anita Meinelt nicht unkommentiert stehen lassen. „Hier wird mit Unwahrheiten gearbeitet“, sagt sie.
Es werde suggeriert, dass ein „Ja“ beim Bürgerentscheid automatisch zu niedrigeren Abwassergebühren führen würde. „Das ist schlichtweg falsch“, stellt Meinelt fest. Die Vergleichszahlen aus anderen Kommunen, die in einem Flyer der Initiatoren genannt werden, führen ihrer Meinung nach in die Irre. So sei bei einigen Kommunen, die ihre Gebühren gesplittet nach Schmutz- und Regenwasser erheben, nur die Gebühr für das Einleiten von Schmutzwasser angegeben.
Um das zu prüfen hat man im Rathaus am Dienstag die aktuellen Gebühren in zahlreichen anderen Städten und Gemeinden erfragt. Für Wang zum Beispiel ist im Flyer eine Gebühr von 2,37 Euro pro Kubikmeter genannt. Das sei aber nur der Preis für Schmutzwasser, so Meinelt. Insgesamt seien 2,69 Euro fällig. In Moosburg, wo noch nicht gesplittet wird, sind es 2,89 Euro pro Kubikmeter. Eine Stadt wie Moosburg sei allerdings nicht mit ländlichen Kommunen vergleichbar. „Das ist wie Äpfel und Birnen“, findet die Bürgermeisterin.
Mehr dazu in der Moosburger Zeitung vom 6. Januar.
http://www.idowa.de/vilsbiburger-zeitung/container/container/con/818560.html
(nach oben)
Mönchweiler: Behörde droht mit Verschluss
Die Landwirte der Tannenhöfe verstehen die Ablehnung der Klärung über Klärteiche nicht und sträuben sich gegen den Anschluss ans Kanalnetz.
Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt ein Thema die Gemüter in der Gemeinde: eine befriedigende Abwasserkonzeption für die Tannenhöfe. Die Genehmigungen der Kleinkläranlagen der vier landwirtschaftlichen Anwesen waren befristet und sind abgelaufen.Da die Drei-Kammer-Gruben nicht dem heutigen Stand der Abwasserreinigungstechnik entsprechen, ist eine Verlängerung der Genehmigungsdauer nicht mehr zu erreichen. Für die Gemeinde galt es nun, eine wirtschaftlich vertretbare Lösung für alle Beteiligten zu finden.
Man suchte und fand – scheinbar – einen Konsens: Die Tannenhöfe sollen über eine Druckleitung an das Kanalnetz der Gemeinde angeschlossen werden. Der verbleibende Kostenanteil für die vier betroffenen Hofstellen wird auf jeweils 10 000 Euro pauschaliert – zuzüglich der individuellen Abwasserbeiträge laut Satzung. Die Gemeinde würde die Unterhaltungslast für die Druckleitung ab Pumpenschacht bei den einzelnen Gehöften bis zur Einleitungsstelle beim Sportplatz übernehmen. Für die Unterhaltung und die Betriebskosten der Zuleitung vom Haus zum Pumpenschacht, des Pumpenschachtes und der Pumpen bei den Gehöften wären die Anlieger zuständig.
Dieser Lösung würde das zuständige Wasserwirtschaftsamt zustimmen. Die betroffenen Landwirte strebten zunächst an, die vorhandenen Kleinkläranlagen um eine weitere Reinigungsstufe in Form eines Klärteiches oder eines Schilfbeetes zu ergänzen. Dies hätte Investitionskosten von 10 000 bis 15 000 Euro je Gehöft verursacht. Für die Anwohner wären auch weiterhin keine Abwassergebühren angefallen.
Wegen der teilweisen Lage innerhalb des Wasserschutzgebietes II wird diese Variante vom Wasserwirtschaftsamt jedoch verworfen. Genehmigungsfähig wäre hingegen die Umrüstung der Kleinkläranlagen in geschlossene Gruben mit regelmäßiger Abfuhr. Diese Lösung würde jedoch neben den Investitionskosten sehr hohe laufende Kosten verursachen. Bei Fremdabfuhr fielen rund elf Euro pro Kubikmeter an. Deshalb wurde diese Variante auch von den Landwirten verworfen.
Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung stand Fachgebietsleiter Martin Fetscher vom Amt für Boden- und Gewässerschutz bereit für die zahlreichen Fragen der Gemeinderäte. Ein Brief von einem Landwirt hatte die Räte aufgeschreckt, an ein abschließendes Votum war plötzlich nicht mehr zu denken. Man wolle erst genau wissen, „welche Paragraphen zur Ablehnung der Klärteiche geführt haben“, so Gemeinderat Peter Kaiser. Im übrigen sei zu fragen. „ob die Entscheidung des Wasserwirtschaftsamts auch vor Gericht stand hält“, fragte Gemeinderat Willi Storz. Schließlich hätte ein Teil der Landwirte einen Rechtsanwalt mit der „Wahrung ihrer Interessen“ beauftragt.
Fetscher kündigte an, dass das Wasserwirtschaftsamt nicht mehr länger zuwarten werde: „Wir haben die bestehende Situation …mehr:
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.moenchweiler-behoerde-droht-mit-verschluss.fb409681-670a-49fc-986d-07f78814f96b.html
(nach oben)
Mönchweiler: Alternativen der Abwasserentsorgung
Vorspann
Klärteich: Diese Alternative bevorzugen die betroffenen Landwirte. Die vorhandenen Kleinkläranlagen würden um eine zusätzliche Reinigungsstufe ergänzt. Pro Gehöft würde diese Variante Kosten in Höhe von rund 10 000 bis 15 000 Euro verursachen. Darüber hinaus fallen so zwar auch zukünftig keine Abwassergebühren an, es wären aber weiterhin eine Kleineinleiterabgabe und die Wartungskosten der Anlage zu bezahlen. Wegen der Lage der betroffenen Flurstücke in der Zone zwei des Wasserschutzgebietes wird diese Variante vom Wasserwirtschaftsamt nicht genehmigt.
Geschlossene Gruben: Genehmigungsfähig wäre die Umrüstung der Kleinkläranlagen in geschlossenen Gruben mit regelmäßiger Abfuhr des Abwassers durch die Landwirte oder die Gemeinde und die zentrale Einleitung an einer Übergabestation in das Kanalnetz („Rollender Kanal“). Hierzu müssten jedoch weitere Behälter gebaut werden. Neben den Investitionskosten von rund 10 000 Euro würde insbesondere die Abfuhr (bei Fremdabfuhr etwa elf Euro pro Kubikmeter) extrem hohe Kosten verursachen. Diese Variante ist deshalb nicht praktikabel und wird von allen Seiten abgelehnt.
Anschluss an das Kanalnetz: Diese Variante war zunächst als viel zu teuer verworfen worden, scheint nun aber die einzig praktikable zu sein. Die Gesamtkosten der Kanalverlegung bis …mehr:
http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/moenchweiler/Alternativen-der-Abwasserentsorgung;art372526,4675628
(nach oben)
AZV Unteres Leinetal : Delitzsch muss raus
Ohne eigenes Verschulden ist Delitzsch durch die Eingemeindung von
Poßdorf und Spröda in den Abwasserzweckverband Unteres Leinetal
hineingeraten, der wirtschaftlich katastrophal geführt wurde und nun
mit ca. 5 Mio. Euro hochverschuldet ist.
Naheliegend wäre eine regionale Zusammenarbeit mit einem anderen
Abwasserzweckverband. Die hat es mit Bad Düben auch gegeben, aber
den Dübenern reicht es jetzt – weitere Zusammenarbeit wird es nicht
geben, auch nicht mit Delitzsch oder Eilenburg.
Jahrelang hat der Verbandsvorsitzende Tiefensee tatenlos hingenommen,
dass der Verband gegen die Wand fährt. Jetzt ist sie da – die Wand.
Rücktrittsforderungen widerstand Tiefensee mit Rückendeckung seiner
CDU-Parteifreunde, obwohl dringend der Weg für eine Neuausrichtung
des Verbandes frei gemacht werden müsste; dann wäre vielleicht auch
wieder Zusammenarbeit möglich. Stattdessen aber setzt der Verband
auf eine europaweite Ausschreibung der Betriebsführung. Was dies
letztlich für die Gebührenzahler in den Gemeinden bedeutet ist ungewiss,
aber man kann es sich an den Fingern abzählen, wenn man die
Schulden mal durch die Zahl der betroffenen Einwohner dividiert.
Warum eigentlich äußert sich Herr Tiefensee niemals öffentlich zur Lage
seines AZV, zu den jetzt erfolgenden drastischen Gebührenerhöhungen
oder zu der Rücktrittsforderung des Löbnitzer Gemeinderates Wittig?
Als Delitzscher Stadtrat sehe ich derzeit keine Hoffnung. Der Verband
ist …mehr:
http://www.delitzsch-spd.de/index.php?nr=5058&menu=1
(nach oben)
Hamburg: Energieeinsatz auf den Hamburger Kläranlagen
Wer sich für den Energieeinsatz auf den Hamburger Klärwerken und für deren Kohlendioxidemissionen interessiert, findet zahlreiche Daten und Hintergrundinformationen in der sechs Seiten umfassenden Drucksache 19/7877 der Hamburger Bürgerschaft, mit der der Hamburger Senat auf die schriftliche Kleine Anfrage „Weniger CO2 und Energie durch verbesserte Abwassertechnik“ eines SPD-Abgeordneten in der Bürgerschaft antwortet.
www.buergerschaft-hh.de/parldok
(nach oben)
WVS: „Die Leute können rechnen“
Der Forderungskatalog der Bürgerinitiative gegen überhöhte Kommunal- abgaben stand im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen Bürgern und WVS-Werkleitung.
Bad Salzungen – Zehn Punkte hat der Forderungskatalog der Bürgerinitiative gegen überhöhte Kommunalabgaben Bad Salzungen und Umgebung (BI). Darunter sind solche wie die sofortige Abschaffung der Abwasserbeiträge, die Überarbeitung der Gebührenstruktur von Wasser- und Abwassergebühren, die Reduzierung der Investitionen sowie der Schuldenabbau. Auch fordert die BI die Namen der Verantwortlichen, die für die Investitionen beim WVS in den 90er Jahren verantwortlich waren.
Ein Jahr lang hatte die Bürgerinitiative um diesen Gesprächstermin gerungen. WVS-Verbandsvorsitzender und Kreisstadt-Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) hatte zwar immer Gesprächsbereitschaft signalisiert, aber darauf bestanden, dass die Forderungen vor dem Gespräch mit der BI zuerst im Verbraucherbeirat diskutiert werden. Nachdem das abgearbeitet war, kam es nun am Dienstagabend nach einem Jahr zu dem Gespräch zwischen WVS-Werkleitung, dem Verbraucherbeirat und Mitgliedern der Bürgerinitiative. Von den geladenen Landtagsabgeordneten hatte nur Frank Kuschel (Linke) den Weg nach Leimbach ins “ Weiße Roß“ gefunden.
Nur rund 20 Bürger verfolgten das Gespräch. Der Versuch den ganzen Fragenkatalog abzuarbeiten, scheiterte. Grund war einfach die zu knapp bemessene Zeit. BI-Vorsitzender Gundolf Troppa brach nach fast dreistündiger Debatte die Veranstaltung ab. Man vereinbarte jedoch für Anfang April den Fortsetzungstermin. Er soll dann in Bad Salzungen stattfinden, um Bürgermeister Bohl entgegenzukommen, der als Verbandsvorsitzender des WVS nur Termine in Bad Salzungen wahrnehmen will und am Dienstag eindeutig klarstellte, dass dieser Termin in Leimbach für ihn nur eine Ausnahme sein kann.
Abwasserbeiträge
Eine der wichtigsten Forderungen der Bürgerinitiative ist die Abschaffung der Abwasserbeiträge. „Aus Sicht des Verbandes ist eine solche Forderung nicht durchsetzbar“, sagte Verbandsvorsitzender Klaus Bohl unumwunden. Werkleiter Heiko Pagel unterlegte das mit Zahlen. Lege man die Zahlen von 2010 zugrunde, würde eine Abschaffung der Beiträge im Abwasserbereich eine horrende Steigerung der Gebühren zur Folge haben. Betragen die Gebühren zurzeit im Abwasser 2,26 Euro pro Kubikmeter (ohne Grundgebühr), so würden sie sich auf knapp fünf Euro pro Kubikmeter erhöhen.
Aus Sicht des Verbandes sei wichtig, so Pagel, dass die Regelungen bei Wasser, wo die Beiträge abgeschafft wurden und das Land Zinsbeihilfen zahlt, beibehalten werden und auch im Abwasser die Privilegierungstatbestände erhalten bleiben. Ein Bürger wollte wissen, warum dann viele Verbände, darunter auch die Stadt Erfurt, bis heute keine Beiträge erheben. Udo Schilling, Mitglied des WVS-Werksausschusses und Bürgermeister der Moorgrund-Gemeinde, verwies auf die rechtlichen Grundlagen und die unterschiedlichen Bedingungen der einzelnen Verbände. Rechtlich sei klar, dass Abwasserbeiträge zur Finanzierung der Investitionen im Abwasser erhoben werden müssen. Dass 47 Verbände das bisher nicht tun, liege daran, „dass sie noch nicht so weit sind, die Kläranlage beispielsweise noch nicht fertig ist“. Als Beispiel nannte Schilling die Gemeinde Marksuhl. Wenn die Kläranlage dort einmal fertig sei, müsse auch diese Gemeinde Abwasserbeiträge erheben.
Selbst das Mitglied des Landtages Frank Kuschel (Linke) sagte, dass eine völlige Abschaffung der Abwasserbeiträge im Verbandsgebiet des WVS nicht möglich sein werde. Der WVS Bad Salzungen habe sehr ungünstige Bedingungen. Die einzige größere Stadt sei Bad Salzungen mit knapp 16 000 Einwohnern. Die restlichen 59 000 Abnehmer kommen vom flachen Land. Viele Verbände hätten wenigstens die Hälfte der Verbraucher in großen Ballungszentren konzentriert. Allerdings, so Kuschel, sollte im Verband über eine Reduzierung der Beiträge nachgedacht werden. Nur noch 14 Aufgabenträger hätten eine Abwasserbeitrag von über drei Euro pro Quadratmeter Fläche. Wenn man diesen Beitrag beispielsweise um zwei Euro reduziere, ergebe sich eine Steigerung der Gebühren von 23 bis 28 Cent pro Kubikmeter Abwasser
Grundlagen falsch
Gundolf Troppa, Vorsitzender der Bürgerinitiative gegen überhöhte Kommunalabgaben Bad Salzungen und Umgebung (BI) und auch BI-Mitglied Jürgen Adler machten noch einmal auf die für sie falschen Grundlagen der Beitragsberechnung aufmerksam. Die Menschen verstünden nicht, was Abwasserbeiträge mit der Grundstücksfläche und der Geschosshöhe zu tun haben. Das produziere Ungerechtigkeit. Denn die Oma, die allein im Haus lebe, müsse bei gleicher Grundstücksgröße für ihr kleines Häuschen genauso viel Beitrag zahlen wie die fünfköpfige Familie.
Heftig gestritten wurde erneut über Sinn und Unsinn zentraler Kläranlagen. Hans-Gerd Oetzel und Wolfgang Held aus Unterbreizbach stellten erneut die Kläranlage in Unterbreizbach in Frage und wollten wissen, wieso die Ortsteile Räsa und Pferdsdorf angeschlossen werden müssen. Statt einen Aschehaldesammler mit 2,3 Millionen Euro zu bauen, sollte das Fördergeld den Menschen lieber für Kleinkläranlagen ausgereicht werden. Pagel forderte die Unterbreizbacher auf, endlich die Beschlüsse des eigenen Gemeinderates dazu zu akzeptieren.
Martin Henkel, BI Schweina, warnte davor, immer nur rückwärts zu diskutieren. Die Kläranlagen seien Tatsachen. Nun sollte sich der Verband eine neues Standbein suchen, und die Menschen beim Betreiben und bei der Wartung ihrer Kleinkläranlagen unterstützen. Bohl verwies darauf, dass sich die Bewegung längst umgekehrt habe und Menschen, die vom WVS nicht angeschlossen werden sollen, beispielsweise in Hohleborn oder Wildprechtroda, darum bitten, zentrale Lösungen zu schaffen. „Die Leute können rechnen“, sagte Bohl. Und Schilling ergänzte, dass eine Vollbiologie für den Einzelnen teurer komme, als der Anschluss an die zentrale Kläranlage. Im Wartburgkreis liege der durchschnittliche Beitrag bei knapp 3000 Euro, eine Kleinkläranlage koste aber zwischen 3000 und 5000 Euro plus jährlicher Energie- und Wartungskosten.
Sehr sachlich verlief die Debatte darüber, inwieweit man bei Wasser und Abwasser nicht die Grundgebühr senken und dafür die Leistungsgebühr …mehr:
http://www.freies-wort.de/nachrichten/regional/badsalzungen/fwstzslzlokal/art2446,1328042
(nach oben)
Aßlar: „Erhöhung ist rechtmäßig“
Widerspruchsausschuss des Kreises zum Thema „Abwasser in Aßlar“
Aßlar (gh). Die Vorlage des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Aßlar durch Bürgermeister Roland Esch (FWG) hat diesmal eine besondere Note erhalten, denn „die für das Haushaltsjahr 2010 beschlossene und eingeführte Gebührenerhöhung hat – wie wir alle wissen – für großen Wirbel gesorgt.“
Eine Bürgerinitiative habe „zum Kampf“ gegen die Erhöhung aufgerufen und vorgedruckte Widerspruchsschreiben verteilt. Grund war vor allem die fast 70-prozentige Abwasser-Gebührenerhöhung.
Die standardisierten Widersprüche, rund 950, lägen beim Widerspruchsausschuss des Lahn-Dill-Kreises. Und dessen Ausschussvorsitzender habe allen Widerspruchsführer geschrieben, mit den Feststellungen, dass die kostendeckende Gebührenerhöhung rechtlich in Ordnung und auch das gesamte Prozedere rechtmäßig sei. Vor diesem Hintergrund regte er an, Widersprüche zurückzunehmen. Hiervon hätten nach telefonischer Mitteilung des Kreises bereits „Hunderte“ Gebrauch gemacht.
Esch gab einen Vergleich mit Nachbarkommunen. Mit 2,60 Euro pro Kubikmeter seien im Lahn-Dill-Kreis nur Dillenburg (2,19), Haiger (2,50), und Sinn (2,13) billiger als Aßlar.
Kritik gabs am BI-Vorsitzenden Dietmar Zwerenz. So seien mit rechtlich aus Sicht von Fachleuten untauglichen Vordrucken viele Leute dazu animiert worden, ein Rechtsmittel einzulegen, das die Vorstufe eines Klageverfahrens ist. Man habe sie nicht darüber aufgeklärt, was dieses Rechtsmittel bedeute, dass solche Verfahren grundsätzlich Kosten verursachen, die vom Unterliegenden zu tragen seien.
Stadt und Stadtwerke hätten erreicht, Widerspruchsführer gebührenfrei zu stellen, wenn sie nach entsprechender Information ihre Widersprüche zurücknehmen. Wer weitermache, müsse im konkreten Fall klagen. Eine Klagebegründung sei aber nicht …mehr:
http://www.mittelhessen.de/lokales/top_news_aus_regionen/top_news_region_wetzlar_und_giessen/280691_erhoehung_ist_rechtmaessig.html
(nach oben)
Himmelkron: Geistesblitz spart 300 000 Euro
Die Gemeinde Himmelkron wird in der Klärschlammentsorgung einen eigenen Weg gehen: Die Himmelkroner setzen auf solare Klärschlammtrocknung. Ein entsprechendes Konzept wurde von Klärwärter Thomas Opel entwickelt.
Die Klärschlammentsorgung kostet der Gemeinde bisher jährlich 42 000 Euro. Ab 2013 haben Gemeinden nicht mehr die Möglichkeit, getrockneten Klärschlamm auf Feldern auszubringen, dann bleibe nur noch die Möglichkeit, den getrockneten Klärschlamm zu verbrennen, was laut Klärwärter Opel 60 000 Euro kosten würde. Nachdem Klärschlamm zu 96 Prozent aus Wasser bestehe, bemühe man sich, den Klärschlamm zu trocknen.
Abwärme als Trockner
Eine entsprechende Investition hätte jedoch 700 000 Euro verschlungen, so erste Überlegungen. Da kam Opel die Idee, die vorhandene Abwärme der Kläranlage zum Trocknen des Klärschlamm zu nutzen. Sieben entsprechende Versuche brachten Opel der Lösung näher. Zusammen mit der Firma Dry-Tec wurde schließlich eine Möglichkeit gefunden, die eine Trockensubstanz von 65 Prozent ermöglicht. Würde eine Wärmepumpe eingesetzt, könnte dieser Prozentsatz noch gesteigert werden.
Alles in allem spart die Lösung …mehr:
http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/1284815/details_8.htm
(nach oben)
Weissenfels: Umweltschützer zeigen Abwasserverband an
Die Auseinandersetzungen um die Kläranlage Weißenfels haben einen neuen Höhepunkt erreicht.
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands (BUND) hat Strafanzeige gegen den Zweckverband für Abwasserentsorgung Weißenfels (ZAW) als Betreiber erstattet. Hintergrund ist, dass zu stark verschmutztes Wasser in die Saale geleitet wird. Bei den jüngsten Überschreitungen der Grenzwerte Ende 2010 ist laut BUND das 24-fache des Erlaubten erreicht worden. Für den BUND gilt das Tönnies-Fleischwerk als wesentlicher Verursacher, weil es die maximal zulässigen Einleitmengen pro Tag mehrfach übertroffen habe. Weißenfels‘ Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) bestreitet, dass das die Ursache für die Grenzwertüberschreitungen ist. Tönnies sei der einzige Einleiter, den man lückenlos unter Kontrolle habe.
Ob es zu einem Verfahren kommt, ist noch unklar. Staatsanwalt Hans-Jürgen Neufang sagte auf Nachfrage der MZ, dass die Prüfung der Anzeige noch laufe.
Aufgrund der desolaten Kläranlage entsteht nicht nur ein Umweltschaden in der Saale, sondern droht auch ein finanzielles Desaster für …mehr:
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1295417196470
(nach oben)
Zweckverband Ostharz: entsorgt zukünftig selbst Kleinkläranlagen und abflusslose Abwassersammelgruben
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, der Zweckverband Ostharz übernimmt ab 01.01.2011 die Abfuhr von Kleinkläranlagen– und Sammelgrubeninhalten in allen Orten des Verbandsgebietes in Eigenregie.
– Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen Entsprechend dem Jahresabfuhrplan erfolgt einmal jährlich die Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen in festgelegten Zeiträumen für die jeweiligen Orte. Beachten Sie bitte diesbezüglich unsere Bekanntmachungen in der örtlichen Presse. Die Abfuhr erfolgt weiterhin straßenweise! Die betroffenen Kunden erhalten rechtzeitig vor Beginn der Abfuhr ein Informationsschreiben mit konkretem Termin. Kunden, die kein Terminschreiben erhalten haben, sind gemäß §14 der Abwasserentsorgungssatzung (in der Fassung vom 19.03.2008) ebenso verpflichtet, ihre Kleinkläranlagen mindestens einmal jährlich vom Fäkalschlamm entsorgen zu lassen. Die Abfuhr ist in diesem Fall selbständig im entsprechenden Zeitraum ( siehe Jahresabfuhrplan) beim Zweckverband anzumelden.
– Vollbiologische Kleinkläranlagen ( wasserrechtliche Erlaubnis des Landkreises muss erteilt sein) sind nach Bedarf gemäß Wartungsprotokoll zur Abfuhr anzumelden.
– Abfuhr von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben Für die Entleerung von abflusslosen Sammelgruben, die in der Regel mehrmals im Jahr erfolgen muss, empfehlen wir den betroffenen Grundstückseigentümern bzw. deren Beauftragten einen entsprechenden Abfuhrrhythmus mit dem Zweckverband Ostharz zu vereinbaren. Kunden mit bisher bestehenden Daueraufträgen bzw. die einen Dauerauftrag vereinbaren möchten, bitten wir, sich zwecks Abstimmung der Details mit dem Zweckverband in Verbindung zu setzen
E-Mail: ilmone.ebeling@zweckverband-ostharz.de
(nach oben)
Innsbruck: Sanieren wo andere Urlaub machen – Kanalsanierung in Innsbruck
Die Sanierung des Kanalnetzes in der historischen Innsbrucker Altstadt mit dem „Insituform-Verfahren“ ermöglichte es, knapp 1.750m Kanal DN 250-450 zu sanieren, ohne die Touristenströme aus aller Welt bei der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten Innsbrucks spürbar zu beeinträchtigen. Das Lösungswort hierfür: grabenlose Kanalsanierung. Bereits seit 2004 vertrauen die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) bei der Modernisierung ihres teilweise über 100 Jahre alten Kanalnetzes neben der klassischen Variante –Neuverlegung in offener Bauweise – auch auf die Sanierung mit innovativen Methoden der grabenlosen Kanalsanierung. Hierbei greifen die IKB immer häufiger auf die Linersanierung als wirtschaftliche Gesamtrenovierungsmaßnahme ganzer Kanalhaltungen zurück. Im Jahr 2008 stand nun, nach einer vorhergegangenen TV-Untersuchung und Zustandsbewertung, die Sanierung des Kanalnetzes im Altstadtbereich Innsbrucks an. Die Innsbrucker Altstadt ist mit ihren historischen Häusern aus dem 15. Jahrhundert ein wahres Schmuckstück, welches jährlich hunderttausende Touristen anzieht. Besonders beliebt ist das Wahrzeichen von Innsbruck, das „Goldene Dachl“: ein mit 2.657 feuervergoldeten Kupferschindeln gedeckter Prunkerker, der im Auftrag des Kaiser Maximilian I. an das bestehende Haus angebaut wurde. Zudem besteht die Altstadt aus einer Vielzahl kleiner Gässchen, die links und rechts von der Hauptstraße, der Herzog-Friedrich-Straße, abzweigen und teilweise nur zu Fuß zu erreichen sind. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte (und der ausreichend groß dimensionierten Kanäle) waren sich die Verantwortlichen bei der IKB, Dipl.-Ing. Bernhard Zit und dem zuständigen Ingenieurbüro INGUTIS, Dipl.-Ing. Andreas Beuntner schnell darüber einig, dass hier der Einsatz der grabenlosen Kanalsanierung aufgrund der geringen Beeinträchtigung von Anwohnern, Gewerbe und Tourismus ideal geeignet ist. Zumal sich dadurch auch noch ein großer Teil der Kosten gegenüber der Erneuerung der Kanäle in offener Bauweise einsparen ließ. Den Zuschlag für die Maßnahme und somit den Auftrag zur Sanierung der insgesamt ca. 1.750m Abwasserkanal DN 250-450 erhielt die Fa. Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH, Niederlassung München. Das Sanierungsprogramm stellte für die Spezialisten der Fa. Insituform, als Marktführer für grabenlose Kanalsanierung in Deutschland, keine besondere Problematik dar. Wohl aber waren bei diesem Projekt einige Randbedingungen zu beachten, die es von alltäglichen Baustellen abhoben. Spezielle Randbedingungen Dass der Sanierungsbereich innerhalb einer Fußgängerzone liegt, die ab 10:30 Uhr (von 06:00 Uhr bis 10:30 Uhr ist der Lieferverkehr zugelassen) nicht mehr von Fahrzeugen aller Art befahren werden darf, mag zunächst sehr positiv klingen. Die Realität sah aber leider anders aus: Die autofreien Flächen des spärlich vorhandenen Platzangebotes nach 10:30 Uhr waren innerhalb kürzester Zeit von den Ständen und Tischen der anliegenden Geschäfte und Gastwirtschaften blockiert. Und da dies, besonders in den Sommermonaten, eine wichtige Einnahmequelle darstellt, war ein großes Maß an Aufklärungs- und Abstimmungsarbeit notwendig, um die Einschränkungen sowohl für den Gaststätten- als auch für den Baubetrieb so gering als möglich zu halten. In Zusammenarbeit mit dem Obmann der Kaufleute und der Gaststätten sowie der Magistratsabteilung für Straßen- und Verkehrsrecht der Stadt Innsbruck wurde deshalb ein Bauablaufplan erstellt, der die Interessen aller Beteiligten berücksichtigte. Dieser sah auch mehrere Inversionen während der Nacht an den besonders sensiblen Stellen vor. Eine weitere besondere Randbedingung: die große Anzahl an einleitenden Betrieben.
http://www.insituform.de/uploads/tx_nxttcontentadditionalfields/Innsbruck_bi-UmweltBau_1-10_118-119.pdf
(nach oben)
ZEHDENICK: Entwässerungsbetrieb und Technische Uni Cottbus testen Pflanzen für die Klärschlammreinigung
ENTSORGUNG: Kupfergehalt grenzwertig
Das Zehdenicker Abwasser hat einen vergleichsweise hohen Kupfergehalt. Er liegt im Klärschlamm zwar noch unter dem gesetzlich zugelassenen Wert, doch könnte es passieren, dass er diese Marke überschreitet, sagt Stadtwerkechef Uwe Mietrasch. Der Versorger kümmert sich im Auftrag der Stadt um die Geschäfte des Entwässerungsbetriebs.
Wenn der Kupfergehalt im Klärschlamm zu hoch ist, wird es für den Eigenbetrieb Abwasser teuer. Dann kann der Dienstleister die jährlich anfallende Masse nicht mehr zu 100 Prozent an Landwirte abgeben, die ihn als Dünger auf Äckern einsetzen. Die Substanz müsste dann auf anderem Wege entsorgt werden, und das kann teuer werden. Die Kosten dafür würden sich dann auch in den Abwassergebühren widerspiegeln. Deshalb steht der Eigenbetrieb in engem Kontakt mit der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) in Cottbus, um mit Hilfe eines natürlichen und vor allem preiswerten Verfahrens den Kupfergehalt niedrig zu halten.
In einem ersten Versuch mit der BTU wurden verschiedene Pflanzen getestet. Dabei ging es darum zu ermitteln, inwieweit Kupfer aus dem Klärschlamm gezogen werden kann. Diesen Prozess in großem Umfang angewendet, nennt man Phytosanierung oder Phytoremediation. Damit wird die Sanierung von verunreinigten und kontaminierten Böden oder Grundwassers bezeichnet. Bei dem Versuch der BTU haben sich zwei Pflanzen als besonders geeignet herausgestellt. Eine Forschungsarbeit ist dazu entstanden und jetzt kann dieses Verfahren vor Ort in Zehdenick großflächig im Klärschlamm angewendet werden. „Wasserhyazinthe und Schilf sind besonders verheißungsvoll“, sagt Mietrasch. Die Wasserhyazinthe ist keine einheimische Pflanze, sie ist in den Tropen zu Hause. Sie überlebt deshalb keinen Mitteleuropäischen Winter im Freien. Für die Stadt wäre diese Überbrückungszeit kein Problem. Der Schlamm könnte im Winter gepuffert werden und im Frühjahr wieder mit den Pflanzen besetzt werden.
Die Wasserhyazinthe hat noch einen anderen Vorteil. Sie besitzt eine extrem hohe Resistenz gegen hohe Nährstoffgehalte. Das lässt sie einerseits sehr schnell wachsen, andererseits ist sie durch die hohe Nährstoffaufnahme sehr energiereich. Die könnte demnach sehr gut als Biomasse eingesetzt werden und in einer Biogasanlage zur Gewinnung alternativer Energien genutzt werden. Und hier schließt sich wieder ein Thema an, das in Zehdenick derzeit völlig ausgeblendet wird. Noch Mitte vergangenen Jahres sollte ein Projekt der Stadtwerke vorgestellt werden, das sich mit einer Biogasanlage unmittelbar auf dem Gelände der Kläranlage befasst hat. Die Widerstände in der Havelstadt sind aus unterschiedlichen Motiven heraus zu groß, als dass bisher konkreter darüber gesprochen werden konnte. Die Ängste der Anwohner in der Siedlung II sind verständlich. Sie wollen keine Lärm- und Geruchsbelästigung. Ungeachtet dessen ist aber auch nicht über einen Alternativstandort gesprochen worden.
Die Stadtwerke haben jetzt die Absicht, die Pflanze zu finden, die dem Entwässerungsbetrieb am meisten hilft. Die Wasserhyazinthe wäre eine Herausforderung, weil sie in unseren Breiten nicht natürlich vorkommt und viel Biomasse entwickelt. Schilf ist dagegen vor allem als Reinigungspflanze im Abwasserbereich schon bekannt. Hier bleibt zu beobachten, inwieweit Schilf genügend Kupfer aus dem Klärschlamm ziehen kann. (Von Andreas Röhl)
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11986430/61129/Entwaesserungsbetrieb-und-Technische-Uni-Cottbus-testen-Pflanzen-fuer.html
(nach oben)
Wittstock: Wasser- und Abwasserverband erledigte alle für 2010 geplanten Investitionen
Etwa eine Million Euro im Trinkwasserbereich und eine halbe Million im Abwasserbereich investierte der Wittstocker Wasser- und Abwasserverband (WAV) im vergangenen Jahr. Für 2011 sieht der Plan 700 000 Euro im Trinkwasserbereich und 570 000 Euro für Investitionen der Abwasseranlagen vor.
Während bei Trinkwasser mit 5300 Anschlüssen (Anschlussgrad von 99 %) fast alle Haushalte am Netz sind, liegt der Anschlussgrad beim Abwasser bei 75 %. „Das bleibt auch so“, sagt Verbandsgeschäftsführer Manfred Strüfing. Neue Abwasserkanäle sollen auf absehbare Zeit in keiner weiteren Ortschaft gebaut werden.
Ebenfalls bleiben vorerst die Preise stabil. Sie liegen beim Trinkwasser seit 1997 unverändert bei 1,55 Euro je Kubikmeter plus 5,35 Euro monatliche Grundgebühr. Im Abwasserbereich sind bei Anschluss an die Kanalisation seit einigen Jahren gleichbleibend 3,72 Euro je Kubikmeter zu zahlen (plus 7 Euro monatliche Grundgebühr). Bei mobiler Entsorgung fallen 3,98 Euro je Kubikmeter an (Grundgebühr 2,40 Euro). Vor der Einführung der im Jahr 2006 eingeführten Regel „Wasser gleich Abwasser“ waren für die Grubenleerung mehr als sieben Euro je Kubikmeter zu berappen.
Größte Investition im Trinkwasserbereich war der über zwei Jahre laufende Bau des Wulfersdorfer Wasserwerkes, der vom Land gefördert wurde. Es kostete insgesamt etwa eine Million Euro. Seit 2010 ersetzt es das außer Betrieb genommene alte Wasserwerk. Eigentlich sollte jetzt in diesem Jahr von Wulfersdorf aus Freyenstein beliefert werden, um das dortige alte Wasserwerk nebst Brunnen stillzulegen. Doch wurde der Leitungsbau nach Freyenstein verschoben, da das Land bisher keine Fördermittel freigab. Nach Freyenstein sollen in ferner Zukunft auch Ackerfelde und Niemerlang an den Wulfersdorfer Wasserlieferanten angeschlossen werden. Denn in Wulfersdorf gibt es laut Strüfing „sehr gutes Grundwasser“, mit dem der Verband wenig Aufbereitungsprobleme habe.
Trinkwasserleitungen wurden vor allem zusammen mit Straßenbauarbeiten erneuert. 120 000 Euro kostete die Leitung in Wittstock in der Burgstraße und am Kyritzer Tor bis zur Glinzebrücke. Hier war die archäologische Begleitung laut Strüfing „recht kostenintensiv“. 32 000 Euro waren für die Trinkwasserleitung Am Rosenwinkel zu zahlen und weitere 37 000 Euro Am Rosenplan.
Trinkwasserleitungen wurden in den Gröper Gärten bis zum Rote-Mühle-Weg verlegt (22 000 Euro), wo sich Eigenheimbesitzer bisher über eigene Brunnen versorgt hatten. Anschließend erneuerte die Stadt hier die Straße.
Beim dritten und letzten Bauabschnitt der Landesstraßen in Herzsprung mussten in der Fretzdorfer Straße Trinkwasserleitungen teilweise umverlegt werden, damit sie nicht unter der Straße oder Gehwegen verlaufen. „Im Trinkwasserbereich ist nichts mehr offen, außer einige Rechnungen“, berichtete der Verbandsgeschäftsführer.
Im Abwasserbereich wurde für 100 000 Euro die Kanalisation gleichzeitig zum Straßenbau in der Wittstocker Burgstraße errichtet. Im ersten Bauabschnitt des Rackstädter Weges wurde der Schmutzwasserkanal umverlegt und erneuert bis an die Rheinsberger Straße (80 000 Euro). Der zweite Bauabschnitt bis an den Amselweg wird begonnen, wenn es die Witterung zulässt. Dafür gibt es Fördermittel vom Land.
Für die Schmutzwasserleitung in den Gröper Gärten zahlte der Verband 25 000 Euro.
Anlageteile der Kläranlage wurden im Jahr 2010 für zirka 50 000 Euro erneuert. Etwa die gleiche Summe kam bei der Verbesserung von Pumpwerken und Steuerungstechnik …mehr:
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11983917/61299/Wittstocker-Wasser-und-Abwasserverband-erledigte-alle-fuer-geplanten.html
(nach oben)
Schmedehausen: Bakterien mit Atemnot
Die Teichkläranlage in Schmedehausen hat ein Problem – und das vor allem im Winter. Wenn bei Frost eine Eisschicht das Wasser bedeckt, wird der Sauerstoffaustausch über die Wasseroberfläche empfindlich gestört. Den Sauerstoff brauchen aber die Bakterien, die biologisch die Schadstoffe im Abwasser abbauen sollen. „Kommt weniger Sauerstoff bei ihnen an, können die Mikroorganismen ihre Arbeit nur noch unvollkommen verrichten, und die sonst übliche Wasserqualität am Ablauf wird nicht mehr erreicht,“ sagt Dietmar Beinker, beim Bau- und Entsorgungsbetrieb zuständig für die Entwässerungs- und Kanalplanung.
Und Abwassermeister Josef Averbeck ergänzt: „Die Teichkläranlage in Schmedehausen, die 1985 als Pilotprojekt des Landes in Betrieb ging, ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. So werden Stickstoff und Phosphat nur zum Teil aus dem Abwasser entfernt, was seinerzeit auch nicht gefordert war.“
Konsequenz: Der Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde hat jetzt festgelegt, dass die Anlage in dieser Form nur noch fünf Jahre betrieben werden darf. Sie reinigt das Abwasser von rund 170 Schmedehausener Bürgern sowie das Abwasser der Tankstelle und zweier Toilettenanlagen an Autobahnraststätten. Vom Einlauf gelangt das Abwasser zunächst in ein abgeteiltes Becken, in dem sich der Schlamm absetzt. Dann durchfließt es drei Teiche, in denen Bakterien mit Hilfe von Sauerstoff die Schadstoffe abbauen. Beinker: „Der Sauerstoffaustausch ist bei einer Eisdecke erheblich gestört. Das beeinflusst wiederum negativ die Parameter des gereinigten Abwassers, das über den Ablauf in den Eltingmühlenbach gelangt. Der Gesetzgeber schreibt uns jetzt vor, Maßnahmen zu ergreifen, um die Wasserqualität zu verbessern.“
Was kann die Stadt tun? Josef Averbeck: „Wir können die Kläranlage umbauen, mit der benachbarten Kläranlage für die Siedlung am Franz-Felix-See zusammen- legen ober das komplette Mischwasser aus Schmedehausen zur Grevener Kläranlage pumpen. Letzteres wäre jedoch mit großem Aufwand verbunden, weil große Menge Abwasser anfallen.“
In diesem Jahr startet der Bau- und Entsorgungsbetrieb zunächst einmal eine aufwendige Messreihe von Abwasserwerten. Ein Ingenieurbüro …mehr:
http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_steinfurt/greven/1476510_bakterien_mit_atemnot.html
(nach oben)
Pfullingen: Ausschreibung: Abholung, Transport und thermische Verwertung von entwässertem Klärschlamm in Kläranlage Pfullingen
Abholung, Transport und thermische Verwertung von entwässertem Klärschlamm der Kläranlage Pfullingen des Zweckverband Sammelklärwerk Oberes Echaztal mit Entwässerungsgraden zwischen 25 % – 35 % TS, Jahresmenge ca. 2 700 Mg/a Filterkuchen. 2 700 Mg/a Filterkuchen; 5 400 Mg Filterkuchen über die Laufzeit. Mehr:
http://www.bauportal-deutschland.de/oeffentliche_ausschreibung_vobvol_details_Abholung_Transport_und_thermische_
Verwertung_von_entwaessertem_Klaerschlamm_72793_Klaeranlage_Pfulli_308939.html
(nach oben)
Parchim-Lübz: Drehort für „Hammer der Woche“
Am Einlass wurde jeder kontrolliert.
DARGELÜTZ – Vor den Toren der einstigen Kaserne in Dargelütz waren am Donnerstagabend Absperrgitter und Scheinwerfer aufgebaut. Mitarbeiter des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz (WAZV) sowie eines privaten Sicherheitsdienstes kontrollierten Personen und Fahrzeuge. „Wir lassen nur Menschen rein, die eine Einladung vorweisen können und etwa 50 Personen, die die Versammlung als Gäste besuchen wollen“, erklärte ein Wachmann. Zusätzlich patrouillierte in unregelmäßigen Abständen ein Streifenwagen der Polizei. „Wir haben diese Maßnahmen getroffen, weil uns Demonstrationen von Bürgerinitiativen angekündigt sind. Schon vor einem Jahr gab es Probleme bei der Verbandsversammlung. Die Kommunalaufsicht und die Bürgermeister verlangten eine Atmosphäre, die ein ordentliches und sicheres Arbeiten ermöglicht“, begründet WAZV-Geschäftsführer Heinz Schünemann diese ungewöhnliche Maßnahme. Auf der Tagesordnung der Beratung des WAZV standen u. a. Beschlüsse zu Trink- und Schmutzwasserbeitragssatzungen, die zuvor auf Druck von Bürgerinitiativen und nach erfolgreichen Klagen vom Oberverwaltungsgericht Greifswald für ungültig erklärt worden sind.
Im Saal hätten durchaus deutlich mehr Besucher Platz gefunden. Für die stimmberechtigten Bürgermeister waren zwei lange Tafeln reserviert. Die eine Tafel blieb fast leer, obwohl fast alle Stimmberechtigten (48 für den Trinkwasserbereich und 42 für den Schutzwasserteil) anwesend waren. „Das ist eine große Sauerei, eigentlich ist die geforderte Öffentlichkeit nicht gegeben“, empörte sich Angelika von Fuchs von der Bürgerinitiative Gallin-Kuppentin. Verbandsvorsteherin Uta Bossow gab zu Beginn Rechtsanwalt Olaf Hünemörder das Wort, der den WAZV-Standpunkt zu den aktuellen Gerichtsurteilen erläuterte. Danach ging es um Satzungspunkte wie die Beitragspflicht für Grundstückseigner im Außenbereich sowie um den Kreis der Beitragspflichtigen. Wolfgang Hilpert von der Arbeitsgruppe Abwasser im Verband berichtete, dass es etliche Kontakte mit anderen Zweckverbänden im Land gab und deren Finanzierungsmodelle studiert wurden. Hilpert bemängelte die relativ späte Urteilsbegründung, die die Arbeit der Arbeitsgruppe behindert habe. Dem stimmte Reinhard Müller, Bürgermeister von Tessenow, zu. Auch er fühle sich nicht ausreichend informiert. Grebbins Bürgermeister Klaus-Dieter Möller kündigte seinen Widerspruch gegen den Beschluss an, da dies seine Einwohner von ihm erwarten würden.
Als Vertreter der Bürgerinitiative sich zu Wort meldeten, spitzte sich die Situation zu. Mehrfach drohte die Verbandsvorsteherin, den Saal räumen zu lassen. „Laut Geschäftsordnung haben Sie kein Recht der Diskussion“, sagte sie. Buh-Rufe und Fußtrampeln folgten. 9. Dezember zu knapp für weitreichende Entscheidungen sei. „Wir wollen mitreden, denn es geht um unser Geld“, war aus dem Publikum zu hören. Mehr:
http://www.zkwal.de/index.phtml?showdata-78&Instanz=148&Datensatz=57&SpecialTop=1
(nach oben)
Northeim: Klärwerk wird aufgerüstet
Die Leistungsfähigkeit der Northeimer Kläranlage am Kalbesbrook soll erhöht werden. Dafür investiert der Eigenbetrieb Abwasser der Stadt mehr als 600 000 Euro. Die letzten Aufträge für die umfangreiche Modernisierung der Anlage in Höhe von fast 180 000 Euro vergab kürzlich der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs.
Zur Betriebs-Optimierung des Klärwerks soll im Betriebsgebäude der Anlage in Kürze ein Prozessleitsystem eingebaut werden. Die 113 000 Euro teure Installation übernimmt eine Northeimer Firma. An das Leitsystem sollen über eine so genannte Fernwirkzentrale die Abwasserpumpwerke Hammenstedt, Stöckheim, Rhumestraße, Eschenschlag und Sülbendweg angeschlossen werden. Die übrigen Pumpstationen sollen in den kommenden Jahren in das Leitsystem integriert werden.
Neuer Radlader
Für 66 000 Euro kauft der Eigenbetrieb zudem einen gebrauchten Teleskopradlader. Mit ihm soll künftig der Klärschlamm über fünf Meter nach oben in das Schlammlager des Klärwerks befördert werden. Der Radlader mehr:
http://www.hna.de/nachrichten/landkreis-northeim/northeim/klaerwerk-wird-aufgeruestet-1063309.html
(nach oben)
Meppen: Stadtwerke modernisieren Kläranlage
Die Stadtwerke Meppen erweitern und modernisieren die Kläranlage an der Schützenstraße. Ende November erfolgte der Spatenstich zum Bau eines neuen Nachklärbeckens. Im Zuge der 1 Millionen Euro teuren Baumaßnahme wird auch die Elektrotechnik erneuert.
Die Kläranlage Meppen befindet sich in der Schützenstraße. Hier werden die Abwässer aus der Kernstadt und den Ortsteilen Borken, Hemsen, Hüntel, Helte, Schwefingen, Teglingen, Bokeloh und Apeldorn gereinigt. Anfang der neunziger Jahre wurde die Anlage grundlegend erneuert und auf eine Größe von so genannten 40000 Einwohnerwerten ausgebaut. Dieser Wert umfasst auch die entsprechend umgerechnete Schmutzbelastung durch die Industrie und das Gewerbe.
„Aktuelle Auswertungen haben gezeigt, dass die Zulaufbelastung der Kläranlage Meppen auf rund 44000 Einwohnerwerte gestiegen war“, sagt Projektleiterin Waltraud Aepken von den Meppener Stadtwerken. Auch wenn die geforderten Grenzwerte bis zum heutigen Tage nach kleineren Umbaumaßnahmen und betrieblichen Optimierungen eingehalten werden konnte, sei ein zweites Nachklärbecken jetzt erforderlich. Das neue Becken wird einen Durchmesser von 24 Metern sowie eine Wassertiefe von 4 Metern haben. Es wird als Stahlbetonbehälter erstellt und in den Baugrund eingelassen, so dass die Wasseroberfläche frei sichtbar ist.
Im Nachklärbecken wird das in der Kläranlage gereinigte Wasser-Schlamm-Gemisch beruhigt. Der Schlamm setzt sich am Beckenboden ab und wird zum Teil in den Reinigungsprozess zurückgeführt und zum anderen Teil als Klärschlamm in der Landwirtschaft als Dünger verwertet. Das übrige saubere Wasser wird bei guter Qualität in die Nordradde geleitet. „Das durch die erhöhten Abwassermengen ohnehin notwendige zweite Nachklärbecken stabilisiert die Reinigungsleistung der Kläranlage weiter, entlastet das vorhandene Nachklärbecken und dient als Ausfallreserve bei notwendigen Reparaturen“, erklärt Aepken.
Im Zuge der Maßnahme, die Bestandteil des technischen Gesamtkonzeptes für die Kläranlage ist, wird auch die Elektrotechnik modernisiert. Stadtwerkeleiterin Mechthild Wessels sagt, dass „sämtliche Maßnahmen zu einer höheren Betriebssicherheit und Prozessstabilität und einer noch besseren Wasserqualität führen.“ Bei entsprechender Witterung können die neuen Anlagenteile bis Mitte 2011 in Betrieb genommen werden. Insgesamt investieren die Meppener Stadtwerke in die Kläranlage rund 1 Millionen Euro. Die Europäische Union gewährt einen Zuschuss von 225000 Euro aus dem „EFRE-Programm“.
erstellt am 25.11.2010
Quelle:
http://www.meppen.de/magazin/artikel.php?artikel=526&type=&menuid=28&topmenu=27
(nach oben)
AZV Mariatal: Bank zur Zahlung von Schadensersatz an Abwasserzweckverband verurteilt
Der für das Bankrecht zuständige 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart hat am 27. Oktober 2010 die Deutsche Bank verurteilt, an einen ihrer Kunden, den oberschwäbischen kommunalen Abwasserzweckverband Mariatal (Ravensburg), Schadensersatz in Höhe von 710 000 Euro zu zahlen. Das Oberlandesgericht hielt die Beratung der Bank für fehlerhaft und verneinte gleichzeitig ein Mitverschulden des Kunden.
Der Zweckverband macht die beklagte Bank für Verluste von 710 000 Euro verantwortlich, die im Zusammenhang mit einem im Sommer 2005 abgeschlossenen Zinssatz-Swap („Swap“ 5 Tausch) entstanden sind. Streitig ist zwischen den Parteien, ob die beklagte Bank vor Abschluss des Vertrages über die Risiken richtig beraten hatte. Der Bankensenat hielt an seiner früheren Entscheidung vom 26. Februar 2010 (Az. 9 U 164/08) zu Swap-Verträgen fest, wonach diese als ein von der Bank konstruiertes Glücksspiel anzusehen seien. Die Bank müsse darüber aufklären, dass sie die Chancen zum Nachteil des Kunden gestaltet habe und dieser nach den anerkannten Wahrscheinlichkeitsmodellen eine höhere Verlustwahrscheinlichkeit habe.
Mit Blick auf den Verband als kommunales Versorgungsunternehmen beanstandete das Oberlandesgericht eine nicht anlegergerechte Beratung der Bank. Die Beklagte habe auch gewusst, dass der kommunale Verband keine riskanten Geldanlagegeschäfte abschließen dürfe. Es habe sich um ein für diesen unzulässiges Spekulationsgeschäft gehandelt. Der Senat verneinte ein Mitverschulden des Verbands. Die Bank sei als Expertin für kommunales Finanzmanagement mit hohem Fachwissen aufgetreten. Sie habe das kommunalrechtliche Spekulationsverbot gerade zum Gegenstand ihrer Beratung für den Kläger gemacht. Der Verband habe ihr daher vertrauen und annehmen dürfen, dass diese Geschäfte zulässig seien.
Das Oberlandesgericht hat die Revision zum Bundesgerichtshof zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen.
www.olg-stuttgart.de (Az. 9 U 148/08)
(nach oben)
Löhne: Auftrag der Wirtschaftsbetriebe
Die Wirtschaftsbetriebe Löhne erteilten der ARGE on/off e+a (on/off engineering gmbh und on/off automation gmbh) heute einen Auftrag über die Erneuerung der Fernwirktechnik für das Kanalnetz der Kläranlage Löhne. Die Maßnahme beinhaltet die Modernisierung der Fernwirkebene für das gesamte Kanalnetz inkl. der Umrüstung von insgesamt 46 Fernwirkunterstationen. Dabei werden die bisherigen analogen Telekom-Datenverbindungen auf ADSL- bzw. GPRS-/UMTS-Verbindungen umgestellt und mit der neu zu errichtenden PCS7-Fernwirkzentrale in das bestehende PCS7-Prozessleitsystem der Kläranlage integriert.
Quelle: http://www.onoff-automation.de/Aktuelle-Meldungen.478.0.html?&cHash=f7e1c175ed&tx_ttnews%5Btt_news%5D=121
(nach oben)
OOWV: Huder Kläranlage wird erweitert
Die Kläranlage in Hude wird erweitert. Im Juni soll mit dem Bau eines neuen Beckens mit integrierter Vorklärung begonnen werden. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) investiert laut Pressesprecher Lutz Timmermann rund 2,4 Millionen Euro in der Gemeinde Hude. Der größte Teil der Summe – rund 1,9 Millionen Euro – ist für den Ausbau des Klärwerks vorgesehen. Außerdem seien Maßnahmen im Bereich des Kanalnetzes und der Pumpwerke geplant.
„Die Kläranlage Hude ist inzwischen vollständig ausgelastet“, teilte OOWV-Sprecher Timmermann mit. Zur Stabilisierung des Betriebs und auch zur Sicherstellung der weiteren Entwicklung in der Gemeinde sei eine Erweiterung erforderlich.
„Die Kläranlage ist mit ihrer Leistung am Ende“, sagte auch Ralf Huismann, stellvertretender Betriebsleiter der Anlage an der Straße Leckerhörne. Nach Angaben des OOWV sind 4600 Haushalte in Hude, Wüsting und Altmoorhausen an das Klärwerk angeschlossen. Das entspricht laut Huismann 14000 Einwohnergleichwerten. Als Einwohnergleichwert wird die tägliche Abwassermenge bezeichnet, die ein Einwohner verursacht.
Weitere 3000 Einwohnergleichwerte sollen durch den Bau des neuen Beckens hinzukommen, das kleiner dimensionierte Teile der bestehenden Anlage ersetzen soll. Damit soll nach Auskunft des stellvertretenden Betriebsleiters sichergestellt werden, dass die Kapazitäten der Kläranlage ausreichen, wenn in der Gemeinde durch weitere Wohngebiete und neue Betriebe zusätzliches Abwasser anfällt.
Mit den Bauarbeiten soll im Juni begonnen werden. Für den Bau des Beckens werden nach Angaben von Timmermann im Wirtschaftsplan „OOWV Abwasser“, den die Verbandsversammlung gerade genehmigt habe, rund 1,9 Millionen Euro veranschlagt. Der geplante Ausbau werde über die Abwassergebühren finanziert. „Eine Erhöhung der Gebühren steht aber nicht an“, fügte der OOWV-Sprecher hinzu.
Das geplante Kombinationsbecken enthält laut Huismann eine Vorklärung und ein Belebungsbecken. In der Vorklärung …mehr:
http://www.weser-kurier.de/Artikel/Region/Landkreis+Oldenburg/302775/Huder+Klaeranlage+wird+erweitert.html
(nach oben)
Heidenfeld: Röthleiner Rat befürwortet Erweiterung der Kläranlage
Ja zu Fünf-Millionen-Projekt
Nur ein Mitglied war dagegen: Der Röthleiner Gemeinderat hat Ja gesagt zur Erweiterung der Kläranlage in Heidenfeld. Die Finanzierung des Fünf-Millionen-Euro-Projekts ist dagegen noch offen.
Zuvor hatte Schwebheims Bürgermeister Hans Fischer wie gewünscht den Rat über das Projekt des Zweckverbandes „Abwasserbeseitigung Unterer Unkenbach“ informiert, das bereits beschlossen und baurechtlich nicht mehr aufzuhalten sei. Momentan sei die Kläranlage in Heidenfeld für etwa 9000 Nutzer angelegt und gerate bei 11 000 bis 18 000 Einwohner-Gleichwerten (EGW) an den Rand der Belastbarkeit. Angesichts der demografischen Entwicklung strebe man eine Kapazität von 14 000 EGW an, so Fischer.
Möglich seien zwei Varianten: eine klassische aerobe Anlage mit Sauerstoffzufuhr, wie sie bereits in Heidenfeld in Betrieb ist, oder die vom Zweckverband favorisierte anaerobe mit Biogasanlage, die zwar keinen Gewinn erwirtschafte, aber doch eine „schwarze Null“ schreiben könne, da der erzeugte Strom selbst verwertet werden kann.
Verweis auf Nachhaltigkeit
Zudem sei der anaerob aufbereitete Klärschlamm besser verwertbar als der aerobe und die Biogasanlage spare so Energiekosten. Zudem können laut Fischers Präsentation im Faulturm zusätzlich andere organische Abfälle wie zum Beispiel Backabfälle vergoren werden. Ein großer Vorteil der ökologischeren Anlage sei neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch die mögliche Gliederung in mehrere Bauabschnitte.
Bei einer späteren – momentan aber nicht nötigen – Erweiterung der momentan anvisierten 14 000 Nutzer auf 18 000 fallen dann Mehrkosten von etwa 300 000 Euro an. Das Projekt umfasst den Bau einer neuen Sandfang- und Ölabscheidervorrichtung, einer zweiten Straße und einer „Art Treibhaus“ zur Trocknung des Klärschlamms.
3,6 Millionen Euro kostet die komplette Erweiterung, weitere 1,7 Millionen …mehr:
http://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Ja-zu-Fuenf-Millionen-Projekt;art763,5892779
(nach oben)
Bovenden: Abwasser wird in Nörten gereinigt
Das Abwasser aus den Ortsteilen, Reyershausen, Billingshausen und Spanbeck soll künftig in der Kläranlage Nörten-Hardenberg gereinigt werden. Einstimmig hat der Bau- und Umweltausschuss des Flecken Bovenden empfohlen, einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Flecken Nörten-Hardenberg zuzustimmen. Auch der Rat ist dieser Empfehlung mehrheitlich gefolgt.
In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr hat sich auch der Rat des Flecken Nörten-Hardenberg dafür ausgesprochen, eine entsprechende Zweckvereinbarung zu schließen. Laut Beschluss aus dem Nörtener Verwaltungsausschuss kann die Verwaltung die erforderlichen Aufträge vergeben. Im Frühjahr oder Frühsommer sollen die Arbeiten beginnen, sagte Nörtens Kämmerin Astrid Klinkert-Kittel.
Für den Bau der Transportleitung von der Abwasserreinigungsanlage (Ara) Reyershausen bis zum Kanalnetz des Flecken Nörten betragen die Kosten rund 1,2 Millionen Euro. Insgesamt würden jährliche Kosten von rund 204 000 Euro entstehen. Durch die Schließung der Ara Reyershausen ergäben sich jedoch Einsparungen in Höhe von rund 155 000 Euro. Für die Bovender Bürger hat das voraussichtlich eine Gebührenerhöhung von 13 Cent pro Kubikmeter zur Folge.
Allein schon deshalb bevorzuge der Flecken den Anschluss an die Kläranlage in Nörten, machte die Verwaltung deutlich. Die Kosten für die Sanierung der Kläranlage Reyershausen belaufen sich laut Bovender Gemeindeverwaltung auf rund 750 000 Euro. Die jährlichen Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten werden mit 67 500 Euro angesetzt, Für die Bürger ergäbe sich bei dieser Variante eine Gebührenanhebung von 16 Cent pro Kubikmeter. Außerdem sei man mit der einmaligen Investition …mehr:
http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Goettingen/Uebersicht/Bovendens-Abwasser-wird-in-Noerten-gereinigt
(nach oben)
Belgern: Betreibermodell oder Wiedereingliederung
Die Rolandstadt ist nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Betreiber für die Kläranlage. Allerdings ist noch nicht klar, ob ein Betreibermodell – wie ursprünglich vorgesehen war – in Betracht gezogen wird oder ob die Wiedereingliederung in den Zweckverband Torgau-Westelbien doch noch zum Tragen kommt. Das gab Bürgermeister Harald Thomas gegenüber der TZ nun bekannt. Ein Vorgespräch mit dem Zweckverband (ZV) hat diesbezüglich schon stattgefunden. „Allerdings besteht jetzt noch seitens des ZV Informationsbedarf, sodass in nächster Zeit einige Gespräche folgen werden“, so Harald Thomas weiter.
Inwiefern dann Preiserhöhungen die Folge seien werden, hänge letztendlich von dieser Entscheidung ab. „Dennoch soll es auch in Zukunft für die Bürger im Entsorgungsgebiet Belgern akzeptable Abwassergebühren geben“, fährt der Bürgermeister fort. So wurde vorerst auch die europaweite Ausschreibung bezüglich eines externen Betreibers auf Eis gelegt. Das beauftragte Planungsbüro hat jedoch Vorbereitungen getroffen, um gegebenenfalls sofort damit beginnen zu können. Laut Stadtoberhaupt ist es dringend notwendig, einen neuen Betreiber für das Klärwerk zu finden, da man die starken Schwankungen bei den Reinigungs- sowie die Probleme mit überhöhten Ablaufwerten endlich in den Griff bekommen will. Daraufhin gab er zu verstehen: „Es ist wichtig, in Notfällen oder in unerwarteten Situationen fachlich kompetente Leute an der Seite zu haben.“ Die Kläranlage Belgern …mehr:
http://www.torgauerzeitung.de/Default.aspx?t=NewsDetailModus(54240)
(nach oben)
Unteres Glantal: Neubau des Verbindungssammlers „Odenbach-Medard“
Anschluss des Odenbachtales an die Gruppenkläranlage Lauterecken
Neustadt an der Weinstraße/Odenbach – Wie Ralf Neumann, Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, mitteilt, wurde dem Abwasserzweckverband „Unteres Glantal“ die Genehmigung zum Neubau des Verbindungssammlers von der Ortsgemeinde Odenbach zur Ortsgemeinde Medard erteilt. Der Bau des Verbindungssammlers ist für den Anschluss des Einzugsgebietes der Kläranlage Odenbach an die Gruppenkläranlage (GKA) Lauterecken notwendig. Der geplante Verbindungssammler hat eine Länge von ca. 3,5 km und verläuft überwiegend im Gleiskörper der Draisinenstrecke, parallel zur B 420.
Zur Zeit werden die Abwässer der Ortsgemeinden Odenbach, Adenbach, Ginsweiler und Reipoltskirchen noch in der alten Tropfkörperkläranlage in Odenbach gereinigt, die 1977 in Betrieb ging. Die Kläranlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und muss daher stillgelegt werden. Die GKA in Lauterecken ist für den geplanten Anschluss ausreichend groß bemessen. Sie wurde in den neunziger Jahren für 9,5 Millionen DM saniert und auf 32.000 Einwohnerwerte erweitert. Der Anschluss des Odenbachtales wurde schon damals bei der Bemessung berücksichtigt.
Zukünftig sollen alle Abwässer des Odenbachtales in der GKA Lauterecken behandelt werden. Deshalb wird in einem weiteren Schritt die Kläranlage in Nußbach aufgelassen und die Ortsgemeinde über einen neu zu bauenden Verbindungssammler an die Ortsgemeinde Reipoltskirchen angeschlossen. Außerdem ist die Anpassung aller im Einzugsgebiet vorhandenen Regenentlastungsbauwerke an den Stand der Technik notwendig. Insgesamt müssen hierzu circa 540 Kubikmeter an neuem Rückhaltevolumen in der Kanalisation geschaffen werden. Dieses wird durch den Neubau von fünf Regenüberlaufbecken realisiert.
Für die Gesamtmaßnahme „Anschluss des Odenbachtales an die GKA Lauterecken“ inklusive der Verbindungssammler, dem Rückbau der Kläranlagen Odenbach und Nußbach, sowie dem Neubau beziehungsweise der Sanierung der Regenentlastungsanlagen werden circa 3,6 Millionen Euro veranschlagt. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hatte ergeben, dass der Anschluss des Odenbachtales an die GKA Lauterecken die kostengünstigste Variante darstellt. Die Umsetzung aller Maßnahmen soll bis Ende 2014 abgeschlossen sein. Im Abwasserzweckverband Unteres Glantal sind neben der Verbandsgemeinde Lauterecken noch die Verbandsgemeinden Altenglan und Wolfstein an den Maßnahmen gemäß der anteiligen Einwohnerwerte beteiligt. Die Maßnahmen werden entsprechend der jeweiligen Entgeltsbelastung der Verbandsgemeinden vom Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz mittels zinslosen Darlehen gefördert.
Mit der Durchführung der Gesamtmaßnahmen wird ein großer Beitrag zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erbracht, deren Ziele unter anderem die Herstellung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der Oberflächengewässer in der EU sind.
Die Maßnahmen sind Bestandteil des Maßnahmeprogramms zur Reduzierung der Stickstoff- und Phosphoreinträge in das Gewässer, und betreffen das Schwerpunktgewässer Glan des Bewirtschaftungsplans Rheinland-Pfalz.
(nach oben)
Breisgauer Bucht – Großkläranlage 30 Jahre Erfolgsgeschichte
Verbandsversammlung billigt Millioneninvestitionen im Forchheimer Wald / Größte Einzelmaßnahme: Modernisierung der elektronischen Einrichtungen.
FORCHHEIM. Die Kläranlage Breisgauer Bucht arbeitet seit 30 Jahren erfolgreich. 5,6 Millionen Euro werden 2011 in die Sanierung und Modernisierung der Anlagen investiert. Die Verbandsversammlung stimmte dem Wirtschaftsplan für das nächste Jahr zu und erhielt Informationen über neueste Studien zur Nutzung der Abwasserwärme.
Zuerst gab es Zahlen: Der Abwasserzweckverband (AZV) Breisgauer Bucht legte die Jahresrechnung 2009 vor und beschloss den Wirtschaftsplan für 2011. Im vergangenen Jahr lagen Einnahmen und Ausgaben bei 18,5 Millionen Euro. Knapp drei Millionen Euro wurden investiert: Rohwassserpumpwerk, Rechengebäude und Belebungsbecken wurden saniert. „Es waren zwölf erfolgreiche Monate“, sagte der Verbandsvorsitzende, Freiburgs Bürgermeister Otto Neideck.
2009 wies eine Besonderheit auf: Mit 36 000 Kubikmetern Abwasser wurde die geringste Menge in der Geschichte des Verbands geklärt. Im Schnitt kommen 43,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr in der Anlage an. Gründe: 2009 war sehr trocken, auch machte sich der sinkende Trinkwasserverbrauch bemerkbar.
Der Wirtschaftsplan 2011 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 15, 8 Millionen Euro vor. 5,6 Millionen Euro werden investiert. Größte Einzelmaßnahme ist die Modernisierung der elektrotechnischen Einrichtungen mit 2,3 Millionen Euro. Die Neuordnung der Prozessleitsysteme wird rund eine Million Euro kosten. Die Sanierung der Fällmittelstation ist mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Rund rund eine halbe Million Euro ist für die Sanierung verschiedener Abschnitte im Kanalnetz vorgesehen. Finanziert werden die Investitionen über eine Kreditaufnahme, die im Wirtschaftsplan mit 6,4 Millionen Euro veranschlagt ist.
Die Verbandsumlage steigt: Die Mitgliedsgemeinden müssen rund 14 Millionen Euro aufbringen und damit 210 00 Euro mehr als 2010 zahlen. Von 2007 bis 2009 lag die Verbandsumlage konstant bei 13,3 Millionen. 2011 wird sie um zwei Prozent steigen und der Trend geht weiter. Bis 2014 wird die Umlage wegen der vorgesehenen Investitionen zum Erhalt der 30 Jahre alten Anlage auf 15 Millionen Euro steigen. Damit ist die Umlage wieder auf dem Stand von 1998, so die Verbandsspitze. Es gab auch eine gute Nachricht: 2010 wurden zehn Millionen Euro umgeschuldet. Die neuen Darlehen sind mit 3,5 Prozent statt wie bisher mit fünf Prozent verzinst und bringen eine jährliche Entlastung von 150.000 Euro.
Die Verbandsversammlung stimmte Jahresrechnung und Wirtschaftsplan zu. Sie nahm das Ergebnis der Finanzprüfung zur Kenntnis. „Unauffällig“ lautete die Bilanz der Gemeindeprüfungsanstalt für …mehr:
http://www.badische-zeitung.de/kreis-emmendingen/grossklaeranlage-breisgauer-bucht-30-jahre-erfolgsgeschichte–38350998.html
(nach oben)
KLEINES WIESENTAL: Vier Millionen für Wasser/Abwasser
Zuschüsse für Projekte im Kleinen Wiesental werden beantragt.
Bürgermeister Gerd Schönbett sprach im Gemeinderat von knapp vier Millionen Euro, die die Gemeinde Kleines Wiesental in den kommenden Jahren in Maßnahmen für die Abwasserentsorgung sowie der Wasserversorgung ihrer Ortsteile investieren will.
Für zwei Projekte der Abwasserentsorgung sollen dieses Jahr beim Regierungspräsidium noch Zuschüsse beantragt werden. Hierbei handelt es sich um den Bau des Abwassersammlers von Wies nach Tegernau sowie den Ausbau der Ortskanalisation im Ortsteil Demberg. Beim Bau des Sammlers, so Bürgermeister Schönbett, habe man sich für eine Tunnelbohrlösung ohne Pumpwerke entschieden, da es sich hierbei mittelfristig um die günstigere Variante handelt. Auch sei hierbei mit geringeren Folgekosten zu rechnen.
Umsetzen möchte die Gemeinde 2011 auch ihr Wasserversorgungskonzept, …mehr:
http://www.badische-zeitung.de/kleines-wiesental/vier-millionen-fuer-wasser-abwasser
(nach oben)
Mannheim: Klärschlammvergasung eingeweiht
Im Klärwerk der Stadtentwässerung Mannheim ging am 9. November 2010 europaweit eine der ersten Anlagen zur Vergasung von Klärschlamm und Rechengut in Betrieb. Die Anlage hat eine Kapazität von 5000 Tonnen pro Jahr. Nach Fertigstellung von zwei weiteren Ausbaustufen soll das Klärwerk Mannheim, das bereits zu 60 Prozent seinen Energiebedarf durch erneuerbare Energien selbst deckt, diesen Anteil auf weit über 90 Prozent steigern. Nach Umsetzung aller Maßnahmen werde die Reduktion der CO2 -Emissionen pro Jahr circa 40 000 Tonnen betragen, so die Stadt Mannheim in einer Pressemitteilung. Die Anlage wurde in 20-monatiger Bauzeit vom Hersteller Kopf-SynGas GmbH & Ko. KG selbst errichtet und wird zunächst für ein Jahr von ihm betrieben.
Quelle: www.dwa.de
(nach oben)
Holzkirchhausen: Wärmegewinnung auf der Kläranlage
Gerade jetzt, in der kalten Jahreszeit, weiß das Betriebspersonal von Kläranlagen gut geheizte Betriebs- und Sozialräume zu schätzen. Auch die Möglichkeit, nach schmutzigen und kalten Außeneinsätzen eine heiße Dusche nehmen zu können, ist mehr als nur eine hygienische Notwendigkeit. Üblicherweise werden für die Heizung und Warmwasserbereitung auf Kläranlagen handelsübliche Heizungsanlagen und fossile Brennstoffe verwendet. Das erhöht die Betriebsausgaben und den CO2-Ausstoß. Bestenfalls wird, wenn ein Faulturm vorhanden ist, selbst erzeugtes Gas verbrannt oder die Abwärme eines Blockheizkraftwerkes genutzt.
Dabei fließen Tag für Tag völlig unbeachtet große Energiemengen in jede Kläranlage und, nach Durchlauf des Prozesses, auch wieder ungenutzt hinaus. Durch Einsatz von Wärmetauschern und einer Wärmepumpe kann dem Abwasser mehr als genug Energie entnommen werden, um den kompletten Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser einer Kläranlage zu decken. Wegen der großen Wassermenge führen schon geringste Temperaturdifferenzen auf der Primärseite zu ausreichenden Vorlauftemperaturen auf der Sekundärseite. Ein solches System hat KUHN im Laufe dieses Jahres auf der modernen SBR-Anlage in Holzkirchhausen installiert und damit die Planung des Büros SAG umgesetzt. Jetzt, im Winter, zeigt es seine Leistungsfähigkeit.
Schon nach Errichtung des Rohbaus wurden Ende 2009 ca. 540 m Soleleitung in den 3 Becken verlegt und dann im Profilbeton eingegossen. Dieses Jahr wurde im Zuge der Ausrüstung der Kläranlage auch die Wärmegewinnung installiert. Hier zeigte sich einmal mehr die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von KUHN. Durch unseren Geschäftsbereich ‚Haustechnik‘ hatten wir nicht nur gute Kontakte zu den entsprechenden Lieferanten, hier die renommierte Fa. Stiebel-Eltron, sondern auch alle für die Umsetzung nötigen Fachleute im eigenen Hause. Von der Beratung des Projektleiters über die Auswahl der geeigneten Komponenten bis zur Montage und Inbetriebnahme der gesamten Anlage: die Spezialisten, die sonst Häuser, Schulen und Kasernen mit zukunftsweisender Heiztechnik versorgen, haben hier ihr Können für eine moderne Kläranlage eingesetzt.
http://www.kuhn-gmbh.de/de/aktuelles.html
(nach oben)
Biberach: Gisela Ringwald beerbt Rainer Gutmann
Rückblicke auf ein eher ruhiges Jahr haben die Berichte bei der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Kinzig- und Harmersbachtal im Biberacher Rathaus geboten. Verbandsrechner Rainer Gutmann wurde verabschiedet und seine Nachfolgerin Gisela Ringwald vorgestellt.
Vorsitzender Hans Peter Heizmann lobte die „immer sehr angenehme Zusammenarbeit“. Als Nachfolgerin wurde die Haslacher Kämmerin Gisela Ringwald vorgestellt. Die 37-jährige Kämmerin der Stadt Haslach legte als erstes Zahlenwerk die Jahresrechnung 2009 vor und später auch den Haushaltsplan für 2011. Bei einem Volumen von knapp 2,7 Millionen Euro sind nach den kostenintensiven Vorjahren keinerlei Kreditaufnahmen für Investitionen mehr vorgesehen. Nachdem die Verbandskläranlage nun bestens für die Zukunft gerüstet ist, sollen die Schulden bis 2014 um eine runde Million Euro abgebaut werden.
Die praktische Seite erläuterte Betriebsleiter Aldrin Mattes. Die letzten Arbeiten der umfangreichen Sanierung wurden gemacht, und die Umstellung vom alten auf das neue Prozessleitsystem erforderte eine ständige Überwachung und Kontrolle. „Die Koordination der Arbeiten und die Gewährleistung der Sicherheit war für alle Beteiligten eine große Herausforderung“, so Mattes.
Besonders freute sich Vorsitzender Hans Peter Heizmann über die Energiebilanz der Anlage: 82 Prozent des benötigten Stroms werden im eigenen Blockheizkraftwerk erzeugt, wobei bei Überschüssen ein geringer Teil auch ins öffentliche Netz eingespeist wird. Einen detaillierten mehr:
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.haslach-i-k-gisela-ringwald-beerbt-rainer-gutmann.2e7473c7-52df-4cee-a8b6-b72753ed739b.html
(nach oben)
AZV Südholstein: Baubeginn für neue Biofilter
Biofilter sollen den Gestank stoppen / Investition: 1,2 Millionen Euro / Fertigstellung: März 2011.
Hetlingen. Spätestens im Frühjahr 2011 soll der Ärger über den Gestank vom Klärwerk der Vergangenheit angehören. Der Abwasser-Zweckverband (azv) Südholstein hat jetzt mit dem Bau eines Bio-Wäschers begonnen. 1,2 Millionen Euro wird in das Projekt investiert.
„Wir freuen uns, dass es mit dem Hochbau nun losgeht“, erklärt Verbandsgeschäftsführer Lutz Altenwerth. Damit werde Ende März 2011 eine Anlage in Betrieb gehen, die dem azv und den Hetlinger Bürgern ein hohes Maß an Sicherheit dafür bieten wird, dass das Thema Geruchsbelästigung das Verhältnis zwischen dem Klärwerk und seiner Standortgemeinde nicht mehr belaste.
Zwei Wäscher aus den siebziger Jahren hatten die Techniker des Zweckverbandes als Verursacher des Geruchs ausgemacht, der besonders im sehr heißen Sommer 2009 für reichlich Ärger im Dorf gesorgt hatte. Ursprünglich sollten sie in zwei Arbeitsstufen gegen Biofilter ausgetauscht werden. Doch diese Planungen hat man beim azv noch einmal überarbeitet und in einer Bauphase zusammengefasst.
Biofilter sind bereits mehrere auf dem Klärwerksgelände im Einsatz. Diese Technik leistet gute Dienste. Während Abluftwäscher geruchsintensive Substanzen in Waschflüssigkeiten chemisch binden, säubern bei Biofiltern Mikroorganismen …mehr:
http://www.ln-online.de/artikel/2873053/Baubeginn_f%FCr_neue_Biofilter.htm
(nach oben)