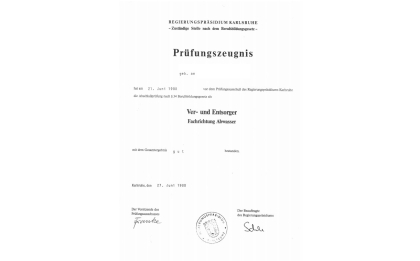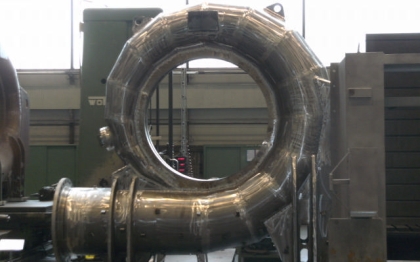1. Einleitung
Tenside sind oberflächenaktive Substanzen (eng. surfactant = surface active agent), die sich an Grenzflächen anreichern und als Lösungsvermittler die Grenzflächenspannung zwischen zwei verschiedenen Phasen herabsetzen. Sie sind also in der Lage, nicht mischbare Flüssigkeiten – z.B. Öl und Wasser – zu dispergieren, d. h. sie fein ineinander zu verteilen. Dies wird durch ihren amphiphilen (= beides liebenden) Charakter ermöglicht, der sich aus ihrem molekularen Aufbau ergibt. Tenside besitzen einen hydrophilen (wasserliebenden) und einen hydrophoben (wasserabweisenden) Teil. Der hydrophile Teil ist gleichzeitig polar und lipophob (fettabweisend), während der hydrophobe Teil unpolar und lipophil (fettliebend) ist. In wässrigen Phasen bilden Tenside kugelförmige Strukturen, so genannte Mizellen, die jeweils mehrere Tensidmoleküle enthalten (Abb. 1).
| Bei niedrigen Tensidkonzentrationen positionieren sich die einzelnen Moleküle zunächst an der freien Oberfläche. Mit steigender Tensidkonzentration nimmt die Oberflächenspannung der Flüssigkeit ab. Sobald eine bestimmte Tensidkonzentration erreicht ist, kommt es zur Mizellenbildung, da nun alle Plätze an der Oberfläche besetzt sind. Ab dieser Konzentration bleibt die Oberflächenspannung der Flüssigkeit konstant. Diese für jedes Tensid spezifische Konzentration wird kritische Mizellbildungskonzentration (eng. critical micelle concentration = cmc) genannt und ist ein wichtiger Parameter bezüglich der Anwendbarkeit der Tenside. |
 |
Synthetische Tenside haben wie viele industriell hergestellte Stoffe ihr Gegenstück in der Natur. Natürliche Tenside oder Biotenside werden von Mikroorganismen hergestellt und sind somit auch biologisch abbaubar. Eine Voraussetzung für die biologische Abbaubarkeit ist die Anwesenheit von dazu befähigten Organismen. Da die Herstellung von Biotensiden jedoch sehr teuer ist, werden überwiegend synthetische Tenside genutzt.
2. Klassifizierung von Tensiden
Tenside können sowohl anhand ihrer wasserabweisenden als auch ihrer wasserliebenden Gruppen klassifiziert werden. In der Praxis erfolgt die Klassifizierung überwiegend nach den wasserliebenden Gruppen. Dabei werden die Tenside in ionische, nichtionische und amphotere/zwitterionische Tenside eingeteilt.
Ionische Tenside werden in anionische und kationische Tenside unterschieden. Bei anionischen Tensiden ist die wasserliebende Gruppe negativ geladen, bei kationischen Tensiden dagegen positiv. Der wasserliebende Teil von nichtionischen Tensiden ist ungeladen. Bei amphoteren Tensiden – auch zwitterionische Tenside genannt – sind Kation und Anion durch kovalente Bindungen verknüpft, sodass die Tensidmoleküle wie nichtionische Tenside nach außen hin elektrisch ungeladen sind, durch die Zugabe von Anionen oder Kationen jedoch zu anionischen oder kationischen Tensiden werden können (Tab. 1). Bei der Klassifizierung nach wasserabweisenden Gruppen wird in Kohlenwasserstofftenside, Perfluortenside, Silikontenside und Block-Copolymere unterschieden (Kosswig & Stache, 1993).
Tabelle 1: Einteilung der Tenside nach hydrophilen (wasserliebenden) Gruppen

3. Allgemeine Anwendungsbereiche
Die erste nachweisbare Nutzung von Tensiden wird den Sumerern um 2500 v. Chr. in Form von Seife zugeschrieben. Die Herstellung erfolgte durch die Verseifung von Öl und Pottasche mit Alkalien wie Soda. Aufgrund des Mangels an Pottasche und Soda war Seife ein kostbares Gut, das eher als Heilmittel oder Kosmetikum diente und nicht wie heute für die Reinigung verwendet wurde. Erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde Seife für den Großteil der Bevölkerung erschwinglich, da die Verfügbarkeit von Soda durch das Leblanc-Verfahren sichergestellt wurde (Kosswig & Stache, 1993).
Tenside besitzen aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten und Funktionen, die weit über die Verwendung als Reinigungsmittel hinausgehen. Die oberflächenaktiven Substanzen werden auch in der Kosmetik sowie in vielfältigen industriellen und technischen Prozessen verwendet.
Wirtschaftlich stellen anionische Tenside die wichtigste Tensidklasse dar, gefolgt von nichtionischen Tensiden. Ein Tensid alleine kann meist nicht alle Anforderungen im Hinblick auf die gewünschte Leistung (z.B. Reinigung) sowie ökologische und wirtschaftliche Aspekte erfüllen. Deshalb werden häufig Tensidmischungen genutzt, in denen sich die verschiedenen Tenside in ihren Eigenschaften ergänzen.
Die Grundlage für viele waschtechnische Prozesse wie Schmutzablösung, Netzwirkung, Dispergier- und Schmutztragevermögen besteht in der Adsorption der Tenside an Grenzflächen. In wässrigen (polaren) Phasen kehrt sich der wasserliebende Teil der Tenside der wässrigen Phase zu, während der wasserabweisende Teil aus der wässrigen Phase hinausgedrängt wird. Der wasserabweisende Teil führt zu einer Anziehung der Tensidmoleküle zum festen, unpolaren Substrat, wie beispielsweise Schmutzpartikeln und Textilfasern. Diese werden im Wasser oft negativ geladen und stoßen sich somit stärker ab. Außerdem werden die Bindungsenergien zwischen Schmutz und Substrat herabgesetzt, sodass sich der Schmutz leichter entfernen lässt.
Die Anwendungen von Tensiden in Reinigungsmitteln erstrecken sich von Waschmitteln über Spülmittel zu Industriereinigungsmitteln. Waschmittel können durch die Verwendung verschiedener Tenside an das gewünschte Ergebnis angepasst werden. In Wollwaschmitteln werden beispielsweise neben nichtionischen Tensiden auch kationische Tenside eingesetzt, die die Wolle weich und flauschig machen.
Bei Geschirrspülmitteln werden die Tensidmischungen an manuelles oder maschinelles Spülen angepasst. In Handspülmitteln sind Tenside essentiell, die die Haut nicht angreifen. Beim maschinellen Spülen spielen beispielsweise Schauminhibitoren eine Rolle, die dafür sorgen, dass es bei der hohen Pumpleistung nicht zur übermäßigen Schaumbildung und dadurch zu Maschinenschäden kommt. In Industriereinigungsmitteln kommt es darauf an, ob diese alkalisch, neutral oder sauer sind. Dementsprechend müssen die ausgewählten Tenside eine Stabilität im alkalischen oder sauren Milieu aufweisen.
Auch in der Kosmetik findet eine vielfältige Nutzung von Tensiden statt. Im Gegensatz zu Industriereinigungsmitteln steht hier die Hautverträglichkeit im Vordergrund. Da bei der Hautreinigung neben unerwünschtem Fett auch Hautfette mit entfernt werden, kann es bei zu starker Entfettung zu einer kurzzeitigen Veränderung bis zu einer Zerstörung der Hautbarrierefunktion (dem Schutzmantel der Haut) kommen. Mögliche Folgen sind trockene Haut aufgrund eines erhöhten Wasserverlusts oder andere Hautirritationen, da die Haut nun auch durchlässiger für Fremdstoffe gemacht wird. Um diese Nebenwirkungen auszuschließen, sollten möglichst milde Tenside in der Kosmetikindustrie genutzt werden. Allergische Reaktionen sind meist nicht den Tensiden, sondern den zugefügten Duftstoffen und Konservierungsmitteln zuzuschreiben.
Während bei der kosmetischen Reinigung meist anionische und amphotere Tenside genutzt werden, werden bei der Pflege der Haut überwiegend nichtionische Tenside als Emulgatoren genutzt. Bei der Haarpflege dominieren kationische Tenside, weil sich die Haare durch die positive Ladung besser kämmen lassen. Die dermatologische Verträglichkeit spielt bei Pflegeprodukten eine primäre Rolle, da diese meist bis zur nächsten Reinigung auf der Haut verbleiben und nicht wie bei Reinigungsmitteln schnell wieder abgespült werden (Kosswig & Stache, 1993).
In der Lebensmittelindustrie werden Tenside eingesetzt, um die Konsistenz oder auch die Verteilung der verschiedenen Phasen ineinander zu beeinflussen. Weit verbreitet ist der Einsatz von Tensiden als Emulgatoren in Milchprodukten, Margarine, Brotaufstrichen oder Dressings, um die Bestandteile Wasser und Fett miteinander zu vermischen (Tripathy et al., 2018).
In Pflanzenschutzmitteln werden Tenside als Emulgatoren genutzt, um durch das Herabsetzen der Oberflächenspannung eine gleichmäßige Verteilung der Spritzflüssigkeit auf großen Flächen sowie eine bessere Benetzung der Pflanzen zu gewährleisten. Außerdem können Tenside die Wirkstoffmenge bestimmen, die auf der Blattoberfläche zurückbleibt und dadurch das Eindringen des Wirkstoffes in die Pflanze beeinflussen (Kosswig & Stache, 1993).
In der pharmazeutischen Industrie werden die Funktionen von Tensiden genutzt, um Wirkstoffe in Tabletten im Körper gezielt zu aktivieren. Dadurch kann sowohl die Resorption des Wirkstoffs im Körper als auch seine Verträglichkeit gesteuert werden. Mit Emulgatoren kann eine Depotwirkung sowie eine beschleunigte oder verzögerte Wirkung von Arzneimitteln erzielt werden. In diesem Anwendungsbereich kommt es maßgeblich auf die pharmakologische und toxikologische Unbedenklichkeit der genutzten Tenside an (Kosswig & Stache, 1993). Um Arzneimittel im Körper gegen die eigene Immunabwehr zu schützen und um ihre Bioverfügbarkeit zu erhöhen, werden diese in sogenannte Liposomen eingebettet (Kepczynski & Róg, 2016). Liposome sind kugelförmig und bestehen aus einer Doppelschicht von Membranmolekülen, die einen wasserliebenden und wasserabweisenden Teil besitzen. Die dadurch entstandene Membran kann in ihrem Inneren fettliebende Substanzen einlagern und im Körper zum gewünschten Wirkort transportieren. Vor allem für die Krebstherapie besitzt die Nutzung von Liposomen eine große Bedeutung (Liang et al., 2019).
In der Textilindustrie existiert ebenfalls ein breites Spektrum für die Verwendung von Tensiden. Diese werden unter anderem zur Vorbehandlung von Fasern, in Färbereihilfsmitteln, Hydrophobiermitteln (zur Imprägnierung), Antistatika oder Beschichtungsmitteln eingesetzt.
Bei der Herstellung von Lacken, Pigmenten und Druckfarben werden Tenside als Dispergier-, Antiabsetz- oder Verlaufmittel zugegeben. In der Papierindustrie finden Tenside in vielen Prozessen Anwendung. Beispielsweise werden sie zur Harzentfernung bei der Zellstoffgewinnung und Pigmentdispergierung sowie zur Schaumbekämpfung eingesetzt. Zudem kommen Tenside bei der Regenerierung von Altpapier zum Einsatz. In der Lederindustrie werden Tenside in verschiedenen Arbeitsphasen wie der Vorbehandlung, Gerbung und Nachbehandlung sowie der Pflege des Leders verwendet. In der Fotoindustrie können Tenside in Gießhilfsmitteln, Antistatika, Gleitmitteln sowie Emulgier- und Dispergiermitteln gefunden werden. Bei der Betonproduktion werden schäumende Tenside als Luftporenbildner in Leichtbeton eingesetzt, der dadurch eine geringere Anfälligkeit gegenüber Frostschäden erlangt (Kosswig & Stache, 1993).
In der Mineralölindustrie werden Tenside genutzt, um das Kälteverhalten der Produkte zu verbessern und um Korrosionsschäden zu verhindern. Kraftstoffen werden Tenside zur Vermeidung von Ablagerungen durch Verbrennungsrückstände sowie zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und zur Reduzierung von Schadstoffemissionen zugesetzt.
Einige Tenside wie quartäre Ammoniumverbindungen werden aufgrund ihrer bakteriostatischen Wirkung als Biozide oder in Desinfektionsmitteln eingesetzt. Aufgrund ihrer permanent positiven Ladung adsorbieren sie stark an Oberflächen und Partikeln. In Kläranlagen werden sie schlecht biologisch abgebaut, aber adsorptiv zurückgehalten, so dass sie im Klärschlamm wieder zu finden sind. Desinfektions- und Reinigungsmittel mit quartären Ammoniumverbindungen sollten vermieden werden, da einige Stoffgruppen als wassergefährdend eingestuft werden (LANUV, 2014).
In Feuerlöschschäumen waren früher perfluorierte Tenside (PFT) enthalten, die für eine bessere Benetzung von brennenden Flächen und somit für bessere Löscheigenschaften sorgten. Außerdem verhinderten sie eine Rückzündung der Schaummittel, wodurch das Löschpersonal besser geschützt wurde. Seit Juli 2020 ist der Einsatz von Perfluoroktansäure (PFOA), einer Leitsubstanz unter den perfluorierten Tensiden, jedoch verboten, da diese Art von Tensiden in der Umwelt nicht biologisch abbaubar ist und sich in Lebewesen anreichert (UBA, 2017).
Tenside werden darüber hinaus für die biologische Sanierung von mit Schadstoffen kontaminierten Böden genutzt. Sie können die Bioverfügbarkeit von organischen Schadstoffen wie polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) erhöhen, die dadurch von spezialisierten Mikroorganismen abgebaut werden können (Geller, 2001). Die Erhöhung der Bioverfügbarkeit wird durch die Verringerung der Oberflächenspannung zwischen den unpolaren Kohlenwasserstoffen und ihrer wässrigen Umgebung erreicht. Die wasserabweisende Gruppe des Tensids lagert sich dabei an die fettliebenden Schadstoffe an. Diese werden wiederum durch die wasserliebende Gruppe des Tensids in Lösung gebracht, wodurch ihre biologische Verfügbarkeit erhöht wird (Oberthür, 2004). Bei der Bodensanierung sind Biotenside eine Alternative zu schwer abbaubaren synthetischen Tensiden. Es besteht die Möglichkeit, dass Bakterien die Biotenside vor Ort produzieren, um Schadstoffe abzubauen. Dabei müssen sich die Bakterien jedoch zunächst gegen die ansässige, konkurrenzstarke Mikroflora behaupten, die schon an die Standortbedingungen angepasst ist (Geller, 2001).
Weiterhin erstreckt sich die Nutzung von Tensiden auf die metallverarbeitende Industrie, die Galvanotechnik, den Bergbau, die Erdölförderung und viele weitere Bereiche (Kosswig & Stache, 1993).
4. Biologischer Abbau und Anwendung von Tensiden in Kläranlagen
Wenn Tenside für eine bestimmte Anwendung genutzt werden sollen, ist bei der Auswahl größte Sorgfalt geboten, da viele synthetische Tenside nicht vollständig biologisch abbaubar sind. Zunächst unterliegen sie dem Primärabbau, bei dem sie ihre Oberflächenaktivität verlieren. Der wasserliebende Teil wird dabei vom wasserabweisenden Teil getrennt. Bei diesem Prozess entstehen Metabolite (Abbauprodukte), die durch den Endabbau in Wasser, Mineralien und CO2 zerlegt werden müssen. Einige Metabolite sind jedoch nicht biologisch abbaubar und können aufgrund ihrer steigenden Hydrophobizität toxischer sein als ihre Ausgangssubstanzen. Für eine effiziente Mineralisation der Tenside ist darüber hinaus eine spezielle Bakteriengemeinschaft in einer an die Tenside angepassten Umgebung (z.B. im Belebtschlamm in Kläranlagen) notwendig, da die Tenside je nach Abwasserzusammensetzung und -herkunft die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen (Carvalho et al., 2003).
| Auch in Kläranlagen besitzen Tenside vielfältige Anwendungsbereiche. Der Einsatz von Tensiden als Hilfsmittel in Kläranlagen scheint zunächst paradox, da sich im Abwasser schon ein großes Tensidgemisch aus Reinigungsmitteln, Kosmetika und Industrie befindet. Diese Tenside haben ihre Oberflächenaktivität jedoch meist schon durch den bereits im Kanal durchlaufenen Primärabbau verloren (Strunkheide, 2003). |
 |
Die Bakterien besitzen eine äußere Schutzhülle, die sogenannte Zellmembran. Die Zellmembran besteht aus Phospholipiden, die eine Doppelschicht bilden und als Biotenside bezeichnet werden, da sie wie die synthetischen Tenside einen wasserliebenden Kopf und wasserabweisenden, fettliebenden Schwanz besitzen (Abb. 2).
 |
Aufgrund des ähnlichen Aufbaus können sich externe Tenside in die Zellmembran von Bakterien einlagern. So wie Tenside in Kosmetikprodukten unsere Haut durchlässiger für bestimmte Stoffe machen, führt auch die Einlagerung von Tensiden in die Zellmembran dazu, dass ihre Durchlässigkeit (Permeabilität) steigt (Abb. 3). Dadurch können Biomoleküle (z.B. Enzyme) leichter aus der Bakterienzelle hinaus transportiert werden, was einen schnelleren Abbau der Abwasserinhaltsstoffe ermöglicht (Oberthür, 2004).
Durch die Einlagerung der Tenside in die Zellmembran können die Belebtschlamm-bakterien bei Belastungsstößen zügiger arbeiten. Da der Transportwiderstand in der Zellmembran durch die eingelagerten Tenside herabgesetzt wird, können die Mikroorganismen die Abwasserinhaltsstoffe deutlich schneller abbauen. Der beschleunigte Abbau der Abwasserschmutzfracht wird durch weitere Mechanismen begünstigt. Zum einen hemmen die zugesetzten Tenside die Koaleszenz der Luftblasen im Belebungsbecken. Das bedeutet, dass der eingeblasene Sauerstoff in kleineren Bläschen vorliegt und sich zudem länger im Belebungsbecken hält.
|
Durch die kleineren Bläschen wird die Kontaktfläche für die Mikroorganismen und somit deren Sauerstoffversorgung erhöht. Zum anderen werden wasserunlösliche Kohlenstoffverbindungen (v.a. Fette) zu feinsten Tröpfchen dispergiert. Dies erhöht die Angriffsfläche für Mikroorganismen erheblich, da diese über die Zellmembran direkt mit dispergierten Tröpfchen in Kontakt treten können (Strunkheide, 2003).
In Folge des schnelleren Abbaus können sich deutlich mehr höher organisierte, räuberische Organismen (z.B. Wimpertierchen, Räder- oder Bärtierchen) in der Mikroorganismengemeinschaft im Belebtschlamm (Belebtschlammbiozönose) entwickeln. Die höher organisierten Organismen sind überwiegend an geringere Belastungen (BSB5, NH4-N) bzw. relativ hohe Sauerstoffkonzentrationen angepasst und können sich bei abweichenden Bedingungen nicht im Belebungsbecken halten. Werden die Stoßbelastungen von den Bakterien aufgrund des „Tensid-Dopings“ schneller abgebaut, können sich die höheren Organismen deutlich besser vermehren. Diese räuberischen Organismen benötigen für den Fang ihrer Beute viel Energie, sodass ein Großteil der verfügbaren Nahrungsenergie nicht in Biomasse, sondern in CO2 umgewandelt wird.
Dieser Effekt kann einerseits zur Reduktion von Überschussschlamm auf Kläranlagen genutzt werden (Bioserve-Verfahren). Dafür wird eine bestimmte Tensidmischung in geringer Konzentration in den Rücklaufschlamm dosiert. Der TS-Gehalt im Belebungsbecken wird dabei konstant gehalten. Durch die erhöhte Fraßtätigkeit der Belebtschlammorganismen sinkt der spezifische Überschussschlammanfall bezogen auf die CSB-Fracht im Zulauf zur Biologie. Das Schlammalter steigt infolge dessen an, ohne dass der TS-Gehalt angehoben werden muss.
Andererseits kann durch die Dosierung von Tensiden in den Rücklaufschlamm Belüftungsenergie eingespart werden (Bioserve-Energy-Verfahren). Aufgrund der höheren Anzahl an räuberischen Organismen, die den Großteil der Nahrungsenergie in CO2 umwandeln, sinkt der TS-Gehalt im Belebungsbecken bei konstantem Überschussschlamm-Abzug. Da der Biomassegehalt nun geringer ist, steigt die Schlammbelastung an. Aufgrund des verringerten TS-Gehalts sinkt die Grundatmung des Belebtschlammes, wodurch der Stromverbrauch um ca. 10 % pro g TS/l gesenkt werden kann. Trotz der höheren Schlammbelastung wird die Reinigungsleistung der Kläranlage nicht beeinträchtigt, da die Stoffwechselgeschwindigkeit durch die Tensidzugabe erhöht wird. Die höhere Schlammbelastung sorgt dagegen für einen höheren Energiegehalt des Überschussschlammes, was zusätzlich zur eingesparten Belüftungsenergie zu einer besseren Gasausbeute im Faulturm führt.
Bei beiden Verfahren werden Gram-positive Fadenbakterien wie Microthrix parvicella und Nocardioforme Actinomyceten („Nocardia“) reduziert, da die von ihnen bevorzugten Substrate durch die Tenside auch für flockenbildende Bakterien verfügbar gemacht werden und sie somit deren Konkurrenz unterliegen. Auch die Zunahme der räuberischen Organismen (z. B. Zangenrädertierchen wie Cephalodella spp.) führen zum vermehrten Fraß der Fadenbakterien. Das Schlammabsetzverhalten wird verbessert, da sich auch Organismen („Weidegänger“) vermehren, die eine sogenannte „Flockenpflege“ betreiben (z.B. Aspidisca spp.). Die Belebtschlammflocken bleiben durch das „Abweiden“ rund und kompakt, weshalb sie sich besser absetzen.
Der beschleunigte Substratabbau begünstigt die Ausbildung einer stabilen und leistungsfähigen Belebtschlammbiozönose mit vielen Protozoen. Diese leistungsstarke Organismengemeinschaft sorgt für einen zuverlässigen Abbau der CSB- und BSB5-Frachten und eine stabile Nitrifikation.
In hohen Konzentrationen können Tenside jedoch auch zu Membrandefekten führen und die Zelle zerstören (Oberthür, 2004). Für den Überschussschlammaufschluss mit Tensiden (TESI) wird genau dies genutzt, indem vor der maschinellen Eindickung eine erhöhte Tensidkonzentration auf den Überschussschlamm dosiert wird. Aufgrund der gesteigerten Membrandurchlässigkeit können die Bakterienzellen besser aufgeschlossen werden, wodurch die Gasausbeute im Faulturm steigt.
Zudem werden die Bindungen zwischen den Belebtschlammflocken geschwächt und die Auflösung von eiweißhaltigen Schleimstoffen (extrazellulären polymeren Substanzen = EPS) unterstützt. Durch die Zerstörung der Flockenstruktur wird Wasser aus dem Inneren der Flocken frei, was in einer verbesserten Schlammentwässerung resultiert (Guan et al., 2017). Die von der Bioserve GmbH verwendeten Tenside sind leicht abbaubar und unterliegen einem vollständigen biologischen Abbau nach 28 Tagen (Testreihe OECD 301 F).
Tenside können neben der Entfernung von Schadstoffen aus Böden (siehe Abschnitt 3) auch zur Entfernung von organischen Schadstoffen aus dem Schlamm beitragen. Der Mechanismus ist dabei derselbe: Die Bioverfügbarkeit der Schadstoffe wird durch eine Verringerung der Oberflächenspannung zwischen Schlamm und Schadstoff verbessert, was den biologischen Abbau durch Mikroorganismen ermöglicht (Guan et al., 2017).
Neben organischen Schadstoffen können auch Schwermetalle mithilfe von Tensiden aus dem Schlamm entfernt werden. Aufgrund ihrer Bindungsfähigkeit können Tenside die Desorption von Schwermetallen vom Schlamm verbessern. Auch bei der Biolaugung (bioleaching) führt der Einsatz von Tensiden zu einer erfolgreichen Entfernung von Schwermetallen aus dem Schlamm. Dabei spielt die Versauerung des Schlamms durch Eisenoxidation (durch Acidithiobacillus ferrooxidans) oder Schwefeloxidation (durch A. thiooxidans) eine wichtige Rolle. Der Zusatz von Tensiden verringert die Oberflächenspannung von Schwefel, wodurch dessen Oxidation durch A. thiooxidans beschleunigt wird. Durch die dabei produzierte Säure wird die Löslichkeit der Schwermetalle erhöht (Guan et al., 2017; Xin et al., 2009).
5. Fazit
Die Anwendungsgebiete der Tenside sind aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften breit gefächert. In der Industrie werden je nach Anspruch an die Reinigungsleistung, Hautverträglichkeit, Schaumbildung etc. verschiedenste Tenside oder Tensidmischungen hergestellt und genutzt. Sehr häufig ist auch der Einsatz als Emulgatoren und Netzmittel. Im Umweltbereich werden Tenside verwendet, um mit Schadstoffen kontaminierte Böden zu reinigen.
Die Bioserve GmbH macht sich zu Nutze, dass einige Tenside die Durchlässigkeit von Zellmembranen erhöhen, und somit den Abbau von Abwasserinhaltsstoffen beschleunigen. Daraus resultieren eine bessere Flockenstruktur, eine leistungsfähigere Belebtschlammbiozönose, eine Reduzierung von Fadenbakterien, bessere Ablaufkonzentrationen von CSB, BSB5 und Stickstoff sowie eine Begrenzung des biologischen Überschussschlammanfalls, was wiederum eine Entlastung der Schlammbehandlungsanlagen mit sich bringt.
Bei der Verwendung von Tensiden müssen jedoch auch die Risiken für die Umwelt in Betracht gezogen werden. Bei der Auswahl der Tenside für bestimmte Anwendungen sollten immer Tenside genutzt werden, die gut biologisch abbaubar sind und somit keinen Schaden in der Umwelt anrichten können.
Die Anwendungsmöglichkeiten von Tensiden unterliegen einer stetigen Entwicklung und es werden immer neue Einsatzgebiete erforscht. Die Nutzung von Tensiden zur besseren Übermittlung von medizinischen Wirkstoffen im Körper ist nur ein Gebiet mit großem Potenzial. Hierdurch können beispielsweise verbesserte Methoden für die Krebstherapie entwickelt werden. Aber auch im Abwasserbereich bergen Tenside ein großes Potenzial. Durch ihren Einsatz können Kosten, die durch die Klärschlammentsorgung oder Belüftung entstehen, erheblich reduziert werden. Darüber hinaus tragen sie zum Gewässerschutz bei, indem die Ablaufwerte reduziert werden.
Anschrift des Verfassers:
Felicitas Schulz
Bioserve GmbH
Rheinhessenstraße 9a
D-55129 Mainz
Tel.: 06131/28 910-16
Fax: 06131/28 910-17
schulz@bioserve-gmbh.de
http://www.bioserve-gmbh.de
6. Literatur
| 1. |
Calbiochem (Bhairi, S. M.) (1997): Detergents – A Guide to the Properties and Uses of Detergents in Biological Systems, Calbiochem-Novabiochem Corporation. |
| |
|
| 2. |
Kosswig, K., Stache, H. (1993): Die Tenside, Carl Hanser Verlag München Wien, ISBN 3‐446‐16201‐1. |
| |
|
| 3. |
Tripathy, D. B., Mishra, A., Clark, J., Farmer, T. (2018): Synthesis, chemistry, physicochemical properties and industrial applications of amino acid surfactants: A review, C. R. Chimie, 21: 112-130. |
| |
|
| 4. |
Kepczynski, M., Róg, T. (2016): Functionalized lipids and surfactants for specific applications, Biochimica et Biophysica Acta, 1858: 2362–2379. |
| |
|
| 5. |
Liang, C., Chao, Y., Yi, X., Xu, J., Feng, L., Zhao, Q., Yang, K., Liu, Z. (2019): Nanoparticle-mediated internal radioisotope therapy to locally increase the tumor vasculature permeability for synergistically improved cancer therapies, Biomaterials, 197: 368-379. |
| |
|
| 6. |
LANUV (2014): ECHO-Stoffbericht, Quartäre Ammoniumverbindungen (QAV), abgerufen am 10.07.2020 unter https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/analytik/pdf/ECHO_QAV_Mai_2014.pdf. |
| |
|
| 7. |
UBA (2017): EU verbietet PFOA, abgerufen am 08.07.2020 unter
https://www.umweltbundesamt.de/themen/eu-verbietet-pfoa. |
| |
|
| 8. |
Geller, A. (2001): Leitfaden „Biologische Verfahren zur Bodensanierung“, Hrsg. UBA, Berlin. |
| |
|
| 9. |
Oberthür, A. M. C. (2004): Aerob-thermophile Reinigung mineralölkontaminierter Abwässer, Dissertation, Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften, Universität Bayreth. |
| |
|
| 10. |
Carvalho, G., Novais, J. M, Pinheiro, H. M. (2003): Activated sludge acclimatisation kinetics to non-ionic surfactants, Environmental Technology, 24: 1, 109-114 |
| |
|
| 11. |
Strunkheide, J. (2003): Neue Gesetztesvorgaben für Kläranlagen – Überschussschlamm-Reduktion durch Tenside, Klärtechnik, Sonderdruck aus wwt 12/2003, S. 34-41. |
| |
|
| 12. |
Guan, R., Yuan, X., Wu, Z., Wang, H., Jiang, L., Li, Y., Zeng, g. (2017): Functionality of surfactants in waste-activated sludge treatment: a review, Science of the Total Environment, 609: 1433-1442. |
| |
|
| 13. |
OECD (1992): OECD Guideline for Testing of Chemicals, Adopted by the Council on 17th July 1992, Ready Biodegradability abgerufen am 18.06.2020 http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/1948209.pdf. |
| |
|
| 14. |
Xin, B., Zhang, D., Zhang, X., Xia, Y., Wu, F., Chen, S., Li, L. (2009): Bioleaching mechanism of Co and Li from spent lithium-ion battery by the mixed culture of acidophilic sulfur-oxidizing and iron-oxidizing bacteria, Bioresource Technology, 100: 6163–6169. |