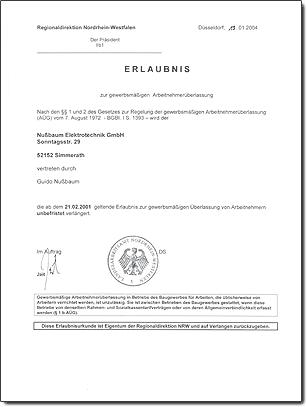Zu den Archiv Meldungen aus 2010 bis 2022.
2024
Kabinett verabschiedet Entwurf zu Änderungen des Landeswassergesetzes
Das schleswig holsteinische Kabinett hat den Entwurf der Novelle des Landeswassergesetzes (LWG) verabschiedet. Mit der Gesetzesnovelle reagiert die Landesregierung insbesondere auf die Zunahme von Extremwetterereignissen im Zuge der Klimakrise und nimmt notwendige gesetzliche Anpassungen nach der schweren Ostseesturmflut vor einem Jahr vor.
Im novellierten LWG lassen sich die Ziele der Klimaanpassung im Wesentlichen auf zwei Säulen aufteilen:
● Regelungen im Bereich Küsten und Hochwasserschutz
● Regelungen zur Klimaanpassung in der Wasserwirtschaft.
Zum Thema „Klimaanpassung im Küsten und Hochwasserschutz“ ist unter an derem Folgendes vorgesehen: Bauten des Küstenschutzes wie Deiche liegen künftig im überragenden öffentlichen Interesse (§ 63) und genießen somit einen entsprechenden Vorrang bei der Abwägung entgegenstehender Belange. Für andere Maßnahmen des Hochwasserschutzes wird das öffentliche Interesse des Hochwasserschutzes gesetzlich verankert. Das schließt vorsorgenden Hochwasserschutz mit ein, etwa die Anlage von Flussauen oder von benötigten Retentionsflächen. Damit zusammenhängend fordert § 57 die Kommunen und Wasser und Bodenverbände auf, kommunale Hochwasserschutzkonzepte zu erstellen. In den Plan und Genehmigungsverfahren von Hochwasserschutzanlagen können künftig Projektmanager eingesetzt werden (§ 84a). Die Erstellung von Starkregenkarten durch die Kommunen wird gesetzlich verankert, sodass Menschen in Schleswig Holstein das Überschwemmungsrisiko für ihre Wohnungen und Häuser genau kennen und entsprechend Vorsorgetreffen können (§ 77).
Die Regelungen zur Klimaanpassung in der Wasserwirtschaft betreffen zum Beispiel den Wasserrückhalt in der Fläche als Element der Gewässerunterhaltung (§ 25). In neu bebauten Gebieten – zum Beispiel Wohn oder Industriegebieten – soll Regenwasser nicht abgeleitet werden, sondern vorrangig versickern. Kommunen bekommen die Möglichkeit, Maßnahmen zur Starkregenvorsorge in die Abwassergebühren einfließen zu lassen. Das können zum Beispiel Kosten für eine Niederschlagswasserversickerung vor Ort sein, die Schaffung von Notwasserwegen oder Kosten für Retentionsflächen. Angesichts künftig zunehmender Dürren sieht § 41 vor, dass Gemeinden verpflichtet werden können, Konzepte zur Sicherstellung der künftigen Wasserversorgung aufzustellen. Ein dritter Bereich des Gesetzes be trifft Verfahrensvereinfachungen. Im Bereich der Abwasserbeseitigung beispielsweise erfolgen in § 45 Erleichterungen für die Gemeinden, die flexibler die Abwasserbeseitigung auf willige Private übertragen können. Nach über zehn Jahren soll im Landeswasserabgabengesetz ein Inflationsausgleich erfolgen. Insgesamt wird ein zusätzliches Abgabenaufkommen von rund sieben Millionen Euro pro Jahr erwartet.
Der Gesetzentwurf wird nun, Stand Anfang November 2024, an den Landtag zur weiteren Befassung übersandt. Das Inkrafttreten wird zum Jahresbeginn 2025 angestrebt.
(nach oben)
Kabinett verabschiedet ersten Entwurf der Novelle des Landeswassergesetzes
Umweltminister Goldschmidt: „Wir machen Schleswig-Holstein klimakrisenfester und ziehen die Lehren aus der Oktobersturmflut“
KIEL. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat das Kabinett gestern (23. Juli) den ersten Entwurf der Novelle des Landeswassergesetzes (LWG) verabschiedet. Mit der Gesetzesnovelle reagiert die Landesregierung auf die Zunahme von Extremwetterereignissen im Zuge der Klimakrise und nimmt notwendige gesetzliche Anpassungen nach der schweren Sturmflut im vergangenen Oktober vor. Außerdem werden verschiedene wasserverkehrsrechtliche Bestimmungen in der Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (MWVATT) überarbeitet.
„Hitze, Dürre, Starkregen: Die Klimakrise stellt Schleswig-Holsteins Wasserwirtschaft vor immer größere Herausforderungen. Das hat die Oktobersturmflut im letzten Jahr schonungslos gezeigt. Mit der Gesetzesnovelle werden wichtige Stellschrauben nachjustiert, damit unsere Küsten besser geschützt und unsere Wasserressourcen besser gemanagt werden können. Wir machen Schleswig-Holstein klimakrisenfester und ziehen die Lehren aus der Oktobersturmflut“, erklärte Umweltminister Tobias Goldschmidt. Gleichzeitig sorge man dafür, dass Schleswig-Holsteins Häfen ihre Bedeutung als wichtige Umschlagplätze für das klimaneutrale Industrieland weiter steigern können.
Der Gesetzentwurf sei eine ausgewogene Novelle. „Wir tun, was im Zuge eines steigenden Meeresspiegelanstiegs getan werden muss, tragen aber auch dem enormen Anpassungsdruck, der auf Wasserwirtschaft, Kommunen und den Küstenregionen lastet, Rechnung“, so Goldschmidt. „Bei allen gesetzlichen Anpassungen war für uns der Schutz von Leib und Leben sowie eine funktionierende Daseinsvorsorge leitend. Wir haben ein paar echte Planungs- und Baubeschleuniger für den Küstenschutz in das Gesetz aufgenommen und versetzen die Kommunen in die Lage, sich besser auf Hochwassersituationen vorzubereiten. Außerdem ermöglichen wir es den Unterhaltungsverbänden, den lokalen Wasserhaushalt so zu organisieren, dass genügend Wasser in Trockenphasen vorhanden ist und Regenwasser zur Grundwasserneubildung genutzt werden kann“, erklärte Goldschmidt. Die Lehren aus der Sturmflut ziehe man, indem Betreiber von Campingplätzen und Sportboothäfen künftig vor den spezifischen Sturmflutgefahren warnen müssen.
Der Gesetzentwurf geht nun in die Verbändeanhörung und wird danach vom Umweltministerium überarbeitet und erneut im Kabinett behandelt. Anschließend erfolgt die Befassung des Landtags. Das Inkrafttreten wird zum Jahresbeginn 2025 angestrebt.
Wichtige Neuregelungen der LWG-Novelle sind
• die Festschreibung des überragenden öffentlichen Interesses für Bauten des Küstenschutzes sowie das öffentliche Interesse für den Hochwasserschutz, einschließlich des vorsorgenden Hochwasserschutzes; (§ 63);
• die Möglichkeit, zur Verfahrensbeschleunigung Projektmanager in Planfeststellungsverfahre einzusetzen, um beschleunigte Verfahrensabläufe beim Bau von Deichen und Küstenschutzanlagen zu erreichen (§ 84a);
• eine Hinweispflicht für die Betreiber von Campingplätzen und Sportboothäfen. Damit sollen Menschen frühzeitig vor Gefahren gewarnt und Schäden minimiert werden (§ 82a);
• die gesetzliche Verankerung zur Erstellung von Starkregenkarten durch die Kommunen, sodass Menschen in Schleswig-Holstein das Überschwemmungsrisiko für ihre Wohnungen und Häuser genau kennen und entsprechend Vorsorge treffen können (§ 77);
• die Möglichkeit für Kommunen, Maßnahmen zur Starkregenvorsorge in die Abwassergebühren einfließen zu lassen. Dies unterstützt die handelnden Kommunen bei der Finanzierung (§ 44);
• die Nennung des Wasserrückhalts als Element der Gewässerunterhaltung, um sich besser auf die Herausforderungen des Klimawandels für die Wasserwirtschaft einstellen zu können (§ 25);
• der gesetzlich festgeschriebene Vorrang der Niederschlagswasserversickerung. In bebauten Gebieten – z.B. Wohn- oder Industriegebieten – soll Regenwasser nicht abgeleitet werden, sondern versickern. Das bewirkt, dass das Wasser vor Ort bleibt und zur Grundwasserneubildung beiträgt (§ 44);
• eine Verordnungsermächtigung, um von Gemeinden kommunale Wasserversorgungskonzepte zur Sicherstellung der künftigen Wasserversorgung fordern zu können (§ 41);
• eine gesetzliche Verankerung von Hochwasser- und Küstenschutzkonzepten in den Kommunen (§ 57);
• die gesetzliche Festschreibung des überragenden öffentlichen Interesses für Versorgungshäfen für die Inseln und Halligen (§ 94);
eine moderate Nachjustierung des Landeswasserabgabengesetzes zum Zwecke des Inflationsausgleiches.
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/V/Presse/PI/2024/07/240715_Fl%C3%A4chenrecycling_kopie
(nach oben)
Schleswig will sich besser vor Hochwasser schützen
Rückstauklappen und Pumpen sollen dafür sorgen, dass Regenwasser ablaufen kann, wenn die Schlei hoch steht. Bei Extremlagen hilft das aber nur begrenzt.
von Peer-Axel Kroeske
Bei 1,50 Meter läuft das Wasser der Schlei am Schleswiger Hafen (Kreis Schleswig-Flensburg) über die Kante. Das passiert selten. Verheerend war die Sturmflut von 1872. Danach sind nur leichtere Übertritte für 1941, 1954, 1978, 1979 notiert. Nur im Herbst 2023 lag der Pegel wieder deutlich über der Marke – bei 2,30 Meter. Inzwischen haben die Verantwortlichen vor Ort reagiert und erste Maßnahmen ergriffen. Welche das sind und was sie noch planen für einen wirksameren Hochwasserschutz, das hat wurde jetzt vorgestellt.
Wasser drückt aus dem Hinterland
Fast jährlich registriert die Stadt nämlich Situationen, in denen die 1,50 Meter knapp erreicht werden. Die Schlei schwappt dann zwar nur leicht über die Ufer. Doch Regenwasser von Land kann nicht mehr abfließen. Selbst, wenn es nicht regnet,…mehr:
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Schleswig-will-sich-besser-vor-Hochwasser-schuetzen,hochwasser6040.html
(nach oben)
Machbarkeitsstudien zur Spurenstoffelimination förderfähig
Machbarkeitsstudien für die vierte Reinigungsstufe von Kläranlagen werden in Schleswig-Holstein jetzt förderfähig. Das Land hat seine „Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Abwasserbehandlung in Schleswig-Holstein“ entsprechend überarbeitet. Im Rahmen der Förderrichtlinie stehen zur Abwasserbehandlung in Schleswig-Holstein sechs Millionen Euro zur Verfügung, die aus dem EU Strategieplan der „Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) stammen. Die neue Förderperiode läuft bis 2027, die Fördermaßnahmen sind bis Ende 2029 umzusetzen. In Schleswig-Holstein gibt es bereits zwei vom Land geförderte Projekte zur Spurenstoffelimination – in Rendsburg und Reinfeld. Die Erkenntnisse daraus können für andere Klärwerksbetreiber und auch Kommunen als Erfahrungsberichte und abwandelbare Blaupause dienen. Zukünftig sind Förderungen von kommunalen Kläranlagen zur Nährstoffeliminierung bis zu einer Ausbaugröße von 500w0 Einwohnern in ganz Schleswig-Holstein möglich. Es wird unter anderem angestrebt, die Bewirtschaftungsziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen und die Belastung durch Abwassereinleitungen zu reduzieren, so das Landesumweltministerium in einer Pressemitteilung.
(nach oben)
Sechs Millionen Euro für kommunale Kläranlagen
Um die Belastung der Gewässer durch Abwassereinleitungen zu verringern, will die schleswig-holsteinische Landesregierung kommunale Kläranlagen mit sechs Millionen Euro fördern. Die Fördermittel dafür stammen aus dem EU-Strategieplan zur gemeinsamen Agrarpolitik, wie das Umweltministerium in Kiel am Mittwoch mitteilte. Die Gelder sollen genutzt werden, um die Betreiber bei der Planung des zukünftigen Ausbaus von kommunalen Kläranlagen bei der gezielten Beseitigung von Spurenstoffen zu unterstützen.
«Gesunde Gewässer sind die Grundlage für ein gutes Leben», sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Mit der angepassten Förderrichtlinie arbeite die Landesregierung der Gewässerbelastung durch Spurenstoffe und Nährstoffeinträge entgegen. Untersuchungen des Landes hätten gezeigt, dass mit den Abwassereinleitungen neben Nährstoffen auch immer häufiger Rückstände etwa von Medikamente oder Bioziden in die Gewässer gelange. Diese Stoffe sollen zukünftig gezielt aus dem Abwasser entfernt werden können.
«Wir können in Schleswig-Holstein Betreiber von vor allem kleinen Kläranlagen dabei unterstützen, ihre Anlagen im Bereich der Nährstoffeliminierung zu ertüchtigen», so Goldschmidt. Zudem würden Verbesserungen im Bereich der Klärtechnik auch zum Meeresschutz beitragen. «Mit der Fortschreibung der Förderrichtlinie…mehr:
https://www.sat1regional.de/newsticker/sechs-millionen-euro-fuer-kommunale-klaeranlagen/
(nach oben)
Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Wärmeversorgung für 60.000 Haushalte durch Trinkwassernutzung
- Einsatz von Wärmetauschern im Trinkwassernetz ermöglicht klimafreundliche Erzeugung von Heizenergie
- Trinkwasserverordnung verhindert jedoch Einsatz der nachhaltigen Technologien
- VSHEW fordert Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen
Der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) setzt sich für den Einsatz von Wärmetauschern im Trinkwassernetz zur nachhaltigen Erzeugung von Heizenergie ein und fordert eine Anpassung der Trinkwasserverordnung. Aktuelle Erkenntnisse zeigen, dass die Wärmeauskopplung aus Trinkwasser einen signifikanten Beitrag zu einer klimaneutralen und kostengünstigen Wärmeversorgung leisten kann. Derzeit verhindert jedoch die Trinkwasserverordnung den Einsatz dieser klimafreundlichen und sicheren Technologie. Das Prinzip ist einfach: Trinkwasser wird im Leitungsnetz durch den Einsatz von Wärmetauschern abgekühlt und die dabei freiwerdende Wärme in Heizenergie umgewandelt. Bei besonders langen Trinkwasserleitungen kann dieses Prinzip mehrfach wiederholt werden, da sich das Wasser im Leitungsnetz durch die Erdwärme immer wieder erhitzt. Die Wärmetauscher-Technologie ist durch die Nutzung anderer natürlicher Wärmequellen wie Oberflächengewässer, Grundwasser, Untergrund (Geothermie) oder Außenluft hinreichend bekannt und erprobt. Die 47 größten Wasserversorgungsunternehmen in Schleswig-Holstein liefern jährlich 163 Millionen Kubikmeter Wasser, woraus sich eine nutzbare Wärmemenge von knapp einer Terrawattstunde (TWh) pro Jahr ergibt. Damit könnten 60.000 Haushalte im Land beheizt werden.
Das entspricht in etwa der Zahl der Haushalte im gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde. „In Zeiten der Energieknappheit müssen wir uns von unsinnigen Tabus verabschieden und die gesetzlichen Rahmenbedingungen so anpassen, dass sie den heutigen Gegebenheiten entsprechen und mehr Klimaschutz ermöglichen“, sagt Andreas Wulff, Vorstandsvorsitzender des VSHEW und Geschäftsführer der Stadtwerke Brunsbüttel sowie der Stadtwerke Steinburg. Der VSHEW fordert daher die Landesregierung auf, sich im Bundesrat für eine Novellierung der Trinkwasserverordnung einzusetzen oder eine entsprechende eigene Landes-Trinkwasserverordnung zu erlassen. „Wir dürfen nicht länger tatenlos zusehen, wie ausgerechnet im Klimaschutzland Schleswig Holstein in großem Stil nachhaltige Energie verschwendet wird“, so Wulff weiter.
„Trinkwasser bietet ein großes ungenutztes Potenzial für die Wärmeversorgung“, bestätigt Professor Oliver Opel von der Fachhochschule Westküste. „Es wird ohnehin gefördert und eine Wärmeentnahme stellt keine negative Beeinträchtigung dar. Im Gegenteil, die technische Abkühlung des Trinkwassers würde sogar zu einer hygienischen Verbesserung führen“, so Opel weiter.
Kontakt:
Verband der Schleswig-Holsteinischen
Energie- und Wasserwirtschaft e.V. – VSHEW
Roman Kaak, Geschäftsführer
Tel.: (040) 727 373-92
Mobil: (0170) 288 945 8
E-Mail: kaak@vshew.de
Zum VSHEW: Der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) vertritt als Wirtschaftsverband die Interessen von rund 50 kommunalen Stadt- und Gemeindewerken sowie Versorgungsbetrieben mit einem Gesamtumsatz von zusammen über einer Milliarde Euro. Die VSHEW-Mitgliedsunternehmen versorgen knapp eine Millionen Schleswig-Holsteiner mit Strom, Gas, Wasser und Kommunikationstechnik und beschäftigen mehr als 2.500 Mensche
(nach oben)