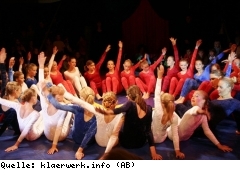Studie „Delphi2017 – Was Menschen morgen bewegt“ prognostiziert deutlichen Wertewandel in Deutschland
Dr. Rusanna Gaber, Unternehmenskommunikation
Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM)
Heidelberg, 22. November 2007 – „Weniger Ich – mehr Wir“ – so lautet eine der neuen Grundorientierungen der Deutschen, die eine langfristige Veränderung der gesellschaftlichen Werte zur Folge haben werden. Dies ist eine zentrale Erkenntnis der Studie „Delphi2017 – Was Menschen morgen bewegt“, die von der GIM, der Gesellschaft für innovative Marktforschung in Heidelberg, durchgeführt wurde. Anhand der Studie wurden fünf zukunftsrelevante Grundorientierungen identifiziert, die in den nächsten zehn Jahren für Lebensbereiche wie Gesundheit, Bildung, Arbeit und Familie prägend sein werden:
1. Managing „Dutility“: Funktionieren im System
2. Living Substance: Zurück zum Wesentlichen
3. Embedding Individuality: Weniger Ich – mehr Wir
4. Creating „Lifeholder Value“: Gestalten und Partizipieren
5. Engaging in a Sane Society: Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
Mehr Informationen unter http://www.g-i-m.com und http://www.delphi2017.com.
Die Zusammenfassung der Studienergebnisse für Deutschland ist auf Anfrage kostenfrei bei Frau Dr. Rusanna Gaber (r.gaber@g-i-m.com) erhältlich.
Die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts waren von Individualisierung, Differenzierung und Pluralisierung geprägt. Nun sind die Menschen in Deutschland bereit, sich auf soziale Gemeinschaften einzulassen und ihre Ansprüche an die individuelle Selbstverwirklichung zurückzufahren (Embedding Individuality). Zugleich tritt die soziale Verantwortung wieder in den Vordergrund. Diese ist jedoch frei von Sozialromantik. Vielmehr erscheint sie in Kombination mit konkreten Hoffnungen auf persönliche Benefits (Enganging in a Sane Society). „Besonders die bürgerliche Mitte wird sich um das Thema ‚Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung‘ neu konstituieren“, lautet ein Resümee der Studie „Delphi2017 – Was Menschen morgen bewegt“, die von den GIM-Forschern Dr. Kerstin Ullrich und Dr. Christian Wenger durchgeführt wurde. Das Thema „Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung“ bietet der von Globalisierung und Reformen gebeutelten Mitte die Chance, eine neue Identität zu entwickeln.
Als weitere Grundorientierung haben die GIM-Forscher das Funktionieren im System (Managing „Dutility“) identifiziert. Dies bezeichnet eine große gesellschaftliche Herausforderung, die jeden einzelnen und alle Schichten der Gesellschaft betrifft: Immer mehr Lebensbereiche müssen in immer weniger Zeit erledigt, organisiert und synchronisiert werden, das Leben ist vollgepackt mit Verpflichtungen, Ansprüchen und Anforderungen. Die frei zur Verfügung stehende Zeit schrumpft. Die Lebensform „Work Versus Life“ wird zu „Multi-Duty-Life“, in dem „Just in-Time“ und „Always On“ zum Alltag gehören. Das Leben wird zunehmend bestimmt von konsequenter Nutzenorientierung und Effizienzsteigerung. Die Folge: Der Raum für Individualität und Selbstverwirklichung schrumpft.
Der kleiner werdende Freiraum ist ein wichtiger Auslöser für die weitere Grundorientierung „Zurück zum Wesentlichen“ (Living Substance). Die Menschen werden sich wieder stärker nach innen richten, so die GIM-Forscher. Es wird ihnen bewusst, dass sie mit ihren Kräften haushalten müssen. Und sie stellen sich deshalb die Frage, was in ihrem Leben wichtig und wesentlich ist. Sie sehnen sich nach Sicherheit, Orientierung und Verlässlichkeit. Hinzu kommt der Wunsch, das eigene Leben stärker in die eigene Hand zu nehmen. Es findet eine Änderung der Einstellung statt: vom Akzeptieren der auferlegten Eigenverantwortung (Rückzug des Staates) und der Verpflichtungszwänge zu einer selbstbestimmten Eigenverantwortung. Als Mitglieder der Gesellschaft wollen die Menschen wieder stärker gestalten und partizipieren, weniger in traditionellen Formen des Engagements (Vereine, Kirche), sondern punktuell und situativ. Sie sind dabei geleitet sowohl von persönlichen als auch beruflichen Interessen (Creating „Lifeholder Value“). Partizipieren heißt heute schon, mit anderen etwas zu bewegen und zugleich in eigener Sache zu handeln.
An der Studie „Delphi2017 – Was Menschen morgen bewegt“ haben mehr als 40 Experten aus Deutschland und sechs weiteren Ländern mitgewirkt. Die Ergebnisse dieser Prognosen basieren auf einer zweistufigen qualitativen Befragung. Weil die Werteentwicklungen international verglichen wurde, entstand ein aussagekräftiges Bild des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland, Russland, USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien für den Zeitraum der nächsten zehn Jahre. Aus den fünf Grundorientierungen haben die Experten die Anforderungen für zukunftsorientiertes Marketing abgeleitet. Unter anderem müssen Unternehmen und Marken in Zukunft auf Kontinuität und Wiedererkennbarkeit setzen und müssen stärker Teil sozialer Gemeinschaften werden.
Das Buch zur Studie erscheint im April 2008 im Verlag Redline Wirtschaft unter dem Titel „Visionen2017 – Was Menschen morgen bewegt“. Autoren sind Dr. Kerstin Ullrich und Dr. Christian Wenger, GIM Heidelberg.
Das Exzerpt zur Studie erhalten Sie gerne auf Anfrage bei gim@talisman-pr.de oder R.Gaber@g-i-m.com im pdf-Format.
Hintergrundinformation:
GIM – Better decisions through deeper understanding
Das Marktforschungsunternehmen GIM, Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH, wurde im Oktober 1987 in Heidelberg gegründet und ist von Wilhelm Kampik (Psychologe) und Stephan Teuber (Soziologe) zu 100% eigentümergeführt. Das Team der GIM wächst kontinuierlich und zählt heute 100 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen betreut über 40 internationale Kunden aus unterschiedlichen Branchen wie FMCG, Banken und Versicherungen, Pharma, Automotive oder Medien und zeigt seine umfassende Kompetenz in mehr als 400 Projekten jährlich. Der Schwerpunkt liegt in der qualitativen Marktforschung, bei der innovative Methoden zum Einsatz kommen. Aber auch die qualitativ orientierte quantitative Marktforschung wird von GIM in vielen Projekten favorisiert. Als Full-Service-Institut kann GIM Marktforschungsdienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten: Vom Tiefenverständnis der Konsumenten und Märkte über die Entwicklung von Konzepten, Marken, Produkten und Werbung bis hin zur Überprüfung des gesamten Marketing-Mix. Das Unternehmen verfügt über spezielles Know-how im Bereich der Tiefenanalyse von Konsumenten, Werteforschung und Innovationsforschung. 2006 zeichnete das Branchenmagazin context GIM als größtes deutsches unabhängiges Marktforschungsunternehmen aus.
GIM ist international tätig. Neben dem Hauptsitz in Heidelberg, an dem 60 Mitarbeiter forschen, wurden weitere Büros weltweit eröffnet: GIM Berlin 2001, GIM Russia in Moskau 2001, GIM Suisse in Zürich 2005 und GIM France in Lyon 2007.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.g-i-m.com
Pressebetreuung GIM / Delphi2017:
Talisman, Kommunikation und Imagebildung, Heike Bedrich, Telefon: 089/18 97 95 46, hb@talisman-pr.de
GIM Gesellschaft für innovative Marktforschung mbH: Dr. Rusanna Gaber, Qualitative Research & Corporate Communications, Telefon: +49 (0) 62 21 / 83 28 – 734, Telefax: +49 (0) 62 21 / 83 28 – 33, E-Mail: R.Gaber@g-i-m.com
Weitere Informationen:
http://www.delphi2017.com – Studienbeschreibung
http://www.g-i-m.com – News „Delphi2017“
URL dieser Pressemitteilung: http://idw-online.de/pages/de/news239644