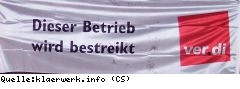Neue Hoffnung für Patienten mit chronischen Wunden: Die euroderm GmbH und das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig haben die Herstellungserlaubnis für künstliche Haut aus patienteneigenen Zellen erhalten.
Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Roman: Man zupfe jemandem einige Haare, und vier bis sechs Wochen später ist daraus ein Stück Haut geworden. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, was Forscher des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig seit kurzer Zeit in ihren neuen Reinräumen machen: »Wir haben gemeinsam mit der euroderm GmbH die Erlaubnis erhalten, Hautgewebe für die Transplantation auf chronische Wunden zu züchten – etwa für Diabetiker, die an offenen Beinen leiden«, sagt Dr. Gerno Schmiedeknecht, Gruppenleiter am IZI.
Bisher transplantieren die Ärzte bei chronischen Wunden Eigenhaut, die sie dem Patienten meist am Oberschenkel entnehmen. Dabei bleiben sowohl am Oberschenkel als auch an den behandelten Wunden Narben zurück. »Stellen wir Eigenhaut stattdessen über das neu zugelassene Verfahren EpiDex® her, erhalten wir gleiche Heilungschancen, ohne dem Patienten Schmerzen zuzufügen. Die künstliche Haut wächst zudem narbenfrei an«, sagt Dr. Andreas Emmendörffer, Geschäftsführer der euroderm GmbH. Ein weiterer Vorteil: Die Transplantation kann ambulant erfolgen. Bereits ein paar Tage später lässt sich sagen, ob die »neue« Haut angewachsen ist. Nach 72 Tagen ist die Haut nicht mehr von gesunder Haut zu unterscheiden.
Doch wie funktioniert das Züchten der neuen Haut? »Wir zupfen dem Patienten am Hinterkopf ein paar Haare aus und gewinnen aus der Haarwurzel adulte Stammzellen. Diese vermehren wir etwa zwei Wochen lang in einer Zellkultur. Anschließend reduzieren wir die Nährflüssigkeit so weit, dass die Oberseiten der Zellen nicht mehr bedeckt sind und mit Luft in Verbindung kommen. Durch den erhöhten Druck, den der Sauerstoff auf die Zelloberflächen ausübt, differenzieren sie sich zu Hautzellen«, erklärt Emmendörffer. Die Forscher züchten auf diese Weise viele kleine Hautstücke, die für jeden Patienten individuell hergestellt werden und aneinandergelegt eine Fläche von 10 bis 100 Quadratzentimetern ergeben. Damit die Sicherheitsbestimmungen jederzeit erfüllt sind, nutzen die Forscher eine neue Reinraumanlage am IZI, die dem neuesten Stand der Technik für die Herstellung verschiedenster Zelltherapeutika entspricht. »Beispielsweise messen wir kontinuierlich die Partikel, die sich im Reinraum befinden. Schwirren zu viele Partikel durch die Luft, ertönt ein Alarmsignal«, sagt Schmiedeknecht. Die Forscher erwarten, im Jahr 2008 monatlich für etwa 10 bis 20 Patienten Häute zu züchten, abhängig davon, wie viele Ärzte diese Therapie verordnen.
Kontakt:
Dr. Gerno Schmiedeknecht
Telefon: +49 341 35536-410
Fax: +49 341 35536-109
Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie
IZI
Deutscher Platz 5e
04103 Leipzig
www.izi.fraunhofer.de