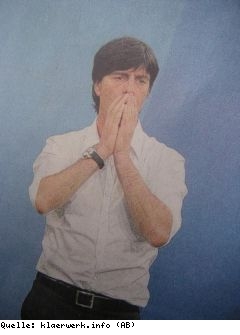Einleitung
Das Belebtschlammverfahren ist das am häufigsten eingesetzte Verfahren zur Reinigung kommunaler Abwässer. Die Qualität des Ablaufwassers ist sehr stark von der Effizienz der Fest/Flüssig-Trennung im Nachklärbecken abhängig. Diese ist nur hoch, wenn die Bildung von Belebtschlammflocken im Belebungsbecken ungestört funktioniert.
Belebtschlammflocken bestehen aus:
→ lebenden Mikroorganismen (Bakterien, Protozoen und Mehrzeller),
→ toten Mikroorganismen,
→ extrazellulären polymeren Substanzen (EPS),
→ anorganischen Bestandteilen.
Die mikrobielle EPS ist der wichtigste Bestandteil für die Flockenbildung. Die Biopolymere haben funktionelle Gruppen wie Hydroxyl-, Carboxyl- und Phosphatgruppen, die die negativ geladenen Oberflächen der Bakterien über so genannte „Brücken“ verbinden.
Belebtschlammflockenbildung
Vor allem zweiwertige Kationen überbrücken die negativ geladenen Enden der EPS und verbinden sie so mit den Oberflächen der Mikroorganismen.

1Braune Kreise: organische Partikel; schwarze Kreuze: anorganische Partikel; schwarze Linien: EPS; rote Striche: negative Ladungen an der EPS
Die Ladung, Größe und der Durchmesser der Hydrathülle der Kationen bestimmt deren „Bindevermögen“. Wenn die Größe der Ionen zunimmt, nimmt die Dicke der Hydrathülle ab. Große Ionen mit hoher Ladung und dünner Hydrathülle können leichter die negativ geladenen Oberflächen der Mikroorganismen mit den negativ geladenen Enden der EPS verbinden als kleine Ionen mit niedriger Ladung und dicker Hydrathülle. Bezüglich der Flockulationskraft der Kationen ergibt sich folgende Reihenfolge:
Ca2+ > Mg2+ > K+ > Na+
Flockenzerfall durch Natriumionen
Natrium ist ein vergleichsweise schlechter Flockenbildner, weil es nur einwertig geladen ist, klein ist und die dickste Hydrathülle hat. Bei vielen Untersuchungen des Einflusses von Ionen auf die Belebtschlammstruktur (siehe Literaturliste) konnte gezeigt werden, dass vor allem Natrium einen negativen Einfluss auf die Schlammstruktur hat. Die Zugabe von einwertigen Kationen führt mit steigender Konzentration zu einer vermehrten Verdrängung von zweiwertigen Kationen durch Ionentausch und nachfolgend zu Flockenzerfall.
Vor allem in der kalten Jahreszeit, bei längeren Niederschlagsperioden oder Schneeschmelze führt der hohe Mischwasserzufluss auf vielen Kläranlagen zu einer Abreicherung von Calciumionen aus den Belebtschlammflocken in das umgebende Abwasser. Infolge dessen wird der Flockenzusammenhalt im Laufe des Winters stark geschwächt. Wenn in dieser Zeit zusätzlich erhöhte Natriumfrachten im Kläranlagenzulauf (z.B. nach Streusalzeinsatz) auftreten, kommt es – häufig von einem Tag auf den anderen – zu einer deutlichen Verschlechterung der Belebtschlammflockenbildung.
Folgende Abbildung 2 zeigt, wie deutlich Natriumionen z.B. die Flockenstabilität (gemessen als Scherstabilität) schädigen (weitere Parameter siehe Kara et.al.):

Der Grund dafür ist, dass es zu einem Ionentausch in den Belebtschlammflocken kommt, bei dem die in den Flocken befindlichen Calciumionen durch die von außen kommenden Natriumionen verdrängt werden. Da Natriumionen wesentlich schlechter für den Flockenzusammenhalt sind als Calciumionen, wird der Belebtschlamm in der Folge deutlich feiner, leichter und scherempfindlicher.
Dieser Zustand bessert sich erst wieder von allein, wenn eine längere Trockenwetterperiode eintritt, in der sich die Belebtschlammflocken wieder mit Calcium anreichern können. Das Calcium stammt überwiegend aus der Wasserhärte (= Ca/Mg-Gehalt) des Trinkwassers und diese kommt bei Trockenwetter weitgehend unverdünnt auf der Kläranlage an, so dass die Calciumkonzentration im Abwasser höher als in den Flocken ist. Dann können sich die Belebtschlammflocken wieder mit Calcium anreichern.
Problematische Einleiter
Probleme mit der Belebtschlammflockenbildung sind besonders ausgeprägt, wenn das Einzugsgebiet einer Kläranlage in einem Gebiet mit „weichem“ Trinkwasser liegt (Wasserhärte 1-10) und zusätzlich von industriellen Einleitern hohe Natriumfrachten eingeleitet werden. In diesem Fall ist die Belebtschlammflockenbildung zumeist ganzjährig beeinträchtigt. Folgende Industriezweige liefern hohe Natriumfrachten:
| 1. | Betriebe , die Lebensmittel herstellen oder verarbeiten, z.B. Molkereien, Schlachthöfe, Fischverarbeiter, Feinkosthersteller, Konservenfabriken, Gemüseverarbeiter, Ölmühlen, Gewürzfabriken etc.. Diese Betriebe setzen natriumhaltige Laugen und Tenside zur Reinigung ihrer Fertigungsanlagen ein. Insbesondere Natronlauge (NaOH) ist ein preiswertes und sehr leistungsfähiges Entfettungsmittel. |
| 2. | Betriebe, die Natronlauge zur Neutralisation saurer Abwässer einsetzen. Das sind häufig ebenfalls Lebensmittelbetriebe wie unter (1), aber auch Getränkehersteller, Brauereien, Gerbereien, Metallverarbeiter etc. |
| 3. | Betriebe, die natrium- oder kochsalz(NaCl)-haltige Produkte herstellen oder verarbeiten, wie Tensidhersteller, Gewürzfabriken, Düngemittelfirmen, aber auch Autobahnmeistereien mit Streusalzverladung. |
| 4. | Deponiesickerwasser |
Typische Natriumwerte auf Kläranlagen
Folgende Tabelle 1 zeigt typische Kationenkonzentrationen im Ablauf von 64 verschiedenen kommunalen Kläranlagen (ohne Deponien) sowie Beispiele für Kläranlagen mit Einleitern der oben angegebenen Kategorien 1-4.

In der Praxis zeigt sich, das die Belebtschlammflockenbildung etwa ab einem Ca/Na-Verhältnis
von < 0,6 problematisch wird. Dann kommt es im Kläranlagenbetrieb zur Verschlechterung folgender Parameter:
– Absetzgeschwindigkeit der Belebtschlammflocken im Nachklärbecken
– Scherstabilität der Belebtschlammflocken (Flockenzerfall beim Pumpen)
– Sichttiefe und Trübung im Nachklärbecken (Flockenzerfall)
– CSB- und P-Konzentrationen im Ablauf (Flockenzerfall)
– Standzeiten der Probenaufbereitung von Online-Messgeräten (Membranen verstopfen)
– Filterlaufzeiten der Flockungsfiltrationen
– Fällmittelverbrauch
– Flockungshilfsmittelverbrauch bei der Überschussschlammeindickung.
In Abhängigkeit davon, ob das Ca/Na-Verhältnis dauerhaft ungünstig ist oder durch ein einmaliges Ereignis verschlechtert wurde, sind die Gegenmaßnahmen zu wählen.
Nach einem einmaligen Natriumeintrag ist ein kurzfristiger Kreide- oder Kalkeinsatz zu empfehlen. Auch die Substitution von NaCl durch MgCl2 oder CaCl2 als Streusalz kann Abhilfe bringen.
Bei dauerhaft ungünstigen Ca/Na-Verhältnissen ist entweder ein dauerhafter Calciumzusatz oder eine Limitierung der Natriumeinleitungen notwendig. So kann z.B. geprüft werden, ob der Einsatz von NaOH zur Neutralisation durch Kalkhydrat oder Kreide ersetzt werden kann.
Labormessungen
Hat man den Verdacht, dass der oben beschriebene Problemkreis auf der eigenen Kläranlage eine Rolle spielen könnte, bekommt man schnell den Wunsch, die relevanten Kationen Ca2+/Mg2+/K+ und Na+ sowie Cl- selbst vor Ort mit geeigneten Betriebsmethoden zu messen.
Für Ca2+/Mg2+/K+ und Cl- gibt es Küvettentests:
Ca/Mg: LCK 327
K LCK 328
Cl LCK 311
Aber Natriumionen können nicht photometrisch bestimmt werden. Dafür eignet sich nach unseren Erfahrungen die ionenselektive Sonde der Fa. Hach-Lange.
Für die Messung benötigt man
– (Multi-Funktions-) Messgerät (z.B. Hach HQ 40d multi)
– Natriumionen-selektive Elektrode
– Standardlösung
– Spüllösung
– Ionenstärkeregulator

Vor Beginn der Messung werden 25 ml der Standardlösung mit 1 Beutel Ionenstärkeregulator vermischt und gemessen. Dabei soll ein Wert von 100 ± 10 mg Na/l herauskommen. Danach wird die Sonde gespült (25 ml Spüllösung + Ionenstärkeregulator).
Nachfolgend können die Wasserproben gemessen werden, wobei wiederum 25 ml Probe mit je 1 Beutel Ionenstärkeregulator gemischt werden. Zur Absicherung der Werte gegen Matrixeinflüsse eignen sich vor allem Verdünnungsreihen.
Bei unseren Messungen im Medium „Ablaufwasser“ kommunaler und industrieller Kläranlagen gab es im Messbereich zwischen 20 und 3000 mg Na/l keine nachweisbaren Störeinflüsse, so dass man davon ausgehen kann, dass das Messverfahren für diese Anwendung sehr gut geeignet ist.
Es ist durchaus empfehlenswert, bei bekanntem, dauerhaft erhöhtem Natriumeintrag oder wiederkehrenden kurzfristigen Beeinträchtigungen der Belebtschlammflockenstruktur regelmäßige Na-Messungen durchzuführen. Das gilt insbesondere dann, wenn man feststellt, dass
| – | die Belebtschlammflocken sich schlecht absetzen, obwohl unter dem Mikroskop keine Fadenbakterien zu sehen sind. |
| – | der Fällmittelverbrauch für die P-Elimination bei ß-Werten > 1,2 liegt (Natrium verzögert Fällungsreaktionen deutlich) |
| – | der Flockungshilfsmittelverbrauch für die Überschussschlammeindickung oder die Faulschlammentwässerung vergleichsweise hoch ist, |
| – | die Schlammentwässerungsergebnisse vergleichsweise schlecht sind. |
– die Belebtschlammflocken sich schlecht absetzen, obwohl unter dem Mikroskop keine Fadenbakterien zu sehen sind.
– der Fällmittelverbrauch für die P-Elimination bei ß-Werten > 1,2 liegt (Natrium verzögert Fällungsreaktionen deutlich)
– der Flockungshilfsmittelverbrauch für die Überschussschlammeindickung oder die Faulschlammentwässerung vergleichsweise hoch ist,
– die Schlammentwässerungsergebnisse vergleichsweise schlecht sind.
In diesen Fällen steht der Aufwand für die regelmäßige Natriummessung in keinem Verhältnis zu den erzielbaren Einsparungen.
Mainz, den 18.6.2010
K. Sölter
Autorin:
Bioserve GmbH
Kirsten Sölter
Rheinhessenstraße 9a
55129 Mainz
Tel.: 06131-28 910-16
Fax: 06131-28 910-17
soelter@bioserve-gmbh.de
Literatur:
| 1. | Sölter, K.: Ursachen für schlecht absetzbare Belebtschlammflocken und was man dagegen tun kann; Vortrag für den Erfahrungsaustausch der Obleute norddeutscher Kläranlagen am 4./5. Mai 2010 in Lüneburg |
| 2. | Kara, F. et al: Monovalent cations and their influence on activated sludge floc chemistry, structure and physical characteristics; Biotechnology and Bioengineering Volume 100, No. 2, June 1, 2008, Seite 231-238 |
| 3. | Wilen, B.-M. et.al.: Influence of flocculation and settling properties of activated sludge in relation to secondary settler performance, Wat. Sci. Tech, Vol. 54, No. 1, 2006, Seite 147-155 |
| 4. | Jarvis, P. et. al.: The duplicity of floc strength, Wat. Sci. Tech, Vol. 50, No. 12, 2004, Seite 63-70 |
| 5. | Jin, B. et. al.: Impacts of morphological, physical and chemical properties of sludge flocs on dewaterability of activated sludge; Chemical Engineering Journal 98 (2004); Seite 115-126 |
| 6. | Tixier, N. et. al.: Effect of pH and ionic environment changes on interparticle interactions affecting activated sludge flocs – a rheological approach, Environmental technology, Vol. 24, 2003, Seite 971-978 |
| 7. | Novak, J.T. et.al: Floc structure and the role of cations, Wat. Sci. Tech, Vol. 44, No. 10, 2001, Seite 209-213 |
| 8. | Biggs, C.A. et. al. Activated sludge flocculation: direct determination of the effect of calcium ions, Wat. Sci. Tech, Vol. 43, No. 11, 2001, Seite 75-80 |
| 9. | Cousin, C.P.: Effect of calcium ion concentrations on the structure of activated sludge flocs, Environmental technology, Vol. 20, 1999, Seite 1129-1138 |
| 10. | Hänel, K. 1986: Biologische Abwasserreinigung mit Belebtschlamm, VEB Gustav Fischer Verlag Jena, ISBN 3-334-00023- |
| 11. | Murthy, S.N. et al: Monitoring cations to predict and improve activated sludge settling and dewatering properties of industrial wastewaters; Wat. Sci. Tech., Vol. 38, No.3, 1998, Seite 119-126 |
| 12. | Murthy, S.N. et al: Influence of cations on activated sludge effluent quality, Annual conference and exposition – water environment federation, No. 455, 1998, Seite 309-324 |
| 13. | Novak, J.T. et. Al.: Cations and activated sludge characteristics, 12th Annual residuals and biosolids management conference, 12-15 Juli, 1998, Washington |
| 14. | Zita, A. et. al.: Effect of ionic strength on Bacterial adhesion and stability of flocs in wastewater activated sludge system, Appl. and Environm. Microbiology, Vol. 60, No. 9, Sept. 1994, Seite 3041-3048 |