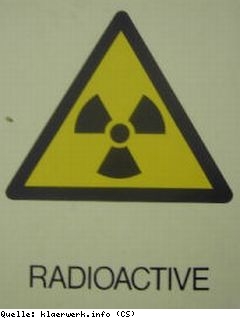Landwirtschaft im Einzugsgebiet der Weser müsste 25 000 t Stickstoff jährlich reduzieren
Mit der Wasserrahmenrichtlinie hat die Europäische Union ein Instrument geschaffen, um die Qualität von Grund- und Oberflächenwasser im Einzugsbereich von Flüssen europaweit zu verbessern. Welche Anstrengungen seitens der Landwirtschaft nötig sind, damit die Wasserqualität der Weser den Vorgaben der EU-Richtlinie genügt, zeigt eine aktuelle Studie des Johann Heinrich von Thünen-Instituts (vTI) in Braunschweig.
Um die Wasserrahmenrichtlinie im Einzugsgebiet der Weser zu erfüllen, sind erhebliche Anstrengungen nötig, vor allem im Bereich der Landwirtschaft, auch wenn diese ihre Stickstoffüberschüsse in den letzten Jahren deutlich reduzieren konnte. Unter anderem müsste der Stickstoffeintrag in die Weser um jährlich rund 25 000 t reduziert werden. „Dies würde jährliche Kosten von über 100 Millionen Euro zusätzlich zu bisherigen Agrarumweltmaßnahmen verursachen, wenn die Beratungskosten hinzugerechnet werden“, erklärt Peter Kreins, Projektleiter am vTI. Diese Ergebnisse basieren auf Berechnungen des Projektes „AGRUM Weser“, die jetzt vom vTI veröffentlicht worden sind.
„Das Pilotprojekt AGRUM Weser bietet erstmals einen übergreifenden Ansatz, um Wirkungen und Kosten von der Landwirtschaft bis hin zu Einträgen in die Gewässer bis 2015 für die Weser zu quantifizieren“, bestätigt Dr. Werner Ambros aus dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das länderübergreifende Forschungsprojekt AGRUM Weser (Analyse von Agrar- und Umweltmaßnahmen im Bereich des landwirtschaftlichen Gewässerschutzes vor dem Hintergrund der EG-Wasserrahmenrichtlinie) untersuchte das gesamte Einzugsgebiet der Weser mithilfe eines Modellverbundes aus einem agrarökonomischen und zwei hydrologischen Modellen. Dadurch ist es erstmals möglich geworden, die Wechselbeziehungen zwischen landwirtschaftlichen Einträgen in die Gewässer und ihren Pfadabhängigkeiten sowie die Wirkung und Kosten von möglichen Maßnahmen im landwirtschaftlichen Gewässerschutz umfassend abzubilden und eine verbesserte Berechnung zu Umsetzungsmöglichkeiten der EU-Wasserrahmenrichtlinie vorzunehmen.
Um die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie bis 2015 zu erfüllen, schlagen die vTI-Wissenschaftler in der Studie eine erste Maßnahmenkombination für die Landwirtschaft vor, die sich auf rund 1,3 Millionen Hektar bezieht und insgesamt über 100 Millionen Euro pro Jahr kosten würde. Dabei wurden die Maßnahmen Zwischenfruchtanbau, keine Ausbringung von Wirtschaftsdünger nach der Ernte, grundwasserschonende Ausbringungstechnik von Gülle und Festmist, Extensivierung von Grünland, Förderung von Extensivkulturen, Reduzierung der Mineraldüngung bei Getreide sowie der Anbau von Winterrübsen in Betracht gezogen. In rund 7 Prozent der Regionen konnte jedoch auch mit diesen Maßnahmen die Zielsetzung nicht erreicht werden, sodass weitere landwirtschaftliche oder wasserwirtschaftliche Maßnahmen notwendig sind.
Die Ergebnisse basieren auf einer dreijährigen Zusammenarbeit der Wissenschaftler des vTI, des Forschungszentrums Jülich (FZJ) und des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) sowie Diskussionen mit Experten aus den Landesministerien der beteiligten Bundesländer und der Flussgebietsgemeinschaft Weser. Der Abschlussbericht des AGRUM Weser Projekts wurde als Sonderheft 336 der Fachzeitschrift Landbauforschung veröffentlicht und kann ab sofort von den Internetseiten des Johann Heinrich von Thünen-Instituts als PDF heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
http://www.vti.bund.de/de/institute/lr/publikationen/lbf/lbf_sh336_de.pdf – Sonderheft 336 der „Landbauforschung“
Dr. Michael Welling, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei