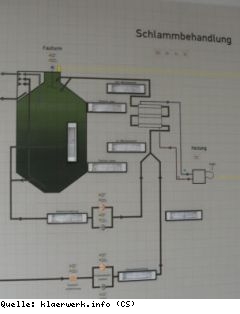Klaus Hans Pecher
Einleitung
Wasser ist die Voraussetzung allen menschlichen Lebens. Nur dort, wo Wasser in
ausreichender Menge und Güte zur Verfügung steht, kann menschliches Leben bestehen
und sich weiterentwickeln. Eine funktionierende Wasserver- und Abwasserentsorgung
bildet damit auch die Basis für den in Deutschland erreichten Lebensstandard und
Wohlstand. Dieses Bewusstsein für die elementare Bedeutung der Wasserver- und
Abwasserentsorgung ist in der Bevölkerung allerdings nicht unmittelbar auch so
verankert, was vermutlich daran liegt, dass sowohl hinsichtlich der Menge als auch in
Hinblick auf die Qualität zu jeder Zeit ausreichend von dem Gut Wasser zur Verfügung
steht. Ein entsprechendes Problembewusstsein wurde damit nicht ausgeprägt. Darüber
hinaus ist Wasser auch ein Rohstoff, der durch seine Nutzung (im Gegensatz z.B. zu
fossilen Brennstoffen) nicht verbraucht wird. Es besteht also auch grundsätzlich keine
globale Gefahr, dass auf der Welt insgesamt nicht mehr ausreichend Wasser vorhanden
sein könnte, auch wenn sich lokal große Probleme in der Zukunft abzeichnen. Die
Gefahren für Deutschland sind allerdings überschaubar.
Eine funktionierende Wasserver- und Abwasserentsorgung wird daher von der deutschen
Bevölkerung generell als selbstverständlich angesehen. Eventuelle Preissteigerungen bei
Selbstverständlichkeiten werden dagegen mit umso größeren Unverständnis zur Kenntnis
genommen, da die Gründe für solche Preisanpassungen ohne entsprechendes
Hintergrundwissen nicht unmittelbar ersichtlich sind. Dies spiegelt sich auch in
Diskussionen zur Preisentwicklung bei den Dienstleistungen zur Wasserver- und
Abwasserentsorgung der vergangenen Jahre wider. Insbesondere die Entwicklung der
Abwassergebühren wurde hier vielfach diskutiert.
Die jährliche Belastung der Bürger für die Abwasserentsorgung ist in Bild 1 im Vergleich
zum allgemeinen Verbraucherindex dargestellt. Dabei wird deutlich, dass im Wesentlichen
eine Parallelentwicklung festzustellen ist. Langfristig ist bei den Ausgaben für die…mehr:
http://www.pecher.de/upload/vo_081125_khp_kanalsanierungevs_final.pdf