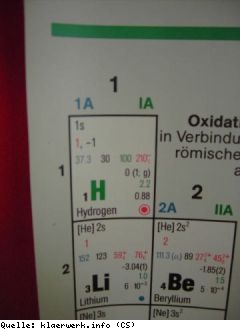Umweltchemie und Ökotoxikologie sind relativ junge Wissenschaften, die die Chemie unter Umweltbedingungen, ihre Wirkungen auf Organismen und Ökosysteme und die damit verbundenen Stoffrisiken untersuchen. Daher ist es verständlich, dass Umweltbehörden auf neue Erkenntnisse in diesen Wissenschaftsdisziplinen angewiesen sind. Solche Forschungsergebnisse werden auf den gemeinsamen Jahrestagungen der Fachgruppe Umweltchemie und Ökotoxikologie der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) und des deutschsprachigen Zweigs der Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe vorgestellt. Gastgeber der 4. Jahrestagung dieser Art, Umwelt 2010, ist erstmals das Umweltbundesamt (UBA) in Dessau-Roßlau. Vom 6. bis 9. September 2010 wird dort unter dem Leitsatz „Von der Erkenntnis zur Entscheidung“ über Themen wie Bioverfügbarkeit und Risikobewertung von Chemikalien, Umweltanalytik und -monitoring, oder Kombinationswirkungen verschiedener Chemikalien gesprochen.
Zu einem der Hauptthemen der Tagung „Bioverfügbarkeit – Zusammenhang von Fate und Effekt“ stellt Dr. Werner Kördel vom Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Schmallenberg eine Literaturstudie vor, die vom UBA vergeben wurde. Ziel war es, die Beurteilung von anorganischen und organischen Schadstoffen in Böden zu verbessern, indem man ihre Bioverfügbarkeit mit einbezieht. Die Ergebnisse sollen in die behördliche Bodenbewertung einbezogen werden. Ein gutes Beispiel, wie man von der Erkenntnis zur Entscheidung gelangen kann!
Kerstin Derz vom Fraunhofer Institut in Schmallenberg wird in Dessau die Ergebnisse dieser Studie für den Transferpfad von Schadstoffen vom Boden in Mikroorganismen vertiefen, der Aussagen über die Abbaubarkeit der Stoffe macht. Außerdem wird sie Hinweise auf geeignete Verfahren geben, mit denen die Bioverfügbarkeit von Schadstoffen, beispielsweise aus Altlastenverdachtsflächen, erfasst werden kann.
Auch die biologische Abbaubarkeit von Pharmazeutika und deren Auswirkungen auf Mikroorganismen im Boden und in Wasser sind Thema in Dessau. Cristobal Giradi vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, Abteilung Umweltbiotechnologie in Leipzig, macht darauf aufmerksam, dass Erkenntnisse über die Bioabbaubarkeit von Chemikalien Schlüsselfaktoren für die Gefahren- und Risikoabschätzung sind. Viele Daten hat man für Gewässersysteme zusammengetragen, die Vorgänge im Boden sind weniger bekannt. Giradi stellt das am Beispiel der Arzneimittelwirkstoffe Ciprofloxacin und Ibuprofen dar.
Andreas Focks wird die Frage der Bioverfügbarkeit am Beispiel der Sulfonamide im Boden erörtern. Sulfonamide gehören zu den ältesten und am häufigsten verwendeten Antibiotikaklassen. Mikroorganismen formen sie chemisch um. Solche Transformationsprodukte lassen sich chemisch analysieren. Sie hinterlassen Spuren im Leben der Mikroorganismen.
Drei Plenarvorträge in Dessau sollen richtungsweisend sein, u. a. der von Dr. Utz Tillmann, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie. Er spricht über „Produktsicherheit in der chemischen Industrie – von der Erkenntnis zur Entscheidung“; denn von der chemischen Industrie wird erwartet, dass ihre Produkte sicher für Mensch und Umwelt sind. Die Gesellschaft bringt die chemische Industrie immer wieder mit Risiken in Verbindung. Doch die Unternehmen dieser Branche bekennen sich zur Verantwortung und wollen mit ihren Produkten und Technologien wesentlich zum Gesundheits-, Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Tillmann zeigt in seinem Vortrag Umfang und Ziel sowie die wichtigsten Grundsätze der Produktverantwortung der chemischen Industrie auf.
Einen Höhepunkt der Veranstaltung bildet am 8. September die Verleihung der Preise der beiden Fachgesellschaften. Der SETAC GLB Nachwuchs-Förderpreis 2010 für die beste Diplom/Magister- oder Masterarbeit wird verliehen an Rebecca Pierstorf für die Arbeit „Gefährdung von Heuschrecken durch Pflanzenschutzmitteln in Kulturlandschaften“ und für die beste Dissertation an Karen Tiede mit dem Titel „Detection and fate of engineered nanoparticles in aquatic systems“. Den mit 3.000 Euro dotierten Preis der GDCh-Fachgruppe Umweltchemie und Ökotoxikologie 2010 für eine herausragende Publikation teilen sich in diesem Jahr Dr. Annekatrin Dreyer und Dr. Marianne Matzke. Beide Auszeichnungen basieren auf herausragenden Publikationen aus dem vergangenen Jahr. Frau Dreyer hat im Rahmen ihrer Promotion am Institut für Küstenforschung des GKSS-Forschungszentrums in Geesthacht von Forschungsschiffen aus den atmosphärischen Transport von per- und polyfluorierten Substanzen untersucht und den globalen Transport dieser Substanzen bis in entlegene Gebiete dokumentieren können. Frau Matzke hat während ihrer Promotion an der Universität Bremen einen wichtigen Beitrag zur Ermittlung der terrestrischen Toxizität von ionischen Flüssigkeiten geleistet. Dabei zeigten sich interessante Einflüsse der Bodenzusammensetzung auf die ökotoxikologischen Effekte dieser Substanzen.
Die Gesellschaft Deutscher Chemiker gehört mit rund 30.000 Mitgliedern zu den größten chemiewissenschaftlichen Gesellschaften weltweit. Sie hat 26 Fachgruppen und Sektionen, darunter die Fachgruppe Umweltchemie und Ökotoxikologie mit über 800 Mitgliedern. Anliegen dieser Fachgruppe ist u.a., alle an Umweltchemie und Ökotoxikologie interessierten Wissenschaftler und Praktiker zusammenzuführen und somit das gesamte Wissensgebiet voranzubringen. Die Fachgruppe will helfen, Kenntnislücken auszufüllen über Eintrag, Verteilung, Umwandlung und Verbleib von chemischen Stoffen in der Umwelt und über die Einwirkungen von Stoffen auf Lebewesen und Lebensräume.
Weitere Informationen:
http://www.gdch.de
Dr. Renate Hoer, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.