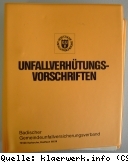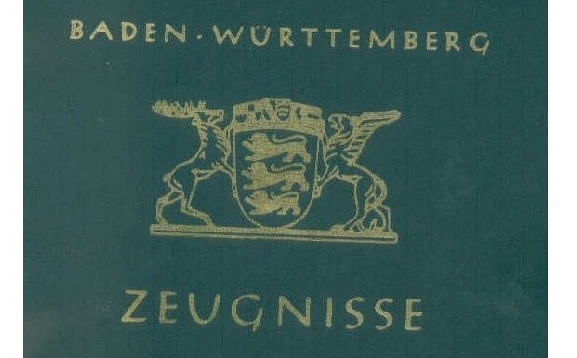PFT: Uhlenberg weist Unterstellungen und Verleumdungen zurück
Als „abenteuerliche Unterstellungen und bösartige Verleumdungen“ hat der Umweltminister von Nordrhein-Westfalen, Eckhard Uhlenberg, aktuelle Medienberichte sowie eine Pressemitteilung der Grünen zu PFT-Befunden in Kläranlagen zurückgewiesen. „Auch dieser Versuch der Welt am Sonntag und der Grünen, eine neue Kampagne zu starten, ist in seiner Unseriosität und Ahnungslosigkeit kaum zu überbieten. Ich werde nicht zulassen, dass die Anstrengungen Nordrhein-Westfalens bei der Bekämpfung von PFT, die es in diesem Umfang nirgendwo in Europa gibt, als Skandal ausgelegt werden“, erklärte Uhlenberg. Er betonte: „Mein Haus hat zu keiner Zeit irgendwelche Daten manipuliert oder Erkenntnisse beschönigt. Diese Behauptung ist grotesk. Wir haben als erstes Bundesland überhaupt Kläranlagen auf PFT untersucht. Auf diesem Wege konnten wir Industriebetriebe identifizieren, die PFT völlig legal verwenden, und damit beginnen, den Einsatz dieser Chemikalie an der Quelle zu reduzieren. Nordrhein-Westfalen nimmt hier bundesweit eine Vorreiter-Rolle ein.“
Der Umweltminister verwies darauf, dass sein Haus alle Daten im Internet veröffentlicht habe. Daraus ergebe sich, dass alle Wasserwerke an der Ruhr den strengen Zielwert von 100 Nanogramm pro Liter Trinkwasser unterschreiten. In der Ruhr gebe es keine höheren PFT-Konzentrationen als in anderen Gewässern in Deutschland.
Uhlenberg nannte drei Beispiele für die mangelhafte Recherche oder das bewusste Verbreiten von Unfug im Bericht der Welt am Sonntag.
Beispiel 1: „Die Daten eines Klärwerks in Brilon-Scharfenberg wurden offenbar gelöscht.“
Tatsache ist, dass die Daten im Internet stehen.
Beispiel 2: Für das Klärwerk Werdohl weise das Ministerium eine Emission von 0 g/d aus, tatsächlich betrage die Belastung 98,6 g/d.
Tatsache ist, dass das Umweltministerium im Internet – für jeden nachprüfbar – eine Belastungvon 98,6 g/d und eine bisher erreichte Frachtreduzierungvon 0 g ausweist.
Beispiel 3: Der Minister habe im Internet dargestellt, insgesamt würden nun aus Kläranlagen weniger als 500 g/d PFT in die Ruhr eingeleitet.
Tatsächlich und für jedermann nachlesbar wird dargestellt, dass die Einträge in alle Gewässer in NRW weniger als 500 g/d betragen. Für die Ruhr wird eine Fracht von 147 g/d ausgewiesen.
Uhlenberg: „Der Vorwurf der Manipulation fällt auf den Verfasser dieses Artikels selbst zurück.“
Januar 2008
http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse080121a.php
(zurück)
RBSV: Stadtwerke-Verbund in entscheidender Phase
Die Vorbereitungen für den Rheinisch-Bergischen Stadtwerke-Verbund (RBSV), dem die Stadtwerke Remscheid (EWR), Solingen (SWS) und Velbert (SWV) angehören sollen, kommen in die entscheidende Phase. Es sei geplant, die derzeit zwischen den Gesellschaftern laufenden Gespräche hinsichtlich der Verteilung der Anteilsquoten in den nächsten Wochen abzuschließen, teilten die Stadtwerke Solingen nach einer Sitzung des Lenkungsausschusses der drei Unternehmen mit. Ziel sei dabei eine Kooperation „auf Augenhöhe“ zu erreichen. Kein Einzelgesellschafter werde eine Sperrminorität an der neuen Dachgesellschaft erreichen.
(zurück)
Neuerungen bei den Essener Wasserwerken / 50 Millionen Euro werden investiert
Die Trinkwasserqualität soll noch besser werden /50 Millionen Euro werden investiert
Die Qualität des Essener Trinkwassers soll in Zukunft noch besser werden. Ziel ist es, die Wasserwerke Essen-Horst und Essen-Überruhr im Verbund zu betreiben. „Dies soll zu einer dauerhaften Absicherung einer qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Wasserproduktion führen“, erläutert Dietmar Bückemeyer, technischer Vorstand der Stadtwerke Essen AG. Insgesamt werden rund 50 Millionen Euro in das Projekt investiert. Diese teilen sich die Stadtwerke Essen AG und die GELSENWASSER AG jeweils zur Hälfte.
Drei zusätzliche Aufbereitungsstufen
Die höhere Qualität soll dadurch erreicht werden, dass die Wasseraufbereitungsanlage in Essen-Überruhr ab dem Jahre 2011 ausschließlich bereits gefiltertes Wasser aus Essen-Horst und Uferfiltrat aus Essen-Überruhr verwendet. Die Wasseraufbereitungsanlage erhält zudem drei neue Aufbereitungsstufen: 1. Aktivkohle-Festbettfilter, 2. zentrale physikalische Entsäuerung, 3. UV-Desinfektion sowie einen Dreikammer-Trinkwasserbehälter. Das bisherige Reini-gungsverfahren der Langsamsandfiltration erfolgt dann aus-schließlich am Standort Burgaltendorf in der ersten Aufbe-reitungsstufe.
Anpassung an zukünftige Herausforderungen
Arzneistoffe, Röntgenkontrastmittel, Flammschutzmittel, PFT etc. werden derzeit im Zusammenhang mit trinkwasserrele-vanten Stoffen immer wieder diskutiert. Durch verbesserte Analytik können einzelne Stoffe in geringsten Mengen, das heißt sogar im Nanogrammbereich (1 Nanogramm entspricht 0,000000001 Gramm) im Trinkwasser nachgewiesen werden. Auch wenn die Trinkwasserverordnung stets von beiden Wasserwerken eingehalten wird, sollen durch das zukünftige Verbundsystem die immer größer werdenden Anforderungen an hochwertiges, gesundes Trinkwasser noch besser erfüllt werden.
Im Hinblick auf PFT unterschreiten die Stadtwerke Essen sogar den Zielwert von 0,0000001 Gramm pro Liter. Der von der Trinkwasserkommission vorgegebene Leitwert, der als lebenslang gesundheitlich unbedenklich angesehen wird, beträgt 0,0000003 Gramm pro Liter. Es werden monatliche Untersuchungen zum Thema PFT durchgeführt, um die hohe Wasserqualität jederzeit zu gewährleisten. Somit steht fest, dass keinerlei Gesundheitsgefährdung besteht. Die Mess-werte veröffentlicht das Unternehmen zudem bereits seit Juni 2006 auf seiner Internetseite.
Wirtschaftlicher Hintergrund
Bereits im Jahr 2002 haben sich die Stadtwerke Essen AG und die GELSENWASSER AG zusammengeschlossen, um die Wasserwerke Essen-Überruhr und Essen-Horst gemein-sam zu betreiben. Im Fokus der Kooperation stehen Gewin-nung, Förderung, Aufbereitung und Bereitstellung von Trink-wasser an der Ruhr in Essen und die entsprechende Liefe-rung an die Gesellschafter. Die Gesellschafter halten jeweils 50 Prozent der Anteile an der Wassergewinnung Essen GmbH (WGE) und haben ihre Wassergewinnungs- und Auf-bereitungsanlagen sowie die Pumpwerke im Ruhrtal in die Gesellschaft mit eingebracht.
7.1.2008
Anfragen der Presse beantwortet:
Dirk Pomplun
Unternehmenskommunikation
Tel. 800 – 1003
(zurück)
Stellungnahme erwünscht – Offenlegung der nordrhein-westfälischen Wasserbewirtschaftungsfragen
Bis zum 22.06.2008 haben alle nordrhein-westfälischen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen, die bis zum Jahr 2015 in Nordrhein-Westfalen vorrangig angegangen werden sollen, Stellung zu nehmen und Vorschläge einzureichen. Zu den Wasserbewirtschaftungsfragen werden dann bis Ende 2009 Wasserbewirtschaftungspläne aufgestellt. Durch ihre Stellungnahme können die Bürgerinnen und Bürger schon jetzt auf den Prozess und die Inhalte der Bewirtschaftungsplanung Einfluss nehmen.
Die Bewirtschaftungspläne sind ein Instrument zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Ziel dieser Richtlinie und damit auch der nordrhein-westfälischen Umweltpolitik ist, die Gewässer – wo immer dieses möglich ist – wieder in einen „guten Zustand“ zu versetzen. Der Begriff „guter Zustand“ orientiert sich dabei an dem natürlichen Zustand, den die Gewässer ohne den Einfluss des Menschen hätten. Um das Ziel zu erreichen, müssen zuerst die noch bestehenden Wasserbewirtschaftungsfragen geklärt werden.
Die fertigen Wasserbewirtschaftungspläne beinhalten dann die Rahmenbedingungen für die Renaturierung sowie die künftige Nutzung der nordrhein-westfälischen Gewässer durch Industrie, Landwirtschaft und Anwohner. Ende dieses Jahres werden die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2009 haben alle Bürgerinnen und Bürger dann die Möglichkeit zu den konkreten Plänen Stellung zu nehmen und weitere Anregungen einzubringen. Ende 2009 werden die Bewirtschaftungspläne in Kraft treten und zur Grundlage behördlichen Handelns werden.
Die Wasserbewirtschaftungspläne werden für alle Regionen Nordrhein-Westfalens unter Leitung der Bezirksregierungen vorbereitet. In die Planungen mit eingebunden sind die Kommunen, die Wasser- und Landschaftsbehörden sowie zahlreiche Vertreter von Interessengruppen wie die Sondergesetzlichen Wasserverbände, Naturschutzverbände, Landwirtschaft und Industrie.
Die Unterlagen zur Anhörung der „Wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen“ sind einsehbar unter www.flussgebiete.nrw.de. Hier gibt es auch die Möglichkeit zur Stellungnahme. Alle Informationen und Unterlagen können außerdem bei den Bezirksregierungen unter dem Stichwort „Wasserrahmenrichtlinie“ angefordert werden. Weitere Informationen zur EG-Wasserrahmenrichtlinie sind zu finden unter www.umwelt.nrw.de/umwelt/wasser/wasserrichtlinie/index.php
Pressemitteilung vom 16.1.2008
(zurück)
Uhlenberg: NRW ist Vorreiter bei der PFT-Bekämpfung
Umweltminister Eckhard Uhlenberg hat zum Jahresende eine positive Bilanz der Anstrengungen zum Abbau der PFT-Belastung in Nordrhein-Westfalen gezogen. „Wir sind europaweit Vorreiter – in der Analyse der Quellen von PFT wie auch im Verringern der Emissionen“, stellte Uhlenberg fest. Der Minister hob hervor: „Wir haben konsequent gehandelt und dafür gesorgt, dass Trinkwasser, das aus dem Gewässersystem von Ruhr und Möhne gewonnen wird, inzwischen wieder einwandfrei ist.“
Der Umweltminister veröffentlichte heute die Ergebnisse eines Monitorings, bei dem flächendeckend die PFT-Konzentration in Kläranlagen erhoben wurde. Von insgesamt 574 untersuchten Anlagen wurde lediglich im Ablauf von 29 kommunalen Kläranlagen und 8 industriellen Kläranlagen PFT-Konzentrationen von über 300 Nanogramm pro Liter gemessen – dem Wert also, der für Trinkwasser als gesundheitlich unbedenklich gilt. Darüber hinaus gab es im Klärschlamm von lediglich 32 kommunalen Kläranlagen eine PFT-Konzentration über 100 Mikrogramm pro Kilogramm.
Auf Basis dieser Befunde hat Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland die Ursachen erhöhter PFT-Einträge ermittelt. 79 indirekt einleitende, meist mittelständische Betriebe der Metall-, Photo-, Textil- und Entsorgungsindustrie sowie der Feuerlöschtechnik konnten als relevant identifiziert werden. „Die meisten dieser Betriebe waren sich über den PFT-Einsatz und dessen Folgen nicht bewusst. Sie tun auch nichts Unrechtes, weil PFT in diesen Verwendungsformen nach wie vor nicht verboten ist“, berichtet Uhlenberg. Dennoch wurden erstmalig in Deutschland bei den indirekt einleitenden Betrieben Maßnahmen ergriffen, die zu einer Reduzierung des PFT-Eintrags führten: zum Beispiel der Einsatz von Ersatzstoffen, die Schließung von Kreisläufen, die zusätzliche Abwasserbehandlung mit Aktivkohle, die getrennte Entsorgung belasteter Teilströme oder die komplette Schließung des Abwassersystems. Zudem gab das Umweltministerium gemeinsam mit den Industrieverbänden Empfehlungen zum Einsatz PFT-freier Substanzen für die betroffenen Unternehmen. Darüber hinaus hat die Landesregierung festgelegt, dass Klärschlämm mit einer PFT-Konzentration von mehr als 100 Nanogramm pro Kilogramm nicht landwirtschaftlich verwertet werden darf und dass PFT-haltige Feuerlöschschäume nur noch zur Gefahrenabwehr, nicht jedoch bei Übungen eingesetzt werden.
Uhlenberg: „All diese Maßnahmen der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen zeigen bereits Wirkung. Wir sind das erste Bundesland, das innerhalb eines Jahres eine deutliche Reduzierung des PFT-Eintrags aus allen relevanten Einleitungen um 35 Prozent erreichen konnte. Insgesamt handelt es sich um Einträge von weniger als 500 Gramm pro Tag, die in die Gewässer eingeleitet werden. Im Interesse der Bürger und der Umwelt wird die Landesregierung ihre Anstrengungen auch im nächsten Jahr fortsetzen.“
Die Ergebnisse des Kläranlagen-Monitorings:
• Kommunale Kläranlagen in NRW
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/klaeranlagen/kom_kas_nrw.pdf
• Kommunale Kläranlagen im Ruhreinzugsbereich
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/klaeranlagen/komkas.pdf
• Direkteinleiter
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/klaeranlagen/direkteinleiter.pdf
• Indirekteinleiter
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/klaeranlagen/indirekteinleiter.pdf
• Alle Kläranlagen in NRW
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/klaeranlagen/alle_kom_kas.pdf
(zurück)
Studie zu Biogasanlagen sieht keine Konkurrenz zur Viehhaltung
Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe in Nordrhein-Westfalen haben sich in den letzten Jahren für die CO2-neutrale Energieerzeugung aus Biogas entschieden und in eigene Anlagen oder Gemeinschaftsanlagen investiert. Dies hat in Landkreisen mit ausgeprägter tierischer Veredelungswirtschaft zu Diskussionen um steigende Pachtpreise und Konkurrenzwirkungen von Biogasanlagen auf die traditionelle Viehwirtschaft geführt. Im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums hat der Fachbereich Agrarwirtschaft Soest der Fachhochschule Südwestfalen daher eine Studie zu regionalen Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion durchgeführt.
„Die Studie stellt eine fundierte Grundlage für eine vorurteilsfreie Diskussion der Wettbewerbssituation dar“, so Landwirtschaftsminister Eckhard Uhlenberg. „Danach gibt es derzeit keine wettbewerbsverzerrende Förderung von Biogasanlagen. Die Anlagen stellen auch keine Bedrohung für Vieh haltende Betriebe dar, sondern können – insbesondere als Gemeinschaftsanlagen – ein zusätzliches Standbein für die Betriebe sein.“ Die Studie macht aber auch deutlich, dass es unter den aktuellen Marktbedingungen erforderlich ist, gezielte Anreize für eine verstärkte Vergärung von Gülle und Reststoffen zu geben. Hier existiert ein hohes Potenzial zur Vermeidung von Treibhausgasen und zur regenerativen Energieerzeugung, ohne dass es zu Konkurrenz mit der Erzeugung von Nahrungsmitteln kommt.
Die Studie vergleicht in Modellrechnungen die Wettbewerbsfähigkeit von Biogasanlagen unter verschiedenen Rahmenbedingungen. Die Autoren stellen darin unter anderem fest, dass derzeit die Anreize zum Bau von Biogasanlagen angesichts der hohen Getreidepreise zu gering sind, um noch einen nennenswerten Zubau von Anlagen zu bewirken. Sie empfehlen deshalb eine Verstärkung und Erweiterung der Anreize zur Wärmenutzung sowie eine Erhöhung der Förderung für kleine, dezentrale Anlagen. Dagegen warnen sie davor, die Anreize für den Anbau von Energiepflanzen wesentlich zu verstärken oder gar an die Getreidepreise zu koppeln.
Die Ergebnisse der Studie dienen auch als Diskussionsbeitrag für die anstehende Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, mit dem die Vergütung für die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien geregelt wird. Die Novelle ist Teil des von der Bundesregierung vorgelegten „Integrierten Klima- und Energiepaketes“ im Rahmen des Meseberger Programms und wird in Kürze im Bundesrat beraten.
Die vorläufigen Ergebnisse des ersten Teils der Studie beziehen sich auf die Struktur- und Einkommenswirkungen in Veredelungsregionen (am Beispiel der Kreise Borken und Steinfurt). Derzeit wird die Studie um den Bereich Grünlandregionen ergänzt, im kommenden Jahr soll sich eine Bewertung der Situation in Ackerbauregionen anschließen.
- Vorläufiger Bericht zum Projekt „Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in NRW“
Pressemitteilung vom Dezember 2007
(zurück)
Immer mehr Lachse in Nordrhein-Westfalen
Der atlantische Lachs hat sich im Jahr 2007 in vielen Gewässern Nordrhein-Westfalens erfolgreich fortgepflanzt. Das haben Wissenschaftler im Auftrag der Bezirksregierung Arnsberg festgestellt.
Dass die Fortpflanzung der Lachse in Nordrhein-Westfalen keine Eintagsfliege war, hat sich in den letzten Monaten bei der Nachsuche mit Hilfe der Elektrobefischung gezeigt. In fünf Zuflüssen der Sieg wurden mehr als 500 Junglachse zwischen vier und sieben Zentimeter Körperlänge nachgewiesen (siehe Foto). Die Fische werden noch ein bis zwei Jahre im Sieggebiet bleiben und anschließend als sogenannte Smolts zum Fressen ins Meer abwandern. Zu diesem Zeitpunkt haben sie dann eine Größe zwischen 13 und 20 Zentimeter.
„Die Zahl der gefangenen Lachse erlaubt eine vorsichtige Hochrechnung, dass der Bestand von Junglachsen aus natürlicher Fortpflanzung etwa 100.000 Individuen im Sieggebiet erreicht“, erläutert Detlev Ingendahl von der Bezirksregierung Arnsberg. Dies entspräche etwa 20 Prozent der Junglachse, die durch das Wanderfischprogramm jährlich zur Stützung der Population ausgesetzt werden.
Seit 1990 wird die Wiederansiedlung des Lachses am Rhein durch die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins koordiniert. Nach der Umweltkatastrophe von Sandoz im Jahr 1986 hatten die Rheinanliegerstaaten vereinbart den ökologischen Zustand des Rheins nachhaltig zu verbessern. Hintergrund: Auch anspruchsvolle Tierarten, wie der Lachs, sollten in das Gewässer zurückkehren können.
In Nordrhein-Westfalen wird seit 1998 im Wanderfischprogramm des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MUNLV) in Kooperation mit dem Fischereiverband NRW für den Schutz der Wanderfische, Lachse, Meerforellen, Aale, Nordseeschnäpel und Maifische gearbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg kümmert sich um die Umsetzung des Projekts.
Auch in den kommenden Jahren sollen weiterhin Lachse ausgesetzt werden, um einen neuen „genetisch angepassten“ Rheinlachsstamm aufzubauen.
Pressemitteilung
Jari Wieschmann 06.12.2007
(zurück)
Wupperverband zahlt 3,5 Mio. Euro an Mitglieder zurück
Energiemanagement: Kosten senken und den Kohlendioxid-Ausstoß reduzieren
Bei der diesjährigen Verbandsversammlung am 4. Dezember in Wuppertal hatten Claus-Jürgen Kaminski, Verbandsratsvorsitzender, und Bernd Wille, Vorstand, gute Nachrichten für die Mitglieder des Wupperverbandes. Im Geschäftsjahr 2006 hatte der Verband einen Überschuss von rund 4 Mio. Euro erwirtschaftet. Im größten Geschäftsbereich des Wupperverbandes – Kläranlagen und Entsorgung – betrug der Überschuss rund 3,5 Mio. Euro. Der Überschuss wurde u. a. durch höhere Erträge aus der Mitverbrennung von Klärschlämmen, geringere Aufwendungen für Instandhaltung und geringere Finanzierungskosten (Abschreibungen/Zinsen) infolge niedriger Investitionen erzielt. Er wird noch in 2007 an die Verbandsmitglieder, die Mitgliedsbeiträge für diesen Geschäftsbereich entrichtet haben, ausgezahlt – also ein kleines Weihnachtsgeschenk.
Im Geschäftsbereich Talsperren und Stauanlagen betrug der
Überschuss in 2006 rund 151.000 Euro, im Geschäftsbereich Gewässerunterhaltung rund 147.000 Euro. Diese Überschüsse werden der Beitragsausgleichsrücklage des jeweiligen Geschäftsbereichs zugeführt und dienen der Stabilität der Beiträge für die kommenden Jahre.
Die Überschüsse wurden in allen Geschäftsbereichen bei voller Leistungserfüllung erzielt.
Für das Jahr 2008 schlägt der Wupperverband seinen Verbandsmitgliedern im Bereich Kläranlagen / Entsorgung zum zweiten Mal in Folge eine Beitragssenkung von 0,7 Prozent bzw. rund 500.000 Euro vor. Der Beitragsbedarf in 2008 beträgt in diesem Geschäftsbereicht somit rund 69,4 Mio. Euro.
In den Geschäftsbereichen Talsperren / Stauanlagen und Gewässerunterhaltung bleibt der Beitragsbedarf in 2008 gegenüber dem Vorjahr konstant.
Energiemanagement spart Kosten und entlastet die Umwelt
Auch der Betrieb gewerblicher Art Wasserkraftanlagen verzeichnete nach Abschluss des Geschäftsjahres 2006 einen Überschuss in Höhe von rund 210.000 Euro, da ganzjährig ausreichend Wasser in den Talsperren zur Wasserkraftnutzung zur Verfügung stand.
Der Wupperverband betreibt derzeit Wasserkraftanlagen im Klärwerk Buchenhofen, an der Wupper-Talsperre und an der Bever-Talsperre. An der Ronsdorfer Talsperre wird eine Kleinwasserkraftanlage als Anschauungsobjekt für den Schulunterricht betrieben. Insgesamt wurden mit den Wasserkraftanlagen des Wupperverbandes in 2006 rund 11 Mio. Kilowattstunden Strom erzeugt. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von 2400 Vier-Personen-Haushalten. Für das Jahr 2008 ist der Einbau von zwei weiteren Wasserkraftanlagen an der Lingese-Talsperre und an der Brucher-Talsperre in Marienheide vorgesehen.
Die Nutzung von erneuerbarer Energie in Form von Wasserkraft ist ein Aspekt in dem Energiekonzept des Wupperverbandes. Das Thema Energie ist für den Verband in unterschiedlichen Bereichen von großer Bedeutung und wird daher in 2008 als Strategiethema behandelt. Die Zielsetzung des Verbandes ist, Energie einzusparen und erneuerbare Energie verstärkt zu nutzen, um Kosten zu senken und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Um dies zu erreichen, hat der Wupperverband z. B. Energieanalysen in seinen Klärwerken durchgeführt, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Durch die Analyse des Energieverbrauchs und die Umsetzung von Einsparmöglichkeiten konnte im Klärwerk Kohlfurth der Verbrauch um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 2004 gesenkt werden.
Das Biogas aus der Klärschlammfaulung wird in sechs Klärwerken zur Stromerzeugung genutzt. In der Schlammverbrennungsanlage wird mit Dampfkraft Strom erzeugt. In 2006 hat der Verband durch die Nutzung erneuerbarer Energie rund 25 Mio. Kilowattstunden Strom erzeugt. Das ist mehr als die Hälfte seines Gesamtstromverbrauchs von rund 42 Mio. Kilowattstunden.
Den Einsatz von erneuerbaren Energien wird der Wupperverband weiter vorantreiben und optimieren. Ein möglicher Weg ist die Vergärung organischer Abfälle, z. B. Gemüse- oder Fettabscheiderabfälle, in den Faulbehältern der Klärwerke zur Steigerung der Biogasproduktion und somit zur Steigerung der Stromerzeugung in den Blockheizkraftwerken.
Wasserwirtschaft in 2007: Trockenmonat im April – Hochwasser im August
In seinem Vortrag über Ereignisse und Entwicklungen in 2007 lenkte Vorstand Bernd Wille das Augenmerk auch auf die wasserwirtschaftlichen Besonderheiten des abgelaufenen Jahres. Das Wasserwirtschaftsjahr 2007 (1. November 2006 bis 31. Oktober 2007) war mit 1.633 Liter Niederschlag pro Quadratmeter an der Messstelle Bever-Talspere um 306 Liter nasser als im Durchschnitt. Es gehörte zu den bisher 10 nassesten Jahren der vergangenen 100 Jahre.
Im April dagegen verzeichnete die Messstelle Bever-Talsperre mit 2,2 Litern Regen pro Quadratmeter nur 2,4 Prozent der durchschnittlichen April-Regenmenge von 91 Litern. Einen derart trockenen April gibt es statistisch nur etwa alle 200 Jahre.
Angesichts der hohen Temperaturen und der Trockenheit im April war in Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern und bei der Veranstaltung „unverDHÜNNt“ an der Trinkwassertalsperre Große Dhünn im September die Sorge der Menschen spürbar, ob die Trinkwasserversorgung im Bergischen Land auch mit Blick auf die möglichen Auswirkungen des Klimawandels ausreichend ist.
Die Trinkwasserversorgung im Bergischen Land ist nach Ansicht von Bernd Wille sehr gut aufgestellt. So ist die Große Dhünn-Talsperre des Wupperverbandes mit ihrem Stauraum von rund 81 Mio. Kubikmetern so bemessen, dass sie auch in zwei aufeinander folgenden Trockenjahren ausreichend Rohwasser für die Trinkwasseraufbereitung zur Verfügung stellen kann. Mit dieser und den weiteren Trinkwassertalsperren der Stadtwerke (z. B. Kerspe-Talsperre, Herbringhauser-Talsperre, Sengbach-Talsperre) im Wuppergebiet sowie den weiteren Gewinnungsanlagen der Stadtwerke stehen ausreichende Mengen an Trinkwasser zur Verfügung.
Der Monat August war insgesamt im Verbandsgebiet nasser als im Durchschnitt. Ein Extremereignis gab es am Abend des 6. August. Örtlich kam es zu starken Gewitterschauern: In Solingen-Unterburg (Messstelle Klärwerk Burg) regnete es innerhalb von ca. drei Stunden 67,9 Liter pro Quadratmeter. Auch das Stadtgebiet Remscheid war von extremen Regenmengen betroffen. An der Messstelle Falkenberg beispielsweise hat es am 6. August im Zeitraum von einer Stunde und 15 Minuten rund 73 Liter pro Quadratmeter geregnet, was statistisch seltener als alle hundert Jahre vorkommt. In Solingen traten der Eschbach und seine Zuläufe, in Remscheid der Morsbach und seine Nebengewässer über die
Ufer. Die Folge waren Überschwemmungen mit zum Teil erheblichen Sachschäden.
Nach den Sofortmaßnahmen an den betroffenen Gewässern zur Beseitigung von Schäden und Hindernissen hatte der Wupperverband in Absprache mit den Kommunen und Behörden mit der Auswertung und Aufarbeitung des Extremereignisses begonnen. Es sollen gemeinsam Möglichkeiten gefunden werden, die Situation an den betroffenen Gewässern zu verbessern.
Angesichts des Hochwassers wird der Wupperverband ein erweitertes Hochwasserschutzkonzept erarbeiten und in 2008 dem Verbandsrat vorlegen. Dieses Konzept soll u.a. Vorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Verband, Kommunen, Feuerwehr und den potenziell betroffenen Bürgern enthalten, aber auch Aspekte der Gewässerunterhaltung berücksichtigen.
(zurück)
Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union ist in der Umsetzung
Wie geht es unseren Flüssen und Bächen? Diese Frage diskutierten am Mittwoch, 7. November, rund 150 Wasserexperten beim 3. Gebietsforum Lippe der Bezirksregierung Arnsberg. Hintergrund ist die europaweit gültige Wasserrahmenrichtlinie.
Als Gastgeberin in Lippstadt begrüßte Dr. Marlies Raudschus die Forumsteilnehmer/-innen und machte sie in ihrer Einführungsansprache zunächst noch einmal mit der komplexen Materie vertraut (siehe Foto).
„Wir stehen unter einem hohen Zeitdruck“, sagte auch Joachim Drüke von der Bezirksregierung Arnsberg. Bis zum 31. Juli kommenden Jahres muss der Entwurf des Bewirtschaftungsplanes mit entsprechenden Maßnahmenpaketen für das Einzugsgebiet der Lippe geschnürt sein. Ziel: einen guten, sprich naturnahen, Zustand der Gewässer zu erreichen. Damit ist gemeint, dass störende Hindernisse beseitigt und der natürliche Lauf der Gewässer wiederhergestellt werden soll.
Bis 2004 sind die Daten im Bereich der Lippe erhoben worden. „Das Ergebnis hat viele erschreckt“, unterstreicht Joachim Drüke, der die Geschäftsstelle zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie leitet. Viele Gewässer hatten nach den Richtlinien der Europäischen Union noch nicht den angestrebten „guten Zustand“ erreicht. „Wir verfolgen daher ein hochgestecktes Ziel“, so Drüke.
Der Einzugsbereich der Lippe umfasst ein Gebiet von 4900 Quadratkilometern. In diesem Gebiet, das sich vom Teutoburger Wald bis Wesel erstreckt, leben rund 1,8 Millionen Menschen. Der Verlauf des rund 220 Kilometer langen Flusses ist sowohl durch die Landwirtschaft, als auch durch Industrie, Bergbau und Energieerzeugung geprägt. In der Folge fließen Nährstoffe (Landwirtschaft) und Salze (Industrie) in die Lippe. Durch die Einleitung der Kraftwerke wird zudem die Temperatur der Lippe ab Hamm erhöht.
Das Einzugsgebiet wurde in elf Planungseinheiten unterteilt. Im kommenden Jahr werden in diesen Einheiten „Runde Tische“ zu einzelnen Themenbereichen (Abwasser, Gewässerstruktur) gebildet. Darin arbeiten Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, Kreise, Wasser- und Naturschutzverbände, aus Landwirtschaft und Industrie mit.
Bei der Aufstellung der Maßnahmenprogramme wird jede Maßnahme auf ihren Nutzen und vor allem auf die entstehenden Kosten abgeklopft. „Was die Wasserrahmenrichtlinie letztlich kosten wird, ist im Moment allerdings überhaupt noch nicht absehbar“, so der Leiter der Geschäftsstelle.
Bis Ende 2009 muss dann der endgültige Bewirtschaftungsplan für die Lippe aufgestellt sein.
(Internet: http://www.flussgebiete.nrw.de, http://www.lippe.nrw.de)
(zurück)
Der Lachs kehrt zurück in die Sieg
Über 400 Lachse sind im Jahr 2007 bisher an den Kontrollstellen des Flusses Sieg registriert worden. Insgesamt kann von über 800 Lachsen ausgegangen werden, da nur etwa 50 Prozent der Fische an den Kontrollstellen erfasst werden. Damit ist das Jahr 2007 ein Rekordjahr, so viele Lachse wurde seit dem Verschwinden der Fische in den 50er Jahren nicht mehr gezählt. Diese Zahlen gab der Staatssekretär des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums, Dr. Alexander Schink, heute bei der Präsentation des Lachsaufstiegs an der Sieg in Buisdorf bei Siegburg bekannt.
„Die aktuellen Ergebnisse machen deutlich, dass das NRW-Wanderfischprogramm erfolgreich und beispielgebend ist„, so Staatssekretär Dr. Schink. „Mit Hilfe von Fördermitteln aus der EU, der Fischereiabgabe und finanzieller Unterstützung durch das Land Nordrhein-Westfalen wurde es möglich, die Bestände von Lachsen und anderen Wanderfischen wieder aufzubauen. Sie sind ein Nachweis für eine erfolgreiche nordrhein-westfälische Gewässerschutzpolitik.“
Schülerinnen und Schüler aus Siegburg und Siegen bekommen zudem die Möglichkeit, die Entwicklung heimischer Lachse hautnah zu verfolgen. Dazu verlieh Staatssekretär Dr. Schink den Schulklassen Urkunden über eine Lachspatenschaft, ein Projekt der Stiftung Wasserlauf. „Dieses Projekt bedeutet ‚Natur zum Anfassen‘ und dieser Titel ist Programm“, so Dr. Schink. Mit der Übernahme einer Lachspatenschaft setzen die Schülerinnen und Schüler eigenhändig Junglachse in die Sieg und informieren sich regelmäßig über die Überlebens- und Rückkehrraten der erwachsenen Lachse. Eine Patenschaft übernommen haben zwei Biokurse der Alexander-von-Humboldt-Realschule in Siegburg und die AG-Lachs des Gymnasium auf der Morgenröte in Siegen.
Zwischen 600.000 und 700.000 Junglachse werden jedes Jahr in nordrhein-westfälische Flüsse ausgesetzt. Aber auch die natürliche Vermehrung der Lachse hat stark zugenommen. Das haben Wissenschaftler aus dem Wanderfischprogramm NRW im Auftrag der Bezirksregierung Arnsberg ermittelt. Nach vorsichtiger Hochrechnung stammen heute im Sieggebiet wieder rund 100.000 Junglachse jährlich aus natürlicher Fortpflanzung. Aus der Sieg wandern die Junglachse dann in die Nordsee. Durch die natürliche Auslese kehren weniger als ein Prozent der ausgewachsenen Tiere zurück um in der Sieg und weiteren nordrhein-westfälischen Flüssen abzulaichen. Weitere Informationen zum nordrhein-westfälischen Wanderfischprogramm sind zu finden unter
http://www.murl.nrw.de/naturschutz/fischerei/wanderfischprogramm/index.php
http://www.wasserlauf-nrw.de/
(zurück)