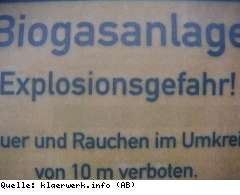Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe in Nordrhein-Westfalen haben sich in den letzten Jahren für die CO2-neutrale Energieerzeugung aus Biogas entschieden und in eigene Anlagen oder Gemeinschaftsanlagen investiert. Dies hat in Landkreisen mit ausgeprägter tierischer Veredelungswirtschaft zu Diskussionen um steigende Pachtpreise und Konkurrenzwirkungen von Biogasanlagen auf die traditionelle Viehwirtschaft geführt. Im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums hat der Fachbereich Agrarwirtschaft Soest der Fachhochschule Südwestfalen daher eine Studie zu regionalen Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion durchgeführt.
„Die Studie stellt eine fundierte Grundlage für eine vorurteilsfreie Diskussion der Wettbewerbssituation dar“, so Landwirtschaftsminister Eckhard Uhlenberg. „Danach gibt es derzeit keine wettbewerbsverzerrende Förderung von Biogasanlagen. Die Anlagen stellen auch keine Bedrohung für Vieh haltende Betriebe dar, sondern können – insbesondere als Gemeinschaftsanlagen – ein zusätzliches Standbein für die Betriebe sein.“ Die Studie macht aber auch deutlich, dass es unter den aktuellen Marktbedingungen erforderlich ist, gezielte Anreize für eine verstärkte Vergärung von Gülle und Reststoffen zu geben. Hier existiert ein hohes Potenzial zur Vermeidung von Treibhausgasen und zur regenerativen Energieerzeugung, ohne dass es zu Konkurrenz mit der Erzeugung von Nahrungsmitteln kommt.
Die Studie vergleicht in Modellrechnungen die Wettbewerbsfähigkeit von Biogasanlagen unter verschiedenen Rahmenbedingungen. Die Autoren stellen darin unter anderem fest, dass derzeit die Anreize zum Bau von Biogasanlagen angesichts der hohen Getreidepreise zu gering sind, um noch einen nennenswerten Zubau von Anlagen zu bewirken. Sie empfehlen deshalb eine Verstärkung und Erweiterung der Anreize zur Wärmenutzung sowie eine Erhöhung der Förderung für kleine, dezentrale Anlagen. Dagegen warnen sie davor, die Anreize für den Anbau von Energiepflanzen wesentlich zu verstärken oder gar an die Getreidepreise zu koppeln.
Die Ergebnisse der Studie dienen auch als Diskussionsbeitrag für die anstehende Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, mit dem die Vergütung für die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien geregelt wird. Die Novelle ist Teil des von der Bundesregierung vorgelegten „Integrierten Klima- und Energiepaketes“ im Rahmen des Meseberger Programms und wird in Kürze im Bundesrat beraten.
Die vorläufigen Ergebnisse des ersten Teils der Studie beziehen sich auf die Struktur- und Einkommenswirkungen in Veredelungsregionen (am Beispiel der Kreise Borken und Steinfurt). Derzeit wird die Studie um den Bereich Grünlandregionen ergänzt, im kommenden Jahr soll sich eine Bewertung der Situation in Ackerbauregionen anschließen.
- Vorläufiger Bericht zum Projekt „Regionale Struktur- und Einkommenswirkungen der Biogasproduktion in NRW“
Pressemitteilung vom Dezember 2007