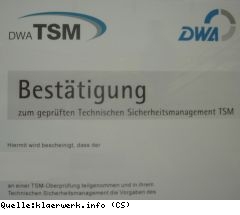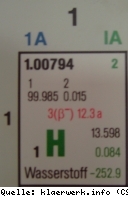Wir heizen mit Abwasser
Wie regenerative Energien genutzt werden können und damit
auch unterirdisch Klimaschutz betreiben werden kann
Seit gut zwei Jahren ist eine Abwasser-Wärmenutzungsanlage
(AWN) bei der Stadtentwässerung in Ludwigshafen am
Rhein erfolgreich in Betrieb. Der Betriebsstandort am unteren
Rheinufer umfasst einen Gebäudekomplex aus Werkstätten,
Garagen, Hauptpumpwerk, Labor und dem Betriebsgebäude
mit Büros, Sozial- und Sanitärräumen. Insgesamt
beträgt die Fläche gut 3000 m², die im Bedarfsfall zu beheizen
ist. Außerdem brauchen täglich 60 Mitarbeiter nach
getaner Arbeit warmes Wasser zum Duschen.
1 Vorbereitungs- und Planungsphase
Begonnen hat das Projekt mit 30 Jahre alten Heizkesseln
(Abbildung 1). Eine Erneuerung der Heizungsanlage war
fällig und damit die Frage „was tun?“ Im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie wurden verschiedene Lösungen geprüft.
Gemeinsam mit dem Gebäudemanagement der Stadtverwaltung
und dem örtlichen Versorgungsunternehmen TWL
(Technische Werke Ludwigshafen) wurden vier Heizvarianten
untersucht. Geprüft wurden die Effizienz und
Wirtschaftlichkeit eines Blockheizkraftwerks (BHKW), einer
Holzpellets-Anlage, einer AWN sowie eines konventionellen
Niedertemperatur-Ölkessels. Die guten baulichen Randbedingungen
– ein großer, begehbarer Abwasserkanal liegt
direkt neben den Betriebsgebäuden – sowie die Möglichkeit
der Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz machten die
Entscheidung leicht. Denn für Modellprojekte zur effizienten
Energieanwendung mit vollständiger Wärmenutzung
wurden Mittel in Höhe von 30 000 Euro in Aussicht gestellt.
Der Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt des
Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) und die TWL beschlossen
ein Energie-Contracting. Das bedeutet: Die Stadtentwässerung
stellt das Abwasser und die AWN zur Verfügung,
die TWL übernimmt die Herstellung der Anlage und
ist für den Betrieb verantwortlich.
Die Anlage
Die AWN besteht aus den Hauptbestandteilen Wärmetauscher
und Wärmepumpen (Abbildung 2). Die Wärmetauscher
werden auf den Boden des Abwasserkanals montiert
und so vom Abwasser überströmt. Das Abwasser hat ganzjährig
eine Temperatur zwischen 12 und 21 °C. Die Wärme-tauscher haben in der Summe eine Fläche von ca. 10 m². Im Wärmetauscher zirkuliert der Solekreislauf, eine Flüssigkeit,
die durch das Abwasser erwärmt wird. In den Wärmepumpen
wird die lauwarme Sole auf eine höhere Temperatur
komprimiert und diese über einen Pufferspeicher an den
Heizkreislauf abgegeben. So soll eine Heizwärmeleistung
von 90 kWth erzielt werden. Parallel zu der AWN wird ein
Niedertemperatur-Ölkessel vorgehalten, um Spitzenlasten
im Winter oder auch Störungen und Reparaturfälle abzudecken.
Ausführungsphase
Eine große technische Herausforderung bestand darin, den
Abwasserdurchfluss (im Durchschnitt 250 l/s) während der
Bauphase umzuleiten. Es musste sichergestellt sein, dass das
Abwasser ohne Beeinträchtigungen im Stadtgebiet weiterhin
zur BASF-Kläranlage gefördert wird (die Stadt Ludwigshafen
betreibt selbst keine eigene Kläranlage). Im ersten Schritt
wurde daher mit einer aufwendigen Konstruktion das Abwasser
im Kanal 1,50 m aufgestaut und dann über ein auf
dem Bankett verlaufendes Gerinne abgeleitet (Abbildung 3).
Jetzt konnte die Kanalsohle von Mitarbeitern der Stadtentwässerung
gründlich gereinigt werden, bevor die Wärmetauscher-
Elemente auf ein Fließmörtelbett aus Kunststoff
montiert wurden …mehr:
http://www.kan.at/upload/medialibrary/KA-Betriebs-Info4-2010.pdf
Autorin
Dipl.-Ing. (FH) Heike Herbig
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen
Stadtentwässerung und Straßenunterhalt
Unteres Rheinufer 47, 67061 Ludwigshafen
(nach oben)
Kooperationsprojekt: Potenziale einer rationellen Wärmenutzung
Am 02.02.2010 lud das Clustermanagement Vertreter aus Forschung und Wirtschaft zu einem ersten Kooperationstreffen ein. Nach thematischen Einführungen durch zwei Teilnehmer zu Potenzialen einer rationellen Wärmenutzung und Möglichkeiten der Wärmegewinnung, lotete die Gruppe unter Leitung des Clustermanagements Möglichkeiten und Grenzen der rationellen Wärmenutzung aus.
Insbesondere wurde auf das bisher wenig genutzte Potenzial der Nutzung industriell-gewerblicher Prozesswärme und die Möglichkeiten einer unterirdischen Wärmespeicherung eingegangen. Zur Ausschöpfung vorhandener Potenziale sind aber eine Reihe von rechtlichen und strukturellen Voraussetzungen nötig, die derzeit noch nicht gegeben und auch noch nicht hinreichend definiert sind.
Die Beschreibung dieser Hemmnisse und Potenziale sowie das Aufzeigen erster Lösungswege wurden in einem internen Strategiepapier im Nachgang des ersten Treffens von den Teilnehmern aufgearbeitet und in einem zweiten Treffen am 12. März 2010 im Clusterbüro diskutiert. Hier wurde als nächster Schritt die Zusammenstellg von „guten Beispielen“ einer rationelleren Wärmenutzung und eine (räumliche) Konkretisierung der Potenziale vereinbart.Mehr:
http://www.umweltcluster-nrw.de/virthos.php/de/News/Newsletter/NL_2010_02.html#Kooperationsprojekte
(nach oben)
Abwasserwärmenutzung in Deutschland
Aktueller Stand und Ausblick
Zusammenfassung
In der Schweiz und Skandinavien sind schon mehr als 100 Anlagen
zur Abwasserwärmenutzung in Betrieb, mit Leistungen
zwischen 100 und 70 000 kW Wärme. Auch in Deutschland
existieren realisierte Anlagen, in jüngster Zeit werden ständig
neue Projekte gestartet. Der Beitrag vermittelt einen Überblick
über die Einsatzmöglichkeiten und den neusten Stand der Abwasserwärmenutzung
in Deutschland.
Fazit
Die Abwasserwärmenutzung hat in den letzten Jahren in
Deutschland eine starke Entwicklung erfahren. Die Technologie
ist inzwischen erprobt, das Interesse der Öffentlichkeit und
Fachwelt nimmt ständig zu. Die gesetzlich-administrativen
Rahmenbedingungen haben sich stark verbessert, so dass auch
ständig neue Projekte gestartet werden. Bei entsprechenden
Voraussetzungen sind Anlagen zur Abwasserwärmenutzung
bereits heute wirtschaftlich konkurrenzfähig. Förderungen, wiesie zum Beispiel vom Land Baden-Württemberg vorbildhaft geleistet
werden, helfen die Realisierung von Demonstrationsbeispielen
und damit auch die verbreitete Umsetzung voranzubringen.
Damit kann nicht nur ein wesentlicher Beitrag zum
Klimaschutz erbracht, sondern auch ein Beitrag zur Stärkung
der deutschen Wirtschaft und zur Erhaltung der regionalen Arbeitsplätze
erzielt werden. Damit dies sichergestellt werden
kann, müssen die Aus- und Weiterbildung sowie die Vermittlung
von Know-how und Erfahrungen in Deutschland nochmals
wesentlich erhöht werden, auf allen Stufen.
Den ganzen Artikel lesen Sie In der Korrespondenz Abwasser Heft 5-2010
Autoren
Dipl.-Geogr. Ernst A. Müller
Geschäftsführer InfraWatt
Leiter Institut Energie in Infrastrukturanlagen
Dr. Jan Butz
Klinger und Partner
Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik GmbH
(nach oben)
HUBER: Abwasserwärmetauscher als Beckenversion RoWinB
Der HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin ist in seiner Art einzigartig. Er vereint auf geniale Weise einen hervorragenden Wärmeübergang mit einer automatischen Abreinigung der Wärmeaustauscherfläche und sorgt durch eine Räumschnecke selbst-ständig für den Austrag von Sedimen-ten. Er ist daher für alle denkbaren Abwässer einsetzbar. Hierbei sei kommunales Abwasser als die häufigste Art erwähnt. Die Entnahme dieses „Rohstoffes“ findet direkt am Kanal bzw. nach der mechanischen Reinigung auf der Kläranlage statt.
Die Wärmeenergie des Abwassers geht auf einer Kläranlage aber keineswegs verloren. Zwar steht das Abwasser in diversen Becken mit kalter Umgebungsluft in Kontakt, erfährt aber durch verschiedene Prozesse ebenso eine Erwärmung. Allgemein betrachtet kann also davon ausgegangen werden, dass das gereinigte Wasser mit einer verhältnismäßig hohen Temperatur dem Vorfluter zugeleitet wird.
Aufgrund der biologischen Stufe ist im Zulauf eines Klärwerks noch eine gewisse Mindesttemperatur einzuhalten. Im Auslauf hingegen ist eine geringe Temperatur sogar erwünscht, da der Eintrag von Wärme in das Vorflutersystem einen nicht unerheblichen Beitrag zur Eutrophierung leistet. Daher sind im Auslauf einer Kläranlage einem hohen Energieentzug keine Grenzen gesetzt. Was liegt daher mehr auf der Hand als die Energie des Abwassers im Ablauf einer Abwasserbehandlungsanlage zu entziehen.
Selbstverständlich ist der HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin auch dieser Aufgabe gewachsen. Aber eine Sedimentaustragschnecke scheint hier nicht nur dem geschulten Blick eines Fachmannes fehl am Platze. Auf diese kann deshalb bei einer Nutzung des Kläranlagenauslaufes verzichtet werden.
Selbst wenn der Auslauf der Kläranlage alle erforderlichen Parameter betreffend seiner Inhaltsstoffe einhält, ist dennoch eine Beeinträchtigung des Wärme-überganges durch Ablagerungen auf den Wärmetauscherrohren nicht auszu-schließen. Aus diesem Grund wird die automatisierte Reinigungseinrichtung des RoWin beibehalten.
Im Gegenteil zu kommunalem Abwasser vor einem Klärwerk befindet sich dessen Auslauf auf einem geodätisch gesehen höheren Niveau, wodurch auf eine energie- und kostenintensive Anhebung verzichtet werden kann. Um die potentielle Energie des Abwasserstroms optimal auszunutzen ist der Wärmetaucher am besten im Auslaufgerinne des Klärwerks direkt zu positionieren.
Da die Höhe eines Moduls und die Modulanzahl als variabel bezeichnet werden können, ist es möglich, den RoWin in ein bereits bestehendes, oder in ein speziell auf den Anwendungsfall ausgelegtes Becken bzw. Gerinne einzusetzen. Durch diese Art des Einbaus wird keine zusätzliche Aufstellfläche benötigt.
Verschraubbare Abdeckungen gewährleisten einerseits die Einhaltung der gesetzlichen Sicherheitsvorschriften, sorgen aber andererseits für einen einfachen sowie schnellen Zugang im Revisionsfalle. Der Kühlwasserkreislauf kann frostsicher und optisch verborgen zur Heizzentrale verlegt werden und somit die Wärmepumpe mit umweltfreundlicher und kostenloser Energie versorgen.
Auf diese Art und Weise können bei der Kommune hohe Energiekosten eingespart werden, welche eine Aufheizung des Faulturms oder die Wärmeversorgung der Sozialgebäude durch konventionelle Energie zwangsläufig mit sich bringen. Pro Sekundenliter können durch Einsatz von HUBER Produkten ca. 10 kW Heizenergie erzeugt werden.
Quelle: http://www.huber.de/de/huber-report/ablage-berichte/energie-aus-abwasser/huber-abwasserwaermetauscher-als-beckenversion-rowinb.html?popup=1
(nach oben)
Wärmeverbund Ingolstadt
Mit dem Projekt „Wärmeverbund Ingolstadt“ soll untersucht werden, ob und ggf. wie Abwärmeströme von Produktionsbetrieben ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll zur Deckung des Wärmebedarfes anderer Industriebetriebe und ggf. sonstiger Wärmeverbraucher genutzt werden können.
Unter den nachfolgenden Links finden Sie weitere Infos:
http://www.lfu.bayern.de/luft/forschung_und_projekte/waermeverbund_in/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/luft/fachinformationen/co2_minderung/doc/waermeverbund_ingolstadt_detailstudie.pdf
(nach oben)
Leitfaden zur Abwärmenutzung in Kommunen
Der Leitfaden beschreibt die Vorgehensweise und Identifizierung von Abwärmequellen und Abwärmenutzern.
Mehr unter:
http://www.lfu.bayern.de/luft/fachinformationen/co2_minderung/doc/leitfaden_abwaermenutzung.pdf
(nach oben)
Baden-Württemberg: Wärme aus Abwasser verstärkt nutzen
Die baden-württembergische Umweltministerin Tanja Gönner gab in Stuttgart am 26. Januar 2010 den Startschuss für eine neue Klimaschutzinitiative: Über neu entwickelte technische Verfahren soll in Baden-Württemberg vermehrt Wärme aus Abwasser für die Wärmeversorgung von Gebäuden genutzt werden. Wasser werde im Winter mit einer Temperatur von 6 bis 10 °C in das Versorgungsnetz gepumpt, erläuterte Gönner. Nach Ableitung im Kanalnetz ergebe sich im Winter eine Durchschnittstemperatur von etwa 12 bis 15 ° C. Über im Kanalnetz installierte Wärmetauscher könnte dem Abwasser diese Wärme wieder entzogen und über Wärmepumpen zum Heizen nutzbar gemacht werden. Bis zu zehn Prozent aller Gebäude könnten über Abwasserwärme beheizt werden. Außerdem könnten die Gebäude in den Sommermonaten über dasselbe technische Verfahren im Umkehrbetrieb gekühlt werden. In einer Umfrage des Städtetags Baden-Württemberg hatte jede vierte von 80 angeschriebenen Kommunen Interesse an der neuen Technik gezeigt. Das Land fördere dazu notwendige Studien zu den jeweils örtlich vorhandenen Energiepotenzialen und der Machbarkeit ihrer Nutzung mit 50 Prozent der Kosten. Fünf Förderanträge seien beim Umweltministerium bereits eingereicht worden. Darüber hinaus gebe es eine weitere Handvoll Städte und Gemeinden, die mit Projekten zur Abwasserwärmenutzung bereits begonnen haben. Die Realisierung von Projekten kann vom Umweltministerium über das KlimaschutzPlus-Förderprogramm gefördert werden; der Fördersatz liegt bei 50 Euro pro eingesparter Tonne CO2 .
Am 27. Januar 2010 fand in Stuttgart eine gemeinsame Veranstaltung des Umweltministeriums, Städtetags, Gemeindetags, Landkreistags und DWA-Landesverbands Baden-Württemberg zum Thema „Wärmegewinnung aus Abwasser“ statt. Die Vorträge stehen zum Download im Internet bereit:
www.dwa-bw.de
(nach oben)
Schweiz: Verein für -Energienutzung aus Abwasser gegründet
Um die Energiepotenziale aus Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser vermehrt zu nutzen, die Öffentlichkeit besser zu informieren und in der Politik mehr Gewicht zu erhalten, haben die Fachverbände VSA, VBSA, SVGW, der Verband Fernwärme Schweiz (VFS) und Vertreter aus der Wirtschaft und der Elektrizitätsbranche am 19. Januar 2010 den neuen Verein InfraWatt gegründet. Die Geschäftsführung von InfraWatt hat Ernst A. Müller übernommen.
www.infrawatt.ch
E-Mail: mueller@infrastrukturanlagen.ch
(nach oben)
Abwasserwärmenutzung:Angebot aus der Schweiz
„In jüngster Zeit wurden verschiedene Anlagen zur Abwasserwärmenutzung realisiert. Wer eine Anlage bei Gelegenheit besichtigen möchte, kann sich melden bei EnergieSchweiz für Infrastrukturanlagen.“
Alle Infos unter:
http://www.bfe.admin.ch/infrastrukturanlagen/01076/01077/index.html?lang=de
(nach oben)
Umweltministerin Tanja Gönner gibt offiziellen Startschuss für neue Klimaschutzinitiative und will verstärkt Wärme aus Abwasser nutzen
„Müssen vorhandene Energiepotenziale noch besser ausschöpfen“
Vorreiter: Ministeriumsneubau soll mit neuer Technik beheizt werden
In Stuttgart gab Umweltministerin Tanja Gönner den offiziellen Startschuss für eine insbesondere mit dem Städtetag und anderen Partnern entwickelte neue Klimaschutzinitiative: Über neu entwickelte technische Verfahren soll in Baden-Württemberg vermehrt Wärme aus Abwasser für die Wärmeversorgung von Gebäuden genutzt werden. Morgen werden sich dazu in einem Fachkongress rund 200 Experten und Vertreter aus Städten und Gemeinden austauschen. „Das Abwasser von privaten Haushalten und Industrie wird über die kommunalen Kanalnetze in die Kläranlagen geleitet. Die enthaltene Wärme geht zumeist ungenutzt verloren. Dabei gibt es zwischenzeitlich ausgereifte neue Umwelttechniken, die es möglich machen die Wärmeenergie zur Wärmeversorgung von Gebäuden zu nutzen und so Gas und Öl einzusparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“ Schließlich bedeuteten weniger Gas- und Ölverbrauch zugleich weniger Emissionen des klimaschädlichen Treibhausgases CO2, so Umweltministerin Gönner.
Wasser werde im Winter mit einer Temperatur von sechs bis zehn Grad Celsius in das Versorgungsnetzt gepumpt, erläuterte Gönner. „Wasser verlässt die Haushalte erheblich wärmer.“ Je nach Nutzung in privaten Haushalten oder in industriellen Prozessen werde das Wasser aufgeheizt, sodass sich nach Ableitung im Kanalnetz im Winter eine Durchschnittstemperatur von etwa 12 bis 15 Grad ergebe. Über im Kanalnetz installierte Wärmetauscher könnte dem Abwasser diese Wärme wieder entzogen und über Wärmepumpen zum Heizen nutzbar gemacht werden. „Das Verfahren eignet sich vor allem für das Beheizen größerer Gebäude wie Schulen und Krankenhäuser“, so Gönner. Die Wärme könne alternativ auch in ein Nahwärmenetz eingespeist werden. Die Wärmepumpe werde zwar in der Regel mit Strom betrieben. Gegenüber einer herkömmlichen Wärmeversorgung könne der CO2-Ausstoß dennoch um mindestens 25 Prozent gesenkt werden. „Auf Grund der konstant erhöhten Temperaturen des Abwassers können bei den Wärmepumpen hohe Jahresarbeitszahlen und damit eine gute Effizienz erzielt werden“, so Gönner.
Nach Expertenschätzung könnten bis zu zehn Prozent aller Gebäude über Abwasserwärme beheizt werden. „Die Potenziale sind damit durchaus beachtlich“, so Gönner. Außerdem könnten die Gebäude in den Sommermonaten über dasselbe technische Verfahren im Umkehrbetrieb gekühlt werden. Bei der Realisierung müssten die Kommunen mitziehen, die in der Regel das Abwasserkanalnetz und Kläranlagen betreiben. „Die Kommunen haben den ersten Zugriff auf diese Energiequelle. Sie verfügen außerdem über geeignete Liegenschaften, die mit Wärme versorgt werden könnten.“ Dabei gebe es in einzelnen Städten und Gemeinden des Landes bereits erste positive Erfahrungen. Unser gemeinsames Anliegen ist es, die Technik und das Verfahren weiter bekannt zu machen und die Kommunen bei diesem neuen Weg der Energieversorgung zu unterstützen, so Gönner.
In einer Umfrage des Städtetags hatte jede vierte von 80 angeschriebenen Kommunen Interesse an der neuen Technik gezeigt. „Es gibt eine große Aufgeschlossenheit. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass weitere Kommunen den Weg mitgehen“, so Umweltministerin Gönner. Vor allem bei ohnehin notwendig werdenden Kanalarbeiten und Sanierungen müsse darüber nachgedacht werden, ob eine Abwasserwärmenutzung sinnvoll zu realisieren sei. Das Land fördere dazu notwendige Studien zu den jeweils örtlich vorhandenen Energiepotenzialen und der Machbarkeit ihrer Nutzung mit 50 Prozent der Kosten. „Wir geben damit einen wichtigen Impuls, solche Vorhaben in Angriff zu nehmen und in die Tat umzusetzen.“ Fünf Förderanträge seien beim Umweltministerium bereits eingereicht worden: Davon zwei Anträge aus Balingen sowie jeweils ein Antrag aus Bruchsal, Esslingen und Göppingen. Darüber hinaus gebe es eine weitere Handvoll Städte und Gemeinden, die mit Projekten zur Abwasserwärmenutzung bereits begonnen haben. Darunter sind unter anderen Backnang, Bretten, Konstanz, Leonberg, Sindelfingen und Vaihingen/Enz.
Das Land wolle bei der Abwasserwärmenutzung selbst gutes Vorbild sein: Der in Stuttgart an der Willy-Brandt-Straße (B 14) geplante Ministeriumsneubau soll über das Abwasser des dort kanalisierten Nesenbachs im Winter beheizt und im Sommer gekühlt werden. „Mit der weiteren Verbreitung dieser neuen Technik können neue Potenziale zur Wärmeversorgung von Gebäuden erschlossen werden“, zeigte sich Gönner überzeugt.
Ergänzende Informationen:
Bereits 1982 wurde im „Salemer Pflegehof“, einer Sozialstätte mit kulturellen Ausstellungsräumen in Esslingen, eine seinerzeit bundesweit erste Pilotanlage zur Abwasserwärmenutzung errichtet. Während in den vergangenen Jahren in der benachbarten Schweiz das Verfahren weitere Verbreitung fand, gibt es in Baden-Württemberg nur vergleichsweise wenige Projekte, in denen die Abwasserwärme genutzt wird (unter anderem beispielsweise in Waiblingen, Singen, Bretten).
Gemeinsam mit dem Städtetag und den weiteren kommunalen Landesverbänden sowie dem DWA hat das Umweltministerium eine Initiative zur weiteren Verbreitung der Abwasserwärmenutzung entwickelt. Studien zu den Potenzialen und zur Machbarkeit ihrer Nutzung werden vom Umweltministerium zu 50 Prozent nach den im vergangenen Jahr neu erlassenen „Förderrichtlinien Abwasser 2009“ gefördert. Im Jahr 2009 hat das Umweltministerium dazu rund 30.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Die Kosten entsprechender Studien belaufen sich auf durchschnittlich 5.000 bis 10.000 Euro. Die Realisierung von entsprechenden Projekten kann schließlich vom Umweltministerium über das KlimaschutzPlus-Förderprogramm gefördert werden; der Fördersatz liegt bei 50 Euro pro eingesparter Tonne CO2.
Nach Schätzung der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall) könnten über Abwasserwärme bis zu zehn Prozent aller Gebäude im Winter mit Wärme versorgt und im Sommer gekühlt werden.
Das Verfahren basiert auf der Entnahme von Wärme über einen Wärmetauscher, der im Abwasserkanal beispielsweise vor einer Kläranlage, aber auch an sonstigen geeigneten Stellen im Kanalnetz installiert wird, und deren anschließende Anhebung auf ein höheres Temperaturniveau mittels einer Wärmepumpe.
Die Effizienz der Anlagen hängt im Wesentlichen von der tatsächlichen Temperatur des Abwassers und der Abwassermenge sowie dem Wirkungsgrad von Wärmetauscher und Wärmepumpe ab. Durchschnittlich verringert sich der Energieverbrauch gemessen am CO2-Ausstoß gegenüber einer herkömmlichen Gas- oder Ölheizung um mindestens 25 Prozent.
Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg
(nach oben)