Messen-, Steuern- und Regeln auf Biogasanlagen
Dr.-Ing. Jürgen Wiese
Die Optimierung von landwirtschaftlichen und industriellen Biogasanlagen gewinnt in jüngster Zeit zunehmend an Bedeutung, u.a. aufgrund der steigenden Rohstoffpreise für nachwachsende Rohstoffe bzw. fallender Entsorgungserlöse für organische Reststoffe. Der Einsatz moderner Mess- und Automationstechnik ist ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Effizienzsteigerung von Biogasanlagen.
Was ist Messen, Steuern und Regeln?
Messen
Aufgabe des Messens ist die experimentelle Bestimmung quantitativ erfassbarer Größen zur Beurteilung der Eigenschaften, Funktion, Qualität und Zuverlässigkeit bestimmter Stoffe.
| online |
= Messen direkt im Prozess |
| |
= quasi in Echtzeit |
| |
= (quasi-)kontinuierlich |
| offline |
= Messen im Labor o.ä. |
| |
= mit (erheblicher) Zeitverzögerung |
| |
= nur (un-)regelmäßi |
Steuern und Regeln
Die gezielte Beeinflussung eines Prozesses mit dem Ziel, eine oder mehrere chemisch-physikalische und biologische Größen (z.B. pH, Temperatur) auf einen gezielten Sollwert zu bringen.
Warum Messen, Steuern und Regeln auf Biogasanlagen?
Die meisten Biogasanlagen sind intransparente Systeme!

Konsequenz: Blackbox-Systeme lassen sich nur schwer analysieren und optimieren!
• Für jeden der vier Teilschritte der Biogaserzeugung sind unterschiedliche Bakterienstämme verantwortlich.
• Der Anaerobprozess wurde von der Natur über viele Hundert Millionen Jahre optimiert. Wie viele spezialisierte Organismen reagieren auch anaerobe Bakterien oft sensibel auf Milieu-Änderungen:
- Änderung des pH-Wertes
- Änderung der Temperatur
- Zu hohe Konzentrationen bestimmter Stoffe (z.B. organische Säuren)
- Suboptimale Nährstoffverhältnisse
- Zu niedrige Konzentration bestimmter Stoffe (z.B. Spurenelemente)
- Starke Belastungsschwankungen
• Das Wachstum anaerober Mikroorganismen ist relativ langsam. D.h. im Falle einer ernsthaften biologischen Störung kann es 2 bis 3 Monate dauern, bis der Prozess wieder auf voller Leistung ist.
Beispiel: Vergleich einer 500 kW-NaWaRo-Biogasanlage mit 70 bzw. 90 % Wirkungsgrad
| |
Einheit |
Anlage A
(suboptimal) |
Anlage B
(Beispiel) |
| Auslastungsgrad |
% |
70 |
90 |
| Energieproduktion pro Jahr |
kWh |
3.066.000 |
3.942.000 |
| Einnahmen (Strom) pro Jahr |
EUR/a |
487.500 |
627.000 |
| Differenz = Mindererlös |
EUR/a |
|
+ 139.500 |
Fehlende Prozessüberwachung kann teuer werden, besonders wenn es zum Versagensfall kommt und die Biogasanlage längere Zeit still steht!
Antriebskräfte für den Einsatz von MSR-Technik
1. Immer mehr größere Biogasanlagen werden gebaut.
2. Zunehmender Druck durch Finanzinstitute und Versicherungen
3. Zunehmender Kostendruck wegen steigender Substratkosten (NaWaRo) bzw. sinkender Entsorgungserlöse (Kofermente)
4. Probleme werden zunehmend komplex:
• Maximierung der Energieproduktion → Erhöhung Einnahmen
• Minimierung der Eingangsstoffen → Reduzierung Ausgaben
• Viele verschiedene Inputstoffe → Nutzung von Marktchancen
• Minimierung der Betriebsrisiken → Hohe Anlagenverfügbarkeit
Was kann auf Biogasanlagen zurzeit gemessen werden?
Flüssig-/Festphase
| Füllstand (Behälter, Reaktionsräume) |
→ online möglich |
| Durchfluss (Beschickung, Reaktionsräume) |
→ online möglich |
| Temperatur (Reaktionsräume) |
→ online möglich |
| pH-Wert (Beschickung, Reaktionsräume) |
→ online möglich |
| LF-Wert (Beschickung, Reaktionsräume) |
→ online möglich |
| Redox (Reaktionsräume) |
→ online möglich |
| TS-Konz. (Beschickung, Reaktionsräume) |
→ online möglich |
| Konz. org. Säuren (Reaktionsräume) |
→ offline |
| NH4-N-Konz. (Reaktionsräume) |
→ offline |
| Säurekapazität (Reaktionsräume) |
→ offline |
Gasphase (Biogas)
| Zusammensetzung (CH4, CO2, O2, H2S + ggf. H2, NH3) |
→ online mögl. |
| Volumenstrom |
→ online mögl. |
| Gasfüllstand |
→ online mögl. |
| Gasdruck |
→ online mögl. |
Beschickung
| Art (Substrattyp) |
→ offline/online |
| Volumen / Gewicht |
→ offline/online |
Maschinen und Apparate
| Betriebszustand (Betriebsstatus, Wartungsintervalle) |
→ online mögl. |
| Energieverbrauch / Leistungsaufnahme |
→ online mögl. |
Was ist bei der Auswahl von Messgeräten zu beachten?
Problematische Messbedingungen
• inhomogene Vielstoffgemische → prinzipiell schwierig zu messen
• Schmutzstoffe (z.B. Fette) → ggf. kurze Reinigungsintervalle
• Zopfende und verstopfende Inhaltsstoffe → ggf. kurze Reinigungsintervalle
• Störstoffe → Querempfindlichkeiten
• Schadstoffe → z.B. H2S-Elektrodenvergiftung von pH-Sonden
• Ggf. Ex-Schutz-Problematik
Konsequenz: robuste Messtechnik auswählen!
Online- versus Offline-Messtechnik
• Welche Messintervalle benötige ich, um den Prozessverlauf adäquat nachbilden zu können?
• Welche Messgenauigkeit benötige ich, um den Prozessverlauf adäquat nachbilden zu können?
• Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis zwischen online- und offline-Messtechnik (Investitions- und Betriebskosten)?
• Lassen sich online-Messgeräte (problemlos) nachrüsten?
• „Nur“ Messgerät oder Grundlage für Steuerungs- und Regelungsstrategien?
Mögliche andere Entscheidungskriterien
• Ist eine einfache Anbindung an die Automationsebene der Biogasanlage möglich?
• Sind ausreichende Reserven auf der Automationsebene vorhanden?
• Digitalisierung der Messtechnik:
• Digitale Messgeräte bieten andere Möglichkeiten bezüglich vorausschauender Wartungskonzepte, Fehleranalyse etc. als analoge Messgeräte.
• Durch digitale Messkonzepte lassen sich ggf. Investitionskostenvorteile erzielen (z.B. nur noch eine Controllerplattform)
Was ist bei der Auswahl von Messpunkten zu beachten?
Mögliche Kriterien
• Wie aufwändig ist die Wartung der Messgeräte an der entsprechenden Stelle? (z.B. Zugänglichkeit)
• Wie (finanziell und technisch) aufwändig/riskant ist der Einbau eines Messgerätes an einer bestimmten Stelle? (z.B. Spannbeton)
• Ist die Messstelle repräsentativ für den Prozess?
• Ex-Schutz-Problematik? (ggf. deutlich höhere Kosten)
• Kann ich es mir finanziell und vom Personalaufwand her leisten, in jedem Reaktionsraum zu messen oder kann ich mit einem Messgerät mehrere Reaktionsräume beproben?
• Art des Messverfahrens: in-situ, on-site, berührungslos …
Was ist auf der Automationsebene zu beachten?
• Der intensive Einsatz von Steuerungs- und Regelungstechnik setzt das Vorhandensein automatisch manipulierbarer Maschinen und Apparate voraus! (z.B. Automatikschieber)
• Beim Bau einer Biogasanlage sollten bereits Reserven auf der Automationsebene eingeplant werden, sodass Messgeräte ohne größeren Aufwand nachgerüstet bzw. Steuerungs- und Regelungskonzepte implementiert werden können!
• Nach Möglichkeit sollten auf der Automatisierungs- und Visualisierungsebene Standardschnittstellen vorhanden sein!
Wie hoch sind die Kosten für Messtechnik?

pH/Redox (≈ 1.000 €) |

TS-Sensor
(ab 3.000 €) |

Biogasanalyse
(≈ 6.000 €) |

Gasfüllstand,
Füllstand
(je < 1.000 €) |

Biogasdurchfluss
(≈ 2.500 €) |

IDM (≈ 2.000 €) |

Autom. Titrator
(≈ 4.000 €) |

TS-Labor (< 2.000 €) |

Leitsystem(Softw.)
(< 15.000 €) |
|
Praxisbeispiel: SBW Biogas Lelbach

Beispiel: BGA Lelbach (Lageplan)

Beispiel: BGA Lelbach (Lageplan)

Beispiel: BGA Lelbach (Eingangsstoffe)

Fahrsilo

Lagertank für Gülle |
Die Anlage wurde konzipiert zu Verwertung verschiedener Nachwachsender Rohstoffe:
• Rindergülle (≈ 15 t/d)
• Maissilage und GPS (25 – 30 t/d) (TS = 28 %)
• Sudangras (< 1 t/d)
• Hühnertrockenkot (< 1 t/d)
• Getreide (Roggen, CCM, Raps) (<< 1 t/d)
• Zuckerrüben (1)
• Futterrüben (1)
(1)saisonaler Ersatz für Getreide und Maissilage |
Beispiel: BGA Lelbach (Prozessleitsystem)
 |
• Modernes Prozessleitsystem (WinCC 6.0)
• Programmierschnittstellen (VBA, C-Script)
• Standardschnittstellen (Active-X, OLE, OPC)
• Datenbankschnittst. (SQL, ODBC, OLE-DB)
• Leistungsfähige Speicherprogrammierbare Steuerung (S7)
• Digitaler Prozessbus (PROFIBUS-DP)
• Fernwirktechnik (mobil und drahtgebunden) und Störmeldekonzepte |
 |
Beispiel: BGA Lelbach (Pumpstation)
 |
• voll automatisiert
• Messgeräte:
• Durchfluss (MID)
• pH-Sonde
• Redox-Sonde
• TS-Sonde
• …
„Spinne“: Durch Nutzung dieser Konstruktion kann jeder Reaktionsraum mit nur einem Satz Messgeräte mehrmals am Tag überwacht werden.
 |
 |
Beispiel: pH, Redox und Gasdurchfluss

Beispiel: TS-Messung

Beispiel: BGA Lelbach (Feststoffdosierer 1)
Beispiel: BGA Lelbach (Feststoffdosierer 1)

Beispiel: BGA Lelbach (Feststoffdosierer 2)
Beispiel: BGA Lelbach (Fermenter/Nachgärer)
Beispiel: BGA Lelbach (Biogas)

 |
• Durchflussmessung
• Gaszusammensetzung
• Methan (CH4) (IR)
• Kohlenstoffdioxid (CO2) (IR)
• Sauerstoff (O2) (EC)
• Schwefelwasserstoff (H2S) (EC)
• Überwachung der Ex-Zone im Gebäude

EC = Elektrochemisch
IR = Infrarot-Absorption |
Beispiel: BGA Lelbach (Sonstige Messdaten)
• Zahlreiche Daten über das BHKW: Drehzahl, Gastemperatur, Temperatur in jedem einzelnen Zylinderkopf, …
• Zahlreiche Daten über die Stromerzeugung: Blindarbeit, Wirkarbeit, cos φ, …
• Zahlreiche Daten über Stromverbrauch: Rührwerke, Antriebe, Frequenzumformer, …
• Zahlreiche Temperaturdaten: Heizkreisläufe, Wärmetauscher, Fermenter, Nachgärer, Wärmemengenzähler
• Lückenlose Dokumentation: Status, Laufzeiten, Schaltzahlen etc. für Pumpen, Rührwerke, Antriebe, Schieber etc.
Beispiel: BGA Lelbach – Betriebsergebnisse

Tabelle: Betriebsdaten der BGA Lelbach (Vergleichswerte nach FNR, 2005 bzw. Hessen, 2006)
(M = Medianwert, MW = Mittelwert, B = Bandbreite)
| Betriebskenngröße |
Einheit |
Lelbach |
Vergleichswert |
| Stromproduktion zu Eingangsstoffen |
kWh/tinput |
251 |
M: 150 |
| Eigenenergieverbrauch (Biogasanlage) |
% |
7,7 |
B: 3-14 r, MW: 8 |
| Stromproduktion pro m3 Biogas |
kWh/m3Biogas |
2,08 |
B: 1,4-2,4 |
| Methanproduktion zu Reaktorvolumen |
m3CH4/(m3R×d) |
1,21 |
B: 0,3-1,1;
MW: 0,74 |
| Motor-Auslastungsgrad (bezogen auf 530 kW) |
% |
95,1 |
MW: 62,0 |
| Abbaugrad der Eingangsstoffe |
% |
76,9 |
MW: 61,5 |
Anmerkungen: Berechnungen und Vergleichsdaten analog den Studien „Ergebnisse des Biogas-Messprogramms“ (FNR-Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, 2005) bzw. „Biogas in Hessen“ (HMUlRV, 2006)
Beispiel: Photometrische Schnelltests
 
Messplatz
Investkosten: < 10.000 € |

Eingabe der offline-Messwerte als Führungsgröße für Leitsystem möglich! |
Beispiel: Automatische Titratoren
 Autom. Titrator(ca. 4.000 €) Autom. Titrator(ca. 4.000 €) |

Eingabe des offline-Messwertes als Führungsgröße für Leitsystem möglich! |
MSR-Anwendungen
• Bilanzen für Energie (Strom, Wärme) und feste, flüssige und gasförmige Stoffe sind möglich.
• Automatisierung und Anlagensteuerung sind auf einem sehr hohen Niveau möglich.
• Lückenlose Dokumentation des Anlagenbetriebs (inkl. der Störungen).
• (Quasi-)kontinuierliche Überwachung wichtiger Betriebs- und Prozessparameter.
• Andere wichtige Betriebsparameter (z.B. hydraulische Verweilzeit) können automatisch kalkuliert werden.
(Zukünftige) MSR-Anwendungen
• Zahlreiche wichtige Daten für
• ein technisches, ökonomisches und ökologisches Controlling and Benchmarking,
• Entscheidungsunterstützende Systeme,
• (anlagenweite) Echtzeitsteuerung/-regelung,
• Künstliche Intelligenz-Anwendungen und
• (anlagenweite) Computermodellierung.
• „Virtuelle Kraftwerke“: virtuelle Kombination von Biogasanlagen und ggf. anderen Erneuerbaren Energien (z.B. Wind) ® Bündelung von Energieproduktionskapazitäten
Zusammenfassung und Fazit
• Der Einsatz umfangreicher Messtechnik macht aus dem „Black-Box-System“ Biogasanlage ein „Gray-Box-System“.
• Ziel: die Anlagenverfügbarkeit und den Auslastungsgrad auf einem möglichst hohen Niveau zu halten.
• Der Stand der Mess- und Prozessleittechnik erlaubt bereits heute eine high-level Automation. Es sind technisch nahezu beliebig komplexe MSR-Konzepte realisierbar.
• Messgeräte müssen gewartet und kontrolliert werden!
• Eine Analytische Qualitätssicherung der online-/offline- Messgeräte ist wichtig, besonders wenn die Messtechnik die Grundlage für Steuerungen und Regelungen ist.
• Die Betreiber von Biogasanlagen müssen entsprechend geschult bzw. für mögliche Probleme sensibilisiert werden!
Autor:
Dr.-Ing. Jürgen Wiese
GKU
Gesellschaft für kommunale Umwelttechnik mbH
Heinrichstraße 17/19
36037 Fulda
Tel.: 0661/12-408
Fax: 0661/12-409
URL: http://www.gku-fulda.de
E-Mail: juergen.wiese@uewag.de

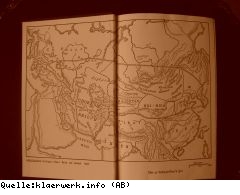



















































































 Autom. Titrator(ca. 4.000 €)
Autom. Titrator(ca. 4.000 €) 
