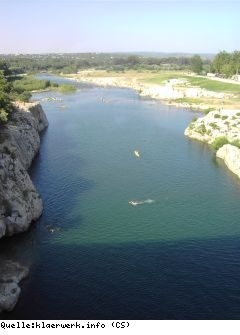Mehr „Perspektive 50plus“ in regionaler Arbeitsmarktpolitik
Aus Anlass des fünften Jahrestreffens des Bundesprogramms „Perspektive 50plus“ erklärt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:
Seit Jahresbeginn läuft die zweite Programmphase des Bundesprogramms „Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“. Am 25. und 26. Mai findet im BMAS in Berlin das fünfte Jahrestreffen von „Perspektive 50plus“ statt. Neben dem Fachaustausch stehen Aktivitäten im Vordergrund, die die Beschäftigungspakte noch stärker in der regionalen Arbeitsmarktpolitik verankern.
Dabei trifft Bundesarbeitsminister Olaf Scholz Vertreter der 62 Beschäftigungspakte und zeichnet ehrenamtliche Perspektive 50plus-Botschafter aus. Darüber hinaus bietet das Treffen zwischen Mitgliedern des Deutschen Bundestags (MdB) und Vertretern der Regionalpakte die Gelegenheit, mehr über die Arbeit der einzelnen Pakte zu erfahren und die Netzwerkarbeit zu verstärken.
Seit Beginn der zweiten Programmphase am 1. Januar 2008 konnte bereits fast 27.000 langzeitarbeitslosen älteren Frauen und Männer ein neuer Arbeitsplatz vermittelt werden. Wenn man die Erfolge der ersten Programmphase hinzuzählt, sind es in den letzten knapp vier Jahren sogar fast 50.000 Menschen, die einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden haben und hierdurch ihre Langzeitarbeitslosigkeit überwunden haben.
Bundesarbeitsminister Olaf Scholz: „Wir wollen und werden die Beschäftigungspakte in den Regionen weiter stärken – beispielsweise durch eine Ausweitung der Programmregionen zur Jahresmitte und eine nochmalige Erhöhung der Aktivierungs- und Vermittlungszahlen.“
Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Aktivitäten für die Paktregionen ausgebaut. Denn durch den Ausbau dieser Arbeit wird das Interesse bei potenziellen Arbeitgebern und älteren Arbeitssuchenden gesteigert. So werden zur Festigung des Bundesprogramms in den Regionen während des zweitägigen Jahrestreffens die Frauen und Männer gewürdigt, die sich ehrenamtlich einsetzen: Perspektive 50plus-Botschafter machen sich für das Programm stark und werben unter anderem in Unternehmen dafür, ältere Langzeitarbeitslose einzustellen. In einer zentralen Festveranstaltung ehrt der Bundesarbeitsminister 27 Frauen und Männer aus den Regionen für ihr nachhaltiges Engagement. Mit der Ehrung sollen auch andere Interessierte ermutigt werden, Botschafter zu werden.
Auch auf regional-politischer Ebene wird das Programm gestärkt. Unter dem Motto „Pakte treffen Politik“ kommen Bundestagsabgeordnete aus den am Bundesprogramm beteiligten Regionen zum Abendempfang am 25. Mai mit Paktvertretern zusammen. An Informationsständen können die Abgeordneten mehr über die Arbeit in ihrem Wahlkreis erfahren und sich austauschen. Auf diese Weise werden die MdB für das Bundesprogramm sensibilisiert, um sich innerhalb ihres Mandats intensiver für Perspektive 50plus einzusetzen.
Das Jahrestreffen dient ebenfalls dazu, europäische Nachbarn über die Arbeit der Beschäftigungspakte zu informieren. So erhalten arbeitsmarktpolitische Akteure aus Österreich und der Schweiz Einblicke in die Arbeit der deutschen Kollegen, um eine Zusammenarbeit im Länderdreieck „Österreich – Schweiz – Deutschland“ zu intensivieren. Hierbei werden grenznahe Pakte wie 50plus Oberrhein und Unternehmenspatenschaft 50+ in Oberbayern und die ZAV eingebunden.
Über das Bundesprogramm des BMAS
„Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“ ist ein Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales seit 2005. Es soll die Beschäftigungsfähigkeiten und -chancen älterer Langzeitarbeitsloser verbessern. Das Bundesprogramm basiert auf einem regionalen Ansatz und wird von 62 regionalen Beschäftigungspakten unterstützt. Dieser Ansatz erlaubt es, gezielt auf die regionalen Besonderheiten einzugehen.
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)
Altersteilzeit
* Stand: Juni 2009
* Verfügbarkeit: verfügbar
* Art.-Nr.: A145
Deckblatt: Broschüre Altersteilzeit
Die Broschüre erklärt den Weg zum gleitenden Übergang in den Ruhestand, die Förderung der Agentur für Arbeit, die Bedingung für die Wiederbesetzung, die Umstellung der Altersrenten auch anhand von Beispielen. Die Teilrente, den Weg von der Altersteilzeitarbeit in die Teilrente und die Höhe der Teilrente. Außerdem ist das Altersteilzeitgesetz abgedruckt.
http://www.bmas.de/coremedia/generator/1804/property=pdf/a145__altersteilzeit__broschuere.pdf
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)
Geringfügige Beschäftigung und Beschäftigung in der Gleitzone
Die Broschüre informiert über die Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung und in der Gleitzone. Zur Illustration sind Beispiele über die Auswirkungen der Neuregelung hinzugefügt.
Im Internetangebot der Bundesagentur für Arbeit kann man gezielt nach geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijobs) suchen.
Geringfügige Beschäftigung und Beschäftigung in der Gleitzone – Download PDF, 817 KB
(http://www.bmas.de/coremedia/generator/3636/property=pdf/geringfuegige__beschaeftigung__433.pdf)
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)
Teilzeit – alles, was Recht ist
Die kostenlose Broschüre „Teilzeit“ des BMAS informiert über die rechtlichen Bedingungen, in Teilzeit zu arbeiten. Dabei werden auch die Themenbereiche „Arbeitsrecht“, „Arbeitsverhältnis“, „Betriebliche Mitbestimmung“, „Sozialversicherungsrecht“, „Geringfügige Beschäftigung“, „Teilrente“, „Altersteilzeit“ und „Elternzeit“ angesprochen. Umfangreich ist die Darstellung des sozialversicherungsrechtlichen Teils – also Unfall-, Kranken-, Pflege- Arbeitslosen- und Rentenversicherung.
Download der Broschüre:
http://www.bmas.de/coremedia/generator/1426/property=pdf/teilzeit__alles__was__recht__ist.pdf
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)
Leistungen an Arbeitgeber, die behinderte oder schwerbehinderte Menschen ausbilden oder beschäftigen.
Die Broschüre informiert vor allem über die Leistungen an Arbeitgeber durch die Bundesagentur für Arbeit, die Integrationsämter und anderer Rehabilitationsträger, wenn behinderte oder schwerbehinderte Menschen ausgebildet oder beschäftigt werden. Hierbei werden auch die Ländersonderprogramme vorgestellt. Daneben wird in der Broschüre auch die Initiative „job-Jobs ohne Barrieren“ vorgestellt und zu jedem Schwerpunkt der Initiative ein Projektbeispiel präsentiert.
Die Publikation ist derzeit vergriffen und wird schnellstmöglich wieder neu aufgelegt. Sie können aber weiterhin Bestellungen aufgeben. Sobald die Publikation wieder verfügbar ist, wird Sie Ihnen zugestellt. Bitte nutzen Sie in der Zwischenzeit den kostenlosen PDF-Download.
Download der Broschüre:
http://www.bmas.de/coremedia/generator/2746/property=pdf/leistungen__an__arbeitgeber__die__790.pdf
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)
Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II: Fragen und Antworten
Die Broschüre erläutert die wesentlichen Begriffe der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Außerdem werden im Kapitel „Fragen und Antworten“ die wichtigsten Fragestellungen aufgegriffen. Beispielrechnungen ermöglichen einen Überblick über die Leistungen nach dem SGB II. Der Text des Sozialgesetzbuches II ist abgedruckt.
Download der Broschüre:
http://www.bmas.de/coremedia/generator/1760/property=pdf/grundsicherung__fuer__arbeitsuchende__sgb__ii.pdf
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)
Kündigungsschutz
Die Broschüre informiert über den allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz, die ordentliche und außerordentliche Kündigung, die Kündigung von befristeten Arbeitsverträgen, zeigt auf, für wen das Kündigungsschutzgesetzgilt und wie es wirkt, erklärt anzeigepflichtige Entlassungen, die Kündigungsfristen und im Anhang ist das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) komplett wiedergegeben.
Download der Broschüre:
http://www.bmas.de/coremedia/generator/1774/property=pdf/kuendigungsschutz.pdf
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)
Zusätzliche Altersvorsorge
Die zusätzliche Altersvorsorge – ergänzend zur gesetzlichen Rentenversicherung – wird immer wichtiger und staatlich gefördert. Sie ist das größte Programm zum Aufbau von Alterseinkommen in der Geschichte der Bundesrepublik. Damit noch mehr Menschen die Vorteile der geförderten Zusatzrente nutzen, sind die Bestimmungen für die Riester-Rente weiter vereinfacht worden.
Wer über die gesetzliche Rente hinaus für das Alter vorsorgen will, hat die freie Wahl. Zusätzliche Alterssicherung ist über den Betrieb und privat möglich. Beide Wege fördert der Gesetzgeber in erheblichem Umfang.
* In dieser Broschüre werden beide Möglichkeiten zum Aufbau einer ergänzenden Rente ausführlich erläutert. Unter anderem stehen dabei folgende Fragen im Vordergrund:
* Wer wird gefördert?
* Was wird gefördert?
* Wie funktioniert die staatliche Förderung im Einzelnen?
* Für wen eignet sich die betriebliche, für wen die private Altersvorsorge besonders?
* Was genau hat sich geändert ab 2005?
* Wo kann man sich beraten lassen und weitere Informationen erhalten?
Die Broschüre ist ein praktischer Ratgeber auf dem Weg zu einem finanziell gesicherten Ruhestand.
Download der Broschüre:
http://www.bmas.de/coremedia/generator/21214/property=pdf/zusaetzliche__altersvorsorge.pdf
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)
Erwerbsminderungsrente
Fast 170.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen jedes Jahr aus gesundheitlichen Gründen ihren Job vor Erreichen des Rentenalters aufgeben. Verminderte Erwerbsfähigkeit, oft verbunden mit dem Verlust des Arbeitsplatzes, ist ein harter Einschnitt in die persönliche Lebensplanung. Doch in dieser schwierigen Situation stehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht ungeschützt da – durch ihre Beiträge zur Rentenversicherung haben sie auch einen umfassenden Schutz gegen den vorzeitigen Verlust ihrer Arbeitskraft erworben. Diese Broschüre informiert Sie über Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit.
Download der Broschüre:
http://www.bmas.de/coremedia/generator/3624/property=pdf/erwerbsminderungsrente__767.pdf
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)
Altersteilzeit
Die Broschüre erklärt den Weg zum gleitenden Übergang in den Ruhestand, die Förderung der Agentur für Arbeit, die Bedingung für die Wiederbesetzung, die Umstellung der Altersrenten auch anhand von Beispielen. Die Teilrente, den Weg von der Altersteilzeitarbeit in die Teilrente und die Höhe der Teilrente. Außerdem ist das Altersteilzeitgesetz abgedruckt.
Download der Broschüre: http://www.bmas.de/coremedia/generator/1804/property=pdf/altersteilzeit__broschuere.pdf
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)
Mitbestimmung – Eine gute Sache.
Das Buch gibt einen kurzen historischen Rückblick und informiert anschließend über das Betriebsverfassungsgesetz incl. der Reform von 2001. Detailliert wird außerdem der rechtliche Rahmen der Mitbestimmung dargelegt und die europäische Mitbestimmung erklärt.
Der Abdruck des Betriebsverfassungsgesetzes, des Sprecherausschussgesetzes, des Montan-Mitbestimmungsgesetzes, des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes, des Drittelbeteiligungsgesetzes, des Mitbestimmungsgesetzes, des Gesetzes über Europäische Betriebsräte, des Gesetzes über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft, des Gesetzes über die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer Europäischen Genossenschaft und des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung schließen das Buch ab.
Download der Broschüre:
http://www.bmas.de/coremedia/generator/1910/property=pdf/mitbestimmung__ein__gutes__unternehmen.pdf
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)
Arbeitsrecht
Die Broschüre ist unterteilt in fünf Kapitel.
Im ersten Kapitel wird die Arbeitsvermittlung, die Stellenausschreibung, die Beteiligung des Betriebsrates, usw. behandelt.
Im zweiten Kapitel steht der Abschluss des Arbeitsvertrages im Vordergrund, hier geht es um Formvorschriften, die Freiheit bei der Arbeitsvertragsgestaltung und die Probearbeit.
Im dritten Kapitel sind die Pflichten des Arbeitnehmers aufgelistet, die Arbeitspflicht, die zeitweilige Befreiung hiervon und die Nebenpflichten.
Im vierten Kapitel finden sich die Pflichten des Arbeitsgeber, z.B. die Entgeltzahlung, der Gleichbehandlungsgrundsatz und die Betriebsänderung.
Im letzten Kapitel geht es um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, also die Kündigung, der Kündigungsschutz, Rechte und Pflichten hieraus.
Download der Broschüre:
http://www.bmas.de/coremedia/generator/1424/property=pdf/arbeitsrecht.pdf
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
(nach oben)