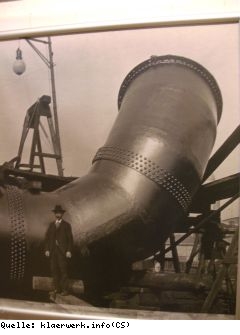Zukunftsweisende Ausbildung im Umweltschutz
Norddeutsche Berufsberater zu Gast beim azv Südholstein
„Ich werde Ihren Betrieb weiterempfehlen.“ Dieses Versprechen im Gästebuch freut die Mitarbeiter des azv Südholstein ganz besonders, stammt es doch von einem wichtigen Multiplikator für die Nachwuchswerbung: vom Berufsberater Uwe Schäfer. Der Teamleiter besuchte mit 23 seiner Kollegen am 11. November 2009 das Kommunalunternehmen, das in Hetlingen das größte Klärwerk Schleswig-Holsteins betreibt.
Vier Stunden lang informierten sich die Fachleute aus Arbeitsagenturen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern über die vier verschiedenen Ausbildungsberufe beim azv. Vor allem die anspruchsvolle Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik stand im Vorder-grund, denn sie war vielen Berufsberatern vor dem Besuch bei den Abwasserprofis kaum bekannt. Des Weiteren informierte der azv über die Ausbildungen zum Industriemechaniker, zum Elektroni-ker für Betriebstechnik und zur Fachkraft für Lagerlogistik.
Bild 1: Auszubildende und Ausbilder empfingen die Gäste im Azubi-Cafe

Im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung standen die Auszubildenden selbst. Im „Azubi-Café“ präsentierten sie den Berufsberatern an drei Info-Tischen ihren Beruf sowie die Ausbildung beim Kommunalunternehmen azv Südholstein. Sie berichteten aus ihrem Arbeitsalltag, stellten typische Werkzeuge vor und beantworteten Fragen der Experten. Später hatten die Besucher Gelegenheit, gemeinsam mit den Azubis und einigen Ausbildern bei einem Rundgang über das Klärwerk die verschiedenen Ausbildungsstätten wie die Metall- und Elektrowerkstatt oder das Zentrum für An-gewandte Klärtechnik direkt vor Ort zu besichtigen. „Wir haben sehr viel über die Ausbildung beim azv und die vielfältigen Aufgaben im Gewässerschutz erfahren“, so Schäfer, Teamleiter bei der Agentur für Arbeit in Elmshorn und Initiator des halbtägigen Treffens.
Beim azv Südholstein spielt die Nachwuchsförderung eine wichtige Rolle und geht weit über die bloße Vermittlung professioneller Fachkenntnisse hinaus. So engagieren sich etliche der Azubis beispielsweise freiwillig als „Energiedetektive“. Sie beschäftigen sich übergreifend mit Fragen des betrieblichen Umweltschutzes und fahnden beispielsweise nach Energiesparmöglichkeiten im Unternehmen. Ihre Ergebnisse veröffentlichen sie in eigenen Faltblättern oder stellen sie firmenintern oder bei größeren Veranstaltungen vor. Möglich seien solche geschäftsbereichsübergreifenden
Angebote nur, weil alle Beteiligten an einem Strang zögen, betont Ute Hagmaier, Referentin Umwelt und Bildung beim azv. „Wir wollen unsere Azubis fit für die Zukunft machen. Dazu gehört auch die Persönlichkeitsbildung und das Erlernen bestimmter Präsentationstechniken“, so Hagmaier. Wer neben einer fundierten Ausbildung auch in der Lage sei, über den Tellerrand des eigenen Berufsbildes zu blicken, werde keine Probleme haben, den wachsenden Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden.
Mädchen sind in technischen Berufen nach wie vor unterrepräsentiert. Speziell den weiblichen Nachwuchs will der azv daher mit dem jährlichen Girls‘ Day ansprechen. Zudem arbeitet das Umweltunternehmen eng mit den Schulen der Umgebung zusammen. „Letztlich versuchen wir so auch, dem absehbaren Fachkräftemangel in der Zukunft entgegenzuwirken und Jugendliche für Umweltberufe zu begeistern“, erklärt Hagmaier. Für seine nachhaltige umweltpädagogische Arbeit wurde der azv Südholstein im September von der deutschen UNESCO-Kommission ausgezeichnet.
Bild 2:Ute Hagmaier, Referentin Umwelt und Bildung beim azv Südholstein und Uwe Schäfer, Teamleiter Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit in Elmshorn, haben das Treffen gemeinsam organisiert
 Die 24 Berufsberater zeigten sich vor allem von der Atmosphäre bei dem Umweltunternehmen begeistert und lobten den offenen Umgang zwischen Auszubildenden, Ausbildern und Kollegen. Und der Besuch bot nicht nur den Berufsberatern viele wichtige Informationen für ihre tägliche Be-ratungsleistung. Auch für den azv hat sich der Austausch gelohnt: Ein Berufsberater engagierte Ute Hagmaier noch während seines Besuchs als Referentin für den Elternabend einer neunten Klasse. Auch die übrigen Einträge im Gästebuch des Kommunalunternehmens zeigen, dass die Veranstaltung einen guten Eindruck auf die Gäste gemacht hat: „Ein Betrieb, in dem sich Azubis und Eltern wohl fühlen müssen“, so das Fazit eines der Berufsberater.
Die 24 Berufsberater zeigten sich vor allem von der Atmosphäre bei dem Umweltunternehmen begeistert und lobten den offenen Umgang zwischen Auszubildenden, Ausbildern und Kollegen. Und der Besuch bot nicht nur den Berufsberatern viele wichtige Informationen für ihre tägliche Be-ratungsleistung. Auch für den azv hat sich der Austausch gelohnt: Ein Berufsberater engagierte Ute Hagmaier noch während seines Besuchs als Referentin für den Elternabend einer neunten Klasse. Auch die übrigen Einträge im Gästebuch des Kommunalunternehmens zeigen, dass die Veranstaltung einen guten Eindruck auf die Gäste gemacht hat: „Ein Betrieb, in dem sich Azubis und Eltern wohl fühlen müssen“, so das Fazit eines der Berufsberater.




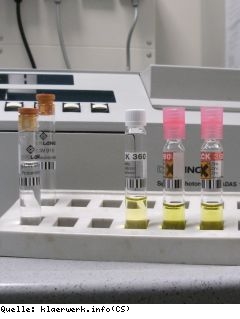


 Die 24 Berufsberater zeigten sich vor allem von der Atmosphäre bei dem Umweltunternehmen begeistert und lobten den offenen Umgang zwischen Auszubildenden, Ausbildern und Kollegen. Und der Besuch bot nicht nur den Berufsberatern viele wichtige Informationen für ihre tägliche Be-ratungsleistung. Auch für den azv hat sich der Austausch gelohnt: Ein Berufsberater engagierte Ute Hagmaier noch während seines Besuchs als Referentin für den Elternabend einer neunten Klasse. Auch die übrigen Einträge im Gästebuch des Kommunalunternehmens zeigen, dass die Veranstaltung einen guten Eindruck auf die Gäste gemacht hat: „Ein Betrieb, in dem sich Azubis und Eltern wohl fühlen müssen“, so das Fazit eines der Berufsberater.
Die 24 Berufsberater zeigten sich vor allem von der Atmosphäre bei dem Umweltunternehmen begeistert und lobten den offenen Umgang zwischen Auszubildenden, Ausbildern und Kollegen. Und der Besuch bot nicht nur den Berufsberatern viele wichtige Informationen für ihre tägliche Be-ratungsleistung. Auch für den azv hat sich der Austausch gelohnt: Ein Berufsberater engagierte Ute Hagmaier noch während seines Besuchs als Referentin für den Elternabend einer neunten Klasse. Auch die übrigen Einträge im Gästebuch des Kommunalunternehmens zeigen, dass die Veranstaltung einen guten Eindruck auf die Gäste gemacht hat: „Ein Betrieb, in dem sich Azubis und Eltern wohl fühlen müssen“, so das Fazit eines der Berufsberater.