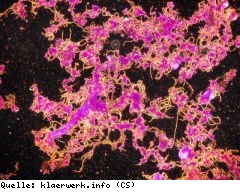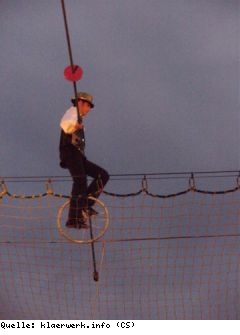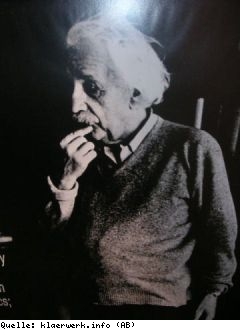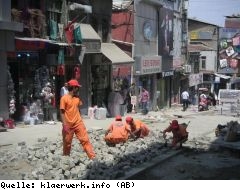Forsa-Umfrage der Deutschen Universität für Weiterbildung zeigt: Um im Beruf Erfolge zu erzielen, setzen die Deutschen auf fachliche und soziale Kompetenzen, Köpfchen und Weiterbildung.
Erfolg ist planbar: Die Mehrheit der Deutschen vertraut im Beruf auf die eigenen Kompetenzen und baut diese systematisch aus. Nur jeder dritte Deutsche verlässt sich für den beruflichen Erfolg auf Glück oder Zufall. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Universität für Weiterbildung (DUW). „Beruflicher Erfolg lässt sich systematisch vorbereiten. Weiterbildung spielt hierbei die Schlüsselrolle“, sagt DUW-Präsidentin Prof. Dr. Ada Pellert. Rund drei Viertel der Deutschen messen regelmäßiger Weiterbildung einen hohen Stellenwert für den Erfolg im Beruf bei.
Kompetenz-Mix und soziale Netzwerke
Laut forsa-Umfrage setzen 90 Prozent der Befragten auf ihre fachlichen Kompetenzen. Auch Intelligenz (83 Prozent) und soziale Kompetenzen (79 Prozent) sind für die Befragten wichtige Erfolgsfaktoren. „Durch Zeugnisse belegbare Qualifikationen sagen noch nichts darüber aus, ob jemand im Berufsalltag auch in ungewohnten, ergebnisoffenen Situationen Entscheidungen fällen kann und handlungsfähig ist. Dazu sind eine Vielzahl von Kompetenzen gefragt – fachliche, soziale, aber auch persönlichkeitsbezogene“, sagt Pellert. Auch sozialen Netzwerken messen 74 Prozent der Befragten einen hohen Stellenwert bei – ihre Bedeutung ist gegenüber der Vorjahres-Umfrage um 8 Prozentpunkte gestiegen. „In sozialen Netzen entwickelt man seine Persönlichkeit weiter und wird häufig zum Experten für ein bestimmtes Thema“, erklärt Pellert. „Die Personalentwicklung sollte Mitarbeitern dafür mehr Freiräume gewähren.“
Junge Generation setzt zunehmend auf fachliche Kompetenzen
Einen Zuwachs von 12 Prozent verzeichnet der Stellenwert von Fachwissen für die Befragten zwischen 25 und 34 Jahren: Gaben 2009 noch 82 Prozent an, fachliche Kompetenzen seien wichtig oder außerordentlich wichtig für den beruflichen Erfolg, waren es in diesem Jahr bereits 94 Prozent. Auch die sozialen Kompetenzen bewerten sie mit 84 Prozent überdurchschnittlich hoch. „Trotz Wirtschaftskrise und Personalabbau suchen Unternehmen händeringend nach Fachkräften“, erklärt Pellert. „Wer beruflich weiterkommen will, muss seine fachlichen und sozialen Kompetenzen regelmäßig aktualisieren. Das hat die junge Generation erkannt.“
Selbständige entdecken den Erfolgsfaktor Weiterbildung
Mit Weiterbildung lassen sich fachliche, soziale und persönlichkeitsbezogene Kompetenzen auf den aktuellen Stand bringen. Vor allem Selbstständige vertrauen vermehrt auf regelmäßige Bildungsmaßnahmen: 76 Prozent gaben an, in puncto Erfolg auf Weiterbildung zu setzen. Dies sind 16 Prozent mehr als in der Vorjahres-Umfrage. „Als Externe wird man für Projekte hinzugezogen, um neue Impulse zu geben. Aktuelle Kenntnisse und innovative Ideen sind unerlässlich. Um erfolgreich zu sein, müssen Selbstständige daher eine permanente Bereitschaft zur Weiterbildung mitbringen“, sagt Kerstin Hochmüller, Gesellschafterin der kopfstand GbR, Bielefeld und MBA-Studentin an der DUW.
Zufriedenheit statt mehr Gehalt
„Beruflicher Erfolg lässt sich nicht nur am Kontostand ablesen“, sagt Pellert, wissenschaftliche Leitung des berufsbegleitenden Masterstudiengangs General Management (MBA) an der Deutschen Universität für Weiterbildung. „Unsere MBA-Interessenten wollen nach einer internen Umfrage vor allem berufliche Aufgaben besser bewältigen und mit ihrer Arbeit zufrieden sein. Beförderung und Gehaltsverbesserung sind eher Nebensache.“ Studierende erwerben im MBA das nötige Rüstzeug, um Management- und Führungsaufgaben zu übernehmen. Sie lernen, sich sicher in Organisationen zu bewegen und entwickeln aus ihrer Berufspraxis heraus im engen Austausch mit Praktikern und Experten ihren eigenen Führungsstil.
Der berufsbegleitende Masterstudienganges General Management (MBA)
Der berufsbegleitende MBA in General Management an der DUW richtet sich an Personen ohne wirtschaftswissenschaftlichen Studienabschluss, die sich auf Aufgaben mit wirtschaftlicher und leitender Verantwortung vorbereiten möchten. Neben einem Hochschulabschluss und guten Englischkenntnissen müssen die Teilnehmer in der Regel eine zweijährige Berufserfahrung vorweisen. Interessierte können sich für den 24-monatigen Masterstudiengang „General Management“ (MBA) an der DUW ab sofort bewerben, der Studienstart ist jederzeit möglich. Weitere Informationen zu Studienprogramm und Anmeldeverfahren finden sich unter www.duw-berlin.de.
Die Deutsche Universität für Weiterbildung
Die Deutsche Universität für Weiterbildung (DUW) mit Sitz in Berlin bietet wissenschaftliche Weiterbildung für Berufstätige mit erstem Studienabschluss. Das Fernstudienangebot der staatlich anerkannten Weiterbildungsuniversität umfasst Masterstudiengänge in den Departments Wirtschaft und Management, Bildung, Gesundheit und Kommunikation sowie weiterbildende Zertifikatsprogramme. Das flexible Blended-Learning-Studiensystem und die individuelle Betreuung ermöglichen es DUW-Studierenden, das Studium mit Privatleben und Beruf zu vereinbaren. Gesellschafter der DUW sind die Freie Universität Berlin und die Stuttgarter Klett Gruppe. Als Public-Private-Partnership steht die DUW für wissenschaftliche Qualität, Arbeitsmarktnähe und Dienstleistungsorientierung.
Mehr zum Thema Erfolg sowie Interessantes rund um die DUW erfahren Sie im DUW-Erfolgsblog unter: http://blog.duw-berlin.de oder unter: http://www.duw-berlin.de
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:
Pressebüro der Deutschen Universität für Weiterbildung
Annika Noffke
Telefon: 030/2000 306 106
E-Mail: annika.noffke@duw-berlin.de
Webseite: http://www.duw-berlin.de/de/presse.html
Weitere Informationen:
http://www.duw-berlin.de
http://blog.duw-berlin.de
Izabela Ahmad, Pressestelle
Deutsche Universität für Weiterbildung