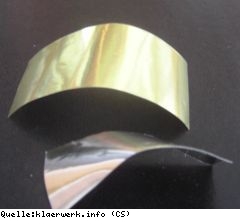Hemer: Kanäle „intelligent“ reinigen
Die Stadtentwässerung Hemer (SEH) nimmt am IKT-Forschungsprojekt „Bedarfsorientiertierte Kanalreinigung“ teil. Dabei nutzte Hemer die Gelegenheit seine Kanalreinigungsstrategie zu überprüfen und nach neuesten Erkenntnissen auszurichten. Eine Diplomarbeit im Forschungsprojekt unterstützte die Konzeptentwicklung vor Ort.
Bedarfsorientiert – mit eigenem Personal
Bedarfsorientierte Kanalreinigungsstrategien wurden in kommunal geführten Betrieben mit eigenem Fuhrpark bisher kaum umgesetzt. Die Aufwandsverminderungen im Bereich der flächendeckenden Unterhaltungsreinigung, die durch das Betriebswissen der Mitarbeiter ermöglicht werden sollen, gefährden zunächst auch Arbeitsplätze beim Betriebspersonal. Deswegen gibt es i.d.R. große Probleme mit der Mitarbeitermotivation und Ängsten um den Arbeitsplatz. Belastbare Überwachungsdaten zu dem Ablagerungsaufkommen sind unter diesen Voraussetzungen schwierig zu erhalten. Die Basis für einen erfolgreichen Strategiewechsel sind daher transparente Zielsetzungen und Konzepte mit langfristigen Perspektiven für den Betrieb. An dieser Stelle setzt die im Rahmen des IKT-Forschungsprojektes „Bedarfsorientierte Kanalreinigung“ erarbeitete Diplomarbeit an:
Diplomarbeitsthema:
Umsetzung einer bedarfsorientierten Kanalreinigungsstrategie: Fallbeispiel Kanalbetrieb Hemer
„In dieser Diplomarbeit wurde eine bedarfsorientierte Reinigungsstrategie konkret an einem Fallbeispiel entwickelt und die erste Phase der Umsetzung unterstützt. Sehr interessant war für mich dabei der intensive, praxisnahe Einblick in die Betriebsprozesse vor Ort. Hervorragend war auch die Unterstützung von Stadtentwässerung und Betriebshof in Hemer“
Dipl.-Ing. Sebastian Beck, Fertigstellung 09/2007,
Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik an der Ruhr-Universität Bochum.
Betriebserfahrungen sind der Schlüssel
Die Stadt Hemer, eine mittelgroße Stadt in Nordrhein-Westfalen, reinigte ihr Kanalnetz nach der Präventivstrategie alle zwei Jahre komplett, gebietsweise auch in kürzeren Intervallen. Aufmerksam geworden durch den Erfahrungsaustausch im Rahmen der Workshops zu dem Forschungsprojekt „Bedarfsorientierte Kanalreinigung“ entschloss sich die Stadtentwässerung Hemer (SEH), ihre Kanalreinigungsstrategie überprüfen zu lassen. Bisher reinigte Hemer sein Kanalnetz wie vielerorts üblich nach der Präventivstrategie – alle zwei Jahre komplett durch. Erklärtes Ziel der SEH ist es, Kanäle intelligent zu reinigen. Das heißt, Betriebserfahrungen über die verschiedenen Netzbereiche mit z.B. verstärkter Ablagerungsbildung in die Reinigungsplanung mit einzubeziehen. Selten verschmutzende Haltungen sollen weniger häufig als schnell verschmutzende Haltungen gereinigt werden.
Analyse des Betriebsprofils und Zusammenführung des Betriebswissens
In einem ersten Schritt wurden die betrieblichen Randbedingungen des Kanalbetriebs der Stadt Hemer aufgenommen und analysiert. Hierzu wurden Befragungen der Mitarbeiter, Begleitungen der Kanalreinigung sowie eine Auswertung von vorhandenem Datenmaterial durchgeführt. Im nächsten Schritt wurde die Ablagerungssituation in den Teilbereichen des Kanalnetzes in Hemer erhoben, die nach dem zweijährlichen Turnus zur Reinigung vorgesehen waren. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden Konzepte für die Umsetzung einer an die vorhandene Betriebsstruktur angepassten bedarfsorientierten Reinigungsstrategie erarbeitet und deren Umsetzung begleitet.
Stichprobenhafte Erhebung des Ablagerungsaufkommens
Im Ergebnis zeigten die Ablagerungsinspektionen, dass in den untersuchten Teilbereichen nach zwei Jahren ohne Kanalreinigung kaum hydraulisch relevante Störungen durch Ablagerungen feststellbar waren. Die vereinzelt angetroffene Bildung von ausgeprägten bleibenden Ablagerungen hatte in der Regel besondere Ursachen:
• bauliche Mängel: z.B. Unterbögen und ausgeprägte Muffenversätze, Wurzeleinwuchs (ist im Rahmen einer Unterhaltungsreinigung nicht zu beseitigen)
• hydraulische Störungen: z.B. durch Rückstauverhältnisse bei seitlichen Zuläufen und in Drosselbereichen an Regenüberläufen oder bei starken Gefällewechseln (Abstürze) sowie zu geringe Abflussverhältnisse
• unplanmäßiger Feststoffeintrag: z.B. Sand, Kies oder auch Beton aus Baumaßnahmen, Bohrkerne und insbesondere herabgestürzte Schmutzfänger
Ein funktionaler Zusammenhang von Gefälle, Nennweite und Rohrmaterial auf die Ablagerungssituation konnte nicht nachgewiesen werden.
Im Rahmen der Ablagerungsuntersuchungen kamen verschiedene Inspektionstechniken zum Einsatz, so z.B. die TV-Untersuchung, die Schachtkamera, der Kanalspiegel, die Inaugenscheinnahme von Schachtgerinnen und die Begehung einzelner Haltungen. Der Kanalbetrieb Hemer bewertet die Methode der Kanalspiegelung als pragmatische Methode, um unter günstigen Randbedingungen (Sonnenlicht) Ablagerungskontrollen für Kanalstrecken kostengünstig und mit geringem Zeitaufwand durchzuführen.
Konzeptentwicklung bedarfsorientierte Kanalreinigung
Zur Entwicklung eines an die Betriebsstruktur des Kanalbetriebs in Hemer angepassten Konzeptes wurden verschiedene Vorgehensweisen diskutiert. Kern der von dem Kanalbetrieb der Stadt Hemer bevorzugten Variante ist es, kontinuierlich Betriebswissen über Kanalablagerungen aufzubauen und Maßnahmen im Hinblick auf den Gewässerschutz verstärkt umzusetzen. Damit gewinnen Schachtinspektionen und Ablagerungskontrollen an Bedeutung. Das Kanalnetz soll zunächst in einem Intervall von zwei Jahren im Hinblick auf Ablagerungen überwacht werden, gebietsweise in kürzeren Intervallen. Die Ablagerungsinspektionen dienen dabei als Synergieeffekt mit den Schachtinspektionen, die durch das DWA-Arbeitsblatt 147 Teil 1 gefordert werden.
Gewässerschutz im BlickGewässerschutz im Blick
Die Kanalreinigung soll im Wesentlichen nur noch nach Feststellung von Ablagerungshöhen von mehr als 15 % der Profilhöhe erfolgen. Die Anforderungen der SüwV Kan NRW werden somit erfüllt. Um die Inspektionsergebnisse zu erfassen, ist eine Datenbank eingerichtet worden. Die Datenbank ermöglicht auch die notwendigen Berichte an die Aufsichtsbehörden. Über Jahre soll dadurch kontinuierlich Betriebswissen über Kanalablagerungen aufgebaut werden und unterhaltungsintensive Objekte erkannt werden. Darüber hinaus soll die Reinigung von Drosselkanälen an Regenüberläufen verstärkt werden, um Inbetriebnahmen der Entlastungsbauwerke und daraus resultierende Feststoffeinträge in Gewässer nach Möglichkeit zu minimieren. Mögliche frei werdende Kapazitäten sollen insbesondere für die häufigere Reinigung der Straßeneinläufe sowie für die Wartung der Bachverrohrungen genutzt werden. Dadurch sollen insbesondere eine Verminderung des Eintrags von Schwermetallen infolge von Straßenabtrieb und eine Begrenzung von Überflutungshäufigkeiten erreicht werden.
Piloteinsatz bestätigt den eingeschlagenen Weg
In einem ersten Piloteinsatz wurde der Stadtteil Deilinghofen „bedarfsorientiert gereinigt“. Alle Haltungen und Schachtbauwerke im genannten Stadtteil wurden lückenlos inspiziert. Die Ergebnisse aus den vorangegangenen Untersuchungen wurden dabei bestätigt. Tendenziell wurde geringes Ablagerungsaufkommen festgestellt. Die Abschnitte, die zunächst Ablagerungshöhen > 15 % der Profilhöhe aufwiesen, wurden in einer Wiederholungsinspektion nach Starkregenereignissen ablagerungsfrei vorgefunden. Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit der bevorzugten Variante der Kanalreinigungsstrategie gegenüber der herkömmlichen Präventivstrategie muss noch erfolgen. Auf Basis der neu entwickelten Strategie wird die Entwicklung der Ablagerungssituation im Kanalnetz der Stadt Hemer jedoch verstärkt überwacht, so dass insbesondere veränderte Abflussverhältnisse infolge geänderter Gebietsstrukturen und Verbraucherverhalten zukünftig gezielter berücksichtigt werden können.
Das Betriebswissen der Mitarbeiter ist der Schlüssel zum Erfolg. Dies wurde auch von den politischen Gremien und der Tagespresse in Hemer aufmerksam aufgenommen:
Vorbildliche Entwässerung in Felsenmeerstadt Hemer
von Paul Kramme
Hemer. „Wir haben eine spannende Unterwelt in Hemer!“. Das war im Betriebsausschuss eine Erkenntnis des Vorsitzenden Bernd Camminadi (SPD).
Wirklich aufschlussreich und informativ war der Bericht des Ingenieurs Sebastian Beck, der dem Gremium seine Diplomarbeit vorstellte: „Entwicklung einer bedarfsgerechten Reinigungsstrategie für eine mittelgroße Stadt in NRW am Beispiel des Kanalnetzes der Stadt Hemer“. Auf der Suche nach dem Thema war Beck an der Ruhr-Universität Bochum auf Hemer aufmerksam geworden. Das Wappen der Felsenmeerstadt lockte, weil er vor acht Jahren hier als Bundeswehrsoldat in der Blücherkaserne stationiert war. Der junge Ingenieur aus Herne arbeitet heute für das renommierte Gelsenkirchener „IKT – Institut für unterirdische Infrastruktur“, das bei Forschungen zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Kanäle nur gereinigt werden sollen, wenn das notwendig sei – was man ja wirklich prüfen kann. Und das ist neu!
Da wird das Thema heiß, weil reduzierter Aufwand Personalentlassung zur Folge haben müsste. Dieses heiße Eisen werde in Hemer offen angegangen, weiß man beim IKT, das den Firmen Stadtbetrieb-Bauhof und Stadtentwässerung Hemer eine „bevorzugte Lage“ bescheinigt, weil man das Hemeraner Kanalnetz selber wartet – was von zwei Drittel der NRW Kommunen als Auftrag vergeben werden muss. Die Stadtentwässerung Hemer erhebt und bewertet den Zustand des Kanalnetzes selber: Ein riesiger Erfahrungsschatz, so lobte Sebastian Beck, und ein riesiger Vorteil gegenüber Gemeinden, die ihre Kanalreinigung ausschreiben müssen. „Erst gefilmt und dann gespült“ ist heutzutage die Devise bei den Kanalpflegern im Rathaus im Gegensatz zum früheren „erst Spülen, dann Filmen“. Innerhalb von 15 Jahren wird das gesamte Kanalnetz gefilmt. Inspiziert wird mit der Schachtkamera und auch erfolgreich mit Kanalspiegeln, die mit reflektiertem Sonnenlicht von oben eine Sichtweite von 20 – 50 Meter in der Unterwelt ermöglichen. Beck empfiehlt für die Untersuchung auch die Anschaffung von starken Taschenlampen, um unabhängig von der Sonne arbeiten zu können.
Fett in der Kanalisation ist ein Riesenproblem
Weniger als fünf Prozent des Hemeraner Kanalnetzes ist begehbar: an der Poststraße und Ostenschlahstraße z.B. und der gesamte Hauptsammler von der Amtskreuzung bis zur Kläranlage. Der gewaltigste Kanaldurchmesser (drei Meter) ist an der Siemensstraße in Westig. „Im Kanal sind die tollsten Geschichten zu finden“, weiß Sebastian Beck. Wurzeleinwuchs gehört dazu, nicht zu vergessen wilde Entsorgung: Beton oder Zement, und Fett im Kanal sei „ein Riesenproblem“. Inspektion gewinnt an Bedeutung, gereinigt wird nach Bedarf, resümiert Beck: „Das Personal entscheidet vor Ort, ob Reinigungsbedarf vorliegt oder nicht. Das Betriebswissen verbleibt in Hemer und nicht beim Dienstleister.“
Ingo Nix (CDU) erkundigte sich nach dem Vortrag: „Hemer hat ein gutes Kanalnetz?“ „Im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe, ja“, bezog Beck sein überregionales Wissen für die Antwort ein. Klaus Hoffmann (FDP): „Führen die Erkenntnisse zu Kostensenkung?“ Willi Große: „Na klar, selbstverständlich wird weniger gereinigt!“. Wie der Spülwagen alternativ eingesetzt werde, fragte Michael Heilmann (UWG).
Dipl.-Ing. Marco Schlüter
Dipl.-Ing. Sebastian Beck
IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH
Exterbruch 1
45886 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 17806-31
Fax: 0209 17806-88
E-Mail: info@ikt.de
Internet: www.ikt.de