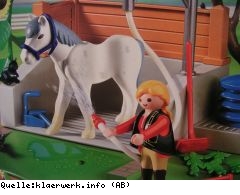Dr.-Ing. G. Seibert-Erling, Kerpen
1 Einleitung
Abwassertechnische Kennzahlen spielen bei der Bemessung und beim Betrieb von Kläranlagen eine wichtige Rolle. Die traditionell bekannten Kennzahlen resultieren aus theoretischen Berechnungen, aus experimentellen Untersuchungen, aus statistischen Auswertungen von Betriebsdaten und aus empirischem Wissen. In den letzten 10 Jahren haben sich eine Reihe neuer Kennzahlen etabliert, resultierend aus unterschiedlichen Projekten zur Optimierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten sowie aus behördlichen Forderun-gen für die Überwachung; auch der verstärkte Einsatz der Simulation hat einige neue Kenngrößen hervorgebracht.
Die Anwendung dieser Kennzahlen im praktischen Kläranlagenbetrieb bereitet oft Probleme, entweder weil die Rechenvorschrift oder die Datenbasis nicht eindeutig definiert ist, oder weil nicht alle Einflussgrößen zur Beschreibung eines technischen Zusammenhanges erfasst sind. Beispielsweise hat sich die Flächenbeschickung zur Beschreibung der Belastbarkeit eines Nachklärbeckens nur bedingt als geeignet erwiesen, da es trotzt Einhaltung des vorgegebenen Bemessungswertes zum Schlammabtrieb kommen kann, insbesondere als Folge hydraulischer Belastungsstöße.
Ein weiterer typischer Mangel bei der Anwendung von Kennzahlen ergibt sich bei auf die Einwohnerbelastung bezogenen Kenngrößen. Hier wird oft nicht angegeben, ob die Ausbaugröße oder die tatsächliche Belastung gemeint ist. Entsprechend abgeleitete spezifische Energieverbräuche oder Kosten können dann sehr stark abweichen.
Zu kritisieren ist auch der zuweilen lässige Umgang bei der Verdichtung und statistischen Auswertung von Betriebsdaten. Ein sehr häufig vorkommender Fehler ist die unzulässige Mittelwertbildung für Datenreihen, bei denen singuläre Werte für die Bewertung ausschlaggebend sind. Wenn beispielsweise der monatliche 15-Minuten-Höchstlastwert des Stromverbrauchs die Abrechnung bestimmt, dann ist ein Mittelwert aus den gemessenen Daten wenig hilfreich. Ebenfalls ergibt es keinen Sinn, den Mittelwert der Sauerstoffgehalte mehrerer Belebungsbecken zu bilden. Was nützt ein Mittelwert von 2 mg/l, wenn das eine Becken mit 4 mg/l unwirtschaftlich überbelüftet wird und in dem anderen Becken anaerobe Zustände vorherrschen. Es soll nicht wenige Kläranlagen geben, die sogar nach dem Mittelwert der Sauerstoffgehalte in unterschiedlichen Becken geregelt werden. Es ist kaum vorstellbar, dass dies zu akzeptablen Betriebsergebnissen führt. Ein scheinbar korrekter Mittelwert ergibt sich auch, wenn der Sauerstoffgehalt morgens zu hoch und nachmittags zu niedrig ist. Im übertragenen Sinne würde niemand akzeptieren, dass die Radmuttern seines Autos lediglich im Mittel mit dem vorgegebenen Drehmoment angezogen sind; hier ist es lebenswichtig, dass der Wert für jede einzelne Schraube stimmt.
2 Kennzahlen und Kennzahlensysteme
2.1 Herkunft und Verwendung von Kennzahlen
Jede technische oder wirtschaftlich orientierte Fachdisziplinen verwendet Kennzahlen oder verfügt sogar über mehr oder weniger ausgefeilte Kennzahlensysteme (Bild 1). Nach einer allgemeinen Definition dienen diese dazu, quantitativ erfassbare Sachverhalte in komprimierter Form wiedergeben zu können. Man unterscheidet im allgemeinen – absolute Kennzahlen (Summe, Differenzen), – relative Kennzahlen (Bezugsgrößen), – aggregierte (verdichtete) Informationen. Daneben werden Kennzahlen auch dazu verwendet, sich schnell einen Überblick zu ver-schaffen und dazu bewusst auf eine detaillierte Zustandserfassung zu verzichten und nur einen kleinen Ausschnitt des insgesamt Erfassbaren wiederzugeben.
Bild 1: Gliederung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen

| • absolute Kennzahlen |
• Operationalisierungs-
funktion |
• Verdichtungsgrad |
• mathematisch verknüpft |
| • relative Kennzahlen |
• Anregungsfunktion |
• Bezugsrahmen |
• systematisch verknüpft |
• aggregierte
Informationen |
• Vorgabefunktion |
• Zweck |
• empirisch begründet |
| |
• Steuerungsfunktionen |
• Bildungsrichtung |
|
| |
• Kontrollfunktionen |
|
|
Kennzahlen unterscheidet man nach unterschiedlichen Kriterien, nach ihrer Funktion in:
| • |
Operationalisierungsfunktion
Bildung von Kennzahlen zur Operationalisierung von Zielen und deren Erreichung (Leistungen), z.B. Energieverbrauch, Abwassergebühren |
| • |
Anregungsfunktion
Laufende Erfassung von Kennzahlen zur Erkennung von Auffälligkeiten und Veränderungen, z.B. Schlammeigenschaften, Abwasserzusammensetzung |
| • |
Vorgabefunktion
Ermittlungen kritischer Kennzahlenwerte als Zielgrößen für Teilbereiche, z.B. Verschleißgrenzen für Aggregate |
| • |
Steuerungsfunktionen
Verwendung von Kennzahlen zur Vereinfachung der Prozessführung, z.B. der β-Wert für die Phosphat-Fällung |
| • |
Kontrollfunktion
Laufende Erfassung von Kennzahlen zur Erkennung von Soll-Ist-Abweichungen, z.B. Prozesswerte O2, TS und spezifische Energieverbräuche einzelner Aggregate |
Hinsichtlich der Art von Kennzahlen unterscheidet man:
| • |
nach dem Verdichtungsgrad
Relative Kennzahlen ←→ absolute Kennzahlen (Kenngrößen) oder zeitliche Verdichtung von Datenreihen (2-Stunden – Tages – Monats – Jahreswerte)
|
| • |
nach dem Bezugsrahmen
Lokale Kennzahlen ←→ globale Kennzahlen |
| • |
nach dem Zweck
Kennzahlen als vereinfachte Abbildungen der Realität als Mittel zur Erkenntnisgewinnung, deskriptive Kennzahlen ←→ normative Kennzahlen |
| • |
nach der Bildungsrichtung
Kennzahlen als Verdichtung komplexer Zusammenhänge (bottom-up) gegen Kennzahlen als logisch abgeleitete Abbildung der komplexen Realität (top-down) |
2.2 Fehler bei der Anwendung von Kennzahlen
Kennzahlen sind oft wichtige Planungs- und Entscheidungsgrundlagen. Es darf aber nicht übersehen werden, das sie mit einer Reihe von Problemen behaftet sein können, die ihre Anwendung einschränken oder sogar verbieten. Dem großen Vorteil von Kennzahlen, große und schwierig zu überschauende Datenmengen zu wenigen aussagekräftigen Größen verdichten zu können, steht die Schwierigkeit gegenüber, die gesamten zur Verfügung stehenden Informationen so zu strukturieren, dass gerade die relevante Erkenntnis ohne Nebenwirkungen und Seiteneffekte abgefiltert wird. Folgende Fehler können üblicherweise auftreten:
| • |
Erzeugung einer Kennzahleninflation
Es werden zu viele Kennzahlen gebildet, deren Aussagekraft im Verhältnis zum Aufwand für ihre Ermittlungen letztlich zu gering ist und schon von anderen Kennzahlen abgedeckt wird. |
| • |
Fehler bei der Kennzahlendefinition
Die zur Bildung der Kennzahlen herangezogenen Daten sind sehr genau zu spezifizieren und exakt abzugrenzen. Insbesondere bei Kennzahlen, die nicht allein statische oder stationäre Zusammenhänge oder Größen enthalten, ist die Zeitabhängigkeit eindeutig zu beschreiben. Darüber hinaus ist in vielen Fällen ausschlaggebend, ob zur Ermittlung von Messgrößen direkte oder indirekte Messverfahren oder sogar Berechnungsgrößen verwendet werden. |
| • |
Mangelnde Konsistenz von Kennzahlen
Die Verwendung mehrerer Kennzahlen in einem Kennzahlensystem darf nicht zu einem Widerspruch führen. Es dürfen nur solche Größen zueinander in Beziehung gesetzt werden, zwischen denen ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Fehlende Konsistenz kann ansonsten zu gravierenden Fehlentscheidungen führen. |
Aus den vorhergehend angesprochenen Grenzen der Anwendbarkeit von Einzelkennzahlen ergibt sich die Notwendigkeit einer integralen Festlegung von Kennzahlen als sog. Kennzahlensystem. Ziel ist dabei, Mehrdeutigkeiten in der Interpretation zu vermeiden und die Abhängigkeiten zwischen einzelnen Systemelementen besser zu beschreiben.
2.3 Kennzahlensysteme
Als Kennzahlensystem bezeichnet man die systematische Zusammenstellung von Einzelkennzahlen, die in einer ursächlichen Beziehung zueinander stehen, sich ergänzen und insgesamt auf ein übergeordnetes Ziel ausgerichtet sind. Dabei unterscheidet man im wesentlichen 3 generelle Systemformen:
| • |
Mathematisch verknüpftes Kennzahlensystem
Ein solches Kennzahlensystem liegt vor, wenn die Einzelkennzahlen durch mathematische Operationen miteinander verknüpft sind. Der Vorteil solcher Systeme ist die unbestreitbare Exaktheit und Genauigkeit. Nachteilig ist, dass die Übersichtlichkeit und Aussagefähigkeit dadurch stark eingeschränkt wird, dass sehr viele Hilfswerte als „mathematische Brücken“ in Kauf genommen werden. Gerade für mit Messfehlern behaftete Betriebsdaten ergeben sich dadurch nur mit großem Aufwand behebbare Schwierigkeiten. Ein typisches Bespiel ist die Simulation; darauf wird weiter unten noch näher eingegangen. |
| • |
Systematisch verknüpftes Kennzahlensystem
Hier wird von einem Oberziel ausgehend ein System von Kennzahlen gebildet, das nur die wesentlichen Entscheidungen mit einbezieht. Somit lassen sich nach Ermittlung der einzelnen Kennzahlen die Auswirkungen auf das Oberziel unmittelbar erkennen. Ein Beispiel dafür ist die energetische Optimierung von Kläranlagen. |
| • |
Empirisch begründetes Kennzahlensystem
Noch zielgerichteter als beim systematisch verknüpften Kennzahlensystem wird beim empirisch begründeten Kennzahlensystem vorgegangen. Es beschränkt sich genau auf die Funktionen, die das Erfolgsziel auch tatsächlich beeinflussen. Ein solches System zeichnet sich dadurch aus, dass man bei komplexen Entscheidungen durch einen zweifachen Reduktionsprozess von der Realität zur modellmäßigen Abbildung durch aggregierte Kennzahlen gelangt und sich dann bei der Kennzahlenbildung auf die Erfolgs- oder entscheidungsrelevanten Bestandteile konzentriert. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Ermittlung der Abwasserabgabe. Hier wird aus der täglichen Zulaufwassermenge die Jahresschmutzwassermenge ermittelt und dann durch die Bewertung der Schädlichkeit einzelner Parameter und unter Berücksichtigung der Einhaltung der Überwachungswerte eine einzige Zahl ermittelt, die aus der Sicht des Gesetzgebers die Leistungsfähigkeit der Kläranlage wiederspiegelt. |
3 Abwassertechnische Kennzahlen und ihre Einsatzfelder
Kennzahlen und Kennzahlensysteme sind in der Abwassertechnik für eine Vielzahl von Bereichen und Aufgaben bekannt. Einige davon werden nachfolgend beschrieben und in Bezug auf die vorherigen Definitionen erläutert.
Bild 2: Kennzahlen in der Abwassertechnik

| • |
die Bemessung von Kläranlagen
Grundlage für die Bemessung ist das Arbeitsblatt ATV A131. Im Grunde handelt es sich dabei um ein empirisch begründetes Kennzahlensystem, welches jedoch seit der letzten Überarbeitung allmählich zu einem mathematisch verknüpften System mutiert. Dies gilt insbesondere für die Bemessung der Belebung, die im Gegensatz zu früher heute schon teilweise auf Bilanzgleichungen für die wichtigsten Stoffgruppen basiert. |
| • |
die Simulation
Im Bereich der Simulationstechnik hat sich das IAWQ-Modell als Standard durchgesetzt. Hier handelt es sich eindeutig um einen streng mathematische orientiertes Kennzahlensystem. Die Schwierigkeiten, ein solches Modell an die praktischen Gegebenheiten des Kläranlagenbetriebes mit allen Unwägbarkeiten bezüglich der Abwasserzusammensetzung und der auftretenden Messfehler anzupassen, sind in entsprechenden Erfahrungsberichten oft genug beschrieben worden. |
| • |
die energetische Optimierung
Bei der energetische Optimierung nach dem Handbuch „Energie in Kläranlagen“ des Landes Nordrhein-Westfalen [1] handelt es sich um einen systematisch verknüpftes Kennzahlensystem. Die dort beschriebene Methode der „Feinanalyse“ befasst sich mit der energetischen Gesamteffizienz der Kläranlagen. Sie bezieht verfahrenstechnische und betriebliche Daten in die Auswertung ein, filtert die energetisch relevanten Informationen aus und liefert dann sehr schnell die gewünschte Information. Ziel der Feinanalyse ist, die energetische Effizienz der Kläranlage zu steigern und die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Maßnahmen nachzuweisen. |
| • |
das Benchmarking
Beim Benchmarking wird angestrebt, die Wirtschaftlichkeit der Anlagen durch systematische Vergleiche zu prüfen und zu verbessern. Dazu müssen einzelne vergleichbare Bereiche identifiziert, die Bestmarken ermittelt und die Ursachen für die Unterschreitung gefunden werden, um dann die Betriebs- und Prozessführung an das Vorbild der jeweils Besten anzupassen. |
Den genannten Bereichen ist zu eigen, das sie zwar auf betrieblichen Daten aufsetzen, die statistisch ausgewertet und von Ausreißern bereinigt wurden; letztlich bleiben es aber Planungsinstrumente, mit denen das Betriebspersonal oft nur während der Datenerhebung intensiver in Kontakt kommt.
4 Anwendung von Kennzahlen im praktischen Betrieb
Wirklich interessant wird es, wenn Kennzahlen im praktischen Kläranlagenbetrieb angewendet werden, beispielsweise um die Bemessungswerte zu überprüfen oder um Leistungskennwerte zu ermitteln. Das Dilemma beginnt häufig schon bei der Datenerfassung, weil die in den letzten Jahren stattgefundene inflationäre Entwicklung der Kennzahlen einen exponentiellen Anstieg der zu speichernden Datenmenge nach sich gezogen hat. Im Zeitalter billigen Speicherplatzes ist das eine leicht zu erfüllende Forderung. In den wenigsten Fällen sind die Daten jedoch auf Konsistenz und auf Plausibilität geprüft. Nach einer groben Einschätzung aufgrund von Erfahrungswerten dürfte nur der kleinste Teil der Daten uneingeschränkt weiterverwendbar sein. Ein größerer Teil ist meist noch mit vertretbarem Aufwand rekonstruierbar. Mehr als die Hälfte ist der Daten landet in der Regel auf dem Datenfriedhof, weil die Werte fehlerhaft sind oder überhaupt nicht benötigt werden (Bild 3).
Bild 3: Erfahrungswerte zur Qualität gespeicherter Daten

Die konventionellen Kennzahlen sind für den Betrieb von Kläranlagen nur bedingt geeignet. Insofern bietet auch die darauf basierende Protokollierung nach ATV M260 keine weitere Unterstützung. In Ermangelung eines speziellen betrieblichen Kennzahlensystem haben deshalb viele Betriebsleiter eigene Excel-Tabellen entwickelt, in denen die ihrer Erfahrung nach wichtigsten Größen ermittelt werden. Diese Kenngrößen sind teilweise anlagenbezogen und deshalb nicht ohne weiteres mit anderen Kläranlagen vergleichbar. Sie sind aber zuweilen hilfreicher zur Bewertung des Betriebsverhaltens als die aus der Bemessung bekannten Werte. Vielfach interessiert gar nicht der absolute Vergleich mit anderen Anlagen, sondern die relative Änderung eines Zustandes über der Zeit für die spezielle Anlage. Das hat etwas mit den aus der Messtechnik bekannten Begriffen Genauigkeit und der Reproduzierbarkeit zu tun: Für die Ermittlung der Abwasserabgabe ist bei der Durchflussmessung die absolute Genauigkeit keine Frage. Dagegen kommt es bei der täglichen Bestimmung des Schlammvolumens auf die Reproduzierbarkeit an, weil gerade bei dieser Art von Messungen der sog. „Nasenfaktor“ einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Messergebnis hat.
Im folgenden wird an zwei Beispielen auf die Anwendung von Kenngrößen in der betrieblichen Praxis eingegangen.
4.1 Kenngrößen des Systems Belebung – Nachklärung
Das System Belebung – Nachklärung ist bezüglich des Parameters Schlamm bzw. Feststoffe als Einheit zu behandeln. Obwohl darauf schon seit mehr als 30 Jahren hingewiesen wird [2], basieren die meisten bekannten Kennzahlen immer noch auf einer nach Bauwerken getrennten Betrachtung. Nach dem Arbeitsblatt ATV A131 sind die wichtigsten Kenngrößen:
| • |
der Trockensubstanzgehalt in der Belebung TSBB und im Rücklaufschlamm TSRS, |
| • |
das Rücklaufverhältnis RV = QRS/Q, |
| • |
die Flächenbeschickung qA, |
| • |
die Schlammvolumenbeschickung qSV, |
| • |
das Vergleichsschlammvolumen VSV, |
| • |
der Schlammindex ISV. |
Die Flächenbeschickung ist ursprünglich der Quotient aus dem Durchfluss im Zulauf des Beckens und der durchströmten Fläche und wurde vor ca. 40 Jahren zur Beurteilung vertikal durchströmter Becken eingeführt. Dort entspricht sie der resultierenden Strömungsgeschwindigkeit in der vertikalen Hauptströmungsrichtung. Später wurde diese Kenngröße aber auch für Rund- und Längsbecken verwendet, obwohl die maßgebliche Strömungsgeschwindigkeit sich nicht mehr allein aus der Oberfläche, sondern aufgrund der horizontalen Strömung auch aus der Beckentiefe ergibt; zudem ist die Wirkungsrichtung der Schwerkraft bei diesen Becken nicht mit der Hauptströmungsrichtung identisch. Als Folge daraus ergeben sich zur Bewertung des eigentlich interessierenden Absetzverhaltens je nach Beckentyp unterschiedliche Vergleichszahlen. Die Flächenbeschickung soll heute bei horizontal durchströmten Becken 1,6 m/h, bei vertikal durchströmten Becken 2,0 m/h nicht übersteigen. Die Schlammvolumenbeschickung soll je nach Beckentyp einen Wert von 500 – 650 l/(m2 h) unterschreiten.
Nachdem in den letzten 10-20 Jahren zahlreiche bautechnische Optimierungen an Nachklärbecken vorgenommen wurden und trotzdem in den letzten Jahren trotzdem häufiger Probleme mit Schlammabtrieb aufgetreten sind, darf sicherlich auch noch einmal die Frage erlaubt sein, ob denn die bekannten Kenngrößen die richtigen sind. Zumindest deuten die Ergebnisse der von Botsch durchgeführten Untersuchungen mittels Strömungssimulation [3] darauf hin, dass zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit bei instationärer Belastung die konventionellen Kenngrößen nicht ausreichen. Dies ist nicht weiter verwunderlich, weil die bekannten Kenngrößen überwiegend aus statistischen Auswertungen von Messergebnissen im stationären Zustand abgeleitet sind. Er hat deshalb neue Kenngrößen wie Schlammfüllungsgrad, Ausnutzungsgrad und Trockensubstanz-Füllungszeit eingeführt.
Weiterhin ist zwischenzeitlich belegt, dass eine zeitabhängige Veränderung der Schlammeigenschaften auftritt, deren Ursachen allerdings noch nicht genauer bekannt sind. Beispiels-weise wurde von Marx experimentell nachgewiesen, dass der Schlammindex die Absetzeigenschaften nur sehr unzureichend beschreibt [4]. Durch Aufzeichnung des zeitlichen Verlaufs der Absetzkurve stellte er fest, dass Schlammproben nach den vorgeschriebenen 30 Minuten Absetzzeit zwar das gleiche Schlammvolumen hatten, dass aber die Absetzgeschwindigkeit in den ersten Minuten deutlich variieren kann. Aus diesem Grund wird schon heute auf vielen Kläranlagen neben dem 30-Minuten-Schlammindex auch der 7-Minuten-Schlammindex bestimmt, der mit der Belastung der Nachklärung in den meisten Fällen wesentlich besser korreliert. Besonders interessant dürfte in diesem Zusammenhang die Neuentwicklung von Online-Messgeräten für den Schlammindex sein, die zudem den zeitlichen Verlauf der Absetzkurve automatisch erfassen können. Weitere Erkenntnisse sind auch vom Vergleich dieser Messungen mit Schlammkonzentrationsprofilen in den Nachklärbecken zu erwarten.
Eine wichtige Kenngröße des Systems Belebung – Nachklärung ist die Gesamtschlammmenge, also die gesamte im System befindliche Feststoffmasse. Sie bestimmt nach großtechnischen Untersuchungen das dynamische Verhalten des Schlammkreislaufes und die Belastungsgrenze der Nachklärung. Ihre Einführung in das Regelwerk ist mehrfach gescheitert, nicht zuletzt wegen der bauwerksbezogenen Betrachtung.
4.2 Kenngrößen für die Belüftung
Der Sauerstoffverbrauch setzt sich nach ATV A131 zusammen aus dem Verbrauch für die Kohlenstoffelimination OVd,C und gegebenenfalls dem Bedarf für Nitrifikation OVd,N sowie der Einsparung an Sauerstoff aus der Denitrifikation OVd,D. Mit den Stoßfaktoren fC und fN erhält man daraus den Sauerstoffverbrauch für die Tagesspitze OVh. Der Sauerstoffbedarf unter Betriebsbedingungen ergibt sich durch Multiplikation mit dem Sauerstoffzufuhrfaktor α unter Berücksichtigung der Differenz aus Betriebskonzentration und Sättigungskonzentration. Mit dem prozentualen Anteil des Sauerstoffs in der Luft und der Einblastiefe ergibt sich dann die entsprechende Luftmenge im Normzustand. Die Verdichtergröße und die erforderliche Ansaugluftmenge erhält man schließlich aus der Auslegungsgleichung für den jeweiligen Verdichtertyp. Wichtigste Einflussgröße ist die Druckdifferenz im System, die sich aus dem Druckverlust der Armaturen, Rohrleitungen und Belüfterelemente zusammensetzt; daneben gehen der Absolutdruck, die Temperatur und die Feuchte in die Berechnung ein.
Ein Vergleich von Auslegungs- und Betriebswerten ist nicht ohne weiteres möglich. Zum einen wird bei der Bemessung ein konstanter Sauerstoffgehalt unterstellt, der im praktischen Betrieb durch eine Regelung eingehalten werden muss. Die entscheidende Größe für die Beurteilung ist allerdings nicht der Sauerstoffgehalt, sondern die Luftmenge, die als Stellgröße im Regelkreis auftritt. Da gemeinhin die Erfassung der Luftmenge eigentlich bis heute als weniger wichtig eingestuft wird und zuverlässige Messgeräte nicht billig sind, wird meist darauf verzichtet.
Wie wertvoll die Erfassung nicht nur der Luftmenge, sondern auch energetischer Größen, wie die elektrische Leistung der Verdichter, zur Beurteilung des Belüftungssystems sein kann, soll im folgenden anhand der Messergebnisse einer großtechnischen Anlage dargestellt werden.
Bild 4: Regelungsergebnisse und Kenngrößen der Belüftung KA Oftringen (Schweiz)


Eine höchst sensible Kennzahl für die Lufterzeugung und -verteilung ist die auf die elektrische Wirkleistung der Verdichter bezogene Luftmenge. Dieser einfach und online zu ermittelnde Wert ist zwar für jede Kläranlage aufgrund der Belastung, der Bauausführung und der anlagentechnischen Ausrüstung unterschiedlich, er zeigt aber für die einzelne Anlage jede Unregelmäßigkeit im Belüftungssystem sofort und deutlich an. Man erkennt unmittelbar, ob Verdichter in Bereichen mit schlechtem Wirkungsgrad betrieben werden; bei geplatzten Belüfterelementen oder Leckagen an Schiebern und Rohrleitungen macht diese Kurve sogar einen regelrechten Sprung.
Im Bild 4 sind für die Belüftungsregelung der KA Oftringen (Schweiz), eine Kläranlage mit einer Ausbaugröße von 250.000 EW und 70-80% Industrieanteil, der Druck in der Sammelleitung und die Luftmenge dargestellt. Es ist dort eine Druckkonstantregelung mit von den Öffnungsgraden der Schieber abhängigem variablem Druck (Gleitdruckregelung) in Betrieb. Die elektrische Leistung der Gebläse wird als Momentanwert erfasst und ebenfalls aufgezeichnet. Aus diesen einfach zu ermittelnden Werten kann dann die spezifische Leistung, quasi der momentane energetische Aufwand für die Lufterzeugung, berechnet werden. Diese Kenngröße ist in der Abwassertechnik bisher nicht üblich, weil sie für unterschiedliche Kläranlagen nicht vergleichbar ist. Für die KA Oftringen ist sie jedoch ein wichtiger Wert für die Beurteilung des gesamten Belüftungssystems. Die Sensitivität gegen geringste Änderungen ist so groß, dass ungünstige Wirkungsgradbereiche der Turboverdichter, eine Belegung oder Schäden an den EPD-Membranen oder Störungen im Bereich der Regelung sofort auffallen. Eine weitere interessante Kurve ist der Druckverlust der Belüfter, der durch ein automatisches Mess- und Regenerierungsprogramm im laufenden Kläranlagenbetrieb täglich ermittelt wird. Damit kann eine Belagsbildung der Belüfter frühzeitig und zuverlässig erkannt werden.
Beim Belüftungssystem kommt es generell darauf an, kleinste und teilweise schleichende Veränderungen des technischen Betriebszustandes von Verdichtern, Luftleitungen, Belüftern, Steuerungen und Regelungen möglichst einfach zu erkennen und zu beurteilen, um Verschlechterungen möglichst sofort entgegenzuwirken. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Diskussion um die Belagsbildung auf EPD-Membranen und die damit einhergehende Reduzierung der Leistungsfähigkeit des Belüftungssystems hat sich gezeigt, dass es bei dem Herzstück der Kläranlage an praktikablen betrieblichen Kennzahlen fehlt, sonst hätte dieser Effekt von den Betreibern wesentlich früher bemerkt werden müssen.
5 Schlussfolgerung und Ausblick
In der Abwassertechnik werden mehrere Kennzahlensysteme verwendet, die allerdings nur begrenzt aufeinander abgestimmt und konsistent sind. Die vorhandenen Systeme zur Bemessung, zur Simulation und zur Optimierung werden in ihrer Betrachtung zunehmend differenzierter und bescheren immer neue Kennzahlen. Diese inflationäre Entwicklung ist mit einiger Sorge zu sehen. Häufig ist es auch so, dass aus den Ergebnissen neuerer Forschungsarbeiten interessante neue Kennzahlen resultieren; man muss dann aber auch fragen, ob die bisher verwendeten Kennzahlen weiterhin erforderlich sind. Vor allem führt die Inflation der Kenngrößen zu gigantischen Datenmengen, die zu deren Berechnung notwen-dig sind. Man gewinnt zunehmend den Eindruck, dass die Zeit reif ist für eine Konsolidierungsphase und eine Abstimmung der vorhandenen Systeme aufeinander.
Für den Kläranlagenbetrieb existiert grundsätzlich kein spezielles Kennzahlensystem. Die Kenngrößen aus der Bemessung sind hier nur eingeschränkt verwendbar. Sie basieren nur selten auf betriebsüblichen und online messbaren Daten; ihre Ermittlung ist entsprechend aufwändig. Grundsätzlich ist deshalb zu fragen, welchen Nutzen diese Daten für den Betrieb bringen, oder ob nicht andere und einfacher zu ermittelnde Größen aufgrund der Verfügbarkeit der Basiswerte besser geeignet sind. Insbesondere ist abzuwägen, ob die Vergleichbarkeit mit anderen Kläranlagen oder die relative Veränderung in Bezug auf die betrachtete Anlage wichtiger zu beurteilen sind.
Literatur
| [1] |
Müller, E.A., Kobel, B., Seibert-Erling, G. et al.:
Energie in Kläranlagen, Handbuch sowie Grob- und Feinanalysen, Ministerium für Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf 1999 |
| [2] |
Merkel, W.:
Untersuchungen über das Verhalten des belebten Schlammes im System Belebungsbecken – Nachklärbecken
Gewässerschutz – Wasser – Abwasser, Heft 5, 1971 |
| [3] |
Botsch, B.:
Hydraulische Kennwerte für Nachklärbecken – Definition und Vergleich mit Angaben des Arbeitsblattes ATV-A131
Korrespondenz Abwasser 45 (1998), S. 1289-1300 |
| [4] |
Marx, W.:
Verfahrenstechnische Optimierung durch den Einsatz von Prozessmesstechnik Beitrag zum Seminar „Die transparente Kläranlage“ im Frühjahr 1999 |
Anschrift des Autors:
Ingenieurbüro Becker + Gedusch
Heppendorfer Straße 3
50170 Kerpen
Tel.: (02273) 5958-20
mailto:g.seibert-erling@wirberaten.de
www.wirberaten.de