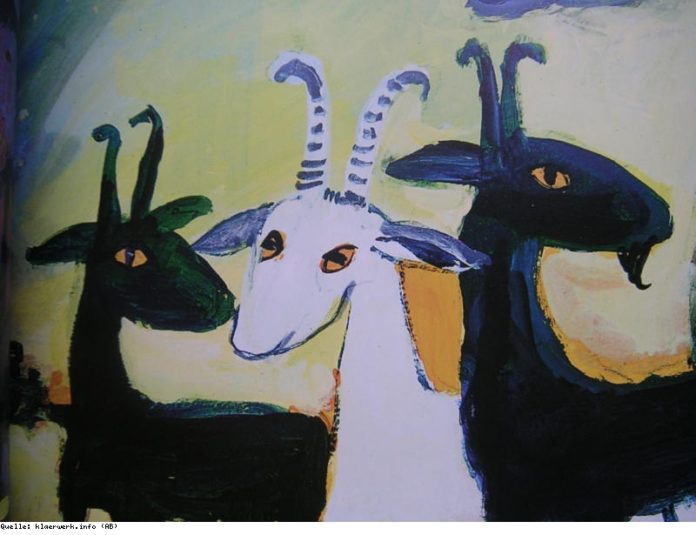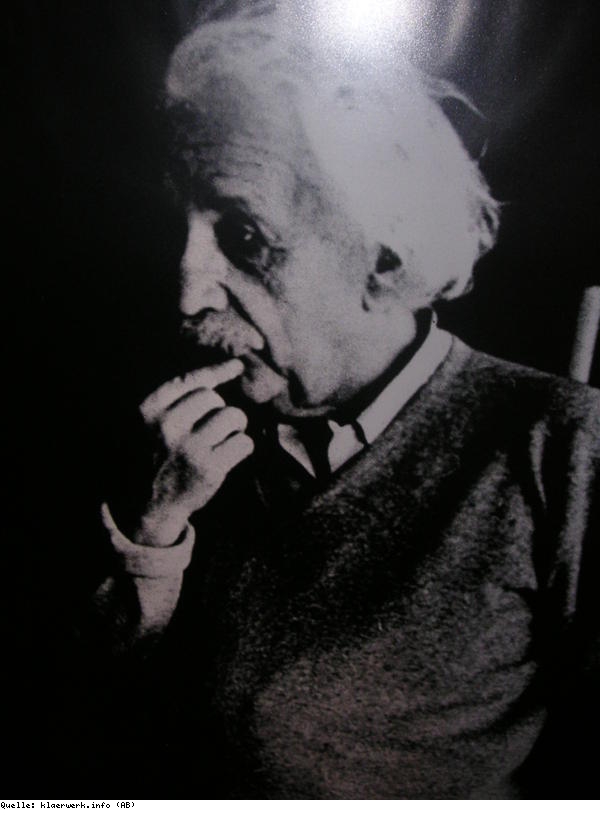| Ausgabe Oktober 2015 (http://www.tuev-seminare.net/upload/pdffiles/VEFK/vefk_aktuell-2015-10.pdf) |
| • |
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten(EFK-FT) |
| • |
Industrie 4.0 |
| • |
Stromausfall in Berlin Mitte |
| • |
In eigener Sache |
| • |
Die neue Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 01.06.2015 |
| Ausgabe April 2015 (http://www.tuev-seminare.net/upload/pdffiles/VEFK/vefk_aktuell-2015-04.pdf) |
| • |
Wartungs-und Instandhaltungsarbeiten an Hochspannungsanlagen |
| • |
Qualifizierung zum Erwerb der Schaltberechtigung |
| • |
Neufassung der Betriebssicherheitsverordnung |
| • |
Einkauf von LED-Leuchtmitteln |
| • |
In eigener Sache |
| • |
Neues Förderprogramm: Energieberatung für den Mittelstand |
| Ausgabe Oktober 2014 (http://www.tuev-seminare.net/upload/pdffiles/VEFK/vefk_aktuell-2014-10.pdf) |
| • |
Instandhaltung elektrischer Anlagen |
| • |
Unfallgeschehen in Ländern der EU |
| • |
Neubau Seminar- und Bürogebäude in Hattingen |
| • |
Neuer Zahlenschlüssel aus einem Guss |
| • |
Benutzung von Hubarbeitsbühnen bei AuS-Arbeiten |
| • |
Für Sie gesehen |
| • |
In eigener Sache |
| Ausgabe Februar 2014 (http://www.tuev-seminare.net/upload/pdffiles/VEFK/vefk_aktuell-2014-02.pdf) |
| • |
Gefahrstoffe bei elektrischen Instandhaltungsarbeiten |
| • |
Schuster, bleib bei Deinen Leisten! |
| • |
Die neue Arbeitsmittel- und Anlagensicherheitsverordnung – ArbmittV |
| • |
In eigener Sache |
| • |
Neue Sicherheitskennzeichnung |
| • |
Einsatz von Leitungsrollern auf Baustellen |
| • |
Kundenanfrage zu vermieteten Arbeitsmitteln |
| Ausgabe Oktober 2013 (http://www.tuev-seminare.net/upload/pdffiles/VEFK/vefk_aktuell-2013-02.pdf) |
| • |
Gefahrstoffverzeichnis für die Elektrowerkstatt |
| • |
Anforderungen und Vorgaben aus der Gefahrstoffverordnung |
| • |
Empfehlungen für den Umgang mit Gefahrstoffen |
| • |
Abfallentsorgung und umweltgerechtes Verhalten |
| • |
Gefahrstoffe im Elektrobereich |
| • |
Arbeiten unter Spannung |
| • |
Schutzkonzepte zum Schutz des Kopfes vor den Auswirkungen und Einwirkungen eines Störlichtbogens |
| Ausgabe April 2013 (http://www.tuev-seminare.net/upload/pdffiles/VEFK/vefk_aktuell-2013-01.pdf) |
| • |
Arbeiten an Mittelspannungsanlagen |
| • |
Mittelspannungsaltanlagen |
| • |
Fortsetzung der Reihe „Power Quality“ |
| • |
LED-Röhrenlampen |
| • |
Integrierter Brandschutz bei der Nachrüstung mittlerer Photovoltaikanlagen |
| Ausgabe Oktober 2012 (http://www.tuev-seminare.net/data/vefk_aktuell-2012-10.pdf) |
| • |
Sicherheitsmaßnahmen beim Wechseln von NH-Sicherungseinsätzen |
| • |
Fortsetzung der Reihe „Organisation der Elektroabteilung“, hier: Arbeiten unter Spannung |
| • |
Power Quality |
| Ausgabe August 2012 (http://www.tuev-seminare.net/data/vtfk_aktuell-2012-08.pdf) |
| • |
Einweg Augenspülflasche |
| • |
Alleinarbeit |
| • |
Risikoanalyse nach Nohl |
| • |
Manipulation an Maschinen |
| • |
Benutzung von Arbeitsmitteln |
| • |
Mannheimer Memorandum |
| Ausgabe Mai 2012 (http://www.tuev-seminare.net/data/vefk_aktuell-2012-05.pdf) |
| • |
Montagearbeiten bei der Fehlereingrenzung in Hilfsstromkreisen |
| • |
Fortsetzung der Reihe „Organisation der Elektroabteilung“ |
| • |
BGV A3 Prüfungen |
| • |
AuS Tätigkeiten, die generell unter Spannung ausgeführt werden dürfen – Definition nach VDE 0105-100 / 6.3.2 |
| • |
Anforderungen an elektrische Installationen |
| Ausgabe Februar 2012 (http://www.tuev-seminare.net/data/vtfk_aktuell-2012-02.pdf) |
| • |
Gefährliche Arbeiten |
| • |
Besondere Unterweisungen |
| • |
Persönliche Schutzausrüstung – PSA |
| • |
Führungskräfte in der Nachweispflicht |
| • |
G 25 – Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten |
| • |
Haftung von Führungskräften |
| • |
Unfälle in der Instandhaltung |
| • |
Gasflaschentransportsystem |
| Ausgabe Oktober 2011 (http://www.tuev-seminare.net/data/vefk_aktuell-2011-10.pdf) |
| • |
Arbeitsschutzmittel |
| • |
Organisation der Elektroabteilung (Fortsetzung) |
| • |
Auswahl sicherer Messgeräte |
| • |
Ausstattung und Betreiben von Batterieanlagen |
| • |
Prüfung neuer Betriebsmittel |
| • |
Neue Anforderungen für das Bedienen von Hubarbeitsbühnen |
| • |
Sind Fahrzeuge Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung? |
| • |
Sicherheitsunterweisung für Elektrofachkräfte |
Ausgabe Juli 2011 (http://www.tuev-seminare.net/data/vtfk_aktuell-2011-07.pdf)
|
| • |
Sind Fahrzeuge Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung? |
| • |
Mindestvorschriften für Arbeitsmittel |
| • |
Brandschutz / -bekämpfung |
| • |
Mängel an Gerüsten |
| • |
Gefahrstoffe in der Instandhaltung |
| • |
Explosionsgefährdung bei und durch Instandhaltungsarbeiten |
| • |
Rechtliche Stellung von Unfallverhütungsvorschriften, Technischen Regeln für Betriebssicherheit
(TRBS) und VDI-Richtlinien |
| Ausgabe April 2011 (http://www.tuev-seminare.net/data/vefk_aktuell-2011-04.pdf) |
| • |
Ausstattung von NS- und HS-Schalträumen |
| • |
Rechtliche Stellung von Unfallverhütungsvorschriften, VDE-Bestimmungen und Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) |
| • |
Haftung von Führungskräften |
| • |
Gefährdung durch elektromagnetische Felder |
| • |
Anforderungen aus der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) an Bereiche mit
gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre |
Ausgabe Dezember 2010 (http://www.tuev-seminare.net/data/vtfk_aktuell-2010-12.pdf)
|
| • |
Neue Anforderungen für das Bedienen von Hubarbeitsbühnen |
| • |
Eignungsuntersuchungen G 25 und G 41 |
| • |
Kundenanfrage zum Thema: Vermietete Arbeitsmittel |
| • |
Fachkraft für Explosionsschutz – ExFa® |
| • |
Instandhaltungsarbeiten auf Dächern |
| • |
Hochgelegene Arbeitsplätze |
| • |
Neue Maschinenrichtlinie |
| • |
Neue Gesetze und Verordnungen für Kälte-/ Klimaanlagen und Wärmepumpen |
| • |
Sicherheitsunterweisung für Instandhalter |
| • |
Pumpen in Heizungsanlagen privater Haushalte |
| • |
TRBS 2101 – Prüfungen |
| Ausgabe Oktober 2010 (http://www.tuev-seminare.net/data/vefk_aktuell-2010-10.pdf) |
| • |
Anlagenbetreiber |
| • |
Prüfplatz in der Elektrowerkstatt |
| • |
Baustromverteiler |
| • |
Befähigung zum Arbeiten unter Spannung |
| • |
Hochgelegene Arbeitsplätze |
| • |
Blitzschutz |
| • |
Schalten in Anlagen > 1 kV |
| • |
Prüfung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen |
| Ausgabe Mai 2010 (http://www.tuev-seminare.net/data/vtfk_aktuell-2010-05.pdf) |
| • |
Das neue WHG |
| • |
Sicherheit für Arbeitnehmer anderer Firmen |
| • |
GHS-Verordnung |
| • |
Beauftragte Personen für Aufzugsanlagen gemäß TRBS 3121 |
| • |
Anschlagmittel, Ketten, Seile und Hebebänder |
| • |
Quo Vadis Dipl.-Ing.? |
| • |
Hydraulik-/ Hochdruckschläuche – BGR 237 |
| • |
BGI 861-2, Sicherer Umgang mit Türen |
| • |
Leiterunfälle belegen Platz 1 aller Abstürze |
| • |
Neuerungen in der Betriebssicherheitsverordnung zum 29.12.2009 |
| • |
Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A 1.7 – Türen und Tore |
| • |
Heben und Tragen von Lasten |
| • |
Gültigkeit der EN 954-1 verlängert |
| Ausgabe März 2010 (http://www.tuev-seminare.net/data/vefk_aktuell-2010-03.pdf) |
| • |
Pumpen in Heizungsanlagen privater Haushalte |
| • |
Blitz- und Überspannungsschutz |
| • |
10. Fachtagung Elektrotechnik |
| • |
Gelegentliches Handhaben durch EuP |
| • |
Fachkraft für Explosionsschutz |
| • |
Brandschutz / -bekämpfung |
| • |
Gültigkeit der EN 954-1 verlängert |
| • |
Ausstattung von Schalt- und Verteilerräumen |
| • |
Die neue VDE 0105-100:2009-10 „Betrieb von elektrischen Anlagen“ |
| Ausgabe November 2009 (http://www.tuev-seminare.net/data/vefk_aktuell-2010-03.pdf) |
| • |
Kühlschmierstoffe |
| • |
Unfälle in der Instandhaltung |
| • |
Verpflichtung zur Bestellung einer Verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) |
| • |
Elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP) in der Instand haltung |
| • |
Prüfungen durch befähigte Personen |
| • |
Hydraulikverschraubungen |
| • |
Kundenanfrage zum Thema Lichtbogenschweißeinrichtungen |
| • |
Fachkraft für Explosionsschutz |
| • |
Veränderungen in der gesetzlichen Unfallversicherung |
| • |
Wartungsarbeiten an RLT-Anlagen |
| • |
Sonderbetriebsarten von Maschinen |
| Ausgabe Oktober 2009 (https://klaerwerk.info/wp-content/uploads/2020/10/VEKF-Oktober-09.pdf) |
| • |
Anlagenverantwortlicher (AnVA) VDE 0105-100 |
| • |
Wussten Sie, dass … |
| • |
TÜV Saarland Bildung + Consulting weitet ihre Aktivitäten
im englischsprachigen Ausland aus |
| • |
TRBS 1201 – Prüfungen |
| • |
TRBS 2131 – Elektrische Gefährdung |
| • |
Neue Anforderungen – TRBS 2131 – Elektrische Gefährdung |
| • |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) |
| • |
Electrostatic Discharge – ESD |
| • |
GHS-Verordnung |
| • |
Änderungen in der VDE 0105-100 |
| Ausgabe Juni 2009 (https://klaerwerk.info/wp-content/uploads/2020/10/VEKF-Juni-09.pdf) |
| • |
Änderungen bei der Prüfung elektrischer Anlagen, Maschinen und Arbeitsmittel |
| • |
Wussten Sie, dass … |
| • |
Verantwortliche Elektrofachkraft |
| • |
Unfallgeschehen im Elektrobereich |
| • |
HS-Anlagen ab 1 kV |
| • |
Elektrotechnisch unterwiesene Person |
| • |
10. Fachtagung Elektrotechnik |
| • |
Regelwerk zur Sicherheitsbeleuchtung |
| • |
Arbeiten unter Spannung |
| • |
Elektrische Ausrüstung von Maschinen |
| • |
Aufzeichnungen von Prüfungen nach BetrSichV und TRBS 1201 |
| • |
Die neue VDE 0701-0702 |
| • |
Häufig gestellte Fragen |
| • |
Änderung der fachlichen Betreuung unserer Kunden |