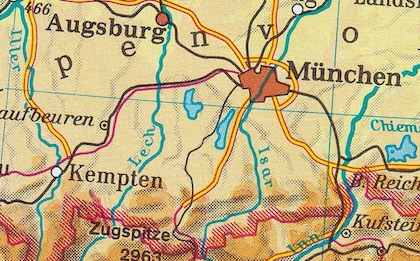2023
- Kein Wasseranschlussbeitrag für Photovoltaik-Freiflächenanlage
- Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang – Versickerung über Rigole
Kein Wasseranschlussbeitrag für Photovoltaik-Freiflächenanlage
Die Eigentümer eines Grundstücks im Tecklenburger Land, auf dem eine Photovoltaik-Freiflächenanlage errichtet worden ist, sind nicht verpflichtet, für die Möglichkeit, das Grundstück an die öffentliche Wasserversorgung anzuschließen, einen Anschlussbeitrag nach dem Kommunalabgabengesetz NRW zu zahlen. Dies hat das Oberverwaltungsgericht heute entschieden und damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts Münster bestätigt.
Die Eigentümer sind vom Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land zu einem Anschlussbeitrag in Höhe von rund 46.000 Euro für eine vor ihrem Grundstück verlaufende Frischwasserleitung herangezogen worden. Nach dem Bebauungsplan darf auf dem Grundstück nur eine Photovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden. Die Eigentümer hielten den Heranziehungsbescheid für rechtswidrig. Insbesondere machten sie geltend, die Möglichkeit, das Grundstück an die öffentliche Wasserversorgung anzuschließen, vermittle ihnen keinen wirtschaftlichen Vorteil, wie er für die Beitragserhebung erforderlich sei. Für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage bestehe kein Bedarf an einer (leitungsgebundenen) Wasserversorgung. Der Wasserversorgungsverband vertrat demgegenüber die Ansicht, jedenfalls für die von Zeit zu Zeit erforderliche Reinigung der Solarpanele sowie unter Brandschutzgesichtspunkten sei eine Wasserversorgung nützlich bzw. notwendig. Das Verwaltungsgericht Münster hat auf die Klage der Eigentümer den Beitragsbescheid aufgehoben. Die dagegen gerichtete Berufung des Wasserversorgungsverbands hatte nun beim Oberverwaltungsgericht keinen Erfolg.
Zur Begründung hat der 15. Senat ausgeführt: Ein Wasseranschluss ist für die Grundstücksnutzung mit einer Photovoltaik-Freiflächenanlage regelmäßig nicht mit einem wirtschaftlichen Vorteil verbunden. Ein wirtschaftlicher Vorteil liegt vor, wenn die Wasserversorgung die bauliche Nutzung des Grundstücks erst ermöglicht oder sie zumindest verbessert. Bei einer allein zulässigen Bebauung mit einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ist dies typischerweise nicht der Fall. Die Bereitstellung von Löschwasser ist in der Regel so auch hier – nicht Aufgabe des Grundstückseigentümers. Die Möglichkeit, für die Reinigung der Solarpanele auf das Leitungswasser zurückzugreifen, ist ebenfalls kein beitragsrelevanter Vorteil. Zwar wird durch die Reinigung, die typischerweise in einem zeitlichen Abstand zwischen einem und mehreren Jahren sinnvoll ist, die Effektivität der Anlage gewährleistet und auch ihre Lebensdauer günstig beeinflusst. Dies ist hier aber ausnahmsweise kein beitragsrelevanter Vorteil. Denn der Eigentümer der Anlage kann den seltenen Bedarf an Reinigungswasser auch durch gleichwertige private Vorkehrungen decken, die für ihn in der Regel ökonomisch sinnvoller sind. An eine Gleichwertigkeit von Wasserversorgungs- und entsorgungsalternativen gegenüber entsprechenden Leistungen öffentlich-rechtlicher Einrichtungen sind zwar sehr strenge Anforderungen zu stellen. Jedoch stehen einer Reinigung der Solarpanele durch Unternehmen, die das hierfür erforderliche Wasser etwa im Tank heranschaffen, weder öffentliche noch private Belange entgegen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Reinigungsbedarf für Photovoltaik-Freiflächenanlagen nur sehr selten besteht und typischerweise langfristig planbar ist, so dass eine ständig verfügbare Wasserleitung keinen erkennbaren Vorteil bietet. Der öffentlich-rechtliche Versorgungsträger hat zwar grundsätzlich die Möglichkeit, satzungsrechtlich einen Anschluss- und Benutzungszwang für sein Leitungsnetz anzuordnen, was die Berufung auf die alternative Gebrauchsmöglichkeit ausschließen würde. Vorliegend sieht die Satzung des beklagten Wasserversorgungsverbandes eine Anschluss- und Benutzungspflicht jedoch nur für Grundstücke vor, auf denen regelmäßig Wasser verbraucht wird. Gerade das ist aufgrund des zu erwartenden größeren zeitlichen Abstands zwischen den einzelnen Reinigungen einer Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht der Fall.
Der Senat hat die Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Hiergegen kann der Beklagte Beschwerde einlegen.
Aktenzeichen: 15 A 3204/20 (I. Instanz: VG Münster 3 K 1634/18)
https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/46_230829/index.php