Mitte November 2007 hat die neue Brennstoffzelle auf der Kläranlage ihren Betrieb aufgenommen. Sie wird nur mit Klärgas betrieben, und „sie werde eine deutlich effizientere Nutzung der erneuerbaren Energie bei deutlich geringeren Schadstoffausstoß liefern„, sagte Ministerialdirigent Peter Fuhrmann vom Landesumweltministerium anlässlich der Inbetriebnahme. Das Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft und das Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung der Universität Stuttgart werden anfallende Betriebsdaten erheben und auswerten. Dadurch erwartet man unter anderem auch Prognosen über weitere Einsatzmöglichkeiten auf anderen Kläranlagen. Mehr als 450.000 € lässt sich das Land diese Untersuchung kosten.
Einsatzbeispiel von Membrankleinkläranlagen
Anlässlich der 17. Aachener Tagung Ende Oktober 2007 stellte Martin Freund vom Lippeverband das Projekt „AKWA Dahlener Feld“ vor. Bei dem Versuch “ Alternativen der kommunalen Wasserver -und Abwasserentsorgung “ wurde die Zweckmässigkeit von Membrankleinkläranlagen im ländlichen Raum getestet.
Ausgewählt wurde ein Wohngebiet der Stadt Selm mit etwa 100 Einwohnern. Die Siedlung hat keine zentrale Trinkwasserversorgung und auch keine Abwasserentsorgung. Aktuell sind 21 Membrankleinkläranlagen in Betrieb und die ersten Erfahrungen zeigen, dass der vorgeschriebene Überwachungswert von 150 Milligramm pro Liter für die CSB-Konzentration eingehalten wird. Erfreulich und wichtig ist, dass in hygienischer Sicht sogar die Anforderungen der EU-Badegewässer -Richtlinie eingehalten werden.
Im Jahr 2006 hat das Fraunhofer Institut auf seiner Homepage das Projekt so vorgestellt:
Das Fraunhofer ISI hat ein neues Geschäftsmodell für den Einsatz dezentraler Membrankläranlagen entwickelt. Hohe Investitionen für Gemeinden und Nutzer entfallen – ideal für abseits gelegene Wohngebiete. Auch die Umwelt profitiert: Das Abwasser erreicht Badegewässerqualität.
Wie bringt man Innovationen schneller zur Anwendung? Mit neuen Geschäftsmodellen zum Beispiel, sagt das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Beispiel Kläranlagen: Weil die Stadt Selm im Kreis Unna kein Geld für den Abwasseranschluss von 25 Häusern im Wohngebiet Dahler Feld hatte, hätten die Hausbesitzer ihre maroden alten Kläranlagen auf eigene Rechnung ersetzen müssen. Das gelang erst dank eines neuen Geschäftsmodells des Fraunhofer ISI, das mit Unterstützung der West-LB entwickelt wurde. Es sieht vor, dass die modernen, aber in der Anschaffung teureren Membrankleinkläranlagen zunächst von einem Unternehmen – in diesem Fall vom Lippe-Verband – gekauft, eingebaut und betrieben werden und nach zehn Jahren in den Besitz der Hauseigentümer übergehen. Die schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen entfallen für sie die Anschaffungskosten von rund 6000 Euro pro Anlage für einen Vierpersonenhaushalt, in den ersten zehn Jahren zahlen sie nur eine Gebühr. Zum anderen erzielen die Membrankläranlagen eine Abwasserqualität, die auch in Zukunft selbst schärfste Grenzwerte einhält. Das Abwasser, das am Ende des dreistufigen Reinigungsprozesses die Kläranlage im Garten verlässt, hat Badegewässerqualität nach EU-Richtlinie und kann problemlos im Erdreich versickern.
Das Fraunhofer ISI begleitete die Umsetzung des Geschäftsmodells „Zentraler Betrieb dezentraler Anlagen“ mit vier Informationsveranstaltungen für die Bürger sowie einer soeben abgeschlossenen Umfrage, die die Zufriedenheit der Bewohner mit dem Umsetzungsprozess und der Leistung der Kläranlagen bewertete. Die Rückmeldungen sind durchweg positiv: Gelobt werden die Zukunftssicherheit des Konzepts, die kompetente Betreuung durch das Projekt-Team sowie das gute Reinigungsergebnis der Anlagen, das zum Teil besser ist als die Abwasserreinigung in großen Kläranlagen. Zwei weitere Umfragen bis zum Abschluss des Projekts in zwei Jahren sollen klären, ob der Betrieb weiter stabil läuft und wo noch Optimierungsbedarf besteht.
Das Potenzial des Geschäftsmodells, das mit dem Lippe-Verband, RUFIS, der RWTH Aachen sowie dem Ingenieurbüro Prof. Stein&Partner entwickelt wurde, ist enorm. Viele Abwasserkanäle in Deutschland sind marode und müssten dringend saniert werden, doch den Gemeinden fehlt das Geld. Der Betrieb dezentraler Kläranlagen im Rahmen eines Betreibermodells würde die Abwasserreinigung auch im ländlichen Raum auf eine professionelle Basis stellen. Selbst für dichter besiedelte Gebiete wäre das Konzept eine wirtschaftlich und technisch interessante Alternative. „In der Wohnungswirtschaft könnte sich ein großer Markt für dezentrale Abwasseranlagen entwickeln“, sagt ISI-Projektleiter Dominik Toussaint. Auch für Entwicklungsländer sei das Geschäftsmodell eine interessante Variante.
Die Presseinformationen des Fraunhofer ISI finden Sie auch im Internet unter www.isi.fraunhofer.de/pr/presse.htm.
Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) untersucht Marktpotenziale technischer Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Die interdisziplinären Forschungsgruppen konzentrieren sich auf neue Technologien, Industrie- und Serviceinnovationen, Energiepolitik und nachhaltiges Wirtschaften sowie auf die Dynamik neuer Märkte und die Innovationspolitik.
Allergische Reaktionen bei Hautkontakt mit Trinkwasser
Betroffene Personen werden für eine Studie gesucht
 In letzter Zeit traten in einigen Regionen der Bundesrepublik bei Personen gesundheitliche Beschwerden auf, die im Zusammenhang mit dem Hautkontakt von Trinkwasser stehen sollen. Das Umweltbundesamt (UBA) möchte sich dieser Problematik mit einer Studie annehmen.
In letzter Zeit traten in einigen Regionen der Bundesrepublik bei Personen gesundheitliche Beschwerden auf, die im Zusammenhang mit dem Hautkontakt von Trinkwasser stehen sollen. Das Umweltbundesamt (UBA) möchte sich dieser Problematik mit einer Studie annehmen.
Falls Sie auch von Beschwerden bei Hautkontakt mit Trinkwasser betroffen sind, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich an dieser Studie beteiligen würden.
Im ersten Teil der Studie möchten wir Sie bitten, den kurzen Fragebogen zu beantworten und an das Umweltbundesamt zurückzusenden.
Im zweiten Teil der Studie würden wir Sie gegebenenfalls aufsuchen, eine ausführliche Anamnese (Umfeldanalyse) erheben, weitere Fragen für die Klärung der Ursachen stellen sowie einige Wasserproben aus dem betreffenden Wasserhahn entnehmen und analysieren.
Am Schluss werden Sie über die Ergebnisse informiert. Die Auswertung der Studie erfolgt anonymisiert. Es wird sichergestellt, dass Ihre persönlichen Angaben nicht weitergegeben werden.
Für Ihre Mitarbeit an der Studie möchten wir uns schon jetzt herzlich bedanken.
- Fragebogen online
(https://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/downloads/trinkwasser/Fragebogen-Allergie.htm)
- Fragebogen (PDF / 20 KB)
(http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/downloads/trinkwasser/Fragebogen-Allergie.pdf)
http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/trinkwasser/trinkwasserallergie.htm
Nase im Magen
 Riechzellen bereiten Verdauungstrakt auf Arbeit vor
Riechzellen bereiten Verdauungstrakt auf Arbeit vor
Von Jan Friese
Biologie. – Fast jedes Gericht der Welt schmeckt ohne die richtigen Gewürze nur halb so gut. Wissenschaftler der TU-München und der Münchener Ludwig-Maximilian Universität entdeckten nun, dass auch der Magen ein gut gewürztes Essen erkennt. Er besitzt Geruchssensoren, die identisch mit denen in der Nase sind.
Den gesamten Artikel lesen Sie unter:
Informationen zu MBR- Anlagen
Ende Oktober gab Prof. Pinnekamp vom Institut für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen in seinem Vortrag anlässlich der „Aachener Tagung Wasser und Membrane“ einen Überblick über die derzeit eingesetzte Membrantechnik. So gibt es in Deutschland 17 kommunale Anlagen unterschiedlicher Größe, weltweit haben die Anlagen in den letzten 10 Jahren aber stark zugenommen. Derzeit behandeln etwa 800 Anlagen mit einer Gesamtausbaugröße von knapp 1,2 Mio. Kubikmeter kommunale Abwässer. Asien und Nordamerika haben mit knapp 600 die meisten Anlagen, in Europa sind es 169, von denen die meisten in Großbritannien und Deutschland stehen. Zu den großen. Anbietern zählt die Zenon-GE, weiter kommen als Anbieter die japanische Kubota und aus Deutschland KMS-Puron, Rhodia-Orelis, Huber und A3 hinzu.
Prof. Pinnekamp ist der Ansicht, dass die Zukunft der Membrantechnik im Bereich der Abwasserbehandlung nicht unbedingt im Bereich von Membranbioreaktoren liege. Diese Technik käme für ihn nur in Frage, wenn alte Kläranlagen aus dem Betrieb genommen und durch neue Anlagen ersetzt werden. Interessanter sei die Technik als nachgeschaltete Zusatzklärung, um höhere Reinigungsstandards zu erzielen.
BR 11-07
Bioenergie macht Bier nicht teurer
Antworten aus der Wissenschaft: Dr. Hans Oechsner, Agrartechniker an der Universität Hohenheim, zu Preissteigerungen bei Lebensmitteln und der Rolle der Bioenergie
Florian Klebs, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Universität Hohenheim
Korrektur vom 16.11.2007
 Anbauflächen sind begrenzt, wird für Bioenergie angepflanzt, bleibt kein Platz für Nahrungsmittel-Anbau. Als Folge werden Milch und Brot derzeit teurer. Richtig?
Anbauflächen sind begrenzt, wird für Bioenergie angepflanzt, bleibt kein Platz für Nahrungsmittel-Anbau. Als Folge werden Milch und Brot derzeit teurer. Richtig?
Dr. Oechsner: Nein, das wäre zu kurz gegriffen. Ursachen sind vielmehr weltweite Ereignisse, das heißt, schlechte Ernten und die veränderten Ernährungsgewohnheiten in Schwellenländern wie Indien und China. Hauptproblem in Deutschland ist jedoch der jahrelange Preisverfall, den wir vor dem jetzigen Preisanstieg erlebt haben. Die angebliche Krise ist also hausgemacht.
Das müssen Sie erklären.
Dr. Oechsner: Für einen Doppelzentner Getreide bekommen Sie derzeit 17 bis 18 Euro – das ist das gleiche Preisniveau wie vor 30 Jahren: Der Getreidepreis war in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gefallen. Das Preistief war vor ca. zwei Jahren mit maximal 10 Euro für den Doppelzentner erreicht. Bei diesen Preisen gab es keinen Anreiz, in Züchtung oder Anbau zu investieren – und das rächt sich jetzt. Bei den derzeit angestiegenen Preisen für die Produkte besteht nun wieder mehr Investitionsanreiz. Und das betrifft natürlich nicht nur die deutsche Landwirtschaft, sondern auch in besonderem Maße zum Beispiel die neuen EU-Staaten.
Und wie wirken sich globale Ereignisse aus?
Dr. Oechsner: Wegen Dürre erlebt Australien seit mehreren Jahren Missernten, die Getreide im asiatischen Raum knapp werden lassen. Hinzukommen veränderte Ernährungsgewohnheiten in Schwellenländern: Die Nachfrage an tierischen Produkten wie Milch und Fleisch steigt. Um ein Kilo Fleisch zu erzeugen, braucht man aber drei Kilo Futtergetreide, und auch das treibt die Preise am Weltmarkt in die Höhe.
Dann hat die Bioenergie also keinerlei Schuld am Preisanstieg?
Dr. Oechsner: In Deutschland ist ihr Einfluss minimal. Von bundesweit grob elf Millionen Hektar Ackerland werden laut aktuellen Zahlen der Bundesregierung nur 400.000 Hektar für Biogas, 250.000 Hektar für Zucker und Stärke zur Bioethanolproduktion und 1.120.000 Hektar für Biodiesel genutzt. Das sind nur ca. 15 Prozent der Ackerfläche Deutschlands. Gleichzeitig mussten bisher zehn Prozent der Ackerflächen still gelegt werden – dort durften die Landwirte also keine Nahrungsmittel, wohl aber Energiepflanzen anbauen. Bioenergie kann also nicht für den Preisanstieg von Lebensmittel verantwortlich gemacht werden.
Schauen wir über den Tellerrand: Besteht nicht trotzdem die Gefahr, dass landwirtschaftlich orientierte Länder die Nahrungsmittelproduktion vernachlässigen, um Bioenergie für die Industriestaaten zu produzieren?
Dr. Oechsner: Für ein vertretbares Nebeneinander von Lebensmittel und Bioenergie muss sicher die Effizienz der Pflanzenproduktion gesteigert werden. Dass das sehr gut möglich ist, zeigt zum Beispiel Russland: Früher Importeur, heute in der Lage zu exportieren. Auch in Polen oder Rumänien werden weite Flächen äußerst extensiv genutzt, weil es keinen Anreiz gab, in die Produktion zu investieren.
Sie vertreten eine Intensivierung der Landwirtschaft. Gerade das ist aber auch eine Kritik an der Bioenergie: dass sie hochintensive Monokulturen erzeugt, die ökologisch problematisch sind?
Dr. Oechsner: Mit Steigerung der Produktivität meine ich eine nachhaltige Pflanzenproduktion mit regelmäßigem Fruchtwechsels, die auf keinen Fall nur auf der Basis von Monokulturen betrieben werden darf. Weltweit gibt es aber auch Nischen, die noch gar nicht erschlossen sind: So könnten zum Beispiel organische Abfälle verwendet werden. Und gerade in Entwicklungsländern fallen oft Stoffe mit energetischem Potential an, die aber nicht genutzt werden – dazu gehören auch häusliche Abwässer oder Klärschlamm. Für solche Einsatzideen gibt es häufig leider noch wenig Bewusstsein. Ein weiterer Punkt: Die Ausbeute der Energienanlagen sollte gesteigert werden. In Biogasanlagen wird meist nur Strom produziert, die Wärme wird häufig gar nicht oder nur zum Teil genutzt. Alternativ könnte das Gas gereinigt und ins Netz eingespeist oder komprimiert und als Treibstoff verkauft werden. Letztlich bleibt es aber immer eine Güterabwägung, was auf dem Acker angebaut wird.
Wieso?
Dr. Oechsner: Die Gesellschaft muss wissen, welchen Wert für sie Nahrung, Landschaftsschutz, Kulturlandschaften und Energie haben. Bislang ist der Stellenwert von Nahrung in der Gesellschaft immer noch zu gering. Selbst der aktuelle Weizenpreis von 18 Euro pro Doppelzentner liegt unter dem energetischen Wert von Weizen von mehr als 25 Euro. Es bleibt also billiger, mit Weizen zu heizen, als Brot daraus zu backen.
Fragen: Sandra Leppin
Kontakt:
Dr. Hans Oechsner, Universität Hohenheim, Landesanstalt für Landwirtschaftliches Maschinen- und Bauwesen
Tel.: 0711 459-22683, E-mail: oechsner@uni-hohenheim.de
URL dieser Pressemitteilung: http://idw-online.de/pages/de/news235858
Verursacher müssen Umweltschäden künftig auf eigene Kosten beseitigen
Neues Umweltschadensgesetz legt einheitliche Anforderungen für die Sanierung der Umweltschäden fest
 Ab morgen brechen härtere Zeiten für Verursacher von Schäden an Umweltgütern an: Wer bei einer beruflichen Tätigkeit die Umwelt schädigt, hat diesen Schaden wieder zu beseitigen. Dies besagt das Umweltschadensgesetz (USchadG), das am 14. November 2007 in Kraft tritt. Behörden und Umweltverbände wachen über den Vollzug des Gesetzes. „Das neue Umweltschadensgesetz stärkt das Verursacher- und das Vorsorgeprinzip“, erläutert der Präsident des Umweltbundesamtes, Prof. Dr. Andreas Troge. „Dies bringt der Umwelt einen Nutzen durch Prävention: Weil Berufstätige, beispielsweise Unternehmer, spätere Schäden auf eigene Kosten zu sanieren haben, schafft das neue Gesetz den Anreiz, sich jetzt so vorsichtig zu verhalten, dass Umweltschäden und damit Sanierungskosten gar nicht erst entstehen.“
Ab morgen brechen härtere Zeiten für Verursacher von Schäden an Umweltgütern an: Wer bei einer beruflichen Tätigkeit die Umwelt schädigt, hat diesen Schaden wieder zu beseitigen. Dies besagt das Umweltschadensgesetz (USchadG), das am 14. November 2007 in Kraft tritt. Behörden und Umweltverbände wachen über den Vollzug des Gesetzes. „Das neue Umweltschadensgesetz stärkt das Verursacher- und das Vorsorgeprinzip“, erläutert der Präsident des Umweltbundesamtes, Prof. Dr. Andreas Troge. „Dies bringt der Umwelt einen Nutzen durch Prävention: Weil Berufstätige, beispielsweise Unternehmer, spätere Schäden auf eigene Kosten zu sanieren haben, schafft das neue Gesetz den Anreiz, sich jetzt so vorsichtig zu verhalten, dass Umweltschäden und damit Sanierungskosten gar nicht erst entstehen.“
Das Umweltschadensgesetz enthält Mindestanforderungen für den Fall, dass geschützte Arten und Lebensräume, Gewässer oder Böden erheblich zu Schaden kommen oder eine solche erhebliche Schädigung droht. Die Schädigung oder die Gefahr einer Schädigung muss Folge einer beruflichen Tätigkeit sein. Für bestimmte, im Gesetz aufgezählte Tätigkeiten kommt es nicht auf ein Verschulden an. Solche potenziell gefährlichen Tätigkeiten sind beispielsweise der Betrieb eines Kraftwerks oder einer Abfalldeponie, der Transport von Gefahrgütern auf der Straße oder die Einleitung von Stoffen in Gewässer. Droht bei einer beruflichen Tätigkeit der Eintritt eines Umweltschadens, so muss der Verursacher alles tun, um diese Gefahr zu bannen. Ist der Schaden hingegen bereits eingetreten, so muss der Verursacher diesen auf eigene Kosten beseitigen.
Das Umweltschadensgesetz setzt auf die Initiative von betroffenen Einzelpersonen und der Umweltverbände: Diese können sich an die von den Ländern bestimmten Behörden mit der Maßgabe wenden, gegen den vermeintlichen Verursacher eines Umweltschadens vorzugehen. Letztlich können die individuell Betroffenen und die Umweltverbände behördliches Einschreiten auch gerichtlich durchsetzen. Vor allem den Umweltverbänden weist das Umweltschadensgesetz damit eine wichtige Rolle zu: Wegen ihrer Kompetenz und Erfahrung können sie Behörden auf Missstände hinweisen und so Sanierungsverfahren anstoßen. Die Behörde kann ihrerseits Sanierungsverfahren anordnen und überwacht den Schadenverursacher bei der Sanierung. Das Umweltschadensgesetz beugt damit eventuellen Schwächen des Vollzugs des Umweltrechts vor.
Mit dem Umweltschadensgesetz setzt Deutschland die europäische Richtlinie über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (2004/35/EG) vom 21. April 2004 in deutsches Recht um. Deutschland ist einer der ersten EU-Mitgliedstaaten, der die Richtlinie in die eigene Rechtsordnung integriert.
Das Umweltschadensgesetz können Sie hier herunterladen: http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/u_schad_g.pdf,
Eine englische Fassung des Gesetzes finden Sie unter: http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/u_schad_g_eng.pdf.
Die umgesetzte europäische Richtlinie ist unter folgendem Link erhältlich:
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/richtlinie_umwelthaftung.pdf.
Martin Ittershagen, Pressestelle
Umweltbundesamt (UBA)
Dessau-Roßlau, 13.11.2007
URL dieser Pressemitteilung: http://idw-online.de/pages/de/news235020
Fische nach Brand PFT- belastet
Ein Großbrand in St. Wendel führte dazu, dass im Schwarzbach die Fische durch Rückstände aus dem eingesetzten Löschschaum mit PFT belastet wurden. Das Umweltministerium hat Analysen in Auftrag gegeben, die jetzt zeigten, dass die aktuell gefundenen Rückstandsmengen inzwischen so gering sind, dass die Verzehrwarnung im Abschnitt unterhalb der Mündung des Schwarzbaches ist aufgehoben werden konnte.
Br 11-07
Termin für Neue Klärschlammverordnung
Der Referatsleiter des BMU, Claus-Gerhard Bergs sagte im Rahmen der Expertenrunde “ Qualitätssicherung von Klärschlamm “ in Butzbach, dass Mitte November der Arbeitsentwurf zur Novelle veröffentlichte wird. Bis Mitte 2008 soll dann der Referentenentwurf vorliegen, dadurch sei damit zu rechnen, dass die neue Verordnung frühestens Anfang 2009 in Kraft tritt.
BR 11-07
Vom Weltraum zurück an die Uni – Zoologe der Uni Stuttgart berichtet über Bärtierchen-Forschung
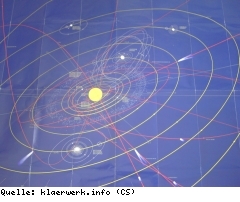 Im September brachte eine Trägerrakete im Rahmen der FOTON-M3-Mission die Bärtierchen-Experimente des Stuttgarter Zoologen Dr. Ralph O. Schill sowie dessen schwedischem Kollegen Dr. Ingemar Jönsson ins Weltall. Inzwischen sind die Tardigraden, wie Bärtierchen wissenschaftlich heißen, wieder zurück an der Universität Stuttgart und werden weiter untersucht. Am 15. November um 19.00 Uhr gibt Schill in einem öffentlichen Vortrag und in Filmsequenzen Einblicke in das Leben der zähen Winzlinge. Die Veranstaltung mit dem Titel „Das Leben der Bärtierchen – Biologischer Stillstand in der Natur“ findet auf dem Campus Vaihingen der Uni Stuttgart, Pfaffenwaldring 57, Hörsaal 57.04 statt.
Im September brachte eine Trägerrakete im Rahmen der FOTON-M3-Mission die Bärtierchen-Experimente des Stuttgarter Zoologen Dr. Ralph O. Schill sowie dessen schwedischem Kollegen Dr. Ingemar Jönsson ins Weltall. Inzwischen sind die Tardigraden, wie Bärtierchen wissenschaftlich heißen, wieder zurück an der Universität Stuttgart und werden weiter untersucht. Am 15. November um 19.00 Uhr gibt Schill in einem öffentlichen Vortrag und in Filmsequenzen Einblicke in das Leben der zähen Winzlinge. Die Veranstaltung mit dem Titel „Das Leben der Bärtierchen – Biologischer Stillstand in der Natur“ findet auf dem Campus Vaihingen der Uni Stuttgart, Pfaffenwaldring 57, Hörsaal 57.04 statt.
Bärtierchen gehören zu den wahren Überlebenskünstlern im Tierreich. Sie sind zwar nur einen Millimeter groß und leben meist versteckt in Moosen, auf feuchten Böden oder im Wasser. Ihre Fähigkeiten, sich auf schlechte Umweltbedingungen wie Trockenheit oder Kälte einzustellen, sind jedoch nicht zu übertreffen: Innerhalb weniger Stunden können sie tönnchenförmige Dauerstadien bilden und so auf bessere Zeiten warten. In diesem Stadium flogen mehrere hundert Bärtierchen insgesamt 189 Mal um die Erde. Dabei wurden sie der Kälte, dem Vakuum und der direkten Weltraumstrahlung ausgesetzt.
Am Biologischen Institut der Uni Stuttgart, Abteilung Zoologie, wird nun untersucht, wie viele Tierchen den knapp 12-tägigen Weltraumausflug überstanden haben und ob sie noch in der Lage sind, erfolgreich Nachwuchs zu produzieren. Hierfür ist eine Vielzahl von Experimenten geplant. Mit den Ergebnissen ist Anfang 2008 zu rechnen. Schill beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit diesen faszinierenden Lebewesen. „Ein besseres Verständnis der Überlebensmechanismen von Bärtierchen kann zur Entwicklung von neuen Methoden führen, die es in der Zukunft ermöglichen, Zellen und Gewebe zu konservieren oder entstandene Schäden zu reduzieren“, sagt der Wissenschaftler. Die Forschungen sind beispielsweise für Biobanken von großem Interesse.
Weitere Informationen bei Dr. Ralph O. Schill, Biologisches Institut, Abt. Zoologie, Tel. 0711/685-69143, e-mail ralph.schill@bio.uni-stuttgart.de, http://www.funcrypta.de.
Ursula Zitzler, Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Universität Stuttgart
07.11.2007
URL dieser Pressemitteilung: http://idw-online.de/pages/de/news234073


