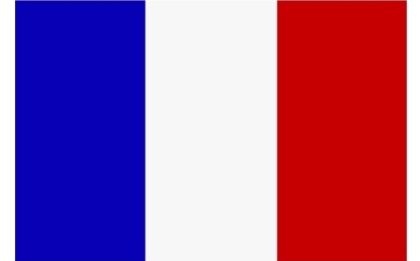Zurück zur Übersicht Aus der EU und aller Welt
Innsbruck: Rauch will Corona-Abwassermonitoring als „Wachtürme“ erhalten
Mit bundesweit 48 Kläranlagen will Gesundheitsminister Rauch (Grüne) die Entwicklung des Coronavirus im Auge behalten. Laut einer neuen Studie bringen die Abwassertests der Intensivmedizin 13 Tage Vorwarnzeit.
Obwohl mit 30. Juni die letzten Corona-Maßnahmen Geschichte sein werden, hält Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vorerst am Covid-Abwassermonitoring fest. „Das sind wichtige …mehr:
https://www.tt.com/artikel/30845982/rauch-will-corona-abwassermonitoring-als-wachtuerme-erhalten
(nach oben)
Hunderte Höfe in Osttirol sind nicht erschlossen
Erhebungen haben ergeben: 650 Objekte haben in Osttirol Abwasserentsorgung, die nicht dem Stand der Technik entspricht. Für rund 300 wird derzeit in den Gemeinden nach Lösungen gesucht.
Auf Teufel komm raus wurde in den 1990er-Jahren in Osttirol Kanal gebaut. Abwasser galt es zu sammeln und in Kläranlagen zu leiten. In allen Gemeinden wurden sogenannte gelbe Linien gezogen. Und alle Objekte innerhalb dieser Linie wurden an das öffentliche Kanalnetz …mehr:
https://www.kleinezeitung.at/kaernten/osttirol/aktuelles_osttirol/6248488
(nach oben)
Kreislaufwirtschaftsstrategie Österreich
Österreich in den Kreislauf führen
Bei einer gemeinsamen Veranstaltung von ÖWAV (Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband) und BMK (Bundesministerium für Klimaschutz) am 13. Oktober 2022 wurde die Kreislaufwirtschaftsstrategie Österreich der einschlägigen Fachwelt präsentiert. Über 200 Expertinnen und Experten trafen sich in Wien zur Vorstellung des erarbeiteten Strategiepapiers und diskutierten die Potenziale, die mit der beinhalteten Vision und ihren konkreten Umsetzungszielen für Österreich verbunden sind.
Die Kreislaufwirtschaft spielt eine Schlüsselrolle in der Transformation hin zu einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Gesellschaft. Um eine österreichische „Circular Economy“ möglichst umfassend und wirksam aufzustellen, wurde unter Einbindung zahlreicher Stakeholder eine gemeinsame „Kreislaufwirtschaftsstrategie Österreich“ erarbeitet. Am 13. Oktober wurde sie in Wien präsentiert. Bei ihren Grußworten zu Beginn der Veranstaltung zählte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler via Videobotschaft die zahlreichen Herausforderungen der aktuellen Zeit auf: „Klimakrise, Umweltverschmutzung und der einhergehende Biodiversitätsverlust sowie die Verknappung endlicher Ressourcen zeigen die Grenzen unseres linearen Wirtschaftens auf und erfordern eine fundamentale Transformation. Hier setzt das Konzept der Kreislaufwirtschaft an, dessen Umsetzung alternativlos ist, um innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten zu bleiben.“ Bundesministerin Gewessler selbst hatte im Herbst 2020 den Startschuss für die Arbeiten an einer österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie gegeben. In einem breit angelegten Beteiligungsprozess haben seither 250 Expertinnen und Experten aus verschiedensten Disziplinen ihr Fachwissen eingebracht, um gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, die notwendig sind, um eine klimaneutrale, nachhaltige Kreislaufwirtschaft bis 2050 umzusetzen. „Gerade die jüngsten Entwicklungen zeigen auf beklemmende Weise, wie wichtig die Sicherheit der Verfügbarkeit von Rohstoffen ist. Auch hier kann die Kreislaufwirtschaft einen wichtigen Beitrag leisten, unabhängiger von Importen zu werden und die Krisenfestigkeit der österreichischen Wirtschaft zu stärken. Wir werden es nur gemeinsam schaffen, die heutige Veranstaltung ist ein wichtiger weiterer Schritt in diese Richtung“, erklärte Bundesministerin Gewessler.
Im Anschluss fasste Hugo-Maria Schally von der Europäischen Kommission (GD-Umwelt) die vorliegende Kreislaufwirtschaftsstrategie Österreichs in den Rahmen des übergeordneten europäischen Green Deals und des Circular-Economy-Aktionsplans. Schally betonte, dass Europa es sich nicht leisten könne einem ressourcenintensiven Wirtschafts- und Verbrauchsmuster zu folgen: „Nur der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft kann die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken, da dadurch Ressourcenknappheiten und Preisschwankungen bei Rohmaterialien minimiert werden können.“ Die derzeitige Krise mache dies noch klarer und sollte bei allen Wirtschaftstreibenden zu einem Umdenken führen, so Schally. Danach gab Thomas Jakl vom Bundesministerium für Klimaschutz (BMK) Einblick in das „Making-Of“ der Kreislaufwirtschaftsstrategie. „Wir haben im Strategiefindungsprozess hunderte Stakeholder eingebunden. Wir konnten damit einen wichtigen zivilgesellschaftlichen Dialog anfachen“, freute sich Jakl. „Die Strategie ist eine Richtschnur. In der Umsetzung jedoch müssen wir nun auf allen Manualen spielen: Förderungen, Gesetze, Beschaffungswesen.“ Diese beginne am Tag nach der Beschlussfassung durch den Ministerrat, den Jakl in den nächsten Wochen erwartet: „Ich bin zuversichtlich, dass die Kreislaufwirtschaftsstrategie im Rahmen des neuen Transformationsprogramms der Bundesregierung – das rund 5,7 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 beinhalten soll – Umsetzung finden und Feuerkraft entwickeln kann.“
Andreas Tschulik, BMK, ging näher auf die zentralen Schlüsselsektoren und die Details der Transformationsschwerpunkte ein, die in der Kreislaufwirtschaftsstrategie adressiert werden. „Es wurde kein theoretisches Werk geschaffen, sondern ein umfassender Instrumentenmix und verschiedene Maßnahmen von Recht und Forschung bis hin zu Information und Bewusstseinsbildung zusammengefasst“, erklärte Tschulik. Im Detail sollen beispielsweise Anstöße gegeben werden für die verstärkte Nutzung von Sekundärrohstoffen oder das Forcieren zirkulärer Kriterien in Beschaffung und Bauaufträgen der öffentlichen Hand. „Wir beginnen bereits mit der Umsetzung erster Aktivitäten und bauen beispielsweise in diesen Wochen das Circularity Lab Austria auf, um die Transformation in Richtung Kreislaufwirtschaft aktiv anzugehen“, so Tschulik.
Den Beitrag, den die Strategie zu einer nachhaltigen Ressourcennutzung leisten könnte, präsentierte Nina Eisenmenger von der Universität für Bodenkultur. Sie schilderte den über Jahrzehnte hinweg gesteigerten Materialverbrauch in Österreich: 2018 lag etwa der Pro-Kopf-Verbrauch schon bei über 19 Tonnen – deutlich höher als im EU-Durchschnitt (14 Tonnen Materialverbrauch pro Kopf). Das zentrale Ziel müsse es daher sein, eine Entkoppelung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcen- und Materialverbrauch zu erreichen, forderte Eisenmenger: „Auch wenn wir in Österreich schon jetzt eine Zirkularitätsrate von rund zwölf Prozent vorweisen können, wird das für eine Kreislaufwirtschaft nicht ausreichen. Wir brauchen eine große Trendwende, eine Änderung der Lebensstile und des Wachstumsparadigmas.“ Das Ziel müsse – gemäß der Kreislaufwirtschaftsstrategie – die Reduktion des primären Verbrauchs sein, sagte Eisenmenger. In weiterer Folge stellte Harald Friedl vom Circular Economy Lab in Amsterdam einige internationale Leuchtturmprojekte vor und gab einen Überblick zu vergleichbaren Ansätzen in Europa. Friedl zeigte dabei, wie viele Initiativen bereits im Sinne der Kreislaufwirtschaft begonnen wurden und betonte, dass es auch erste wahrnehmbare Impulse hin zu einem nachhaltigen Denken in der internationalen Industrie und Finanzwirtschaft gebe. „Auch in den Vorbereitungen und Trends hin zur nächsten Klimakonferenz COP 27 in Sharm el-Sheikh in Ägypten ist erkennbar, dass viele die Klimaneutralität nur als erreichbar ansehen, wenn wir unsere Produkte und Rohstoffe im Kreislauf führen“, so Friedl. Auch er spornte die Teilnehmenden der Veranstaltung an, mit der österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie nun in die Aktionsphase zu kommen. Parallel zur Entwicklung der Strategie wurden schon im März 2021 auch erste Umsetzungsschritte im Forschungsbereich mit der FTI-Initiative Kreislaufwirtschaft gestartet. Ingo Hegny vom BMK stellte diese neue Initiative vor, ging auf erste eingereichte Projekte ein und gab einen Ausblick für die Zukunft. „Die FTI-Initiative Kreislaufwirtschaft unterstützt innovative Fo schungs- und Entwicklungsvorhaben mit zahlreichen Ausschreibungen“, so Hegny. 2022 und 2023 stünden dafür bereits bis zu 60 Millionen Euro an Fördervolumina zur Verfügung, mit denen die F&E-Aktivitäten in Unternehmen und Institutionen erhöht und neue Technologien gefördert werden sollen, die zur Kreislaufwirtschaft beitragen.
Roland Pomberger von der Montanuniversität Leoben ging zum Abschluss vor allem auf die Rolle der Abfallwirtschaft in der Kreislaufwirtschaftsstrategie ein und analysierte Details aus der Sicht dieses zentralen Sektors. Einen wichtigen Hebel fand Pomberger beispielsweise in der anvisierten Ökomodulation, durch die für kreislauffähige Verpackungen weniger Gebühren anfallen könnten als für nicht-recycelbare. Dies berge große Lenkungspotenziale in sich.
„Früher war die Kreislaufwirtschaft generell ein Anhängsel der Abfallwirtschaft. Nun ist sie aus dem Schatten der Abfallwirtschaft getreten und in Verwaltung und Wirtschaft angekommen“, verdeutlichte Pomberger. „Jetzt müssen wir die Kreislaufwirtschaft nur mehr umsetzen: Ein großer Auftrag.“
Stakeholder in den Startlöchern
In der abschließenden Podiumsdiskussion diskutierte eine hochkarätige Runde aus Expertinnen- und Experten angeregt über die Chancen und Notwendigkeiten der neuen Strategie. VOEB-Präsidentin Gabriele Jüly betonte: „Die Mitgliedsbetriebe des VOEB stehen Gewehr bei Fuß und wollen die Kreislaufwirtschaftsstrategie umsetzen.“ Aktuell fehle es jedoch noch an hochwertigen Recyclinganlagen im Land, gab Jüly zu Bedenken und bat um nötige gesetzliche Rahmenbedingungen und Unterstützung im Bereich Sekundärrohstoffe. Harald Hauke, Abfall Recycling Austria (ARA), bekräftigte das große Ziel der ARA, jede Verpackung zurück in den Kreislauf zu holen: „Für eine leistungsfähige Kreislaufwirtschaft braucht es Circular Economy als wirtschaftlichen Rahmen, eine Community, die gemeinsam am Wandel arbeitet und mehr Verbraucherfreundlichkeit, um die Transformation bequem zu realisieren,“ so Hauke.
Bernadette Luger von der Wiener Magistratsdirektion Bauten und Technik schilderte die Situation aus dem wichtigen Blickwinkel der Ressourcenschonung im Bauwesen. „Die Stadt Wien hat parallel zur Entstehung der Kreislaufwirtschaftsstrategie eigene Ziele in die Strategiepapiere der Stadt verankert“, sagte Luger. Eines dieser Leitziele sei, ab 2030 kreislauffähiges Planen und Bauen zum Standard für Neubau und Sanierung zu machen. „Das Programm DoTank Circular City Wien soll den Übergang zu einer kreislauffähigen Stadt mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im Zentrum fördern“, so Luger. Thomas Kasper von Porr Umwelttechnik wies darauf hin, dass sich in der nächsten Generation der europäischen Bauprodukte-Verordnung der Green Deal und das Kreislaufwirtschaftspaket bereits niederschlagen würden. Jedoch sei es notwendig, sich in Österreich schon heute dem Thema kreislauffähigen Bauens intensiv zu widmen. Roland Pomberger von der Montanuniversität Leoben freute sich, dass mit der Kreislaufwirtschaftsstrategie dieses wichtige Thema nun endlich bei Unternehmen und Institutionen an- gekommen sei. Dies bedeute einen wichtigen Impuls für den Start des Prozesses, nun müssten aber bald Rahmenbedingungen geschaffen werden. Auch Christian Holzer, BMK, unterstrich abschließend die notwendigen nächsten Schritte zum Strategiepapier, das ja bereits im April 2022 finalisiert und in den vergangenen Monaten unter zahlreichen Stakeholder diskutiert worden war. „Leider ist es uns noch nicht gelungen die Kreislaufwirtschaftsstrategie bis dato in den Rang eines Ministerratsbeschlusses zu heben, dies aber ist unser klares Ziel“, so Holzer, der auch mit dieser gelungenen Präsentationsveranstaltung noch vorhandene Bedenken zerstreuen wollte. „Wir haben hier eine Win-Win-Situation geschaffen. Nun ist es Zeit ins Tun zu kommen.“
Kreislaufwirtschaftsstrategie Österreich: Das sind die nächsten Schritte
Wie es nun mit der Strategie weitergehen soll, skizzierte Thomas Jakl vom BMK: „Es wird einen Ministerratsvortrag geben, den die fünf dafür zuständigen Ministerien einbringen werden. Wir hoffen dabei auf einen baldigen Beschluss, damit wir rasch in eine breite Umsetzung gehen können.“ Danach werde eine Roadmap ausgearbeitet mit konkreten Zielen und Deadlines für Fortschrittsberichte. Parallel soll in wenigen Wochen das Circularity Lab Austria gegründet werden, das die Kreislaufwirtschaftsstrategie in ihrer Gänze begleiten und den Fortschritt kontrollieren wird. Und vor allem soll der Partizipationsprozess in der Zivilgesellschaft rasch in die Gänge kommen mit Bürgerkonferenzen, Fokusgruppen und vielem mehr: „Die Kreislaufwirtschaftsstrategie soll eine Richtschnur geben“, erklärte Jakl. „Sie ist ein notwendiger erster Schritt. Jetzt aber beginnt ein Change-Management-Prozess, in dem wir alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, animieren und begeistern müssen. Ein verändertes Konsumdenken ist der zentrale Punkt der Circular Economy. Wenn alle die Kreislaufwirtschaft im Herzen tragen, bedeutet das das Ende der Wegwerfmentalität!“ „Wir haben in Österreich einen sehr hohen Ressourcenverbrauch, bei leider äußerst ertragsarmen Lagerstätten“, ergänzt Roland Pomberger (Montanuniversität Leoben), selbst Massenrohstoffe wie Kies würden bereits spürbar knapp. Dieser Tendenz könne man aber über die österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie wirkungsvoll gegensteuern: „Jetzt müssen wir gemeinsam die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft in Angriff nehmen und dürfen dabei das Thema Freiwilligkeit und Überzeugungsarbeit in der anwendenden Bevölkerung nicht vergessen“, ist sich Pomberger sicher. Dazu sei auch eine Aufwertung des nachrangigen Begriffs der „Sekundärrohstoffe“ anzudenken und diese künftig etwa als „R-Rohstoffe“ zu bezeichnen, um ihre Bedeutung semantisch besser zu besetzen. „Wir müssen in der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft einfach alle Hebel in Bewegung setzen“, so Pomberger. ÖWAV-Geschäftsführer Daniel Resch sieht in diesem Zusammenhang auch Möglichkeiten das Konsumentenverhalten durch Anreize und Förderungen zu lenken. „Konsumentinnen und Konsumenten gehen zum größten Teil den Weg, der die umfangreichsten Vorteile für sie beinhaltet. Hier kann der Gesetzgeber ansetzen und regulierend eingreifen.“ Resch hat dabei vor allem die ressourcenintensive Bauwirtschaft im Blick. So hätten die Stoffströme beim Bauen mit mehr als 50 Prozent den größten Anteil sowohl am Ressourcenverbrauch als auch am Abfallstrom in Österreich. Hinzu komme der enorme Flächenverbrauch für Neubauten und da- für notwendige Infrastrukturmaßnahmen. „Wir werden uns künftig noch mehr überlegen müssen, wie wir Wohnräume schaffen oder Mobilität gewährleisten wollen. Denn mit der Kreislaufwirtschaftsstrategie erhalten sämtliche althergebrachten Muster unseres Wirtschaftens und Zusammenlebens einen neuen Drive.“
https://www.oewav.at/upload/medialibrary/Kreislaufwirtschaftsstrategie__sterreich_endg.pdf
(nach oben)
Neue Förderungsrichtlinien für Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung
Bundesminister Mag. Norbert Totschnig hat neue Förderungsrichtlinien für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft genehmigt, durch die zusätzliche Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und zur Verringerung von Treibhausgasemissionen förderfähig sind.
Der Bereich der Trinkwasserver- und der Abwasserentsorgung kann einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung sowie zur klimaschonenden Energieerzeugung liefern. Derzeit werden rund 56 % des jährlichen Stromverbrauchs bzw. 73 % des jährlichen thermischen Energieverbrauchs im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft selbst erzeugt. Dieser Anteil kann durch weitere Maßnahmen noch gesteigert werden.
Daher sind Einrichtungen zur Erzeugung und Nutzung von Energie oder Wärme aus erneuerbaren Quellen im Ausmaß des Eigenbedarfs auf Anlagen zur Wasserver- Abwasserentsorgung oder Schlammbehandlung auf Grundlage eines Energiekonzepts für die gesamte Anlage förderfähig. Dazu zählt die Nutzung von Sonne, Wind, Erdwärme, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas, Biogas und Abwasserwärme. Ebenfalls auf Grundlage eines Energiekonzepts kommen auf der Energieeinsparungsseite beispielsweise Maßnahmen zur energetischen Optimierung von Kläranlagen in Betracht.
Die neuen Förderungsrichtlinien kommen bereits ab der nächsten Kommissionssitzung im November 2022 zur Anwendung.
Die Förderrichtlinien und weitere Details zu den Regelungen sind unter www.bml.gv.at/foerderung-kommunale-siedlungswasserwirtschaft bzw. www.umweltfoerderung.at/FRL_SWW_2022.pdf abrufbar.
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=454248
(nach oben)
Land Tirol: Verwertung von Klärschlamm geplant
Die Kläranlagen-Betreiber wollen mit Unterstützung des Landes jährlich 60.000 Tonnen Klärschlamm, der in Tirol anfällt, für die Erzeugung von Energie nutzen. Dazu ist die Errichtung einer Verbrennungsanlage geplant, der Standort ist noch unklar. In sieben Jahren sollen damit bis zu 2.000 Haushalte mit Wärme versorgt werden können.
Das Projekt wird Tirol in der jetzigen Situation…mehr:
https://tirol.orf.at/stories/3163659/
(nach oben)
Tirol investiert 2022 über 50 Mio. Euro in den Hochwasserschutz
Das österreichische Bundesland Tirol investiert im laufenden Jahr insgesamt 82,5 Mio. Euro in den Schutz vor Naturgefahren. Im Vergleich zu 2021 ist das ein Plus von 3,5 Prozent. Für Maßnahmen bei Wildbächen sind rund 29,2 Mio. Euro budgetiert, für den Schutz vor Tal- und Hauptgewässern 22,1 Mio. Euro. Somit werden 62 Prozent der Mittel für den Hochwasserschutz und den Schutz vor Wildbächen aufgewendet, teilte die Landesregierung mit. In die Erhaltung des Schutzwaldes fließen 16,4 Mio. Euro, auf den Lawinenschutz 9,2 Mio. Euro und auf den Erosions- und Steinschlagschutz 5,6 Mio. Euro.
Die Mittel stammen vom Bundesministerium für Landwirtschaft, …mehr:
Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.
(nach oben)
Österreich bei Abwasserentsorgung im Spitzenfeld
Österreich ist bei der Abwasserentsorgung EU-weit im Spitzenfeld. Bei den von der Europäischen Umweltagentur (EEA) veröffentlichten Länderprofilen zur kommunalen Abwasserentsorgung war Österreich eines von vier Ländern, das die EU-Vorgaben zu 100 Prozent erfüllte. „96 Prozent der österreichischen Haushalte sind an Kläranlagen angeschlossen“, so Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Aussendung.
Die Entsorgung kommunaler Abwässer ist Kernaufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und ein wichtiger Beitrag zur Reinhaltung der Gewässer. Seit 1959 wurden laut dem Landwirtschaftsministerium rund 50 Milliarden Euro in die Abwasserentsorgung investiert, „deshalb ist die flächendeckende Behandlung von kommunalem Abwasser in Österreich auf einem sehr hohen Niveau sichergestellt“.
„Die im digitalen Wasserinformationssystem für Europa präsentierten Länderprofile der Europäischen Umweltagentur bestätigen, dass Österreich – gemeinsam mit drei weiteren Mitgliedsstaaten – die entsprechende EU-Richtlinie zu 100 Prozent erfüllt. Das ist das Ergebnis unserer konsequenten und hohen Investitionen in diesem Bereich und unseres technischen Wasser-Know-hows“, so Köstinger.
Mit den Länderprofilen präsentiert die EEA Informationen, die die Europäische Kommission über die kommunale Abwasserrichtlinie bei den Mitgliedsstaaten erhebt. Sie zeigen den Status der Ableitung und Behandlung von kommunalem Abwasser im Jahr 2018 und sind Teil des elften Umsetzungsberichts zur Richtlinie, den die Kommission zweijährlich veröffentlicht.
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=435816
(nach oben)
Kärnten: Seenbericht Unterkärntner Seen mit Auf- und Absteigern bei der Wasserqualität
Laut dem aktuellen Kärntner Seenbericht werden zehn Kärntner Gewässer in ihrer Wasserqualität herabgestuft. In Unterkärnten top ist der Linsendorfer See.
Kurz nach den Kindern waren auch die Seen dran – jedes Jahr im Juli steht bei den heimischen Gewässern der Zeugnistag an. Dabei erwiesen sich 22 von 41 überprüften Seen als echte Streber, denn ihnen wurde im Kärntner Seenbericht 2020 eine sehr gute Wasserqualität attestiert. Sie alle zählen zu den nährstoffarmen Gewässern. Im Gegensatz zum Menschen sind Nährstoffe …mehr:
https://www.kleinezeitung.at/kaernten/lavanttal/aktuelles_lavanttal/6013372/Kaerntner-Seenbericht_Unterkaerntner-Seen-mit-Auf-und-Absteigern
(nach oben)
Kläranlagen-Monitoring wird ausgeweitet
Mit einem österreichweiten Forschungsprojekt wird seit Sommer 2020 erfolgreich das Abwasser in Kläranlagen auf das Coronavirus untersucht. In Kärnten wird das Monitoring jetzt ausgeweitet. Zehn Kläranlagen werden zweimal wöchentlich Proben liefern.
Das Forschungsprojekt geht ab sofort in ein regelmäßiges Monitoring über. In den zehn größten Kläranlagen in Kärnten werden seit Beginn der Woche zweimal wöchentlich Abwasserproben gezogen, sagte Günther Weichlinger von der Abteilung Wasserwirtschaft beim Land Kärnten.
Infektionsgeschehen wird abgebildet
Die Probenentnahme erfolgt jeweils vor dem Wochenende und am darauf folgenden Montag. Das Ergebnis der Analyse an der Universität Innsbruck ist ….mehr:
https://kaernten.orf.at/stories/3106776/
(nach oben)
Abwasser-Studie in Vorarlberg: Mehr illegale Drogen in städtischen Gebieten
Abwasser-Studie in Vorarlberg: Mehr illegale Drogen in städtischen Gebieten
Eine Studie in Vorarlberg zeigt, dass in städtischen Gebieten mehr illegale Substanzen konsumiert werden, in ländlichen mehr Alkohol.
In den ländlichen Gebieten Vorarlbergs werden deutlich weniger illegale Drogen konsumiert als in den urbaneren, am wenigsten in den vom Tourismus dominierten Regionen. Das zeigt eine österreichweit einzigartige Studie, die auf Spuren von legalen und illegalen Drogen im Abwasser basiert, wie das Land …mehr:
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5962284/AbwasserStudie-in-Vorarlberg_Mehr-illegale-Drogen-in-staedtischen
(nach oben)
Teures Fehlverhalten: Müll im steirischen Kanal kostet jedes Jahr Millionen
Hygieneartikel & Co, die über die Toiletten entsorgt werden, machen den steirischen Kläranlagen zu schaffen. Die Coronakrise hat das Problem noch verschärft.
Ins steirische Abwassersystem flossen seit 1972 3,6 Milliarden . Exakt 593 Kläranlagen sind in der Steiermark das ganze Jahr über im Dauerbetrieb, um kommunale Abwässer zu reinigen.
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/5865358/Teures-Fehlverhalten_Muell-im-steirischen-Kanal-kostet-jedes-Jahr
(nach oben)
Analysen in Kläranlagen für CoV-Früherkennung
Abwasser von rund 300.000 Salzburgern, das die Kläranlage Siggerwiesen bei Bergheim (Flachgau) reinigt, wird nun in einer bundesweiten Studie auf Rückstände von Coronaviren untersucht. Weil Virenreste im Schmutzwasser sehr früh entdeckt werden können, wollen Forscher daraus ein Frühwarnsystem entwickeln.
Siggerwiesen und 20 andere Kläranlagen sind bundesweit an diesem Forschungsprojekt beteiligt. Die Viren selbst seien längst tot, wenn menschliches Abwasser die Kläranlagen erreiche, sagen die Experten. Ihre Forschung basiert auf ähnlichen Methoden, wie sie bei PCR-Virentests zur Anwendung kommen. Dazu kommen Analysen von DNA-Partikeln, die in Nährlösungen kultiviert und ausgewertet werden.
Suche nach verlässlichem Raster für Prognosen
Der Mikrobiologe Heribert Insam von der Universität Innsbruck sagt, man versuche jetzt mit vielen Daten eine gute Datenbank zu erstellen: „Dann soll man mit einem künftigen Modell hochrechnen können.“ Norbert Kreuzinger ist Experte für Wassergüte von Technischen Universität Wien: „Wir müssen sicher sein, wenn sich Trends entwickeln im Abwasser. Und dafür brauchen wir eine abgesicherte Basis mit der Wissenschaft.“
Politiker hoffen auf Entscheidungsgrundlagen
In kleinerem Rahmen arbeiten die Wissenschafter schon seit März an dem Projekt. Jetzt sollen die Daten aus größeren Kläranlagen mehr Sicherheit bringen. Die Forschung wird mit einer halben Million Euro vom Bund gefördert. Politiker hätten große Erwartungen, sagt Bundesministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP): „Es ist wichtig, dass wir sehr schnell Ausbrüche erkennen. Bevor Menschen Symptome haben, kann im Abwasser das Virus nachgewiesen werden. Wenn man das flächendeckend macht, erhoffen wir uns, schnell größere Ausbrüche zu erkennen.“
Mehr als die Hälfte des Salzburger Abwassers
In Tirol werden derzeit 43 Kläranlagen auf Coronaviren und ihre Rückstände untersucht und auch in Salzburg soll nicht nur in Siggerwiesen genauer hingeschaut werden, sagt der zuständige Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP): „Wir arbeiten dazu im Pongau, Pinzgau und hier im Flachgau. Mehr als die Hälfte aller Abwässer in Salzburg wird derzeit untersucht. Es ist wichtig, dass wir verlässliche Daten bekommen.“
Bis man aus Rückständen im Abwasser ein alltagstaugliches Frühwarnsystem für Infektionscluster entwickelt kann, soll es laut Experten aber noch einige Zeit dauern.
red, salzburg.ORF.at
https://salzburg.orf.at/stories/3063051/
(nach oben)
Corona-Analyse in 43 Tiroler Kläranlagen geplant
Frühwarnsystem
Bekanntlich lassen sich Coronaviren im Abwasser nachweisen. Ab September soll das System auf ganz Tirol ausgeweitet werden. Mit Proben aus 43 Kläranlagen lassen sich 99 Prozent der Bevölkerung…mehr:
https://www.krone.at/2208463
(nach oben)
Pilotprojekt: CoV-Tests in Kläranlagen
Das Coronavirus im Abwasser von Kläranlagen feststellen und damit eine Art Frühwarnsystem entwickeln – das ist das Ziel eines bundesweiten Forschungsprojekts. Die Steiermark ist mit den Kläranlagen in Graz und Langenwang dabei.
Kläranlagen sollen in Zukunft noch nicht entdeckte CoV-Cluster durch ihre regelmäßigen Wasserproben aufspüren. „Wir können seit geraumer Zeit hier im Wasser Rückstände von Drogen und vielem mehr finden, so auch Coronaviren, und wir wollen mit diesem Forschungsprojekt…
https://steiermark.orf.at/stories/3059734/
(nach oben)
In diesen steirischen Kläranlagen sollen Corona-Tests gemacht werden
Wie berichtet, sollen in Kläranlagen Corona-Tests zur Früherkennung stattfinden. Drei Einrichtungen in der Steiermark sind mit an Bord. Mehr:
https://www.kleinezeitung.at/international/corona/5845437/Als-Fruehwarnsystem_In-diesen-steirischen-Klaeranlagen-sollen
(nach oben)
Nachweis viraler Erbinformation im Abwasser: Projekt in Österreich
Dank einer neuen Methode konnte das Erbgut des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 erstmals im Zulauf österreichischer Kläranlagen nachgewiesen werden. Man hofft, so Hinweise auf die Dunkelziffer der mit SARS-CoV-2 infizierten Personen zu bekommen. Zwei österreichischen Forschungsgruppen – einer Gruppe um Heribert Insam von der Universität Innsbruck und dem Team von Norbert Kreuzinger an der TU Wien – gelang es gleichzeitig, das Erbmaterial von SARS-CoV-2 im Zulauf von zwei österreichischen Kläranlagen nachzuweisen. Nun soll ein Frühwarn- bzw. Monitoringsystem aufgebaut werden, mit dessen Hilfe die Gesundheitsbehörden rasch Informationen über Auftreten und Verbreitung des Virus erhalten. Forschungsteams der Medizinischen Universität Innsbruck, der Technischen Universität Wien und der Universität Innsbruck haben sich schon Anfang April 2020 zum „Coron-A“ Konsortium zusammengeschlossen, um gemeinsam herauszufinden, wie das Auftreten von SARS-CoV-2 in häuslichem Abwasser mit der Anzahl der Infektionen im Einzugsgebiet von Kläranlagen im Zusammenhang steht. Die Abwasserproben für das Projekt wurden von Kläranlagen aus Tirol und dem Großraum Wien genommen. Mittels der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) wird in dem Forschungsvorhaben nicht das aktive, infektiöse Virus nachgewiesen, sondern dessen virale RNA. Der Test reagiert somit auch auf Virenbruchstücke, die nicht infektiös sind. Selbst geringste Spuren des Virenerbguts können detektiert werden, so die beteiligten Forscher. Das Coron-A-Konsortium möchte nun einerseits weitere Untersuchungen über die Stabilität der viralen RNA in Abwasserproben durchführen, andererseits sollen in weiterer Folge österreichweit Abwasserproben in unterschiedlicher räumlicher und zeitlicher Auflösung gesammelt und analysiert werden, um die Grundlagen für ein abwasserepidemiologisches Monitoring zu schaffen. Ein regionales Wiederaufflammen der Epidemie soll sich dadurch frühzeitig erkennen lassen.
Assoz. Prof. Dr. Norbert Kreuzinger,
Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement,
Technische Universität Wien
norbkreu@iwag.tuwien.ac.at
(nach oben)
ÖWAV: überreicht Forderungspapier an Bundesministerin Maria Patek
Um die nachhaltige Sicherung der Bundesförderung für die österreichische Trink- und Abwasserwirtschaft einzufordern und auf die Herausforderungen bei der Wert- und Funktionserhaltung der siedlungswasserwirtschaftlichen Infrastruktur hinzuweisen, haben die Verantwortlichen und Partner der Trink- und Abwasserwirtschaft in Österreich unter Federführung des ÖWAV das Papier „Forderungen zur nachhaltigen Sicherung der Bundesförderung für die österreichische Trink- und Abwasserwirtschaft“ erstellt.
Am 3. Dezember 2019 überreichten ÖWAV-Präsident Roland Hohenauer (Dr. Lengyel ZT GmbH), ÖWAV-Vizepräsident Wolfgang Scherz (Abwasserverband Wiener Neustadt-Süd) und ÖWAV-Geschäftsführer Manfred Assmann das Forderungspapier an Bundesministerin Maria Patek (BMNT).
Mitgestaltet und unterzeichnet wurde dieses Papier vom Österreichischen Städtebund, dem Österreichischen Gemeindebund, der Wirtschaftskammer Österreich, der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen, der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) und dem Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV).
Funktionierende Siedlungswasserwirtschaft als ständige Herausforderung
Die Verantwortlichen und Partner der Siedlungswasserwirtschaft sprechen sich im Forderungspapier u. a. für einen Zusagerahmen für die UFG-Förderungen ab 2022 von jährlich 150 Mio. € bei unveränderter Förderungsintensität aus. Zusätzlich wird zum Abbau des aktuellen Förderrückstaus von 137 Mio. € für rund 1.700 offene Förderanträge eine Sondertranche eingefordert.
Die Förderung ist nicht nur als Finanzierungsbestandteil zu sehen, sondern vor allem auch als Lenkungs- und Anreizsystem für Investitionen, welches sozialen Ausgleich ermöglicht und adäquate Qualitätsstandards setzt. In dieser Funktion kann sie durch nichts ersetzt werden, selbst wenn man das Gebührenniveau für die Dienstleistung Siedlungswasserwirtschaft erhöhen würde.
Das Forderungspapier steht unter https://www.oewav.at/forderungspapier2019 zum Download zur Verfügung.
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=385220
(nach oben)
Donau international nur punktuell von stärkeren Fäkalbelastungen betroffen
Die Donau ist international nur punktuell von stärkeren Fäkalbelastungen betroffen. Zu diesem Ergebnis sind Wissenschaftler der MedUni Wien, Med Uni Graz, Technische Universität Wien und der Karl Landsteiner Privatuni für Gesundheitswissenschaften in Krems gekommen. Im Rahmen des mikrobiologischen Untersuchungsprogrammes des Joint Danube Survey hätten sie entlang der Donau und ihrer wichtigsten Zuläufe auf einer Strecke von 2.600 km wie schon in den Vorjahren starke fäkale Belastungen in Serbien, Rumänien und Bulgarien festgestellt, teilten die Hochschulen gemeinsam mit.
In Österreich seien keine bedenklichen Werte gemessen worden. „Verbessert hat sich erfreulicherweise die Situation in Ungarn gleich nach Budapest“, sagte Alexander Kirschner vom Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der MedUni Wien, wo das Interuniversitäre Zentrum für Wasser und Gesundheit (ICC Water & Health) angesiedelt ist.
Der alle sechs Jahre stattfindende Survey wird von der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (ICPDR) mit Unterstützung aller Donauanrainerstaaten auf Basis der EU-Wasserrahmenrichtlinie konzipiert und organisiert. „Der Schwerpunkt der mikrobiologischen Untersuchungen lag dieses Mal auf der erstmaligen Verknüpfung der Analyse des Ausmaßes und der Herkunft fäkaler Belastungen entlang der gesamten Donau mit dem Auftreten von antibiotikaresistenten, klinisch höchst bedeutsamen Bakterien sowie deren Resistenzgenen“, sagte Kirschner. Dafür sei ein neues Konzept entwickelt worden, das erstmals auch quantitative Aussagen über die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen entlang der Hauptabwasserbelastungen ermögliche. Dazu wurden an 30 Probenstellen entlang der Donau und bei weiteren acht ihrer wichtigsten Zubringer Wasser und Biofilmproben (von Steinen und Ästen) genommen und in sechs Partnerlabors in Deutschland, Österreich, Ungarn, Serbien und Rumänien aufbereitet und analysiert.
Die wichtigsten Ergebnisse über die Belastung mit Fäkalkeimen (E.coli) lägen bereits vor, während weitere Analysen noch andauerten, hieß es weiter. Wie schon bei den vorigen Surveys habe es die höchsten Belastungen der Donau in Serbien, Rumänien und Bulgarien gegeben. „In Serbien, einem Nicht-EU Land, existieren keine Abwasserkläranlagen, sodass es hier insbesondere nach großen Städten wie Novi Sad und Belgrad zu kritischen bis starken fäkalen Belastungen der Donau kommt“, sagte Projektpartner Gernot Zarfel vom Diagnostik- und Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin der Med Uni Graz.
Starke fäkale Belastungen wurden auch bei den Zubringern in Rusenski Lom (Bulgarien) und Arges (Rumänien) festgestellt, wobei die Belastung der Arges (Vorfluter der Abwässer der Hauptstadt Bukarest) gegenüber den Vorjahren eine deutliche Verbesserung zeigte. „Das ist vermutlich ebenfalls auf den Ausbau der Hauptkläranlage in dieser Millionenstadt zurückzuführen“, so Zarfel. Die in früheren Jahren noch diagnostizierte starke Belastung der Donau durch Abwässer in Ungarn nach Budapest konnte diesmal nicht gefunden werden, was ebenfalls auf den Ausbau der zentralen Kläranlage in der ungarischen Hauptstadt zurückzuführen sei, so die Experten.
Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.
(nach oben)
Österreich hält Qualitätsziele für Flüsse, Seen und Grundwasser größtenteils ein
In Österreich werden die Qualitätsziele für Grundwasser, Flüsse und Seen größtenteils eingehalten. Zu diesem Ergebnis kommt der Jahresbericht 2014-2016 zur Wassergüte des österreichischen Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT). In dem Bericht werde jedoch auch deutlich, dass zum Schutz der Gewässer künftig noch etwas zu tun sei, teilte das Ministerium in Wien mit.
Die Beobachtungsprogramme für die heimischen Gewässer hätten in Österreich eine lange Tradition und würden vom BMNT zusammen mit den Ämtern der Landesregierungen und dem Umweltbundesamt betrieben. Um alle benötigten Informationen zu erheben, seien im aktuellen Berichtszeitraum das routinemäßige, etablierte Überwachungsprogramm sowie ergänzende Sondermessprogramme durchgeführt worden.
Fast 2.000 Grundwassermessstellen wurden dem Ministerium zufolge bis zu viermal pro Jahr beprobt. Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass die vorgegebenen Schwellenwerte für die meisten der 197 chemischen und physikalisch-chemischen Untersuchungsparameter deutlich unterschritten werden. Bezüglich der Nitratbelastungen sei positiv zu vermerken, dass sich die Anzahl der Beobachtungsgebiete, bei denen der Vorsorgewert (45 mg/l Nitrat an mindestens 30 Prozent der Messstellen) überschritten wird, von sieben auf sechs verringert habe. In der langfristigen Entwicklung der Nitrat-Schwellenwertüberschreitungen (1997 bis 2016) hätten sich geringe Schwankungen gezeigt.
Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen.
(nach oben)
Rund 127 Mio. Euro Fördermittel für Projekte der Wasserwirtschaft freigegeben
Das österreichische Umweltministerium stellt rund 127 Mio. Euro für fast 1.200 Projekte im Hochwasserschutz sowie in der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung bereit. Das habe die Kommissionssitzung Wasserwirtschaft beschlossen, teilte das Ministerium in Wien mit. Dadurch werde ein Investitionsvolumen von ca. 440 Mio. Euro ausgelöst.
Insbesondere die Auswirkungen des Klimawandels machten verstärkte Investitionen in die wasserbezogene Infrastruktur notwendig, erklärte das Ministerium. Starkregenereignisse würden immer häufiger und überforderten die Hochwasserschutzvorrichtungen sowie die hydraulischen Kapazitäten der bestehenden Kanäle. Zusätzlich verursachten ausgedehnte sommerliche Dürreperioden nicht nur im pannonischen Osten Österreichs, sondern auch im Alpenraum Probleme bei der Trinkwasserversorgung.
Den Angaben zufolge hat die Kommissionssitzung Wasserwirtschaft insgesamt 717 Projekte für die kommunale Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung mit rund 50,4 Mio. Euro genehmigt. Im Bereich Hochwasserschutz wurden neben 440 Projekten des vorbeugenden Hochwasserschutzes und der Instandhaltung von bestehenden Anlagen mit einer Bundesförderung von rund 67,4 Mio. Euro auch Sofortmaßnahmen für die vom kürzlichen Hochwasserereignis betroffenen Bereiche Kärntens und Osttirols genehmigt.
Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der nächsten Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.
(nach oben)
1. Publikation der „Jungen Abfallwirtschaft im ÖWAV“
„Abfallwirtschaft 2050 – Bringen neue Herausforderungen auch neue Aufgaben?“
Wie beeinflusst der technische Fortschritt unser zukünftiges Wohnen, die Energieversorgung und wie sehen im Jahr 2050 unsere Ernährungsgewohnheiten, die Produktion, die Güterversorgung und vor allem die Abfallbehandlung aus?
Diese Fragestellungen wurden im Rahmen eines ÖWAV-Workshops der Jungen Abfallwirtschaft (https://www.oewav.at/page.aspx?target=308379) diskutiert und die Ergebnisse grafisch sowie textlich in der ersten Publikation der Jungen Abfallwirtschaft „Abfallwirtschaft 2050“ zusammengefasst. Der Fokus lag auf den Herausforderungen und Aufgaben der europäischen Abfallwirtschaft im Jahr 2050.
Die Publikation steht Ihnen kostenlos als >> Download << zur Verfügung.
>> Weitere Informationen zur „Jungen Abfallwirtschaft im ÖWAV“ finden Sie >> hier <<
Quelle: https://www.oewav.at/Page.aspx?target=309195
(nach oben)
Erfahrungsaustausch Abwasser 2017
Am 8. und 9. November 2017 fand auf Einladung der Graz Holding der 42. Erfahrungsaustausch für Führungskräfte der kommunalen Abwasserwirtschaft im Kompetenzzentrum Wasserwirtschaft der Graz Holding in Graz statt.
Die rund 80 teilnehmenden Obmänner/Obfrauen, GeschäftsführerInnen und BetriebsleiterInnen aus dem Bereich der Abwasserwirtschaft wurden vom Geschäftsführer des ÖWAV, DI Manfred Assmann, vom Vorstandsdirektor der Graz Holding, Dr. Gert Heigl, sowie, später des Tages, vom Ehrenpräsident des ÖWAV HR DI Johann Wiedner begrüßt. Der Vorsitzende der ARGE Abwasser, BR h.c. DI Dr. Wolfgang Scherz, MBA (GF AWV Wr. Neustadt Süd) eröffnete schon traditionell mit dem jährlichen Tätigkeitsbericht die Veranstaltung.
DI Manfred Assmann übernahm die Moderation des ersten Vormittages. Nicht nur technische Themen standen am Programm, sondern auch rechtliche und kaufmännische Inhalte. Neben einem Vortrag zur Softwarenutzung im Kanalmanagement (DI Schwarz, WV Ossiacher See) wurde von GF Mag. Maria Bogensberger (Fa. Quantum) die Studie „Volkswirtschaftliche Aspekte der Wasserwirtschaft“ vorgestellt. Mit einem Beitrag zur Meldeverpflichtung in der Novelle zum Bundesvergabegesetz versuchte RA Mag. Wilhelm Offenbeck Klarheit zu schaffen. Den Abschluss der Vortragsveranstaltung am Vormittag bildete die Vorstellung der Graz Holding, insbesondere des Geschäftsbereichs Abwasser, durch dessen Geschäftsführer und Mitglied des Leitungsausschusses der ARGE Abwasser, DI Kajetan Beutle.
Das Programm des ersten Tages wurde durch die Besichtigung der Baustelle rund um das Murkraftwerk und den zentralen Speicherkanal abgerundet. Den Abschluss bildete ein Empfang auf Einladung der Graz Holding und der Stadt Graz am Schloßberg.
Am zweiten Tag, den BR h.c. DI Dr. Wolfgang Scherz, MBA moderierte, lag der Fokus im Bereich der Unfallverhütung und Sicherheit. Nach einem Beitrag über die Bewilligungspflicht und die Absicherung von Kanalarbeiten im Straßenraum (Dr. Herbert Wimmer, KSMS) wurde in zwei Vorträgen zum Thema Elektrotechnik einerseits erklärt „E-Technik: Wer darf was?“ (Ing. Michael Köstler, Hydroingenieure Umwelttechnik GmbH) und andererseits die wiederkehrenden Überprüfungen in der E-Technik erläutert (Karl Palkowitz, AWV Schwechat).
Zum Schluss der Veranstaltung bot sich noch die Möglichkeit offene Fragen zu behandeln und verschiedenen Themen zu diskutieren. Vor allem das Thema „Datenschutz“ und die neue Datenschutzgrundverordnung wurden intensiv besprochen.
Der ÖWAV möchte sich bei der Graz Holding und allen TeilnehmerInnen recht herzlich für den gelungenen Erfahrungsaustausch und die rege Diskussion bedanken.
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=303261
(nach oben)
ÖWAV-Vollversammlung 2017
Am 4. Mai 2017 lud der ÖWAV zur Vollversammlung in die Räumlichkeiten der Kommunalkredit Austria AG ein.
Im Rahmen der Vollversammlung erstatteten das Präsidium, der Geschäftsführer sowie die Rechnungsprüfer ihre Berichte.
Einen detaillierten Veranstaltungsbericht finden Sie hier: http://www.oewav.at/Page.aspx?target=288193&
(nach oben)
ÖWAV-Leitbild veröffentlicht
Im Rahmen der ÖWAV-Vollversammlung, die am 4. Mai 2017 stattgefunden hat, wurde unter anderem das neu veröffentlichte Leitbild des ÖWAV präsentiert. Im Mittelpunkt dieses Leitbilds steht die Vision „zukunft denken“, die auch im Logo des Verbandes verankert ist.
Übersichtich und prägnant werden die vier zentralen Botschaften „Leistungen für Mitglieder“, „Netzwerkplattform“, „Unabhängigkeit und fachliche Kompetenz“ sowie „Kompetenz und Verantwortung“ erstmals definiert.
Das Leitbild richtet sich an alle Stakeholder, mitumfasst sind selbstverständlich alle Mitgliedsorganisationen und MitarbeiterInnen.
Quelle: http://www.oewav.at/Page.aspx?target=288320&
(nach oben)
EU-Kommission fordert von Österreich die Umsetzung der Richtlinie über prioritäre Stoffe
Die Europäische Kommission fordert Österreich auf, die Richtlinie über prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik in innerstaatliches Recht umzusetzen. Dies hätte bereits bis zum 14. September 2015 geschehen müssen. Nachdem Österreich die ursprüngliche Frist hatte verstreichen lassen, übermittelte die Europäische Kommission am 20. November 2015 ein Aufforderungsschreiben. Da die innerstaatlichen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie sich nach wie vor im Stadium der Konsultation und der Prüfung befinden, folgt nun eine mit Gründen versehene Stellungnahme. Österreich muss nun der Kommission binnen zwei Monaten die Maßnahmen melden, die es ergriffen hat, um seine Rechtsvorschriften mit dem EU-Recht in Einklang zu bringen. Andernfalls kann die Kommission beim Gerichtshof der Europäischen Union Klage einreichen.
(nach oben)
Forderungspapier Siedlungswasserwirtschaft unterzeichnet
Um die Fortführung einer dem Bedarf entsprechenden Dotierung der Bundesförderung zur Finanzierung der Siedlungswasserwirtschaft einzufordern und insbesondere auf die Herausforderungen einer dauerhaften Erhaltung der siedlungswasserwirtschaftlichen Infrastruktur hinzuweisen, erstellten die Verantwortlichen und Partner der Siedlungswasserwirtschaft in Österreich ein gemeinsames Forderungspapier mit dem Titel „Forderungen zur Finanzierung der österreichischen Siedlungswasserwirtschaft“, unterzeichnet vom Österreichischen Städtebund, dem Österreichischen Gemeindebund, der Wirtschaftskammer Österreich, der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach und dem Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV).
Ausgangssituation – Problemstellung
Seit 1960 wurden in Österreich über € 58 Mrd. in die erstmalige Errichtung und den Ausbau der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen und der Abwasserentsorgungsanlagen investiert. Neben dem Gesundheits- und Umwelteffekt wurden dadurch tausende Arbeitsplätze geschaffen, allein im Jahr 2015 mehr als 7.000. Dadurch wurde zwar in diesem Sektor schon sehr viel erreicht, dennoch besteht auch künftig dringender Handlungsbedarf.
Folgende Herausforderungen stellen sich in den nächsten Jahren:
• Dauerhafte Sicherstellung der Funktion durch Sanierung:
Ziel: Erhöhung der Sanierungs- und Reinvestitionsraten zur Sicherung der hohen Qualität der Ver- und Entsorgung.
• Ersterschließung bei Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung:
Ziel: Fertigstellung der Ersterschließung vor allem im ländlichen Bereich; Adaptierung der Infrastruktur infolge des demografischen Wandels.
• Anpassungen an den Klimawandel und die längeren Trockenphasen:
Ziel: Stärkung der Infrastruktur vor allem im Bereich der Trinkwasserversorgung.
Forderungen
Die Verantwortlichen und Partner der Siedlungswasserwirtschaft sprechen sich deswegen im Forderungspapier für die Jahre 2017 und 2018 für einen Zusagerahmen von zumindest jeweils € 150 Mio. und für die Folge jeweils € 120 Mio. aus. Dieser Bedarf lässt sich eindeutig aus der Investitionskostenerhebung Siedlungswasserwirtschaft ableiten (Investitionsbedarf: € 5,5 Mrd. bis 2021).
Das neue Fördersystem zur Erneuerung und Sanierung der wasserbaulichen Infrastruktur würde nicht nur eine flächendeckende Ver- und Entsorgung zu sozial verträglichen Gebühren, sondern durch Investitionen in die Bauwirtschaft auch eine entsprechende Wertschöpfung und die Sicherung von Arbeitsplätzen bewirken.
„Eine funktionierende Siedlungswasserwirtschaft ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine ständige Herausforderung!“
Abschließend möchte sich der ÖWAV bei allen mittragenden Organisationen für die gute Zusammenarbeit bedanken und ersucht die politischen EntscheidungsträgerInnen um ihre Unterstützung zur Sicherstellung des guten Standards der Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und somit des Gewässerschutzes in Österreich.
http://www.oewav.at/page.aspx?target=193865
(nach oben)
Österreichische Siedlungswasserwirtschaft fordert 150 Millionen Euro für die Jahre 2017 und 2018
Die österreichische Siedlungswasserwirtschaft muss im Jahr 2017 und 2018 mindestens mit jeweils 150 Millionen Euro und in den Folgejahren mit jeweils 120 Millionen Euro gefördert werden. Das haben der Österreichische Städtebund, der Österreichische Gemeindebund, die Wirtschaftskammer Österreich, die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach und der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) gegenüber der Bundesregierung in Wien deutlich gemacht.
http://www.euwid-wasser.de/news/international/einzelansicht/Artikel/oesterreichische-siedlungswasserwirtschaft-fordert-150-millionen-euro-fuer-2017-und-2018.html
(nach oben)
Branchenbild der österreichischen Abwasserwirtschaft 2016 veröffentlicht
Im Jänner 2016 wurde erstmals das „Branchenbild der österreichischen Abwasserwirtschaft“ veröffentlicht, das einen kompakten, aktuellen Überblick über die Abwasserwirtschaft in Österreich gibt. Das Branchenbild wurde vom Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) gemeinsam mit der Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) erstellt.
ÖWAV-Präsident Roland Hohenauer (Dr. Lengyel ZT GmbH), die ÖWAV-Vizepräsidenten Michael Amerer (VERBUND) und Gerhard Fenzl (Amt der OÖ Landesregierung), ÖWAV-GF Manfred Assmann sowie KPC-Abteilungsleiter Johannes Laber werden das Branchenbild im März 2016 persönlich an Bundesminister Andrä Rupprechter übergeben.
Die interessierte Öffentlichkeit, die Abwasserbranche und insbesondere die Politik erhalten mit dem Branchenbild die Möglichkeit, sich über die Leistungen der österreichischen Abwasserwirtschaft, die Vielfalt ihrer Aufgaben und die aktuellen Herausforderungen an die Branche zu informieren. Inhaltliche Schwerpunkte sind neben den technischen Kennzahlen vor allem auch der volkswirtschaftliche Nutzen für Österreich, die Leistungen der Branche für die Gesellschaft, die große Bedeutung des Funktions- und Werterhaltes der Anlagen und Netze sowie der damit verbundene künftige Investitionsbedarf.
Das Branchenbild zeigt, dass die österreichische Abwasserwirtschaft dank ihrer gut ausgebildeten Fachkräfte auf einem sehr hohen Niveau arbeitet. Damit werden der Schutz der Gewässer und des Grundwassers als Basis für eine hochwertige Trinkwasserversorgung dauerhaft gesichert. Die Abwasserwirtschaft ist somit ein ausgezeichnetes Beispiel für die innovative Umwelttechnologie Österreichs, die internationale Anerkennung genießt.
Der Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich und die Qualität der Wasserressourcen haben stark von den getätigten Investitionen profitiert, es bleibt aber noch viel zu tun. So ist und bleibt es eine Herausforderung, den hohen Standard der Abwasserreinigung durch effizienten Betrieb der Anlagen zu erhalten. Dafür sind laufende Wartungs-, Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, Anpassungen an den Stand der Technik und die Neuerrichtung von Anlagen nötig. Generell hat sich der Schwerpunkt der Abwasserwirtschaft von der Errichtung zur Erhaltung der Anlagen verschoben. Die Etablierung wirtschaftlicher Instrumente in der Betriebsführung im Sinne eines modernen Assetmanagements stellen ebenfalls einen Schwerpunkt für die Zukunft dar.
Die österreichische Abwasserwirtschaft leistet zudem einen wesentlichen Beitrag zur Volkswirtschaft, aus Sicht der Wertschöpfung, der Beschäftigungszahlen und der Sicherung des Wirtschaftsstandorts.
Die Leistungserbringung und der Beitrag zur österreichischen Volkswirtschaft werden nicht zuletzt durch den Einsatz von Fördermitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie der Bundesländer ermöglicht. Auch in Zukunft sollten Förderungen entscheidend dazu beitragen, positive Impulse und Investitionsanreize zu schaffen.
Das Branchenbild der österreichischen Abwasserwirtschaft steht auf der Homepage des ÖWAV (www.oewav.at/publikationen) sowie der KPC (www.umweltfoerderung.at) zum Gratisdownload zur Verfügung.
(nach oben)
Österreich: 10-Punkte-Plan gegen Plastik in Gewässern
Österreich will den Eintrag von Plastik-partikeln in die Gewässer deutlich verringern. Dies betonte Österreichs Umweltminister Andrä Rupprechter Mitte März anlässlich der Präsentation von zwei Studien über die Qualität der Donau in Wien. Die Untersuchung „Plastik in der Donau“ zeigt auf, dass jährlich ca. 40 Tonnen Plastik über die Donau aus
Österreich abtransportiert werden. Der Großteil davon stammt aus diffusen Quellen. Mit einem 10-Punkte-Maßnah-menprogramm will Österreich nun auf europäischer und nationaler Ebene diesen Eintrag deutlich reduzieren. Auf europäischer Ebene schlägt das Maßnahmenprogramm einheitliche Methoden und Messstandards für Plastikpartikeln in Fließgewässern, die Festlegung von EU-Grenzwerten, einen freiwilligen Aus-stieg der europäische Kosmetikbranche, eine Mikroplastikkonferenz in Brüssel und die Aufnahme in den Umweltbericht 2020 der Europäischen Umweltagentur sowie die Umsetzung einer „Plastiksackerl-Richtlinie“ vor . Auf nationaler Ebene beinhaltet das angedachte Maßnahmenprogramm einen Stakeholder-Dialog zur Donaustudie, einen „Zero-Pellets-Pakt“, die Weiterführung des Messpro-gramms an der Donau und ausgewählten Flüssen gemeinsam mit den Bundesländern, verschiedene Bewusstseinsbildungsmaßnahmen gemeinsam mit Bundesländern/Abfall- und Abwasserverbänden sowie die Bewusstseinsbildung des Umweltministeriums zum Green Event
Song Contest . Eine Zero-Pellets-Loss-Initiative hat das Umweltministerium bereits mit der Kunststoffindustrie ins Leben gerufen. Geplant sind hier technologische Verbesserungen, um Umweltbelastungen weiter zu reduzieren.
(nach oben)
Österreich fordert europäische Strategien für Plastik in Gewässern
Österreich fordert von der EU Strategien zur Bekämpfung der Plastikfrachten in Oberflächengewässern. Flüsse machten nicht an nationalen Grenzen halt, Plastikpartikel in den Flüssen auch nicht. Wenn es um die Identifizierung der Verschmutzungsquellen, um einheitliche Messmethoden in Gewässern und um europaweit vergleichbare Daten gehe, sei ein EU-weites Vorgehen gefordert, betonte das österreichische Umweltministerium anlässlich der Konferenz „Eliminating Plastic and Microplastic Pollution – an urgent need“ in Brüssel. Die Konferenz wurde vom österreichischen Umweltministerium gemeinsam mit einer Reihe von Partnerorganisationen, wie dem Netzwerk der Europäischen Umweltagenturen, dem auch das Österreichische Umweltbundesamt angehört, dem Niederländischen Umweltministerium und der Konvention zum Schutz der Nord-Ostsee (OSPAR) organisiert. Ziel der Konferenz war es, europaweit Maßnahmen zur Eliminierung der Mikroplastikverschmutzung in Flüssen und Meeren zu forcieren. Konkrete Ziele Österreichs sind der freiwillige Verzicht der Kosmetikindustrie auf Mikroplastik sowie die Reduktion von Plastiktüten.
(nach oben)
ÖWAV-Vollversammlung 2015: Roland Hohenauer zum Präsidenten gewählt
Am 7. Mai 2015 lud der ÖWAV seine Mitglieder zur Vollversammlung in die Räumlichkeiten der Kommunalkredit Public Consulting in Wien. Neben der Präsentation des Tätigkeitsberichts 2014/15 standen vor allem die Neuwahlen des Präsidiums, des Vorstands und der Rechnungsprüfer im Mittelpunkt.
BR h.c. DI Roland Hohenauer wurde einstimmig zum neuen ÖWAV-Präsidenten für die Funktionsperiode 2015 – 2019 gewählt, er folgt damit HR DI Johann Wiedner nach, der das Land Steiermark weiterhin im Vorstand vertreten wird. Neu im ÖWAV-Präsidium sind die VizepräsidentInnen Mag. Maria Bogensberger (Quantum GmbH), HR DI Gerhard Fenzl (Amt der OÖ Landesregierung) und GF DI Walter Scharf (IUT GmbH), Vorsitzender der Fachgruppe Abfallwirtschaft und Altlastensanierung. Vorstandsdir. Ing. Mag. Michael Amerer, SC DI Christian Holzer und SC DI Wilfried Schimon sind weiterhin Mitglieder des Präsidiums.
Der ÖWAV bedankt sich auch an dieser Stelle ganz herzlich bei Johann Wiedner für seine Tätigkeit als ÖWAV-Präsident in den Jahren 2011 – 2015 und beim langjährigen Vizepräsidenten o.Univ.-Prof DI Dr. Paul H. Brunner, der im Herbst in den Ruhestand treten wird und seine Funktionen beim ÖWAV niederlegt.
Im Anschluss an die Vollversammlung lud der ÖWAV zu einem Präsidentenempfang in den Räumen der KPC.
http://www.oewav.at/Page.aspx?target=184768&
(nach oben)
Neptun Wasserpreis: Jetzt für die Wasserpreisgemeinde 2015 abstimmen!
Heuer gibt es beim Neptun Wasserpreis eine Premiere: Erstmals wird Österreichs „Wasserpreisgemeinde 2015″ ermittelt – das ist die Gemeinde, welche sich am stärksten im Bereich Wasser engagiert. Die über 200 Vorschläge und Einreichungen in dieser neuen Kategorie zeigen die große Bedeutung und Bandbreite der vorgestellten Projekte.
Online-Voting
Unter den zahlreichen Gemeindevorschlägen aus den sieben teilnehmenden Bundesländern haben fachkompetente Landesjurys bereits die Siegergemeinden auf Landesebene ermittelt: Die sieben Gemeinden Zemendorf-Stöttera (Bgld), Lunz am See (NÖ), Linz (OÖ), Rauris (Sbg), Übelbach (Stmk), Telfs (Tirol) und Hard (Vbg) sind nominiert. Ab sofort entscheidet das Publikum via Online-Voting auf www.wasserpreis.info, welche der sieben Gemeinden als Österreichs Wasserpreisgemeinde 2015 ausgezeichnet wird. Das Abstimmen lohnt sich: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden attraktive Preise wie Thermeneintritte, Gartenbewässerungssysteme und Frottiersets verlost. Das Onlinevoting läuft bis 29. Jänner 2015.
Schönster Wasserplatz
Mittlerweile schon ein Klassiker ist der Wiener Publikumswettbewerb – heuer wurde hier der schönste Wasserplatz gesucht. Dabei steht der Badeplatz an der Donauinsel, in der Lobau und im Lieblingsschwimmbad genauso im Mittelpunkt wie der Wasserspielplatz oder die urbane Entspannung am Donaukanal – die besten Beiträge werden mit insgesamt 3.000 Euro prämiert. 10 kreative Foto- und Filmbeiträge wurden von einer Fachjury aus den über 400 Einreichungen ausgewählt – auch diese stellen sich ab sofort dem Online-Voting.
Hohes Niveau bei Facheinreichungen
Unter den über 200 Einreichungen in den drei Fachkategorien des Neptun Wasserpreises finden sich viele innovative und kreative Projekte. Die Kategorien widmen sich den Themen Forschung und Entwicklung der Ressource Wasser (FORSCHT), sorgsame globale Wassernutzung (GLOBAL) sowie zeitgenössische Kunst zum Thema Wasser (KREATIV). Die PreisträgerInnen in den Fachkategorien werden über Fachjurys ermittelt, die Sieger-Projekte mit je 3.000 Euro prämiert.
Über den Neptun Wasserpreis
Ziel des Neptun Wasserpreis ist es, verstärktes Bewusstsein für die Wichtigkeit der Ressource Wasser zu schaffen und innovative Ideen zum schonenden Umgang mit dem kostbaren Nass zu unterstützen. Bereits zum neunten Mal haben das Ministerium für ein lebenswertes Österreich, das Wirtschaftsministerium, die Wasserverbände ÖVGW und ÖWAV in Zusammenarbeit mit den Landesregierungen und der Salzburg AG sowie den Partnern Kommunalkredit Public Consulting, Wiener Wasser und Verbund den Neptun Wasserpreis ausgeschrieben. Die Preisträgerinnen und Preisträger aller Kategorien werden rund um den Weltwassertag, am 22. März 2015 bekannt gegeben.
Weitere Informationen: www.wasserpreis.info und www.facebook.com/neptun.wasserpreis
(nach oben)
Präsentation der Initiative VOR SORGEN
Mit VOR SORGEN treten der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) und die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) zusammen mit Städte- und Gemeindebund, allen Bundesländern und dem BMLFUW für den Erhalt der Trink- und Abwassernetze in Österreich ein.
Allgemeine Informationen: www.wasseraktiv.at/vorsorgen
Der Erhalt unserer Trink- und Abwassernetze ist eine der großen Aufgaben für die kommenden Jahrzehnte. Um Sie bei Ihrem Bemühen zu unterstützen, die Dringlichkeit des Erhaltes der Trink- und Abwassernetze im Rahmen Ihrer Veranstaltungen und Medien aufzuzeigen, werden von der Initiative VOR SORGEN aktuelle Präsentationsunterlagen (Powerpoint-Präsentation und PDF-Unterlage) in verschiedenen Varianten zum Download zur Verfügung gestellt. Zur Auswahl stehen eine Gesamtpräsentation sowie zwei auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmte Präsentationen zu den Bereichen Kanal und Trinkwasser.
Ebenfalls als Download erhältlich ist das VOR SORGEN Informationsvideo – unterteilt in Kapitel zur gezielten Auswahl für die jeweilige Zielgruppe.
Die Bestellmöglichkeit von Foldern und Plakaten sowie die kostenlose Buchung der Info-Ausstellung sind hier ebenfalls verlinkt.
Download und Informationen: www.wasseraktiv.at/vorsorgen/infomaterial
(nach oben)
Wasserwirtschaftliche Infrastrukturprojekte als wichtige Impulsgeber
Rund 1,19 Millionen Euro freigegeben – LH Wallner und LR Schwärzler: „Unverzichtbare Investitionen in die Lebens- und Standortqualität“
Bregenz (VLK) – Wasserwirtschaftliche Infrastrukturprojekte wie etwa der Erhalt bzw. Ausbau von Wasserversorgungs- oder Abwasserbeseitigungsanlagen sind für die verantwortlichen Gemeinden und Verbände mit einem beachtlichen Kostenaufwand verbunden. Um erforderliche Investitionen trotzdem garantieren zu können, tritt das Land auch in diesem Bereich als verlässlicher Partner auf, betonen Landeshauptmann Markus Wallner und Wasserwirtschaftsreferent Landesrat Erich Schwärzler. Für acht Projekte im Bereich Siedlungswasserbau hat die Landesregierung kürzlich in Summe erneut rund 1,19 Millionen Euro freigegeben.
„Ein vorrangiges Anliegen der Landesregierung ist und bleibt es, die mit einer Fülle von Herausforderungen konfrontierten Vorarlberger Gemeinden bestmöglich zu entlasten und ihnen beim Erhalt und Ausbau ihrer Infrastrukturen engagiert zur Seite zu stehen“, bekräftigt Landeshauptmann Markus Wallner. Wenn es darum geht, den Lebensraum im Sinne der Menschen positiv weiterzuentwickeln, werden sich die Gemeinden auch in Zukunft auf das Land verlassen können, versichert Wallner.
Unverzichtbare Grundausstattung
Landesrat Schwärzler unterstreicht die Zuständigkeit und Verantwortung der öffentlichen Hand für die Wasserwirtschaft: „Wasser ist unser wichtigster Bodenschatz. Ihn gilt es zu schützen und im Eigentum zu bewahren, damit nachfolgende Generationen ebenso die Möglichkeit haben, über das Trinkwasservorkommen im Land selbst zu verfügen.“ Land und Gemeinden würden auch in Sachen Siedlungswasserbau sehr eng zusammenarbeiten. „Für die Attraktivität einer Gemeinde und für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger vor Ort gehört ein gut ausgebautes Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsnetz zur Grundausstattung“, betont der Landesrat. Wert und Notwendigkeit einer intakten Wasser-Infrastruktur werden von Landesseite immer wieder mit unterschiedlichen Aktivitäten und Aktionen ins Bewusstsein gerufen.
Wichtige Projekte
Die vom Land zugesagten Mittel fließen in den Ausbau von Wasserversorgungsanlagen in den Gemeinden Röns und Bürserberg. In den Städten Bregenz und Hohenems, den Marktgemeinden Lustenau und Rankweil und in der Gemeinde Tschagguns werden Abwasserbeseitigungsanlagen erneuert, saniert oder erweitert. Außerdem wurde dem Abwasserverband Region Walgau für die Anbringung einer Photovoltaikanlage bei der Abwasserreinigungsanlage eine Förderung zugesichert. Die Gesamtinvestitionskosten für alle acht Projekte zusammen belaufen sich auf insgesamt mehr als 5,6 Millionen Euro. „Damit sind Infrastrukturprojekte im Bereich der Wasserwirtschaft auch wichtige Impulsgeber für die heimische Wirtschaft“, betont Landeshauptmann Wallner
http://presse.cnv.at/land/dist/vlk-47781.html
(nach oben)
Land fördert den Betrieb von kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen
LH Wallner und LR Schwärzler: „Wichtige Finanzhilfe vor allem für kleinere Gemeinden“
Bregenz (VLK) – Für den Betrieb ihrer Abwasserbeseitigungsanlagen erhalten heuer 19 der 96 Vorarlberger Gemeinden finanzielle Unterstützung vom Land. Insgesamt werden 661.000 Euro ausbezahlt, informieren Landeshauptmann Markus Wallner und der für die Bereiche Umwelt und Wasser zuständige Landesrat Erich Schwärzler. „Das ist eine von etlichen Unterstützungsmaßnahmen des Landes, die darauf abzielt, die Gemeinden wirksam zu entlasten“, erklärt der Landeshauptmann.
Von dem Landesbeitrag würden vor allem kleinere Gemeinden bzw. der ländliche, weniger dicht besiedelte Raum Vorarlbergs profitieren, führt Wallner aus: „Im Mittelpunkt steht die Sicherung von gleichwertigen Lebensbedingungen auch abseits der großen Ballungszentren“. Werden diese Gemeinden in die Lage versetzt, ihre vielfältigen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen, steigt die Lebensqualität vor Ort und die Bevölkerung profitiert. Daher werde das Land auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für die Kommunen bleiben, versichert der Landeshauptmann: „Vorarlbergs Gemeinden können weiterhin auf die Unterstützung des Landes zählen, wenn es um die Sicherung ihrer kommunalen Infrastrukturen geht.“
Gebühren auf leistbarem Niveau
Der Zuschuss an die Gemeinden für den Betrieb ihrer Abwasserbeseitigungsanlagen wirkt sich auch bei den Kanalgebühren positiv aus. „Die Preise werden durch die Förderung für die Menschen auf einem leistbaren Niveau gehalten“, betont Landesrat Schwärzler. Für den Landesrat sichert diese Förderung auch die Lebensqualität in allen Teilen Vorarlbergs: „Für die Attraktivität einer Gemeinde und für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger vor Ort gehört ein gut ausgebautes Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsnetz zur Grundausstattung“. Der Betrieb, Erhalt und Ausbau der gut entwickelten Infrastruktur stelle eine permanente Herausforderung dar, die Land und Gemeinden nur gemeinsam bewältigen können, macht der Landeshauptmann abschließend deutlich.
Redakteur: Mag. Wolfgang Hollenstein
http://presse.cnv.at/land/dist/vlk-46616.html
(nach oben)
Gemeinsam sind wir stärker
Acht Gemeinden beschließen Zusammenarbeit
Die Anforderungen an die Abwasserwirtschaft liegen zunehmend
im Betrieb der Abwasseranlagen sowie in deren Wert und
Funktionserhalt. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden,
wird im Bundesland Oberösterreich verstärkt auf die Bildung
effizienter Organisationsformen mit Zielrichtung interkommunale
Zusammenarbeit gesetzt. Acht Kommunen im oberen Donautal
zwischen Passau und Linz haben sich dieser Herausforderung
gestellt. Nachdem das Land Oberösterreich bereits im
Vorfeld eine eigene Studie zu diesem Thema in Auftrag gegeben
hatte, wurde in intensiver Detailarbeit, unter Einbindung
aller Beteiligter ein Konzept erarbeitet, wie die Aufgabenwahrnehmung
im Rahmen einer Kooperation erfolgen sollte. Die
Prozessbegleitung erfolgte durch die Koordinierungsstelle in
der Abwasserwirtschaft des Landes Oberösterreich. Im…
den ganzen Artikel lesen Sie unter:
https://klaerwerk.info/DWA-Informationen/KA-Betriebs-Infos#2014-1
Verantwortlich
Kanalwartungsverband Oberes Donautal
Niederranna 77, 4085 Wesenufer, Österreich
Tel. +43 (0)72 85/2 46 94
E-Mail: office@kwv-oberesdonautal.at
(nach oben)
Vorarlberg: 95,5 Mio. Euro fließen in Wasserwirtschaft
Heuer werden insgesamt 97,5 Millionen Euro für wasserwirtschaftliche Projekte in Vorarlberg investiert – davon kommen 17,6 Millionen Euro vom Land. Bund und Interessenten steuern die restlichen Mittel bei.
Die Trinkwasserversorgung sichern, Abwässer sammeln und reinigen, um Bäche und Flüsse rein zu halten und die Siedlungsräume bestmöglich gegen Hochwasser schützen – so fassen Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) die Investitionsschwerpunkte zusammen. Um die in der …mehr:
http://vorarlberg.orf.at/news/stories/2580227/
(nach oben)
Initiative in Österreich: VOR SORGEN: Sauberes Trinkwasser – sichere Abwasserentsorgung
Wer daheim den Wasserhahn aufdreht, will sauberes Trinkwasser genießen. Wer die Klospülung betätigt, möchte sein Abwasser sicher entsorgt wissen. Fast alle Haushalte in Österreich können darauf voll vertrauen – sie sind an das öffentliche Trink- und Abwassernetz angeschlossen. „Österreich hat eines der besten Trink- und Abwassersysteme der Welt. Dafür haben wir seit dem Jahr 1959 den stolzen Betrag von 55 Mrd. Euro investiert“, bilanziert Umweltminister Niki Berlakovich. Diese Netze von enormem Wert müssen gepflegt und erhalten werden, und die dafür nötige Finanzierung muss gesichert werden. Mit „VOR SORGEN“ tritt daher die Branche (ÖWAV und ÖVGW) zusammen mit Städte- und Gemeindebund, allen Bundesländern und dem Lebensministerium für den Erhalt der Trink- und Abwassernetze in Österreich auf.
Kommunen und lokale Wasser- und Abwasserverbände sowie alle interessierten Menschen und vor allem die EntscheidungsträgerInnen vor Ort werden in den kommenden Monaten mit Foldern, Plakaten und im Internet (www.wasseraktiv.at/vorsorgen) darüber informiert, wie wichtig es ist diese Systeme zu erhalten und was die besten Strategien und Maßnahmen sind. Ein Online-Schnelltest für Gemeinden und Verbände ermittelt ab März 2013 den kommenden Investitionsbedarf für das Leitungsnetz der eigenen Gemeinde oder den eigenen Verband in einer ersten groben Analyse für die kommenden 10 Jahre. Die eigenen Erhaltungsbemühungen und Erfordernisse der Gemeinde können mit jenen anderer Kommunen verglichen werden. Gleichzeitig startet eine Informationstour durch alle neun Bundesländer mit Veranstaltungen und Events, die von einer kompakten Info-Ausstellung begleitet werden.
Insgesamt sind in Österreich ca. 165.700 Kilometer an öffentlichen Trink- und Abwasserleitungen verlegt. 9 von 10 Haushalte sind an die öffentliche Ver- und Entsorgung angeschlossen. Viele Trink- und Abwasseranlagen, die schon vor Jahrzehnten errichtet wurden, müssen nun oder in den nächsten Jahren erneuert werden. Geschieht das nicht, so droht eine Zunahme von typischen Schäden am System wie undichten Leitungen, Rohrbrüchen oder Verstopfungen. Also geht es um den Erhalt einer sicheren Trinkwasserversorgung auf höchstem Niveau und um den Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen aus Abwasserkanälen.
VOR SORGEN – eine breite Initiative
Wie wichtig der Erhalt funktionierender Trink- und Abwassersysteme für die Gemeinde, die Stadt, die Region, ja für Wirtschaft, Umwelt und Tourismus im ganzen Land ist, soll den EntscheidungsträgerInnen sowie den BürgerInnen noch stärker bewusst werden. Gemeinsam sollen die Gemeinden, die Länder und auch der Bund die nötigen Erhaltungs- und Sanierungsstrategien formulieren und deren Finanzierung und Umsetzung langfristig sicher stellen. Das Lebensministerium unterstützt VOR SORGEN daher zusammen mit allen neun Bundesländern sowie dem Städte- und Gemeindebund, dem ÖWAV (Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband) und der ÖVGW (Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach).
Erfahren Sie mehr über die Initiative und besuchen Sie die Website www.wasseraktiv.at/vorsorgen. Dort können Sie auch weitere Detailinformationen zu den Themen Prüfen, Sanieren und Erhalten oder Info-Material wie Folder oder Plakate bestellen.
http://www.oewav.at/Page.aspx?target=160423&
(nach oben)
Österreich: Rufbereitschaftsdienste für kommunale Abwasseranlagen(Kanalisations- und Kläranlagen)
ÖWAV-Merkblatt
Allgemeines
Kommunale Abwasseranlagen weisen heute zumeist einen hohen Automatisierungsgrad für die meisten Prozesse auf und können daher zeitweise auch ohne ständige Anwesenheit von Personal betrieben werden. Um aber kurzfristig auf Probleme reagieren und die Behebung von Störungen von Anlagen und Einrichtungen durchführen zu können, wird für kommunale Abwasseranlagen ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. Ein Bereitschaftsdienst kann in Form einer Arbeitsbereitschaft (diese ist jedenfalls Teil der Arbeitszeit) oder in Form einer Rufbereitschaft (diese ist nicht zwingend Teil der Arbeitszeit) eingerichtet werden. Im Regelfall wird mit einer Rufbereitschaft das Auslangen gefunden. Oft wird diese auch im wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid vorgeschrieben. Die Rufbereitschaft ist meist so geregelt, dass ein Alarmierungssystem der Anlage den bereitschaftsdiensthabenden Mitarbeiter über ein Mobiltelefonnetz mit näherer Bezeichnung des Defektes bzw. der Störung auf der Anlage alarmiert.
Warum Bereitschaftsdienst?
Kommunale Abwasseranlagen stellen große Investitionen der öffentlichen Hand dar, die von den Kosten und von der technischen Komplexität her mit Industrieanlagen zu vergleichen sind. Für den Betrieb, die Betreuung, Wartung und Instandhaltung dieser Anlagen ist daher entsprechend qualifiziertes Personal erforderlich.
Der Bereitschaftsdienst hat zum Ziel:
• akute bzw. drohende Gewässerverunreinigungen zu verhindern bzw. möglichst schnell abzustellen oder zu reduzieren,
• nachhaltige Beeinträchtigungen der Reinigungsleistung hintanzuhalten, die durch den längeren Ausfall von Anlagenteilen verursacht werden können,
• Schäden, vor allem Folgeschäden an Bau-, Maschinen- und Elektronikteilen durch Störungen außerhalb der üblichen Dienstzeit (Nachtstunden, Wochenende, Feiertag) schnell zu erkennen und zu verhindern bzw. ihre Auswirkungen zu minimieren.
Derartige Schäden verursachen nicht nur direkte und indirekte Wiederherstellungs- bzw. Reparaturkosten, sondern können auch zu einer Gewässerverunreinigung führen (Fischsterben etc.). Dies kann Schadenersatzforderungen sowie verwaltungs- und (umwelt-)strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Der Bereitschaftsdienst stellt nicht nur eine Erfüllung wasserrechtlicher Verpflichtungen dar (Sicherstellung des fachgerechten Betriebes der Anlagen), sondern bedeutet auch Vorsorge zum Vermeiden bzw. Beschränken der Auswirkungen nicht vorhersehbarer Ereignisse und der damit verbundenen Schäden. Der Bereitschaftsdienst trägt zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz.
Rechtliche Grundlagen
Während der Rufbereitschaft kann sich der Bereitschaftsdienst Leistende außerhalb der Dienststelle aufhalten, muss aber telefonisch jederzeit erreichbar sein und innerhalb eines vertretbaren Zeitraumes (z. B. 30 Minuten) auf die Anlagen gelangen können. Beim Eintreffen einer Störungsmeldung entscheidet der Diensthabende, in welcher Form ein Tätigwerden erforderlich ist.
Rechtliche Grundlagen und Grundsätze für den Bereitschaftsdienst sind u. a. im Arbeitszeitgesetz (AZG) und in den Gemeinde-Vertragsbediensteten-Gesetzen der Bundesländer festgelegt. Das AZG gilt speziell für Bedienstete von Abwasser- bzw. Reinhalteverbänden (nach WRG) und betrieblichen Abwasseranlagen und kann durch Kollektivverträge bzw. Betriebsvereinbarungen ergänzt werden.
Insgesamt ist es jedenfalls ratsam, klare Betriebsvereinbarungen zu erstellen, die Regelungen über zeitliche Aufteilung, Entgelt und Umfang der Tätigkeiten im Rahmen der Rufbereitschaft enthalten.
Fachliche Qualifikationen
Aufgrund des Inhaltes der Alarmmeldung, z. B. über ein Mobiltelefon, muss eine entsprechend qualifizierte Fachkraft beurteilen, ob die sofortige Beseitigung des Problems erforderlich ist.
Um auch tatsächlich problemgerecht reagieren zu können, ist für die Rufbereitschaft für kommunale Abwasseranlagen nur ausgebildetes Personal heranzuziehen, das zudem mit den entsprechenden Anlagen und Einrichtungen ausreichend vertraut ist (d. h., dass eine vorangehende Einschulung erforderlich ist).
Dies ist vor allem dann zu berücksichtigen, wenn bei kleineren Abwasseranlagen mit entsprechend geringem Personalstand die Rufbereitschaft aus rechtlichen, organisatorischen und/oder finanziellen Gründen für mehrere Anlagen gemeinsam organisiert wird.
Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auch auf das ÖWAV-…mehr:
http://www.oewav.at/Page.aspx?target=65710&mode=form&app=134598&edit=0¤t=147712&view=134599&predefQuery=-1
(nach oben)
Wasserwirtschaft für Österreicher bei Klimawandel wichtiges, aber kein dominantes Thema
Die große Mehrheit der Österreicher hält den Klimawandel für ein ernstes bis sehr ernstes Problem und plädiert für Anpassungsmaßnahmen. Die Wasserwirtschaft steht für die Bevölkerung hierbei aber nicht im Vordergrund. Allerdings stufen gut 90 Prozent der Bürger auch hier Anpassungsmaßnahmen als wichtig oder sogar sehr wichtig ein.
…mehr unter:
http://www.euwid-wasser.de/nachrichten.html?&tx_ttnews[pointer]=2&cHash=02d6932cad
(nach oben)
Umwelthormone: Frauenboom bei Österreichs Fischen
Kaum Männchen im Netz: Zwei Drittel aller Fische in den fließenden Gewässern Österreichs sind weiblichen Geschlechts. Umweltgifte dürften an dem Phänomen Schuld sein, dessen Gefährlichkeit für den Men… mehr unter:
http://www.newstin.de/tag/de/97737755
wissen-news.de
(nach oben)
93 Prozent der Österreicher gegen Privatisierung der Wasserversorgung
Die Österreicher lehnen eine Privatisierung der Wasserversorgung weiterhin mehrheitlich ab. Wie aus dem „Wasserreport 2008″ der Aqua Quality Austria Wassermarketing GmbH (AQA) hervorgeht, sprechen sich 93 Prozent der Österreicher gegen eine Privatisierung aus.
Den ganzen Artikel lesen Sie unter: http://www.euwid-wasser.de
(nach oben)
Klärschlamm fliegt im Hubschrauber
Nach dem Tiroler Feldschutzgesetz ist die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung verboten. Deshalb muss der Klärschlamm von hochalpinen Schutzhütten mit Hubschraubern oder mit Seilbahnen ins Tal gebracht und dort verbrannt werden. Etwa 150 alpine Schutzhütten sind allein in Tirol davon betroffen. Der österreichische Alpenverein hat sich jetzt dafür ausgesprochen, die Klärschlammentsorgung von Schutzhütten flexibler zu regeln und eine vor Ort- Verwertung zuzulassen. Klärschlamm unterliegt in Österreich der Länderkompetenz. Der Alpenverein hält die Verordnung für überzogen, dagegen steht die Gesetzgebung Tirols, mit einem grundsätzlichen Verbot von landwirtschaftliche Klärschlammverwertung, keine Ausnahmen zulässt.
(nach oben)
Entwicklung und Implementierung einer Abflusssteuerung für das Kanalnetz der Stadt Wien (Entwässerungssysteme)
Lothar Fuchs, Thomas Beeneken (Hannover), Robert Nowak und Gernot Pfannhauser (Wien/Österreich)
Kurzbericht: Die Stadt Wien hat nach umfassenden Untersuchungen zur Aktivierung von Speicherräumen im Kanalnetz beschlossen, ein Echtzeitsteuerungssystem für das Wiener Kanalnetz zu entwickeln und zu implementieren. Diese Entwicklung und Implementierung erstreckten sich über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren und wurde Ende 2005 abgeschlossen.
Das aufgestellte Messnetz dient zur Kalibrierung des Niederschlag-Abfluss-Modells sowie zur Erfassung der aktuellen Wasserstände und Durchflüsse im Rahmen der Steuerung. Es umfasst 25 Niederschlags-, 40 Durchfluss- und 20 Wasserstandsmessgeräte. Das gesamte Wiener Kanalnetz mit ca. 53 000 Haltungen wurde zur Entwicklung der Steuerungsstrategien und für die Online-Simulation auf ein Grobnetz mit ca. 2 200 Haltungen reduziert, zur Ermittlung der abflusswirksamen Flächen wurden Infrarot-Luftbilder verwendet. Basierend auf umfangreichen Simulationsrechungen, wurde eine Regelbasis entwickelt, in dem Programmpaket ITWH-Control abgebildet und im simulierten Steuerungsmodus weiter verfeinert. Im jetzigen Echtzeit-Betrieb kommt zusätzlich ein Vorhersagemodell zum Einsatz. Dabei werden, basierend auf Radar-Niederschlagsdaten, die zukünftigen Niederschläge vorhergesagt, mit denen wiederum mittels eines Online-Simulationsmodells die zu erwartenden Abflüsse und Wasserstände berechnet werden. Die Ergebnisse zeigen eine Reduzierung der Entlastungsmengen um mehr als 30 Prozent. Während des Betriebs wurden umfangreiche Erfahrungen gesammelt, die in eine Verbesserung des Gesamtsystems einfließen.
Den ganzen Bericht kann man in der KA Juli 2007 Seite 680 nachlesen.
(nach oben)
Kläranlage Wiener Neustadt-Süd produziert grünen Strom
Die Kläranlage meldet, dass sie bis Ende Mai 2007 bereits 795200kWh Strom ins öffentliche Netz eingespeist hat. Das sind drei Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2006. Die Eigenbedarfsdeckung lag damit bei ca. 85 Prozent. Eine weitere Verbesserung wird durch den Bau eines zweiten BKH erreicht werden, dessen Bau beschlossen und dessen Einweihung bereits am 8.10.07 stattfinden soll.
Alle Informationen unter www.awvwns.at
(nach oben)