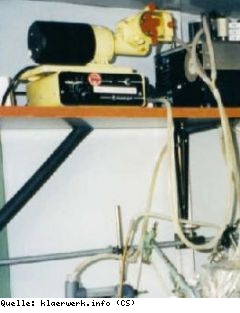Es ist nie verkehrt, von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob sich nicht
in der Kläranlage etwas verbessern lässt. Gibt es neue Erkenntnisse
in der Abwassertechnik, den Tipp eines Praktikers
im KA-Betriebs-Info oder gar eine eigene Idee?
In unserem Fall geht es um das Rechengut. Eigentlich nichts
besonderes, denn normalerweise heißt es: Container voll –
Anruf oder E-Mail – Abfuhr, bezahlen und fertig! Dies war
auch bei uns nicht anders.
Unsere Gruppenkläranlage Rülzheim (41 500 EW) liegt in
Rheinland-Pfalz. Wir betreiben zwei Blockheizkraftwerke
(BHKW) mit einer elektrischen Leistung von je 84 kW und
einer thermischen Leistung von je 141 kW. Die überschüssige
Wärme wird über einen Notkühler abgeschlagen und
nicht genutzt.
Und dann gibt es auch die Entsorgung unseres Rechenguts.
Immerhin kostet im Landkreis Germersheim die Tonne 333
Euro, ohne Transportkosten. Das Rechengut hat trotz Waschung
und Rechengutpresse noch einen sehr hohen Wasseranteil
von ca. 60 %. Danach transportieren wir pro Tonne
600 kg Wasser und zahlen dafür auch noch rund 200 Euro,
während wir für den eigentlichen Feststoffanteil im Rechengut
mit 400 kg rund 130 Euro bezahlen. Dies war absolut
unbefriedigend.
Aber warum nicht eins und eins zusammenzählen. Auf der
einen Seite hatten wir überschüssige Wärme und auf der
anderen Seite ein zu nasses Rechengut. Da muss es doch
eine Lösung geben. Da einfache Dinge meist zum Erfolg führen,
war schnell eine einfache „Heizplatte“ gefertigt. Der
volle Rechengutcontainer wurde nicht abgefahren, sondern
wie ein Topf auf den Herd gestellt: Diese Heizplatte ist so
groß wie die Grundfläche des Containers (Abbildung 1). Sie
kann mit dem Container-LKW bewegt werden.
Zur Erwärmung der Heizplatte wurde der Vorlauf zur Notkühlung
angezapft, so dass das Kühlmedium zuerst durch
die Heizplatte geleitet wird, bevor die Wärme den Notkühler
erreicht. Verteilt wird die Wärmeenergie über eine Heizwendel
(Abbildung 2), die in der mit Wasser gefüllten Platte
installiert ist.
Der volle Rechengutcontainer wurde gewogen und dann auf
die Heizplatte gestellt. Die Wärmeenergie verteilt sich über
den Containerboden in das Rechengut. Bis der nächste
Rechengutcontainer wieder gefüllt ist, ergibt sich eine mittlere
Standzeit auf der Heizplatte von ca. vier Wochen. Bevor
das Rechengut abgefahren wurde, wogen wir es erneut,
denn schließlich wollten wir den Erfolg prüfen. Somit konnten
wir bereits zu Beginn der Versuche „per Wiegeschein“
feststellen, dass der Wasseranteil erheblich gesunken war.
Noch etwas wurde deutlich: Die Materialkosten für die Versuche
amortisierten sich sehr schnell.
Um der Sache weiter auf den Grund zu gehen….mehr:
http://www.kan.at/upload/medialibrary/KA-Betriebs-Info1-2010.pdf
Autor
Abwassermeister Marc Sickelmann
67360 Lingenfeld