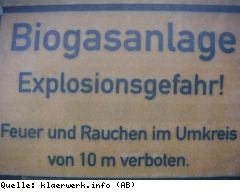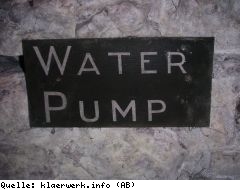Redaktioneller Beitrag von klärwerk.info:
Das Ergebnis des nachfolgend beschriebenen Forschungsvorhabens wurde auf der essener Tagung Mitte März 2010 vorgestellt
Ausgangslage:
Städtische Nutzungen und Infrastrukturen werden infolge des Klimawandels zunehmend durch Starkregen sowie durch lang andauernde Trockenperioden beeinträchtigt. Überschwemmungen und die Überlastung von Kanalnetzen gefährden neben den hygienischen Bedingungen in den Siedlungen auch den Umweltschutz sowie den Betrieb von Infrastrukturnetzen. Diese Problemlagen werden sich nach einschlägigen Prognosen zunehmend verschärfen und durch weitere Entwicklungen, wie z. B. den demographischen und den wirtschaftsräumlichen Wandel überlagert.
Die Notwendigkeit, Siedlungsstrukturen an zunehmende Starkregenereignisse und Dürreperioden anzupassen, wird die Aufgaben der Stadtentwicklung immer mehr bestimmen. Allerdings nehmen wasserwirtschaftliche Belange in der Planungspraxis bisher einen untergeordneten Stellenwert ein. Die Auswirkungen der Stadtplanung auf wasserwirtschaftliche Fachplanungen werden zwar in den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren untersucht, führen jedoch in den meisten Fällen lediglich zu einer nachträglichen Anpassung der Planungskonzepte. Im Hinblick auf die zu erwartenden Folgen des Klimawandels ist es notwendig, dass die Wasserbelange bzw. die Auswirkungen von Starkregen und Dürreperioden auf Raumnutzungen in einem frühzeitigen Stadium der Planungsprozesse berücksichtigt werden.
Projektziele:
Ziel des Forschungsprojektes ist es zu klären, mit welchen Maßnahmen eine vor dem Hintergrund finanzieller Restriktionen und der Unsicherheiten klimatischer Szenarien gelingen kann und welche Rahmenbedingungen zur Umsetzung und Akzeptanz der Maßnahmen auf lokaler Ebene geschaffen werden müssen. In enger Zusammenarbeit mit Praxispartnern im Ruhrgebiet wird ein datenbankbasierter Maßnahmenkatalog erarbeitet, der die Möglichkeiten einer verdeutlicht und in kommunale Entscheidungsprozesse implementiert werden kann. Dabei sollen neben den instrumentellen auch strukturelle Aspekte berücksichtigt werden, um aus den räumlichen Potentialen eines Quartiers oder Stadtteils problembezogene Lösungsstrategien ableiten zu können.
Handlungsfelder:
Das Forschungsprojekt zeigt mögliche Lösungswege auf, mit denen den Herausforderungen des Klimawandels insbesondere im Siedlungsbestand begegnet werden kann. Eine Chance wird dabei im demographischen und wirtschaftlichen Strukturwandel gesehen. Die infolge von Schrumpfungsprozessen entstehenden Brachflächen bieten Potentiale für die Anpassung an veränderte Niederschlagsverhältnisse und somit zum nachhaltigen Umbau der Stadtstruktur sowie zur Verbesserung der Lebensqualitäten.
1. auf administrativer Ebene sind neue Normen, Instrumente und Verfahren notwendig, die eine frühzeitige Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange im Planungsprozess ermöglichen.
2. auf der Umsetzungsebene sind innovative bauliche Lösungen erforderlich, die möglichst kostengünstig und mitunter auch unkonventionell sein sollten. In diesem Zusammenhang nimmt die Zwischennutzung von Flächen zum Wasserrückhalt im Siedlungsbestand einen hohen Stellenwert ein.
3. auf der Akteursebene besteht die Notwendigkeit, einen Wissenstransfer zwischen den Fachdisziplinen zu gewährleisten und die erforderliche Akzeptanz bei den betroffenen Akteuren zu sichern, ohne die eine Umsetzung einer wassersensiblen Stadtentwicklung in bestehenden Siedlungsgebieten nicht möglich ist.
Arbeitsschritte:
Zum Erreichen der Projektziele wurde ein Arbeitsprogramm formuliert, das sich in fünf Arbeitspakete untergliedert:
1. Analyse bestehender Normen, Instrumente und Lösungsansätze im In- und Ausland
2. Identifizierung des Handlungsbedarfes für eine wassersensible Stadtentwicklung
3. Erstellung eines Maßnahmenkatalogs zur wassersensiblen Stadtentwicklung
4. Überprüfung und Bewertung der Maßnahmen hinsichtlich Eignung, Akzeptanz und Übertragbarkeit im Rahmen von Szenarienwerkstätten
5. Entwicklung eines datenbankbasiertes Auskunftssystems zur wassersensiblen Stadtentwicklung in Abhängigkeit siedlungsstruktureller Parameter
Veröffentlichungen:
Abschlussbericht Wassersensible Stadtentwicklung (1. Phase) – Netzwerk für eine nachhaltige Anpassung der regionalen Siedlungswasserwirtschaft an Klimatrends und Extremwetter (April 2008)
Zwischenbericht Wassersensible Stadtentwicklung – Maßnahmen für eine nachhaltige Anpassung der regionalen Siedlungswasserwirtschaft an Klimatrends und Extremwetter (April 2009)
Benden, Jan; Siekmann, Marko: Wassersensible Stadtentwicklung. Anpassung von Siedlungs- und Infrastrukturen an den Klimawandel. Tagungsband zur Klimakonferenz „Anderes Klima – andere Räume!“. Leipzig 3./4.11.2008 (erscheint Beginn 2009)
Benden, Jan: Wassersensibler Stadtumbau im Zeichen des Klimawandels – Lernen von den Niederlanden? In: Stadt Region Land, Heft 86, Aachen 2009
Vorträge:
Benden, Jan: Wassersensible Stadtentwicklung. Anpassung von Siedlungs- und Infrastrukturen an den Klimawandel. Vortrag auf der Klimakonferenz „Anderes Klima – andere Räume!. Universität Leipzig 3. – 4.11.2008
Benden, Jan: Maßnahmen zur Anpassung der regionalen Siedlungswasserwirtschaft an Klimatrends und Starkregenereignisse. AMUS-Ehemaligentreffen. RWTH Aachen, 19.09.2008
Hoelscher, Martin: Wohin mit dem Wasser – Wassersensible Stadtentwicklung als Chance im Klimawandel. Vortrag auf der MUNLV-Tagung „Klimawandel in Ballungsräumen“ BEW Essen
Sonstige Projektinformationen:
Förderer:
Bundesamt für Bildung und Forschung (BMBF); Förderschwerpunkt KlimaZwei
Laufzeit:
04/2008 -03/2010
Projektpartner:
• RWTH Aachen, Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA), Koordination
• RWTH Aachen, Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr (ISB)
• Ruhr-Universität Bochum Fakultät für Psychologie, AG für Umwelt- und Kognitionspsychologie
• Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Studiengang Landschaftsarchitektur
Praxispartner:
Stadt Bochum, Stadt Essen, Stadt Herne, Wasserverband Emschergenossenschaft/Lippeverband, Ruhrverband sowie die Gelsenwasser AG
Bearbeiter am ISB:
Dipl.-Ing. Jan Benden, Dipl.-Ing. Christoph Riegel