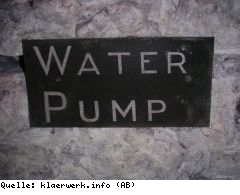Die erfolgreiche Erprobungsphase für ein neues semi-dezentrales Konzept zur Wasserversorgung und Abwasserreinigung wurde fünf Jahre im Rahmen eines Forschungsverbundprojekts vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Heute wird im Neubaugebiet „Am Römerweg“ in Knittlingen bei Pforzheim das Abwasser von 175 Anwohnern anaerob gereinigt und dabei, neben anderen Wertstoffen, bis zu 7000 Liter Biogas pro Tag gewonnen. Am 18. Mai 2010 ist feierliche Finissage: Vertreter des BMBF, der Gemeinde Knittlingen, der Fraunhofer-Gesellschaft und der beteiligten Industriepartner setzen die Biogasverwertung symbolisch in Gang.
Der weltweite Wasserverbrauch für landwirtschaftliche, industrielle und private Nutzung steigt stetig. Intelligente Konzepte zur Verteilung und zur Reinigung von Wasser sind daher gefragt. Gleichzeitig sind Kläranlagen vielerorts der größte kommunale Stromverbraucher, durch den hohen Anfall an Klärschlamm zudem ein großer Abfallproduzent. Ziel des Fraunhofer-Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart war daher, eine neue Art der Wasserwirtschaft zu erproben, um die Umwelt durch Einsparung von Trinkwasser und Energie zu schonen und gleichzeitig Kosten zu sparen. Eine Abwasserreinigung, welche die für ihren Betrieb benötigte Energie weitgehend selbst erzeugt und auch anorganische Bestandteile wiederverwertet, kombiniert mit der Aufbereitung von Regenwasser, ist das Ergebnis des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts „DEUS 21 – Dezentrale urbane Infrastruktursysteme“.
Das Abwasser des heute 175 Anwohner zählenden Neubaugebiets „Am Römerweg“ in Knittlingen wird semi-dezentral gesammelt und gereinigt. Dies geschieht anaerob, das heißt unter Ausschluss von Sauerstoff. Hierbei bauen Bakterien organische Inhaltsstoffe des Abwassers zu Biogas ab. Nach vier Jahren Erprobung wurde 2009 eine Anlage in Betrieb genommen, bei der Feststoffe aus dem Abwasser zunächst in einem Absatzbehälter entfernt und separat bei 37 °C nach dem vom Fraunhofer IGB entwickelten Verfahren der Hochlastfaulung mit Mikrofiltration vergoren werden. Hierbei wird bis zu 5000 Liter Biogas pro Tag produziert. Der Überlauf des Absetzbehälters, dies sind etwa 99 Prozent des Abwasserzulaufs, wird in einem Bioreaktor, der – deutschlandweit erstmalig – nicht beheizt wird, ebenfalls anaerob behandelt. Der Ablauf, also das gereinigte Abwasser, konnte auf Anhieb die Grenzwerte für den chemischen Sauerstoffbedarf von Kläranlagen für weniger als 1000 Einwohner einhalten oder unterschreiten. Hierbei werden noch einmal bis zu 2000 Liter Biogas pro Tag erzeugt. Insgesamt liefert die Anlage so 40-60 Liter Biogas pro Einwohner und Tag. Dies ist mehr als das Doppelte, was eine herkömmliche Kläranlage mit Klärschlammfaulung erzielt. Das in der Demonstrationsanlage entstehende Biogas wird (mangels für diesen Maßstab verfügbarer Kraft-Wärme-Kopplungstechnik) verbrannt und die Wärme zur Beheizung des Faulreaktors genutzt.
Das anaerob gereinigte Abwasser enthält noch relativ hohe Konzentrationen an Ammonium und Phosphor, so dass der Ablauf zur kombinierten Düngung und Bewässerung in der Landwirtschaft geeignet ist. Ist eine solche direkte Nutzung nicht möglich, können die anorganischen Nährstoffe Stickstoff und Phosphor mittels eines umweltfreundlichen Verfahrens als Düngesalze zurückgewonnen werden.
Das Regenwasser im Neubaugebiet wird gesammelt und in einer unterirdischen Zisterne gespeichert. Es wird über verschiedene Stufen – Filtration, Ozonbehandlung, Aktivkohlefilter und Ultrafiltration – gereinigt und entkeimt. Nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten soll das aufbereitete Regenwasser über ein separates Leitungsnetz an die Anwohner verteilt werden, um damit die Gärten zu bewässern, Toiletten zu spülen, Wäsche zu waschen und zu duschen.
Mit dem erfolgreich demonstrierten Verfahrensansatz von DEUS 21 ist der Paradigmenwechsel von der „End-of-pipe“-Technik zur nachhaltigen Wasserver- und Abwasserentsorgung gelungen. DEUS 21 ist insbesondere geeignet für Länder, in denen bisher keine Wasserinfrastruktur existiert.
Das Projekt „DEUS 21 – Dezentrale urbane Wasserinfrastruktursysteme“ wurde in zwei Stufen bis Ende Mai 2010 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Neben dem Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, Stuttgart, waren als Forschungspartner das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe, und in der ersten Phase das ISA der RWTH Aachen beteiligt. Partner aus der Wirtschaft sind die Firmen Eisenmann, EnBW, Gemü, Kerafol, Prov, Roediger und Bellmer.
Weitere Informationen:
http://www.igb.fraunhofer.de/www/presse/jahr/2010/dt/2010-04-29_DEUS
Dr. Claudia Vorbeck, Pressestelle
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB